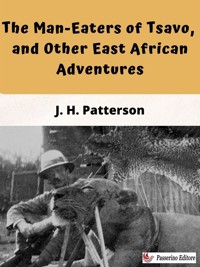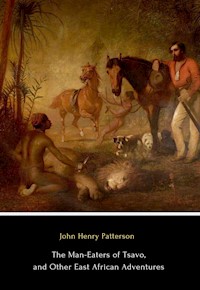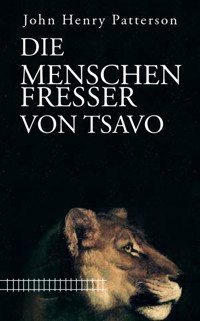
7,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nature Press
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der berühmte Jagdklassiker über das schaurige Löwen-Drama am Fluß Tsavo in Britisch-Ostafrika 1898. Illustrierte Gesamtausgabe einschließlich aller weiteren Jagd- und Abenteuererzählungen John Henry Pattersons. Neu ins Deutsche übertragen von Kai Althoetmar, samt einer ausführlichen Einführung und eines Reports über Man-Eater-Löwen in Afrika heute. - Sie kamen nachts, schlichen sich in die Arbeitercamps und ließen sich durch nichts abschrecken. Sie rissen Zelte ein, scheuten weder Feuer noch Gewehrschüsse und zerrten ihre Opfer durch Dornwälle. Binnen Wochen war der Bau einer Eisenbahnbrücke über den Tsavo in Britisch-Ostafrika 1898 zum Alptraum geworden: für indische Kontraktarbeiter, schwarze Einheimische, britische Kolonialbeamte. Wie viele Menschen die beiden mähnenlosen Löwen töteten, beschäftigt heute die Wissenschaft. Die zwei Menschenfresser, die neun lange Monate die Region Tsavo im heutigen Kenia terrorisierten, machten Geschichte. Mit dem Hollywood-Schocker „Der Geist und die Dunkelheit“ gingen sie in die Filmhistorie ein. Es war der anglo-irische Bahningenieur John Henry Patterson, der dem Spuk um die zwei „Teufel“ schließlich ein Ende bereitete. Nachdem die Bauarbeiten zum Erliegen gekommen waren, hatte sich Patterson auf die Jagd nach den Killerkatzen gemacht. Mehrfach zahlte er beinahe mit dem eigenen Leben. Von diesem schaurigen Drama erzählt dieses Buch. - Kai Althoetmars werkgetreue und akkurate Neuübersetzung dieses zeitlosen Jagd- und Abenteuerklassikers setzt Maßstäbe. Eine ausführliche Einführung widmet sich dem Leben Pattersons, Britisch-Ostafrika und dem Bau der Uganda-Bahn. Auch aktuelle Forschungsstudien zu den „Menschenfressern von Tsavo“ und die filmische Verwertung durch Hollywood skizziert das reich bebilderte Buch. Dazu enthält es auch sämtliche andere Abenteuergeschichten Pattersons, die von Jagdreisen und weiteren Löwen-Dramen im Süden Kenias erzählen. Ein ausführlicher Report Kai Althoetmars über das Phänomen von Man-Eater-Löwen in Ostafrika rundet die Ausgabe ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Menschenfresser von Tsavo
John Henry Patterson
Die Menschenfresser von Tsavo
Ins Deutsche übertragen von Kai Althoetmar
Impressum:
Titel des eBooks: „Die Menschenfresser von Tsavo“.
Originaltitel: „The Man-Eaters of Tsavo and Other East-African Adventures“.
Erscheinungsjahr: 2025. ISBN: 9783759290618.
Inhaltlich Verantwortlicher:
Nature Press
Kai Althoetmar
Am Heiden Weyher 2
53902 Bad Münstereifel
Deutschland
E-Mail: Althoetmar[at]aol.com
Text/Übersetzung: © Kai Althoetmar.
Cover: © Kerstin Koller.
Covermotiv: Tête de lionne (Löwenkopf) von Théodore Géricault (um 1819), Louvre.
Hinweise:
Das Buch „The Man-Eaters of Tsavo and Other East-African Adventures“ von John Henry Patterson ist im Original gemeinfrei. Die vorliegende Übersetzung sowie die Begleittexte (Einführung und „Malawi Secondary Road. Im Geisterwald von Nkhotakota“) sind urheberrechtlich geschützt.
Verlag und Autor folgen der bis 1996 allgemeingültigen und bewährten deutschen Rechtschreibung.
Die Recherchen zu diesem Buch sowie die Übersetzungsarbeit wurden ohne Zuwendungen oder Vergünstigungen Dritter erbracht.
Die vorliegende Übersetzung erfolgte ohne die Verwendung Künstlicher Intelligenz (KI).
Von Löwen und Menschen
Eine Einführung von Kai Althoetmar
Ein Dreivierteljahrhundert lang geisterte eine Opferzahl durch die Welt, die von kaum vorstellbarem Grauen kündete. Die Zahl lautete 135 – in Worten: hundertfünfunddreißig. Exakt so viele Menschen sollen die beiden Menschenfresser von Tsavo getötet haben, als sie 1898 im Südosten des heutigen Kenia neun lange Monate ihr Unwesen trieben. Opfer der zwei mähnenlosen Löwen waren vor allem die indischen Arbeiter, die beim Bau der Uganda-Bahn schufteten und in großen Zeltlagern entlang der Bahntrasse hausten. Das Desaster hielt die Bauarbeiten so lange auf, daß bereits das britische Parlament darüber diskutierte.
Es war der 8. März 1898, als John Henry Patterson in Tsavo ankam. Schon nach wenigen Tagen erfuhr er, daß „ein oder zwei“ Arbeiter nachts aus ihren Zelten gezerrt und von Löwen gefressen worden waren. Bald darauf erwischte es einen seiner indischen Hilfsoffiziere. Nur Blut, Schädel, Knochen und ein paar Fleischbrocken waren von Ungan Singh noch übrig, als Patterson seine Leiche entdeckte. Die Menschenjagd der zwei Tsavo-Löwen nahm kein Ende. Schon bald glaubten die verängstigten indischen Kulis an die alte Legende, es handle sich um menschenfressende Dämonen. Der US-Schriftsteller Philip Caputo schreibt in „Ghosts of Tsavo“ („Unter Menschenfresser. Auf den Spuren der mystischen Löwen von Tsavo“): „Die Eingeborenen, die diesen Mythos verbreiteten, gaben ihm einen antiimperialistischen Beigeschmack, indem sie die Löwen als Reinkarnation afrikanischer Stammesfürsten darstellten, die über den Bau einer Eisenbahn durch das Land ihrer Ahnen zornig waren. ‘Habt Acht, Brüder! Der Teufel naht!’ pflegten sie einander zuzurufen, wenn nachts das ferne Brüllen der Löwen verstummte, denn dieses Schweigen verhieß, daß sie sich wieder anschlichen.“
John Henry Patterson, der Absolvent einer Militärakademie, hatte in Britisch-Indien Erfahrungen bei der Tigerjagd gesammelt. Er war mutig, hatte ein Herz für seine Arbeiter und verstand etwas von Strategie und Taktik. Aber es sollte bis Ende Dezember 1898 dauern, bis die zwei „Teufel“ zur Strecke gebracht waren. Nach seinen Befreiungstaten verglich ihn damals die britische Zeitschrift Spectator mit dem Heiligen Georg, dem Drachentöter, mit dem griechischen Heros Herkules, der den schier unbezwingbaren Nemeischen Löwen tötete, und mit Theseus, der den Minotaurus bezwang.
Patterson, der anglo-irische Militärbauingenieur, war Anfang 1898 nach Britisch-Ostafrika geschickt worden, um bei diesem Projekt den Bau einer Eisenbahnbrücke über den Fluß Tsavo zu beaufsichtigen. Später brachte er die Zahl von insgesamt hundertfünfunddreißig indischen und afrikanischen Löwentoten wiederholt in Umlauf. Der Mann, der die beiden Löwen schließlich erlegt hatte, wollte sich mit der allzu dramatischen Zahl vielleicht noch wichtiger machen, als er war. Die Bahnverwaltung sprach damals von vierundzwanzig Opfern – sie hatte wiederum ein Interesse, die Zahl kleinzuhalten.
2001 kam eine Studie im Journal of East African Natural History zu dem Schluß, daß die Zahl von hundert und mehr Opfern eine Übertreibung gewesen sei. Der US-amerikanische Mammaloge Julian Kerbis Peterhans, außerordentlicher Kurator für Säugetiere am Field Museum of Natural History in Chicago, und sein Kollege Thomas Patrick Gnoske legten sich auf eine Zahl von achtundzwanzig bis einundreißig Opfern fest. Am Field Museum sind die beiden Killerlöwen seit langem ausgestopft zu sehen. John Henry Patterson hatte die Bälge samt Schädeln 1924 an das Museum verkauft, das sie neu präparieren ließ und als Dermoplastiken ausstellte. Was aber war die Ursache für den Raubzug der beiden Löwen?
Inzwischen ist die Forschung zu der Überzeugung gekommen: Zahnweh hatte die beiden Raubkatzen zu Bestien werden lassen. Das zeigen gleich mehrere Studien. Bruce D. Patterson (nicht verwandt mit John Henry Patterson), Zoologe und inzwischen emeritierte Säugetierkurator am Field Museum of Natural History in Chicago, lieferte 2017 mit seiner Kollegin Larisa DeSantis im Fachblatt Scientific Reports Belege dafür, daß der Zustand der Zähne der beiden Löwen ursächlich für die Angriffe auf Menschen gewesen sei. Auf den Zähnen seien keine Spuren der Abnützung zu erkennen. „Sie sehen aus wie die Zähne von Löwen aus dem Zoo“, so Patterson. Die Forscher sind überzeugt, daß die beiden Tsavo-Man-Eater nur von Fleisch gelebt haben – aber nicht von Knochen. John Henry Pattersons Aufzeichungen hatten noch andere Schlüsse nahegelegt: nämlich, daß sie auch Knochen fraßen. Die beiden Raubkatzen hatten laut den Wissenschaftlern offenbar unter schmerzhaften Zahnentzündungen gelitten. Das habe es mindestens einem oder beiden Tieren unmöglich gemacht, Knochen zu zerbeißen oder schwere Tiere zu erlegen. Bruce D. Patterson erklärte 2017: „Wenn ein Löwe einen Büffel nicht mit seinem Biß töten kann, dann ist es für ihn besser, gar nicht anzugreifen. Ansonsten läuft er Gefahr, selbst vom Büffel angegriffen zu werden.“
Bruce D. Patterson war einige Jahre zuvor zusammen mit dem Anthropologen Justin D. Yeakel von der Universität Kalifornien in Santa Cruz und anderen Forschern anhand von Isotopenanalysen zu der Überzeugung gelangt, daß die beiden Löwen etwa fünfunddreißig Menschen getötet hatten. Die Wissenschaftler hatten den Speiseplan der Menschenfresser rekonstruiert. Dazu entnahmen sie aus den Zähnen und Knochen der Löwen Kollagen, aus den Haaren der Tiere Keratin. Mit Hilfe dieser Proben analysierten sie Kohlenstoff- und Stickstoffisotope – deren Zusammensetzung von der Nahrung bestimmt wird. Die gewonnenen Daten verglichen Yeakel und Kollegen mit Isotopenmustern in Gazellen, Impalas und Menschen. Die menschlichen Proben stammten aus menschlichen Skelettresten der damaligen Taita-Bevölkerung, einer Ethnie im Südosten Kenias, die der britischstämmige kenianische Paläoanthropologe Louis Leakey 1929 bei einer Forschungsreise gesammelt hatte.
Die Interpolation der (geschätzten) Daten legte nahe, daß der am 9. Dezember 1898 erlegte Löwe – wissenschaftlich FMNH 23970 geheißen - das Äquivalent von zehneinhalb Menschen gefressen und der am 29. Dezember 1898 geschossene Löwe (FMNH 23969) umgerechnet 24,2 Menschen verspeist hatte. Das heißt aber auch: Da die Löwen oft nur Teile der Getöteten fraßen, kann die Opferzahl eben doch siebzig Menschen und mehr betragen haben. Larisa DeSantis geht übrigens davon aus, daß er (zahn-)gesündere Löwe es sich von dem stark zahngeschädigten Löwen abgeguckt hatte, Menschen zu töten.
Die Forscher merkten aber an, daß die addierte Opferzahl auch bei bis zu zweiundsiebzig Menschen gelegen haben kann. Eine Frage blieb nämlich offen: Wieviele Menschen hatten die beiden „Teufel“ getötet, aber nicht gefressen – etwa weil sie mit Gewehrschüssen verjagt worden sind? John Henry Pattersons Buch erzählt von solchen Fällen.
Yeakel und sein Team schlußfolgern, daß die beiden Löwen im Team gejagt hatten – eine Methode, die Panthera Leo sonst nur bei großen Beutetieren wie Kaffernbüffel, Zebra, Flußpferden, jungen Giraffen oder subadulten Elefanten anwendet. Einen Menschen kann ein Löwe problemlos allein erlegen. Warum kooperierten die beiden Löwen dann?
Ihr Verhalten ist nicht ohne ihre Zahn- und Kieferprobleme zu erklären. Es war der zuerst erschossene Löwe, der schwere Zahn- und Kieferschäden aufwies. Er hatte eine Infektion an der Zahnwurzel des Fangzahns. Der untere rechte Reißzahn wies zudem eine Fraktur auf – hinzu kamen freiliegende Pulpa (Zahnmark), Karies und ein großer periapikaler Abszeß (Eiteransammlung an der Zahnbasis). Außerdem fehlten ihm vier vordere Schneidezähne des Unterkiefers. Möglicherweise war dies Folge eines Huftritts oder Hornstoßes eines Gnus, Zebras oder eines anderen Beutetiers. Jedenfalls dürfte der gebrochene Fangzahn es dem Tier unmöglich gemacht haben, seinen Kiefer in den Hals eines Gnus oder Zebras zu schlagen, um es zu ersticken oder die Luftröhre kollabieren zu lassen. Der zweite Löwe wies bei der Untersuchung leichtere Zahnschäden auf, und zwar einen gebrochenen rechten Backenzahn im Oberkiefer sowie beträchtliche Pulpaexposition. All dies zeigte bereits eine im Jahr 2000 im Journal of the American Association of Forensic Dentists veröffentlichte Studie von Bruce D. Patterson und Ellis J. Neiburger.
Wegen der Zahn- und Kieferschäden konnten die beiden Raubkatzen schlecht natürliche Beute erlegen. Das Angebot an Homo sapiens als Ersatzbeute war überreichlich. Und über dem Menschenfleisch ist weder Fell noch Lederhaut noch Panzer. Trockenheit und Krankheiten hatten zudem die natürlichen Beutetierpopulationen dezimiert. John Henry Pattersons Erzählungen belegen, daß die beiden Löwen nicht von Beginn an gemeinsam auf Menschen losgingen. Sie fanden sich erst im Laufe der Zeit zusammen. Und: Die Löwen, so die Studie, haben keineswegs nur Menschen gefressen. Die Proben zeigten: Der eine fraß eher Menschen, der andere, dessen Zähne besser in Schuß waren, eher Wild. Auf jeden Fall taten sie sich früher oder später zur Jagd zusammen.
Neben den Zahnschäden mag es noch andere Faktoren gegeben haben, weshalb die Löwen sich damals an Menschen vergriffen. Elefantenjagd und Elfenbeinhandel hatten dazu beigetragen, daß sich in der Region der dornige Commiphora-Dornbusch ausbreitete. Auf Swahili heißt diese ökologisch wenig produktive Landschaft Nyika. Dies mag zu einer Reduktion des Beutetierangebots beigetragen haben. Gleiches gilt für die von britischen Siedlern aus Indien eingeschleppte Rinderpest, die 1898 die Bestände an Hausrindern und Büffeln dezimierte.
Eine andere Theorie bringt den – von den Briten bekämpften - Sklavenhandel ins Spiel. Die Karawanen arabischer Sklaventreiber überquerten den Tsavo nahe der geplanten Brücke. John Henry Patterson beschreibt in einer seiner Geschichten das Elend der Schwarzen, die auf diesen Gewaltmärschen Richtung Küste umkamen. Von Sansibar wurden die Sklaven damals in den Orient verfrachtet. Entlang der Route blieben die Leichen liegen – und die Löwen gewöhnten sich an diese „geschenkten“ Mahlzeiten und das Menschenfleisch. Was „Ghost & Darkness“ angeht, überzeugt die These vom fehlenden Futter jedoch nicht. Darbende Löwen hätten auch die Knochen verzehrt – was die beiden Killerlöwen eben nicht taten, wie der Zustand ihrer Zähne verriet.
Die Gesamtlänge der Löwen betrug übrigens – von der Nasenspitze bis zum Schwanzende - 290 bzw. 295 Zentimeter, die Schulterhöhe 1,20 bzw. 1,15 Meter. Damit waren die Tiere vergleichsweise groß. Acht Männer brauchte es damals, um auch nur einen der toten Löwen wegzutragen. Mähnenlos waren sie – wie die männliche Löwenpopulation es dort heute noch ist – aus Anpassung an den ostafrikanischen Dornbuschgürtel. Den Schädelmerkmalen nach waren sie sechseinhalb bis achteinhalb Jahre alt.
Mit den Ergebnissen der Isotopenanalyse und den Zahnuntersuchungen war die Forscherneugier aber noch längst nicht befriedigt. 2024 ging es weiter. Das Fachblatt Current Biology brachte eine Studie der „Ancient DNA“-Spezialistin Alida de Flamingh von der Universität Illinois mit weiteren Neuigkeiten über die beiden berüchtigten Tsavo-Löwen. Anhand alter Proben gewann sie Erbinformationen – mit dem Befund, daß die beiden Löwen Brüder oder Cousins waren. Die Proben waren aus den Zähnen bzw. Zahnlücken gewonnen worden. So konnte ein wenige Millimeter langes Bruchstück eines Haares untersucht werden. Es war menschliches Haar, das genetische Merkmale aufwies, die heute noch für Menschen in Ostafrika typisch sind. Das Haar steckte mit anderen Speiseresten im Hohlraum des abgebrochenen Reißzahns von FMNH 23970.
Wie bei einer Kernbohrung in Flußsedimenten ließ sich plötzlich sagen, wann die Löwen was gefressen hatten. Der Anatom Ogeto Mwebi von den National Museum of Kenya ordnete die Proben unter dem Mikroskop den Beutetierarten zu. Unter den Fragementen waren zahlreiche menschliche. Aber in keiner Schicht der untersuchten Zähne dominierten Menschenhaare. Zum Vorschein kamen Haare von Zebra, Impala, Oryxantilope, Warzenschwein, Stachelschwein, schließlich auch Giraffe, Wasserbock und Gnu. Der Fund von Gnu-Haaren widerlegte die These, daß die Art aus der Region damals verschwunden war. Pattersons Berichten war damals schon zu entnehmen, daß Gnus nicht weit entfernt vorkamen. Der Befund deutet also darauf hin, daß die Löwen durchaus große Tiere erlegen konnten. Wie sonst konnten Giraffenhaare in die Zahnhöhlen geraten? Möglich wäre aber auch, daß sie zuvor verendete Giraffen gefressen hatten.
Thomas Gnoske, Sammlungsmanager im Field Museum, vermutet, daß Büffel die eigentliche Hauptnahrung aller Löwen im Raum Tsavo gewesen seien. In der Nyika gab es nicht viel andere Beute. Als die Rinderpest die Büffelbestände kollabieren ließ, wandten sich „der Geist und die Dunkelheit“ den indischen Kulis zu, die sich zudem mit der afrikanischen Fauna nicht auskannten. Auch an anderen alten Löwenschädeln fanden sich abgebrochene Zähne – ein Beleg dafür, daß Löwen damals vorrangig Büffel fraßen. Dabei verloren manche im Kampf mit den Kolossen einen Fangzahn. Gnoske erklärte 2024: „Knochen schaffen das normalerweise nicht, Büffelhorn dagegen ist mit Sicherheit hart genug, um Löwenzähne zu brechen.“ Nur ein einziges Büffelhaar hatten die Forscher in den Zähnen der beiden Killerlöwen gefunden. Ergo: Die Büffel gingen, die Menschen kamen. Und was beim Brückenbau am Tsavo geschah, ereignete sich auch anderswo. Nur erfuhr die breite Weltöffentlichkeit davon nichts.
Den Auftrag, den Bau der Eisenbahnbrücke über den Tsavo und weiterer Streckenabschnitte zu überwachen, hatte John Henry Patterson Anfang 1898 von der Imperial British East Africa Company erhalten. Im März desselben Jahres kam er an. Den Bau der Uganda-Bahn hatte das britische Parlament 1896 beschlossen. Die Bahnstrecke sollte die Hafenstadt Mombasa mit dem Viktoriasee verbinden und das Landesinnere erschließen. Noch im gleichen Jahr begannen Trassierung und Bau. Kein anderes Verkehrsmittel war damals so leistungsfähig, sicher und zuverlässig wie die Eisenbahn. Karawanen und Ochsenkarren, die bis dahin Afrikas Transportmittel der Wahl waren, fielen plötzlich aus der Zeit. Um 97 Prozent verbilligten sich schlagartig die Warentransporte von der Küste nach Uganda und zurück. Investitionen und Handel blühten auf, im Einzugsbereich der Bahn entstanden zahlreiche Tee- und Kaffeeplantagen.
Nach den spektakulären Entdeckungsreisen David Livingstones und Henry Morton Stanleys ins Herz Ostafrikas hatte unter den europäischen Großmächten der „Wettlauf um Afrika“ begonnen. London wollte sich so schnell wie möglich die Herrschaft über das Nordufer des Viktoriasees und die Quellen des Nils sichern. Es war ein Rennen gegen die Zeit und insbesondere die Deutschen, die sich – unter anderem – weiter südlich und westlich, im heutigen Tansania, Ruanda und Burundi festgesetzt hatten.
Die Eisenbahn war das Instrument schlechthin, um den Kontinent zu erschließen, zu zivilisieren und eben auch zu unterwerfen. Ihre Funktion war wirtschaftlicher wie militärischer Art. Missionarischer Geist und Fortschrittsglaube beseelten die Unternehmung. Weite Teile Schwarzafrikas wurden unter hohen Opfern in das Zeitalter moderner europäischer Zivilisation katapultiert. Die Konfrontation mit den atavistischen Stammesgesellschaften – insbesondere im Landesinneren – war programmiert. Daß der britische „Vorstoß ins Innere“ auch mit Begegnung, Neugier und Entdeckung einherging – davon erzählt Pattersons Buch ebenfalls. Mal sind es die Zusammenkünfte mit afrikanischen Stammesführern, von denen Patterson in seinen weiteren „Abenteuergeschichten“ erzählt, mal liest er am Tsavo verlorengegangene weiße Missionarinnen auf, die es sich in den Kopf gesetzt haben, christlichen Glauben und westliche Zivilisation „in den Busch“ zu tragen.
Kolonialkritiker mögen heute alles in Bausch und Bogen verdammen, was Briten, Deutsche, Franzosen, Belgier oder Portugiesen nach Schwarzafrika gebracht haben, und allein das Fehlerhafte sehen. Dabei wird geflissentlich übersehen, wie die Zustände vor Ankunft der Europäer waren. Patterson erzählt – beiläufig – auch davon: vom Hunger etwa, von Rassismus, Tribalismus und Unterdrückung zwischen den schwarzen Völkern, von den Vernichtungsfeldzügen der Massai, denen ganze Dorfgemeinschaften anderer Ethnien zum Opfer fielen. Und auch von der Plage, der sich die Afrikaner damals – und heute ist es oftmals noch so – in Gestalt menschenfressender Löwen und Krokodile, die am Tsavo lauerten, ausgesetzt sahen. Patterson erzählt auch davon in einer seiner Expeditionsgeschichten, die sich an die Hauptstory, die Geschichte von den zwei „Teufeln“, anschließen.
Wie Man-Eater-Löwen auch nach den Tagen Pattersons in Ostafrika ihr Unwesen trieben, davon erzählt am Ende des Buches die Reportage „Malawi Secondary Road“. Darin berichtet der Übersetzer und Autor dieser Einführung nicht nur von dem Blutzoll, den später die „Menschenfresser von Njombe“ - die zwischen 1932 und 1946 nicht weniger als tausendfünfhundert Menschen im Süden des heutigen Tansania töteten - und andere blutrünstige Löwen forderten. Erzählt wird auch, wie es einem (beinahe) ergehen kann, der die Wildgebiete Afrikas für einen harmlosen und gut kontrollierten Zoo oder Disneypark hält. Das Thema ist bis heute brisant. 2009 schrieb der US-Biologe und bekannte Löwenforscher Craig Packer im Natural History Magazine, daß man allein in Tansania jedes Jahr hundertvierzig Angriffe von Löwen auf Menschen zähle. Die Dunkelziffer liege wohl doppelt so hoch. Gründe sind die Zerstörung des Lebensraums und die Dezimierung von Beutetieren. Wenn Löwen sich nachts an Menschen heranmachen, dann meist wegen Hungers. Bruce D. Patterson erklärte dazu: „Die Jagd auf Menschen ist ein Akt der Verzweiflung.“
Wer mehr zu diesem Thema lesen möchte, dem seien diese vier Bücher zur Lektüre empfohlen: Zuvorderst zu nennen ist „The Lions of Tsavo. Exploring the Legacy of Africa's Notorious Man-Eaters“ (2004) von Bruce D. Patterson - ein wahrer Wissenschaftsthriller.
Lesenswert sind auch Philip Caputos Löwenreport „Unter Menschenfressern. Auf den Spuren der mystischen Löwen von Tsavo“ (2002), Robert R. Frumps „The Man-Eaters of Eden. Life and Death in Kruger Nationalpark“ (2006) und „The Hunter is Death“ (1962) des südafrikanischen Schriftstellers Thomas Victor Bulpin, der sich auf die Spuren der Njombe-Killer und ihres Bezwingers, des legendären Jägers George Rushby, begeben hatte.
Länder wie Kenia, Tansania oder Uganda profitieren heute noch vom damaligen Bahnbau und den Plantagen etwa, die im Zuge dieser Mammutinvestitionen entstanden sind. Die Züge der Uganda-Bahn verkehren wie zu Pattersons Zeiten zwischen Mombasa, Nairobi und Kampala. Die Bezwingung der Wildnis und der technische Fortschritt waren wie einst im Wilden Westen Nordamerikas oder in der Sowjetunion Stalins mit fürchterlichen Opfern verbunden. Beim Bau der Uganda-Bahn war es nicht anders. Es war ein indischer Unternehmer namens Alibhoy Mulla Jeevanjee, der 1895 mit den Briten einen Deal gemacht hatte, ihnen dreißigtausend Inder für den Eisenbahnbau zu vermitteln.
Die, die aus Britisch-Indien kamen, waren Habenichtse und Glücksritter, die vor Hunger und Armut flohen. Viele bezahlten es mit dem Leben. Krankheiten, schlechte Versorgung, Unfälle, Überfälle durch kriegerische Massai forderten ihren Tribut. Die Löwen taten ihr Übriges. Einige Kulis blieben und kamen zu Wohlstand oder gar Reichtum – als Händler in Uganda, bis der schwarze Potentat und Horrorclown Idi Amin sie 1972 in einem Anfall rassistischen und neiderfüllten Wahns außer Landes trieb. Die Inder, die Patterson in seinem Buch mit viel Sympathie beschreibt, etwa sein Gewehrträger Mahina, hatten alles andere als dies verdient.
Unter die Räder kam auch immer wieder die schwarze Ursprungsbevölkerung. Die indischen Kontraktarbeiter schleppten Krankheiten ein, denen die schwarzen Volksgruppen mit ihrem Immunsystem oft nicht gewachsen waren. Es wiederholte sich im kleineren Maßstab, was die Conquista der Spanier und Portugiesen einst in Lateinamerika angerichtet hatte, als sie Pocken und anderes einschleppten. Und auch die Aufstandsbekämpfung der Briten kannte keine Gnade. John Henry Patterson war längst wieder außer Landes, als die britischen Kolonialherren 1905 bei der Nandi-Expedition der King's African Rifles im Südwesten des heutigen Kenia tausendachthundertfünfzig Männer, Frauen und Kinder massakrierten. Was hatten die Nandi, Angehörige einer Nilotengruppe, getan? Sie hatten gegen die Enteigung ihres Landes durch weiße Siedler aufbegehrt, sonst nichts. Von diesen Dingen erzählt die Tsavo-Löwen-Geschichte nicht. Patterson hätte wohl auch als „Nestbeschmutzer“ gegolten. Die Zeiten waren andere. Und: Er war ein treuer und loyaler Diener der Krone.
Im Buch gibt Patterson kaum Details aus seinem Vorleben preis. Er springt zu Beginn seiner „Menschenfresser“-Story, die mehr Report als Horrorroman ist, direkt ins Geschehen. Unprätentiös und nüchtern kommt sein ganzer Katastrophenbericht daher. Ist es Ausdruck soldatischer Reserviertheit oder eines „british understatement“? Geschwätzigkeit jedenfalls lag ihm fern. Patterson war pflichtbewußt, ein Soldat und detailverliebter Ingenieur, Beamter, Officer eben, einer, der zu seinen Jagdausflügen und Exkursionen erst aufbrach, wenn keine Arbeit mehr anlag.
Patterson, 1867 in Irland geboren, hielt seine Herkunft geheim. Der Vater war ein irisch-protestantischer Geistlicher. Über die Mutter ist – abgesehen von der römisch-katholischen Konfession – nicht viel überliefert. Außer den Namen von ein paar Kindheitshelden erfährt der Leser nichts über die frühen Jahre Pattersons. Mit achtundzwanzig, im Jahr 1895, heiratete er seine „Francie“ – Frances Helena Gray, eine Frau von Bildung, die er während seines Dienstes in Indien kennengelernt hatte. Die Dame hatte einen Bachelor in Science und einen Doktorgrad in Jura. Das erste gemeinsame Kind, Ellen Moyra, starb im Alter von nur vier Monaten in Indien. Erst 1909 kam das einzige weitere Kind des Paares in London zur Welt: Sohn Bryan – da war der Vater schon zweiundvierzig. Und es sei angemerkt: Bryan wurde Paläontologe am Field Museum in Chicago.
Wie vertraut John Henry Patterson mit Indien war, zeigt sich im Buch an vielen Stellen. Er spricht Hindi. Inder sind ihm – neben ein paar britischen Beamten und Offizieren – die engsten Gefährten. Mögen sie ihm auch als Gewehrträger, Koch oder „Boy“ - Laufbursche oder „Mächen für alles“ - untergeordnet gewesen sein, so ist seine Sympathie für sie nicht zu übersehen. Patterson war schon mit siebzehn in die British Army eingetreten, das war 1885. Nach dem Besuch der Royal Military Academy im südenglischen Sandhurst, wo das britische Heer seit 1741 seine Offiziere ausbildet, diente er in Übersee. Für zwölf Jahre ging er nach Indien. Dort war es, wo er den Eisenbahn- und Brückenbau in der Praxis lernte. Sandhurst hatte etwas Theorie beigesteuert. Seit jeher wurden dort auch die Engineers ausgebildet, die Pioniertruppen. Seit den 1870er Jahren war dort auch das East India Company's Military Seminary untergebracht – die Schmiede der Offiziere, die in Britisch-Indien dem Empire dienen sollten. Übrigens war der Besuch der Anstalt gebührenpflichtig – Vater Henry oder ein anderer Wohltäter muß tief in die Tasche gegriffen haben, um dem jungen John Henry die Offizierskarriere zu ebnen.
Die Beförderungen blieben nicht aus. Patterson brachte es bis zum Lieutenant Colonel, zum Oberstleutnant (auch wenn Dritte im Buch sogar vom Colonel (Oberst) sprechen). Den Distinguished Service Order, eine hohe Kriegsauszeichnung der britischen Armee, erhielt er 1901 – für seine Tapferkeit im (zweiten) Burenkrieg. Nach seinem Löwen- und Eisenbahnabenteuer in Ostafrika hatte Patterson sich der Reserveeinheit Essex Imperial Yeomanry angeschlossen. 1902, als er längst wieder daheim war, rief ihn die Armee erneut. Doch als sein Schiff mit dem 20th Batallion in Kapstadt eintraf, war der Burenkrieg bereits beendet – und der Held von Tsavo mußte unverrichteterdinge wieder die Heimfahrt antreten.
Der nächste Unruheherd, zu dem Patterson gerufen wurde (oder sich gerufen fühlte), war Nordirland. Der Protestant Patterson kommandierte in West Belfast ein Regiment der Ulster Volunteers, jener 1912 gegründeten protestantisch-unionistischen Miliz, die den Anschluß Nordirlands an die Republik Irland verhindern wollte. Ihr Schreckensszenario war die Home Rule, die „Selbstregierung“ auf der irischen Insel – die Abkehr von London. John Henry Patterson gehört damals wohl zu denen, die – mit Billigung des kaiserlichen Deutschen Reichs – im April 1914 zwanzigtausend Gewehre und zwei Millionen Schuß Munition von Deutschland nach Nordirland schmuggelten. Es war der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der die Home Rule Crisis schlagartig beendete.
Der Löwentöter Patterson fand sich nun plötzlich im Osmanischen Reich wieder. Seine Einheiten waren nun das Zion Mule Corps und später die Jüdische Legion, eine aus fünf Bataillonen gebildete Truppe jüdischer Freiwilliger. Gegner waren die Osmanen. Patterson kommandierte zunächst das Zion Mule Corps, das an der Schlacht von Gallipoli beteiligt war, später das 38. Bataillon der Royal Fusiliers, das auch als Jüdische Legion bekannt wurde.Mit ihr kämpfte er auch im Sinai und in Palastinä gegen die Osmanen. Der Brückenbauer war zum Zionisten geworden.
Den Krieg gewann Patterson. 1920 verließ er die Armee. Aber den Kampf gegen den Antisemitismus, dem seine Truppen – seitens der eigenen Leute - ausgesetzt waren, hatte er nicht gewonnen. Wieder und wieder hatte er der Militärführung drohen müssen: Beendet die antisemitischen Schikanen im Heer – oder ich schmeiße hin!
Der nordirische „Daniel in der Löwengrube“ wurde alt, aber nicht biblisch alt. Patterson starb am 18. Juni 1947 im Alter von neunundsiebzig Jahren im kalifornischen Bel Air, wohin er sich mit seiner Frau 1940 zurückgezogen hatte, bei seinem Freund Marion Travis wohnend – und von seinen britischen Pensionszahlungen abgeschnitten. In den langen Jahren nach seinem Dienstende in der Armee blieb er der jüdischen Sache treu. Drei Bücher veröffentlichte er noch, nachdem 1907 „The Man-Eaters of Tsavo and Other East-African Adventures“ bei Macmillan erschienen war: zunächst, 1909, „In the Grip of the Nyika. Further Adventures in British East Africa“, dann (1916) „With the Zionists in Gallipoli“ und (1922) „With the Judaeans in the Palestine Campaign“, worin er seine Kriegserlebnisse schilderte.
Mag Patterson auch durch seinen Kampf gegen die „Menschenfresser von Tsavo“ Berühmtheit erlangt haben – noch größere Verdienste gebühren ihm an anderer Stelle. Ohnehin ein überzeugter Zionist und bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bereits recht betagt, schlug seine Stunde in den dunkelsten Tagen des jüdischen Volkes. Patterson war einer der Köpfe der Bergson Group, die insbesondere auf den damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt Druck ausübten, die europäischen Juden vor dem Holocaust zu retten. Zunächst hatte sich die Gruppe dafür starkgemacht, eine jüdische Armee – aus staatenlosen Juden und solchen aus Palästina – aufzustellen. Später, als Berichte über die Todesfabriken im deutsch besetzten Polen die USA erreichten, machte die Gruppe vorrangig politischen Druck, um Juden vor ihrer Ermordung durch die Nazis zu retten. Bekanntlich hatte Roosevelt andere Prioritäten, als Gaskammern und Öfen zu bombardieren.
Die sterblichen Überreste John Henry Pattersons und seiner Frau „Francie“, die sechs Wochen nach ihm starb, wurden zunächst auf dem Angelus-Rosedale Cemetery bei Los Angeles bestattet. Weil es aber sein letzter Wunsch gewesen war, nahe der Männer bestattet zu sein, mit denen er im Heiligen Land gekämpft hatte, wurden die Urnen 2014 auf Initiative seines Enkels Alan Patterson umgebettet. Auf dem Friedhof des Kibbuz Avihayil bei Netanya haben er und seine Frau nun ihre letzte Ruhe gefunden. Die Grabrede hielt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.
Das Löwen-Drama von Tsavo beschäftigte schon in den 1950er Jahren Hollywood. 1952 kam der Streifen „Bwana Devil“ („Bwana, der Teufel“) in die Lichtspielsäle. Das US-Filmfaktotum Arch Oboler sorgte für Regie, Drehbuch und Produktionsleitung in einem. Der Abenteuerschocker mit Robert Stack als Bob Hayward und Nigel Bruce – bekannt als Dr. Watson aus den Sherlock-Holmes-Filmen der 40er Jahre – als Dr. Angus McLean in der Hauptrolle verdreht die historischen Fakten gründlich. Im Film sind es zwei britische Ingenieure, die es mit den Löwen zu tun bekommen. Drei Jäger reisen mit Haywards Frau Alice (Barbara Britton) im Schlepptau als Helfer in der Not an – werden aber einer nach dem anderen von den Bestien gefressen. Nun muß Bob selbst auf Löwenpirsch. Am Ende wird die Frau gerettet – und Bob hat bewiesen, daß er kein Schwächling ist. Der Farbfilm wurde übrigens in 3D gezeigt. Es war die Ära der Bewegtbilder mit Tiefeneindruck. Die Kritik war not amused. Das „Lexikon des internationalen Films“ schrieb: „Primitiver Abenteuerfilm, für den - als die erste kommerzielle 3-D-Produktion - mit dem Slogan ‘Ein Löwe auf Ihrem Schoß’ geworben wurde.“ Die Zuschauer sahen sich den Streifen mit billig hergestellten Wegwerf-Pappbrillen mit Polarisationsfolien an und sollen begeistert gewesen sein. Der Film ist – Stand: 2025 – nur noch in den USA als Blu-Ray erhältlich. Ansonsten machen auf eBay noch alte Presse- und Aushangfotos, Filmprogramme und -poster die Runde.
1959 kam die nächste Geschichte über den leidigen Bahnbau in Kenia in die Kinos: „Killers of Kilimanjaro“ („Rivalen unter heißer Sonne“) von Warwick Films. Die Regie hatte Richard Thorpe, der auf billig produzierte Komödien und Western abonniert war. Der Amerikaner war bekannt dafür, seine Budgets zu unterschreiten und jede Szene möglichst nur einmal zu drehen. Das brachte ihm den Spitznamen „Mr. One Take“ ein. Robert Taylor und Donald Pleasence hatten die Hauptrollen. Von einer Verfilmung des Tsavo-Dramas kann indes kaum die Rede sein – allenfalls dürfte es „nach Motiven von …“ heißen. Die Geschichte lehnt sich an das Buch „African Bush Adventures“ von John Alexander Hunter, Großwildjäger in Kenia, und Autor Daniel Pratt Mannix aus dem Jahr 1954.
Erzählt wird die Geschichte Robert Adamsons (gespielt von Robert Taylor), der mit dem Schiff nach Mombasa reist, um herauszufinden, warum es mit dem Bahnbau nicht vorwärtsgeht. Ein Bahningenieur wird vermißt. Der Verdacht fällt zunächst auf arabische Sklavenhändler, die in Karawanen durchs Land ziehen – ein Thema, das auch Pattersons Buch streift. Zudem machen die Deutschen in Tansania mit einem eigenen Bahnprojekt Konkurrenz. Adamson organisiert Träger aus dem Gefängnis Fort Jesus in Mombasa. Der Trip ins Landesinnere wird zur Hölle. Die Bahngleise sind gesprengt, gefährliche Eingeborene vom Stamm der Waarusha treiben sich herum, es fehlt an Wasser, wilde Tiere treten auf den Plan … - mehr sei nicht verraten. Filmdienst.de nannte den britischen Streifen „buntes Abenteuerkino“. Die New York Times erkannte ein „Handbuch von Dschungelklischees“. Über verdrehte Fakten – der Kilimandscharo liegt nun mal in Tansania und nicht in Kenia, und die Waarusha siedeln nicht am Viktoriasee – läßt sich hinwegsehen. Der Film ist – Stand: 2025 – nur als Spanien-Reimport in der englischsprachigen Originalversion erhältlich. Für beide Filme gilt: An „African Queen“ oder „Hatari“ reichen weder „Bwana, der Teufel“ noch „Rivalen unter heißer Sonne“ heran.
Wirkliche Bekanntheit erlangte die Tsavo-Tragödie von 1898 erst durch den Hollywood-Film „The Ghost and the Darkness“ („Der Geist und die Dunkelheit“) aus dem Jahr 1996. Der Titel greift die Bezeichnungen auf, die die einheimischen Massai damals den beiden Horror-Löwen gegeben hatten. Das Drehbuch stammte von dem renommierten Vielschreiber William Goldman, der 1984 bei einer Afrikareise erstmals von der Tsavo-Geschichte gehörte hatte und sie 1989 Paramount anbot – als Mischung aus „Der weiße Hai“ und „Lawrence von Arabien“.
Stephen Hopkins Verfilmung erlaubt sich manche gestalterische Freiheiten, kann aber als halbwegs werkgetreue Adaption der Patterson-Memoiren durchgehen. Val Kilmer spielt den britischen Ingenieur, der an den Tsavo gerufen wird, um den stockenden Bahnbau voranzutreiben. Michael Douglas (statt des eigentlich vorgesehenen Tom Cruise) hat die Rolle des fiktiven Großwildjägers Charles Remington, dessen Figur an den anglo-indischen Raubkatzenjäger Charles Henry Ryall, damals Superintendent der Bahnpolizei, angelehnt ist – der in Pattersons Man-Eater-Report in Erscheinung tritt, allerdings erst in der herzzerreißenden und wahren Geschichte „Ein Menschenfresser in einem Eisenbahnwaggon“, die sich im hinteren Teil des Buches unter den weiteren Abenteuerstories befindet. Remington – der im Film einen Trupp Massai-Krieger befehligt - kommt wie Ryall durch einen Löwen um. Remington wird in der Filmhandlung von einem der Löwen nachts aus dem Zelt gezogen und gefressen. Ein ähnliches Schicksal erlitt Ryall tatsächlich. Was der tragische Superinendent und zwei Kollegen, ein Italiener und ein Österreicher, damals während einer Nacht in einem Bahnwaggon erleben mußten, läßt dem Leser tatsächlich das Blut gefrieren.
Gänzlich erfunden ist der Besuch von Pattersons Frau samt neugeborenem Sohn in Tsavo. Sohn Bryan kam bekanntlich erst 1909 auf die Welt. Viel mehr dürfte dem aufmerksamen Leser aber aufstoßen, daß die beiden Man-Eater im Film Mähnen haben. Die historischen Killerlöwen waren mähnenlos. Die Abweichung ist leicht zu rechtfertigen: 1996 war die Animationstechnik noch nicht so weit. Die zwei Menschenfresser wurden von zwei echten dressierten Löwen namens Bongo und Caesar gedoubelt – und die hatten nun mal Mähnen. Die zwei Raubkatzen stammten aus dem kanadischen Bowmanville Zoo in Clarington, Ontario. Die beiden Löwen waren auch beim Dreh der Tarzan-Abenteuerkomödie „George – Der aus dem Dschungel kam“ (1997) im Einsatz.
Gedreht wurde „Der Geist und die Dunkelheit“ hauptsächlich in Südafrika, und zwar im Wildreservat Songimvelo in Mpumalanga. In Kenia wurden nur wenige Szenen aufgenommen – Grund waren steuerliche Probleme, die die Regierung in Nairobi machte. Die im Film gezeigten Massai waren überwiegend Südafrikaner. Nur bei den Szenen, die die Jagd auf die Löwen zeigten, waren echte Massai im Einsatz. Die Dreharbeiten waren strapaziös und gefährlich. Regisseur Stephen Hopkins berichtete später der Los Angeles Daily News: „Wir hatten Schlangenbisse, Skorpionstiche, Zeckenbißfieber, von Blitzen getroffene Leute, Fluten, sintflutartige Regenfälle, Gewitterstürme, Nilpferde, die unsere Leute durchs Wasser verfolgten, Autos, die ins Wasser gefegt wurden, und einige Todesfälle unter den Crew-Mitgliedern, darunter zwei Fälle von Ertrinken …“
Kommerziell war der Film erfolgreich: Er spielte 87 Millionen US-Dollar ein, bei Produktionskosten von 55 Millionen Dollar. Auch gab es 1997 einen „Oscar“ in der Kategorie „Bester Tonschnitt“. Die Filmkritik war teils verhalten, teils vernichtend. Das „Lexikon des internationalen Films“ urteilte: „Die auf einem Tatsachenroman basierende Verfilmung schöpft die Horror-Elemente der Geschichte voll aus, vernachlässigt aber Dramaturgie und Charakterzeichnung der Personen. So wird der auch schauspielerisch enttäuschende Film nur zu einem oberflächlichen Spannungsvergnügen und beeindruckt letztlich nur durch seine sensationellen Tierdressuren und schönen Landschaftspanoramen.“ In der Presse fiel das Urteil über den Film teilweise hämisch aus. Von „B-Movie“ war viel die Rede. Val Kilmer wurde gar für den Negativ-Preis „Razzie“, den „Golden Raspberry Award“ („Goldene Himbeere“), als schlechtester Schauspieler nominiert. Oberflächliche Schauspielerleistungen, billige Schockeffekte, fehlende Tiefgründigkeit – zu meckern gab es im Feuilleton reichlich. Zu denken gibt eines in der Tat: Selbst Regisseur Hopkins äußerte 1998 in einem Interview, der Film sei ein „großes Durcheinander“ („a mess“). Er sei nicht in der Lage gewesen, ihn sich anzusehen („I haven't been able to watch it.“)
Manchmal ist das Kopfkino eben besser. „The Man-Eaters of Tsavo and Other East-African Adventures“ liefert dafür beste Voraussetzungen.
Zum Geleit – Von John Henry Patterson
Es sind Gefühle allergrößter Bescheidenheit, mit denen ich der Öffentlichkeit die nachfolgenden Seiten vorlege; nun haben mich diejenigen unter meinen Freunden, die von meinen recht einzigartigen Erfahrungen in der Wildnis gehört haben, so oft bedrängt, einen Bericht über meine Abenteuer zu schreiben, daß ich nach einigem Zögern beschlossen habe, dies zu tun.
Ich habe keinen Zweifel daran, daß viele meiner Leser, die vielleicht niemals weitab der Zivilisation gewesen waren, zu der Annahme neigen werden, daß einige der Vorkommnisse übertrieben seien. Ich kann ihnen nur versichern, daß ich die Fakten eher abgemildert habe und daß ich bemüht war, einen absolut nüchternen und geradlinigen Bericht der Dinge zu schreiben, so wie sie tatsächlich passiert sind.
Es sei daran erinnert, daß zu der Zeit, als diese Ereignisse passierten, die Verhältnisse in Britisch-Ostafrika ganz anders waren, als sie es heute sind. Die Eisenbahn, die die Gegend modernisiert und den Fortschritt aufs Gleis gebracht hat, war damals erst im Bau, und das Land, durch das sie gebaut wurde, war noch immer in einem Zustand primitiver Wildheit - wie es die Gegend abseits der Bahnstrecken auch heute noch ist.
Wenn dieser schlichte Bericht über zwei Jahre Arbeit in der Wildnis Interesse erregen oder dazu beitragen sollte, Aufmerksamkeit auf dieses schöne und kostbare Land zu lenken, das wir am Äquator besitzen, so würde ich mich mehr als entschädigt sehen für die Mühsal, ihn zu schreiben.
Ich stehe ganz in der Schuld des ehrenwerten Herrn Cyril Ward, Sir Guilford Molesworths, K.C.I.E. (Knight Commander of the Most Eminent Order of the Indian Empire; Anmerkung K.A.), Herrn T.J. Spooners und Herrn C. Rawsons für ihre Freundlichkeit, mir die Wiedergabe von ihnen aufgenommener Fotos zu gestatten. Mein wärmster Dank gilt außerdem Herrn F.C. Selous, dem Veteranen unter den Pionieren Afrikas, der meinem kleinen Buch freundlicherweise eine Einführung zukommen ließ - jenes „Vorwort“, das er so gut war zu schreiben.
John Henry Patterson im August 1907.
Vorwort – Von Frederick Courteney Selous
Es ist sieben oder acht Jahre her, daß ich erstmals auf den Seiten des Magazins The Field (britisches Jagdmagazin; K.A.) in einem kurzen Bericht des Colonel (Oberst) J.H. Patterson, der damals als Ingenieur beim Bau der Uganda-Bahn arbeitete, etwas über die menschenfressenden Löwen von Tsavo las. (Anmerkung: John Henry Patterson war Lieutenant-Colonel (Oberstleutnant); K.A.)
Meine eigene langjährige Jagderfahrung in Afrika sagte mir sofort, daß jedes Wort dieser nervenaufreibenen Erzählung absolut zutreffend war. Mehr noch: Ich wußte, daß der Autor seine Geschichte in einer höchst uneitlen Weise erzählt und wenig Betonung auf die Gefahren gelegt hatte, denen er ausgesetzt war, als er nachts den fürchterlichen Menschenfressern aufgelauert hatte - insbesondere das eine Mal, als er auf einem leichten Gerüst saß, nur von vier wackeligen Stangen gestützt, und ihm eine der schrecklichen Bestien nachstellte. Zum Glück verlor er nicht die Nerven, und es gelang ihm, den Löwen zu erschießen, als der bereits auf ihn springen wollte. Hätte der Löwe ihn von hinten angegangen, so denke ich, wäre auch Colonel Patterson auf der langen Liste der Opfer gelandet - zumal ich selbst von drei Fällen weiß, in denen Löwen Männer von Bäumen oder Hochständen heruntergerissen haben, die höher waren als das verrückte Konstrukt, auf dem Colonel Patterson in jener Nacht des Schreckens hockte.
Seit den Zeiten Herodots sind bis heute zahllose Geschichten über Löwen erzählt und geschrieben worden. Ich habe selbst einige zu Protokoll gegeben. Aber keine Löwengeschichte, von der ich je gehört oder gelesen habe, gleicht in ihrer dramatischen Bedeutung und der lang anhaltenden Spannung der Geschichte der Menschenfresser von Tsavo, wie sie Colonel Patterson erzählt. Eine Löwengeschichte ist gewöhnlich eine Erzählung von Abenteuern, häufig sehr schrecklicher und pathetischer Art, die ein paar Stunden einer Nacht in Anspruch nehmen. Aber die Erzählung von den Tsavo-Menschenfressern ist ein ganzes Epos schrecklicher Tragödien, die sich über etliche Monate verteilt haben und schließlich erst durch die Mittel und die Entschlossenheit eines einzigen Mannes beendet wurden.
Es war einige Jahre, nachdem ich den ersten veröffentlichten Bericht über die Menschenfresser von Tsavo gelesen hatte, daß ich die Bekanntschaft von Präsident (Theodore) Roosevelt machte. Ich erzählte ihm alles darüber, was mir erinnerlich war. Er war an der Geschichte so stark interessiert, wie er es an allen wahren Geschichten von der Natur und dem Wesen wilder Tiere ist, daß er mich bat, ihm den kurzen Bericht aus der Zeitschrift The Field zu schicken. Das tat ich; und so schrieb Präsident Roosevelt mir in dem letzten Brief, den ich von ihm zu dieser Geschichte erhielt: „Ich denke, daß das Vorkommnis mit den menschenfressenden Löwen in Uganda, wie es in den beiden Artikeln, die Sie mir sandten, geschildert wird, der bemerkenswerteste Bericht ist, der uns aktenkundig ist. Es wäre sehr schade, wenn er nicht in dauerhafter Form erhalten bliebe.“ Nun bin ich froh, annehmen zu dürfen, daß er in dauerhafter Form erhalten bleibt. Und ich wage es, Colonel Patterson zu versichern, daß Präsident Roosevelt zu den am meisten interessierten Lesern seines Buches zählen wird.
Wahrscheinlich werden die Kapitel, die die Geschichte von den menschenfressenden Löwen von Tsavo wiedergeben, stärker aufgenommen werden als die anderen Teile von Colonel Pattersons Buch. Aber ich glaube, daß die meisten Leser mir zustimmen werden, daß das ganze Werk voller Gehalt und Informationen steckt. Colonel Pattersons Bericht, wie er alle Schwierigkeiten beim Bau einer stabilen und beständigen Eisenbahnbrücke über den Fluß Tsavo überwand, ist eine exzellente Lektüre - während der Mut, den er bewies, als er eigenhändig mit Löwen, Nashörnern und anderen gefährlichen Tiere den Kampf aufnahm, noch von dem Schneid, dem Feingefühl und der Entschlossenheit übertroffen wurde, die er zeigte, als er die gewaltige Meuterei bezwang, die einmal unter den einheimischen indischen Arbeitern ausgebrochen war.
Lassen Sie mich am Ende noch sagen, daß ich fast zwei Nächte lang die Korrekturfahnen von Colonel Pattersons Buch gelesen habe und daß ich ihm versichern kann, daß die Zeit dabei wie im Fluge verging. Mein Interesse hielt von der ersten bis zur letzten Seite, da ich spürte, daß jedes Wort, das ich las, der Wahrheit entsprach.
F.C. (Frederick Courteney) Selous, Worplesdon, Surrey, 18. September 1907.
Meine Ankunft in Tsavo
Es war gegen Mittag am 1. März 1898, als ich den engen und ein wenig gefährlichen Hafen von Mombasa an der Ostküste Afrikas erreichte. Die Stadt liegt auf einer Insel gleichen Namens und wird nur von einem sehr engen Kanal, der den Hafen bildet, vom Festland getrennt. Als unser Schiff nahe der malerischen alten portugiesischen Festung hereindampfte, die vor mehr als dreihundert Jahren gebaut worden war, war ich von der eigenartigen Schönheit des Ausblicks, der sich mir nach und nach bot, wie erschlagen. Entgegen meiner Annahme sah alles frisch und grün aus, und ein orientalischer Reiz und Zauber schien über der Insel zu schweben. Die Altstadt war in strahlenden Sonnenschein getaucht und spiegelte sich träge auf dem reglosen Meer. Ihre Flachdächer und irritierend weißen Mauern lugten traumhaft zwischen schwankenden Palmen und ihren erhabenen Kokosnüssen, gewaltigen Affenbrotbäumen und sich spreizenden Mangobäumen hervor. Und der dunkle Hintergrund aus dicht bewaldeten Hügeln und Hängen auf dem Festland bildete eine effektvolle Landschaft, die sich zu einem schönen und mir unerwartetem Bild formte.
Der Hafen war reichlich mit arabischen Dhaus gesprenkelt, von denen einige, glaube ich, bis zum heutigen Tag gelegentlich ein paar Sklaven nach Persien und Arabien schmuggeln. Es war mir immer ein großes Rätsel, wie die Steuermänner kleiner Schiffe ohne die Hilfe von Kompaß und Sextant ihren Weg von Hafen zu Hafen finden und wie sie die fürchterlichen Stürme überstehen, die zu bestimmten Jahreszeiten die östlichen Meere heimsuchen. Ich erinnere mich, einmal bei einer Überfahrt einer Dhau begegnet zu sein, die mitten auf dem Indischen Ozean in Windstille gelegen hatte, als deren Besatzung Notzeichen gab und unser Kapitän langsamer fuhr, um der Sache nachzugehen.