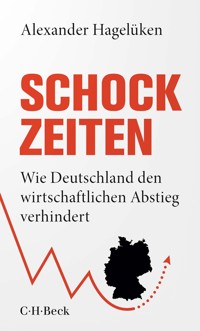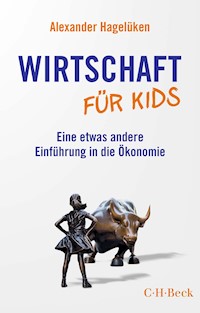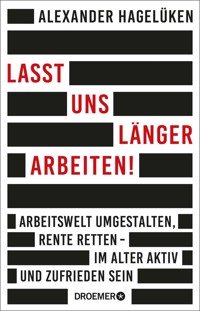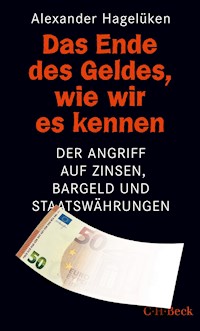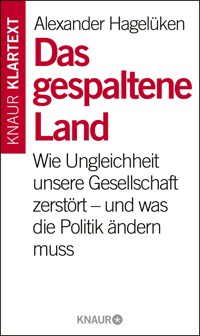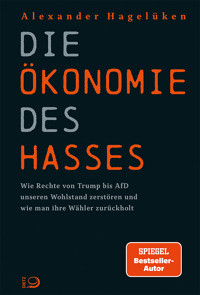
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Rechtspopulisten von Donald Trump bis Alice Weidel locken die Wähler:innen mit Anti-Politik. Sie agitieren gegen Freihandel, EU, Migrant:innen, demokratische Institutionen und Klimaschutz. Doch ihre "Ökonomie des Hasses" zerstört den Wohlstand und verschlechtert das Leben aller, wie die Welt seit der Wahl von Donald Trump täglich erleben muss: Handel und Wirtschaft schrumpfen drastisch, Pflegekräften fehlen, wo Migration verhindert wird, ohne Institutionen kollabiert die Demokratie und ohne Klimaschutz der Planet. Der SZ-Wirtschaftsredakteur Alexander Hagelüken zeigt an vielen Beispielen und Daten, wie die Rechten Reiche noch reicher machen und die Mehrheit der Gesellschaft leidet. Er schlägt neue Wege vor, ihre Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Gerade jetzt brauchen wir eine neue Wirtschaftspolitik, um unsere Demokratie zu bewahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alexander Hagelüken
DIEÖKONOMIE DESHASSES
Wie Rechte von Trump bis AfD unseren Wohlstand zerstören und wie man ihre Wähler zurückholt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8012-0701-4 [Print]
ISBN 978-3-8012-7071-1 [E-Book]
Copyright © 2025 by
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH
Dreizehnmorgenweg 24, 53175 Bonn
Tel. 0228/18 48 77-0 / [email protected]
Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Umschlag: Ralf Schnarrenberger, Hamburg
Satz: Rohtext, Bonn
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, 2025
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet: www.dietz-verlag.de
INHALT
Cover
Titel
Impressum
TEIL I: WARUM SO VIELE MENSCHEN RECHTS WÄHLEN
KAPITEL 1 DIE MOTIVE DER WÄHLER – UND WAS DIE RECHTEN VERSPRECHEN
TEIL II: WAS RECHTE ANRICHTEN
KAPITEL 2 WIE TRUMPS ZOLLINFERNO DER WELTWIRTSCHAFT SCHADET
KAPITEL 3 DER AUSSTIEG AUS DER EU VERNICHTET MILLIONEN JOBS
KAPITEL 4 OHNE MIGRATION WERDEN ALTE NICHT GEPFLEGT UND DIE WIRTSCHAFT SCHRUMPFT
KAPITEL 5 MIT DEMOKRATISCHEN INSTITUTIONEN STIRBT AUCH DER WOHLSTAND
KAPITEL 6 OHNE KLIMASCHUTZ KOLLABIERT DER PLANET
KAPITEL 7 WIE DIE RECHTEN REICHE NOCH REICHER MACHEN
TEIL III: WIE MAN WÄHLER DER RECHTEN ZURÜCKHOLEN KANN
KAPITEL 8 NEUE POLITIK GEGEN RECHTS
KAPITEL 9 POLITIK FÜR DIE MEHRHEIT
KAPITEL 10 EIN GESELLSCHAFTSVERTRAG FÜR MIGRATION
KAPITEL 11 MEHR FÜR ARBEITNEHMER UND ABGEHÄNGTE REGIONEN
KAPITEL 12 MEHR SICHERHEIT FÜR DIE MENSCHEN
DANK
VERWENDETE QUELLEN
ÜBER DEN AUTOR
TEIL I: WARUM SO VIELE MENSCHEN RECHTS WÄHLEN
KAPITEL 1
DIE MOTIVE DER WÄHLER – UND WAS DIE RECHTEN VERSPRECHEN
Es ist halb drei Uhr nachts, als der Mann mit der Tolle die Bühne in West Palm Beach betritt. Gerade haben die Fernsehsender an diesem 7. November 2024 verkündet, dass Donald Trump wohl US-Präsident wird. Am Redepult steht Trump will fix it, er wird Amerika reparieren. Kurze Zeit vorher sind es noch ganz andere Menschen, die hier reparieren. Dutzende Arbeiter schleppen Gitter für Sicherheitszäune heran, montieren, bohren, schwitzen in der Hitze. Manche stammen aus Haiti. Es sind auch Zuwanderer, die Trumps Siegesfeier vorbereiten. Jene Menschen, von denen er bald Millionen aus dem Land werfen will. »An diesem Tag wird Amerika befreit«, tönt der neue Präsident von der Bühne. »Es beginnt das goldene Zeitalter.«
Große Worte macht auch die Frau mit der Halskette. AfD-Chefin Alice Weidel versucht am Abend der Bundestagswahl im Februar 2025 ein Lächeln, doch gleich wird ihre Miene wieder schneidend streng. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg zieht eine rechtspopulistische Partei als zweitstärkste Kraft in den Deutschen Bundestag ein. Weidel verliert keine Zeit mit moderaten Tönen. »Wir werden sie tatsächlich jagen«, droht sie den Parteien der Mitte. Das ist ein anderer Umgang mit dem politischen Kontrahenten, als er in der deutschen Demokratie üblich war. Weidel verwendet tatsächlich den Begriff aus der Welt der Jagd, bei der Tiere getötet werden.
Wer vor zehn Jahren in einen tiefen Schlaf gefallen ist und jetzt aufwacht, kann kaum glauben, wie sich die Welt verändert hat. Überall sind rechte Parteien auf dem Vormarsch, womit ich in diesem Buch Rechtspopulisten und Rechtsextreme meine. Sie sind in Frankreich die stärkste Partei. Ebenso in Italien, wo sie mit Giorgia Meloni die Regierung anführen. Sie haben sich in Mittel- und Osteuropa festgesetzt, in Ungarn und der Slowakei, lange in Tschechien und Polen. In Österreich wurde FPÖ-Chef Herbert Kickl beinahe Regierungschef, Volkskanzler, wie die FPÖ das Amt nennt, so wie es zuvor die Nazis bei Adolf Hitler taten. Die Türkei wird unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan beständig autoritärer. Die AfD will bei der nächsten Bundestagswahl stärkste Partei werden, was sie in Ostdeutschland bereits ist. Zusammen mit dem BSW von Sahra Wagenknecht, das bei Migration oder Klimawandel rechts tönt, erreichte die AfD schon bei dieser Bundestagswahl fast so viele Stimmen wie die Union. Und in den USA hat Donald Trump den mächtigsten Posten des Erdballs erobert: Präsident der stärksten Wirtschafts-, Militär- und Atommacht der Welt.
Der Aufstieg der Rechten bedroht Frieden, Freiheit, Minderheiten und Demokratie. Donald Trump hat im Wahlkampf angekündigt, »wie ein Diktator« zu regieren. Er hebelt demokratische Institutionen wie die Justiz aus und gibt die von Russland mörderisch überfallenen Ukrainer preis. Die mittel- und osteuropäischen Rechten manipulieren das Justizsystem, drangsalieren politische Kontrahenten und versuchen in der EU die Abwehr Russlands zu sabotieren. Der deutsche Verfassungsschutz hat die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, wogegen die Partei geklagt hat, sodass die Einstufung auf Eis liegt. Der Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem verhindern, dass extremistische Parteien die Demokratie zerstören.
Der Aufstieg der Rechten ist die größte Gefahr für die Menschen im Westen seit vielen Jahrzehnten. Zu vergleichen ist diese Gefahr nur mit der Bedrohung durch autoritäre Regime wie Russland und China, die die westlichen Demokratien beseitigen wollen. Fatal ist, dass der Aufstieg der Rechten diese Bedrohung verstärkt. Politiker wie Trump sympathisieren des Öfteren mit Diktatoren wie Wladimir Putin – und schicken sich an, mit ihnen gemeinsame Sache machen.
Vergleichsweise wenig diskutiert wird bisher, welche wirtschaftlichen Konsequenzen der Aufstieg der Rechten auslöst. Dabei wählen viele auch aus wirtschaftlichen Motiven rechts, aus Frust über ihr Einkommen und die Inflation, aus Angst vor dem Abstieg.
In diesem Buch beschäftige ich mich vor allem damit, was ökonomisch mit den Menschen geschieht, wenn Rechte an die Regierung kommen. Ich verstehe das Buch als Information für alle Wählerinnen und Wähler, was aus ihrem Leben werden könnte und aus ihrem materiellen Wohlstand – der heute so groß ist wie nie zuvor in der Geschichte, die von Armut, Hunger und Elend dominiert war. Ich verstehe das Buch als Analyse, wie sich die politischen und ökonomischen Folgen rechter Politik gegenseitig verstärken. Und – in aller Bescheidenheit – als Versuch, Vorschläge zu machen, mit welcher ökonomischen Politik sich womöglich Wähler der Rechten zurückgewinnen lassen. Die Demokratien des Westens sind gefährdet, und mit ihnen Frieden und Freiheit.
Warum wählen heute so viele Menschen rechts? Die politischen, kulturellen und weiteren Ursachen sind von kundigen Fachleuten beschrieben worden. Ich möchte vor allem einen Blick auf die ökonomischen Gründe werfen, und auf damit verwandte Ursachen. Sie verraten etwas darüber, was im Kapitalismus falsch läuft und was die demokratischen Parteien der Mitte falsch machen. An den Motiven rechter Wähler zeigt sich aber auch, dass vieles nicht von den westlichen Demokratien verschuldet ist – und dass der rechte Wahlerfolg sich oft Desinformation und Manipulation verdankt.
Vor der deutschen Bundestagswahl stuften 44 Prozent der Wählerinnen und Wähler die aktuelle wirtschaftliche Lage als schlecht ein. Das ist ein markanter Unterschied zu den 2010er-Jahren. Die Deutschen haben die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP krachend abgewählt. Wirtschaft war für die Deutschen nach Frieden und Sicherheit das entscheidende Thema – vor Migration. Mindestens so schlimm wie die aktuelle Stagnation wog das Gefühl, sich in einer Dauerkrise zu befinden. Tatsächlich ist die deutsche Wirtschaft seit fünf Jahren kaum gewachsen. Dadurch fehlen jedem Deutschen grob gesagt 10.000 Euro Wirtschaftsleistung, also massiv Einkommen. »Was die AfD sehr erfolgreich macht, ist nicht die Lösungen versprechen – sondern die Probleme beim Namen nennen«, urteilt der Forscher Simon Schnetzer.
Bei der Wahlentscheidung sollte allerdings eine Rolle spielen, wer für die wirtschaftlichen Probleme verantwortlich ist. Die gescheiterte Ampel-Regierung trägt daran eine Mitschuld, weil sich SPD und Grüne mit der FDP nicht auf eine Strategie für Wachstum einigen konnten. Wesentliche Gründe für die Dauerkrise kommen jedoch von außen. 2020 verursachte die in China ausgebrochene Corona-Pandemie einen der schwersten wirtschaftlichen Abstürze der Nachkriegszeit. 2022 überfiel Russland die Ukrainer und fügte ihnen unermessliches Leid zu. Ökonomisch war die Folge von Wladimir Putins Kriegsaggression unter anderem, dass die deutsche Industrie kein billiges russisches Gas mehr bekam. Weil die Industrie doppelt so viel zur Wirtschaftsleistung beiträgt wie in anderen Staaten, traf dies Deutschland schwer. Ebenso wie die allgemeinen Preiserhöhungen, die den Konsum reduzierten. Ebenso wie die Subventionen, mit denen China seine Produkte in die westlichen Märkte drückt. Die AfD profitiert von ökonomischen Problemen, die die Ampel nur zum kleineren Teil verursachte.
Auch in den USA haben sich die Wähler stark aus wirtschaftlichen Motiven für Donald Trump entschieden. Dabei lässt sich hier der abgewählten Regierung noch weniger ein Vorwurf machen. »Früher hat die wirtschaftliche Lage einen entscheidenden Einfluss darauf gehabt, ob der Präsident wiedergewählt wird«, sagt die in Berkeley lehrende Ökonomin Ulrike Malmendier. »Das gilt jetzt überhaupt nicht mehr.« Die US-Wirtschaft ist unter Joe Biden um 14 Prozent gewachsen, doppelt so stark wie in Trumps erster Amtszeit bis zum Corona-Ausbruch. Das ist wirtschaftlicher Erfolg.
Politischen Erfolg haben andere. Donald Trump mit seinem faktenfreien Mantra, Biden habe die Wirtschaft ruiniert. Und Alice Weidel mit ihrer Behauptung, die Ampel ziehe »eine Schneise der Verwüstung durch dieses Land«. Für das Schrumpfen der Wirtschaft sei nicht Kriegsherr Putin verantwortlich, sondern allein »diese unfähige Regierung«.
Die Kampagnen der Rechten verfangen auch deshalb, weil in der Ausnahmesituation aus Pandemie und Ukraine-Krieg die Preise raketenhaft stiegen. In Deutschland etwa stiegen sie um 20 Prozent, Energie und Lebensmittel verteuerten sich doppelt so stark. Die Menschen im Westen konnten sich auf einmal von ihrem Geld viel weniger leisten. Jeder Deutsche hat seit 2020 im Schnitt 5.000 Euro weniger ausgegeben. Forscher haben für die Wahlen in 18 Ländern über einen langen Zeitraum untersucht, wozu eine Hochinflation führt: Der Preisschock bewirkt, dass sich Wähler extremen Parteien zuwenden. Aktuell hat jede Regierungspartei in westlichen Ländern Stimmen verloren, was seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr vorgekommen ist. Von der Ampel bis zu den US-Demokraten flogen viele aus der Regierung.
Doch wer hat diesen Inflationsschock verursacht, der ein derartiges politisches Erdbeben auslöst? AfD-Politiker haben schon vor Jahren behauptet, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank löse eine gigantische Inflationswelle aus. Doch das war Fake News. Die Preise stiegen erst, als in den Corona-Lockdowns weltweit Fabriken dicht waren und Lieferketten rissen. Und richtig hoch schossen die Preise erst, nachdem Wladimir Putin die Ukraine überfallen hatte. Nachdem ihn der Westen mit Sanktionen belegt hatte, stoppte er die Lieferung von Öl und Gas. Die Energiepreise vervielfachten sich. Auch Lebensmittel wurden viel teurer, etwa weil die Ukraine als einer der weltgrößten Weizenproduzenten weniger liefern konnte.
Schuld war also Putin, nicht die Ampel. Trotzdem war es die häufig russlandfreundliche AfD, die mit der Putin-Inflation zu ihrem Höhenflug in der Wählergunst ansetzte. Trotz der umfangreichen Hilfen wie der Gaspreisbremse, die einen Großteil der Belastungen abfingen – ebenso wie steigende Löhne. Doch bei den Menschen in Deutschland wie den USA bleibt vor allem hängen, dass sie jetzt mehr für den Einkauf zahlen. Das hat Trump erfolgreich genutzt, obwohl er selbst die Inflation angeheizt hat, als er zu Beginn der Corona-Pandemie Schecks an die Amerikaner verteilte. Trump hat die Inflation erfolgreich auf Joe Biden und Kamala Harris geschoben, sagt die Ökonomin Malmendier. Anders als europäische Regierungen trifft Biden eine Mitschuld an der Teuerungswelle: Seine Ausgabenpakete für die kaputte Infrastruktur, Klimaschutz und Industriejobs trieben die Preise mit hoch. Allerdings wird Amerika dauerhaft von diesen Investitionen profitieren.
Eines haben die Regierungen von Biden über Emmanuel Macron bis zur Ampel verpasst: Sie haben die Menschen zu wenig in ihrem Alltag der Inflationssorgen abgeholt. Ihnen zu wenig klargemacht, wie sie ihnen helfen. Und dass vor allem Kriegsaggressor Putin die Inflation verschuldet. Dabei haben sie übersehen, wie sehr sich Menschen heute über Social Media (des-)informieren. Dort fallen sie schnell auf die Rechten herein, die unablässig behaupten, die Mitte-Regierungen und der Klimaschutz verursachten die Inflation – und alles gehe den Bach herunter. Solche Untergangsszenarien tragen dazu bei, dass Wähler die Teuerung überschätzen. AfD-Anhänger taxierten die Inflationsrate 2024 auf 19 Prozent, zeigt eine Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft. In Wahrheit stiegen die Preise nur noch um 2 Prozent. Die Rechtswähler schätzten die Inflation also zehnmal so schlimm ein, wie sie wirklich war.
Ökonomische Motive für den Rechtsruck lassen sich nicht nur in der unmittelbaren Gegenwart finden. Sie sind auch zu erkennen, wenn man tiefer gräbt – und auf den Siegeszug des Neoliberalismus seit den 1980er-Jahren stößt. Damals riefen Politiker wie US-Präsident Ronald Reagan, die britische Premierministerin Margaret Thatcher und Bundeskanzler Helmut Kohl eine politische Wende aus: weniger Staat, weniger Grenzen für Firmen, weniger Sozialausgaben, weniger Einfluss der Gewerkschaften, weniger Steuern für Reiche und Topverdiener. In den Jahrzehnten zuvor hatten Europa und Nordamerika den Wirtschaftsboom nach dem Zweiten Weltkrieg genutzt, um ihre Gesellschaften umzugestalten: mehr soziale Leistungen, mehr Bildung und eine Verteilung des Wohlstands, etwa durch gewerkschaftliche Tarifverträge und hohe Steuern für Topverdiener. Die Gesellschaften wurden gleicher. Als der Boom stockte, kamen die Neoliberalen an die Macht. Das war auch eine Antwort auf Fehlentwicklungen: Viele Regierungen hatten in den 1970er-Jahren die Wirtschaft vernachlässigt und zu hohe Schulden angehäuft. Doch mit der neoliberalen Wende schlug das Pendel zu weit in die andere Richtung aus. Der Neoliberalismus verteilt den Wohlstand, den der marktwirtschaftliche Kapitalismus zuverlässig produziert, unfair auf die Menschen.
Ein Beispiel ist die Theorie, wonach die ganze Gesellschaft profitiere, wenn Topverdiener und Reiche immer weniger Steuern zahlen. Die Vorteile »oben« fließen angeblich nach »unten« – trickle down. US-Präsident Ronald Reagan halbierte den Spitzensteuersatz. Das Ergebnis: Menschen mit Geld wurden immer reicher. Nach »unten« floss wenig. Im Gegenteil: Die Neoliberalen kürzten staatliche Leistungen zusammen, die Einkommen der Arbeitnehmer stagnierten oft, die Ungleichheit nahm zu. »Lieblose Gier und erstaunliche Dummheit begannen, alles zu zersetzen, was wir nach 1945 zur Verteidigung unserer Demokratien aufgebaut hatten«, schreibt die schottische Autorin A. L. Kennedy.
Nachdem Reagan & Co. den Neoliberalismus etabliert hatten, verfolgten konservative und liberale Politiker von George W. Bush über David Cameron und Angela Merkel bis Emmanuel Macron diese Agenda in unterschiedlicher Stärke weiter. Auch sozialdemokratische Regierungschefs von Gerhard Schröder, Tony Blair und Bill Clinton über Barack Obama bis Olaf Scholz übernahmen Teile der neoliberalen Agenda und enttäuschten so Stammwähler unter den Arbeitnehmern, die sich von ihnen oft nicht mehr vertreten fühlen. Ein rechtspopulistischer Präsident wie Donald Trump ist die Konsequenz von 50 Jahren Vernachlässigung, sagt Robert Reich, Arbeitsminister unter Bill Clinton. »Und ich sage dies sehr persönlich, denn ich war Teil dieses Versagens.« Die Reichen seien viel reicher geworden und die Armen ärmer. »Und während die Ungleichheit immer schlimmer wurde, schrumpfte die Mittelschicht«, analysiert Reich. Viele Menschen seien wütend geworden und überzeugt, dass das System manipuliert sei – zu ihrem Nachteil. »Wenn Du heute ein durchschnittlicher Arbeitnehmer bist, bist Du außerordentlich verwundbar. Niemand schützt Dich.«
Die Politik der westlichen Regierungen war seit den 1980er-Jahren natürlich nicht immer neoliberal. Es gab eine Bewegung dahin und wieder davon weg, und teils wieder dahin – je nachdem, welche Parteien in einem Land gerade regierten und was ihre Überzeugungen waren. Feststellen lässt sich, dass die vergangenen Jahrzehnte viele Menschen enttäuscht haben. »Das westliche Modell der liberalen Demokratie sollte für Arbeitsplätze, Stabilität und hochwertige staatliche Leistungen sorgen. Während es nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils erfolgreich war, ist es seit etwa 1980 in fast allen Bereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben«, bilanziert der Nobelpreisökonom Daron Acemoğlu.
Sein hässlichstes Gesicht zeigte der Neoliberalismus in der Weltfinanzkrise. Reagan und Nachfolger hatten die Kontrollgesetze für Banker und Investoren gekappt, die daraufhin über Jahrzehnte Billionen anhäuften. Dann stürzten ihre irrwitzigen Spekulationen den Erdball 2008 in den schlimmsten Wirtschaftscrash seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Rechnung für die Weltfinanzkrise zahlten aber nicht die Profiteure des neoliberalen Marktradikalismus, sondern die Mehrheit der Menschen: mit Arbeitslosigkeit, neuen Sparprogrammen, Schulden. »Die Sparzwänge nahmen zu«, schreibt Kennedy, »die Schmerzen wurden schlimmer, die Demokratie zersetzte sich«.
Tatsächlich begann der aktuelle Aufstieg der Rechten mit der Weltfinanzkrise, diagnostizierte zehn Jahre danach Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft: »Es ist nicht trivial, die Kosten der Bankenrettungen, des verlorenen Jahrzehnts mit geringem Wirtschaftswachstum, der höheren Staatsverschuldung und der wachsenden Ungleichheit zusammenzurechnen. Aus heutiger Sicht könnte sich als folgenreichstes Erbe der Weltfinanzkrise jedoch das Erstarken des Populismus erweisen.«
Der Zusammenbruch hat die Menschen erschüttert. »Finanzkrisen sind die Systemfehler des Kapitalismus, sie stellen seine Eliten bloß, Banker, Manager und Politiker«, sagte mir Schularick. Es war etwas ganz Anderes geschehen, als Neoliberale suggeriert hatten. Die von Gesetzen befreite Minderheit hatte zugegriffen, die Mehrheit zahlte. Trickle down? Von wegen. Des Kaisers neue Kleider sind gar keine; er ist nackt, und jeder sieht es. Die Welt ist auf den Kopf gestellt. »Die meisten Wählerinnen und Wähler kamen zu dem Schluss, dass sich die Politiker mehr um Banker als um Arbeitnehmer kümmern«, urteilt Daron Acemoğlu, der am Massachusetts Institute of Technology lehrt.
Für mein Buch »Das gespaltene Land« traf ich am Starnberger See ein Bankerpaar, das sich zur Ruhe gesetzt hatte, mit Mitte 40. Die Millionenboni ermöglichten es. Nach der Weltfinanzkrise mussten sie davon keinen Cent zurückerstatten. Als ich das ansprach, wurde die Stimmung eisig. »Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig«, sagte die Bankerin.
Die Weltfinanzkrise ließ die neoliberalen Zumutungen, die den Menschen als notwendig verkauft worden waren, in neuem Licht erscheinen: den Sozialabbau, die staatlichen Sparrunden, die stagnierenden Einkommen. Davon profitierten aber nicht linke Parteien, die wie die natürliche Gegenthese zu entfesselten Bankern wirken. Moritz Schularick hat untersucht, dass es seit 1870 in 20 Ländern rechte Politiker waren, die von Finanzkrisen profitierten – und ihre Stimmen meist verdoppelten. Viele Menschen suchen in einer existenziellen Krise nach einer rechten Führerfigur. In den krisengeprägten 1920er-Jahren liefen sie Nationalisten wie den Nationalsozialisten hinterher. Nach der Weltfinanzkrise wurden Figuren wie Donald Trump und der Franzose Jean-Marie Le Pen populär, die breitbeinig über den Boden trumpeln. »Rechtspopulisten sind sehr geschickt darin, andere verantwortlich zu machen«, erklärte Schularick. »Und das passt: Nach der Krise wollen Menschen einen Schuldigen.«
Als Schuldigen präsentieren die Rechten »das System«: Nur sie allein verträten die wahren Interessen des Volkes. Und sie präsentieren noch einen Schuldigen: Migranten. Die eignen sich für Rechte als Sündenbock, weil sie anders als Banker keine kleine Gruppe sind. Und weil sie anders als Banker durch ihre Hautfarbe, Kleidung oder Sprache im Alltag oft erkennbar sind. Jean-Marie Le Pen, der Gründer des rechtsextremen Front National, erklärte 2013 bei einem Auftritt in Nizza, er könne die Anwesenheit von Roma-Flüchtlingen in der Stadt riechen: »Sie verursachen Hautausschlag.« Die Rechten dehnten ihre Agitation auf anderes Fremde, auf Internationales aus. Auf die EU. Und auf Importe, so wie Trumps Handelsberater Peter Navarro 2011 im Buch »Death by China«. Dabei spielen Rechte ihre Vorteile gegenüber anderen Parteien aus, sagte Moritz Schularick: »Rechte sind besser darin, mit dem Finger zu deuten, etwa auf Fremde, das Ausland.«
Seit der Weltfinanzkrise sammeln die Rechten Stimmen jener, die wirtschaftlich unzufrieden sind. Die Krise bescherte der Welt ein Jahrzehnt niedrigeren Wachstums, in Europa wütete sie als Euro-Krise weiter. Viele Regierungen betrieben wegen der Kosten der Weltfinanzkrise eine harte Sparpolitik. Dazu spürten die Menschen weiter den neoliberalen Sozialabbau, die Kürzungen bei Wohnungen, Bus und Bahn. Und den Verlust von Millionen Industriejobs, ohne dass Arbeitnehmer neue Perspektiven erhielten, weil sich der Staat ja raushalten soll. Seit den 1980er-Jahren wurden ganze Regionen deindustrialisiert: in Nordfrankreich, in Ostdeutschland, im Fabrikgürtel der USA, der durch viele wahlentscheidende Swing States verläuft, die für Donald Trump votierten. Mehr dazu in Kapitel 11Mehr für Arbeitnehmer und abgehängte Regionen.
Auch stagnierende Löhne machen Menschen unzufrieden. Die Globalisierung erzeugt einen wirtschaftlichen Dauerboom, doch die Früchte sind oft ungleich verteilt – sie fließen besonders den Eigentümern der Firmen zu. Neoliberale Politiker drängen Gewerkschaften zurück, die deshalb seltener faire Löhne durchsetzen können. In den USA organisieren sie heute nur noch 6 Prozent der Beschäftigten in privaten Firmen. Stimmten in den 1960er-Jahren zwei Drittel der Arbeiter und Angestellten für die demokratische Partei, sammelt heute Trump bei den Arbeitern die größten Stimmengewinne. Die AfD holte bei der Bundestagswahl 38 Prozent der Arbeiterstimmen. »Die Menschen fühlen sich politisch nicht vertreten und werden empfänglich für Demagogen, die behaupten, die Deportation von Millionen Migranten verbessere ihre Situation – irgendwie«, so der US-Kommentator Harold Meyerson.
Die Rechten sammeln neben wirtschaftlich Unzufriedenen auch die Wähler einer zweiten Gruppe ein, mit der sich viel überschneidet: jene, die den Druck des Wandels spüren. Die die Komplexität der Veränderungen scheuen, wirtschaftliche Konkurrenz, Klimaschutz, Gleichberechtigung, multinationale Gesellschaften, globale Corona-Viren, russische Kriegsgefahr – und sich lieber an einfachen Parolen wärmen, und einfachen Scheinlösungen.
Die reale Welt ist eine mit furchtbar vielen Fragezeichen. Das günstige Dieselauto und die günstige Ölheizung? Weicht klimafreundlichen, womöglich zunächst teureren Alternativen. Die Vorrangstellung als westliche Industrienation? Weicht der Konkurrenz mit Staaten wie China oder Indien. Der lebenslange Arbeitsplatz in einer Firma? Weicht häufigeren Jobwechseln, bei denen man sich häufig neu qualifizieren muss. Die Alleinverdienerfamilie? Reicht nicht mehr zum Leben. Traditionell eingestellte Männer empfinden es als Zumutung, sich auch um Haushalt und Kinder zu kümmern. Und dann ist vielleicht ihre Partnerin auch noch beruflich erfolgreicher. Oder es ist der mexikanische oder syrische Vorarbeiter in der Firma, der mehr Erfolg hat.
Donald Trump gewann bei den beiden bisher einzigen Präsidentschaftswahlen, bei denen die US-Demokraten eine Frau nominierten, im zweiten Fall eine mit indischen und jamaikanischen Wurzeln. Männer, von denen einige tatsächlicher oder gefühlter Statusverlust umtreibt, wählen häufiger Trump und AfD als es Frauen tun.
Eine andere Gruppe, die der Wandel irritiert, sind Menschen, an denen die große Akademisierungswelle der vergangenen Jahrzehnte vorbeigegangen ist. Sie erleben, dass höher Qualifizierte immer besser verdienen als sie. Wer in Deutschland eine Berufsausbildung abgeschlossen hat, verdient im Schnitt etwa halb so viel wie Akademiker mit Diplom oder Doktor. Der Uniabschluss ist auch eine Statusangelegenheit. Nichtakademiker sahen in einer Studie in vielen Ländern für sich selbst über die Jahre einen immer niedrigeren sozialen Status. Der Ökonom Thomas Piketty hat für die Wahlen in 21 Ländern untersucht, dass viele Nichtakademiker seit den 1980er-Jahren mehr und mehr nach rechts rückten. 62 Prozent der Amerikaner mit niedrigen Bildungsabschlüssen wählten Trump.
Eine andere Gruppe sind Menschen auf dem Land, die sich häufiger vom Fortschritt ausgeschlossen fühlen. Seit der Globalisierung konzentriert sich das wirtschaftliche Wachstum stärker in Städten. Landbewohner erleben auch neoliberale Ausgabenkürzungen augenfälliger, wenn die Klinik geschlossen wird und kein Bus mehr fährt. Die AfD sammelt auf dem Land überdurchschnittlich viele Stimmen, während sie in den Städten hinter Union und SPD bleibt.
Besonders oft nach rechts driften Menschen, wenn sie ihre Region als abgehängt betrachten. »Die wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen, die das Gefühl hervorgerufen haben, zurückgelassen zu werden, waren das Produkt der neoliberalen Version der Globalisierung«, sagt der amerikanische Philosoph Michael Sandel. Den US-Nobelpreisökonomen Paul Krugman erinnern die AfD-Erfolge in wirtschaftlich schwachen Gebieten an den Aufstieg Trumps ein Jahrzehnt zuvor. In Ostdeutschland sammelte Alice Weidel bei der Bundestagswahl mit 36 Prozent doppelt so viele Stimmen wie im Westen, wo sie gleichauf mit der SPD lag.
Der Osten Deutschlands ist ein Paradebeispiel dafür, wie ökonomische und andere Faktoren zusammen den Aufstieg der Rechten begünstigen. Die Ostdeutschen erlebten den Zusammenbruch eines diktatorischen, aber seit Jahrzehnten vertrauten Systems. Bei der Wiedervereinigung 1990 fühlten sich viele nicht gleichberechtigt. Auch ökonomisch wurden Fehler gemacht. Mehr als drei Jahrzehnte später sieht sich jeder fünfte Ostdeutsche in einer abgehängten Region leben. Jeder zweite AfD-Wähler sieht die Wiedervereinigung eher negativ – das sind viel mehr als bei den anderen Parteien.
Die westlichen Demokratien sind in den vergangenen Jahrzehnten ungleicher geworden. Besonders krass ist dies in den USA, wo Niedrigverdiener und Teile der Mittelschicht kaum mehr verdienen als in den 1980er-Jahren, wenn man die Inflation abzieht. »Und die gewählten Politiker haben wenig dagegen unternommen«, wie Daron Acemoğlu kritisiert. In Deutschland hat sich der Anteil, den die ärmere Hälfte der Gesellschaft am Gesamtvermögen hält, seit der Wiedervereinigung halbiert. Es leben 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger mehr in Armut als vor 15 Jahren. Staatliche Leistungen wurden häufig gekürzt.
Das Versprechen der Wirtschaftswunderjahre, dass sich harte Arbeit auszahlt und sozialen Aufstieg ermöglicht, ist brüchig geworden. Während die Mehrheit für ein überschaubares Gehalt schuftet und viel ans Finanzamt abgibt, jettet eine globale Reichenschicht zu Luxusevents und zahlt auf Phantastillioneneinkommen wenig Steuern. Milliardäre in Frankreich, den Niederlanden oder den USA zahlen auf ihr Einkommen 2 bis 8 Prozent Steuern.
Die Zustimmung zum bisherigen System bröckelt. Laut Leipziger Autoritarismusstudie sind inzwischen die Hälfte der Deutschen unzufrieden damit, wie die Demokratie funktioniert. Das Vertrauen ist vor allem bei Menschen mit geringen Einkommen sehr niedrig, so das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI). Gefühle des Abgehängtseins und fehlender Anerkennung förderten rechtsextreme Einstellungen. Aber auch Abstiegsängste sind ein Motiv, rechts zu wählen, so Moritz Schularick in seiner Analyse des rechten Aufstiegs: »Man muss etwas haben, um etwas zu verlieren.« Adolf Hitler hätten in erster Linie Kleinbürger, Handwerker und Beamte an die Macht verholfen: »Die hatten Angst, etwas zu verlieren. Die wählten rechts. So auch heute.«
So mischen sich Abstiegsängste mit neoliberal verstärkter Ungleichheit, Frust über das Einkommen, dem Unbehagen am Wandel und den aktuellen Sorgen, etwa über die Teuerungswelle. Manche Motive sind berechtigt, andere weniger. Die Parteien der demokratischen Mitte trifft eine Mitschuld, weil sie Fehlentwicklungen mitgetragen haben. Essenziell aber ist die Erkenntnis, dass es nicht nur an objektiven Gründen liegt, dass Hunderte Millionen Menschen rechts wählen. Rechte verdanken ihre Wahlerfolge nicht nur der Tatsache, dass sie manche Probleme prägnant ansprechen – sondern auch der Desinformation und Manipulation. Wir reden hier nicht davon, dass Politiker aller Lager mal Fakten weglassen, zuspitzen oder verdrehen. Die Betonung liegt auf mal. Bei Rechten geht es häufig um andere Dimensionen. Während Donald Trumps erster Amtszeit zählten die Faktenchecker der Washington Post 30.000 öffentliche Falschaussagen oder Lügen. Das sind pro Tag zwanzig Unwahrheiten, die der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet hat.
Wen die komplexen Fragen der modernen Welt überfordern, der wärmt sich an Schuldzuweisungen und angeblich simplen Lösungen. Dadurch geraten Politiker der demokratischen Mitte, die die komplexen Fragen seriös angehen wollen, schnell in die Defensive. Am schnellsten tun sie das, wenn es um Migration geht, die oft als zentraler Grund genannt wird, warum Menschen rechts wählen. Migration steht typisch für die komplexen Fragen, die moderne Gesellschaften aushandeln müssen. Da stehen auf der einen Seite humanitäre Aspekte wie ein Asylrecht für verfolgte Menschen. Und die unabweisbare Tatsache, dass alternde und schrumpfende Bevölkerungen nur durch Zuwanderer wirtschaftlich erfolgreich und funktionsfähig bleiben. Auf der anderen Seite stehen Sorgen und Vorurteile jener Wählerinnen und Wähler, die Migration ablehnen oder begrenzen wollen.
Die demokratischen Parteien müssen diese beiden Seiten ausbalancieren und dabei Fehler korrigieren, die sie jahrzehntelang gemacht haben: Sie sollten Zuwanderer besser integrieren, mit abgelehnten Asylbewerbern und Straftätern konsequenter umgehen und ausreichend Wohnraum und andere Infrastruktur für die Zuwanderer schaffen. Im Kapitel Ein Gesellschaftsvertrag für Migration mache ich Vorschläge für eine solche Balance. Eine differenzierte Politik hat aber wenig mit dem zu tun, was die Rechten bei der Migration veranstalten.
Donald Trump bezeichnete illegale Migranten als Tiere, Ungeziefer oder Vergewaltiger, die amerikanisches Blut vergifteten. Alice Weidel behauptet, rotgrüne Ideologen »fluten das Land« mit illegalen Migranten, als würden SPD und Grüne diese Menschen herbeitransportieren. Die Partei hat die Rede von »alimentierten Messermännern« und massenhafter »Remigration« als Positionen verankert, die für viele diskutierbar, akzeptabel oder gar notwendig sind. Dabei hilft ihr, dass Union und FDP die Verengung der Migration auf ihre Probleme oft mitmachen. Und Friedrich Merz vor der Wahl sogar zweimal Stimmen der AfD in Kauf nahm, um migrationskritische Vorhaben durch den Bundestag zu bringen. Das verschiebt den Diskurs nach rechts und nutzt vor allem den Rechten, weil die Menschen in der Antimigrationspolitik meist das Original wählen.
Was Trump, Weidel & Co. verbreiten, multiplizieren sie in den Sozialen Medien. In manchen Kanälen haben die Rechten die Hegemonie erobert wie einst Adolf Hitler im damaligen Trendmedium Radio. Die Menschen informieren sich weniger aus seriösen Medien und mehr aus Social-Media-Kanälen, die häufig wahre Fake-News-Schleudern sind. Studien zeigen: Sobald in einer Region schnelle Internetverbindungen soziale Medien auf jedes Handy beamen, sammeln die Rechten mehr Stimmen. Die Algorithmen von TikTok oder Elon Musks X präferieren die agitatorischen Inhalte der Rechten.
Nationen wie die Deutschen sind ausländerfeindlicher geworden. Immer mehr sehen sich offenbar eher durch eine Brachialpolitik gegen Migranten vertreten als durch die komplizierte Art, wie Regierungskoalitionen Kompromisse für ein besseres Leben suchen. Wobei diese unattraktive Komplexität durch die Erfolge der Rechten verstärkt wird, die Stimmanteile der Mitte-Parteien schrumpfen lassen und so immer mehr Koalitionspartner erfordern. Dass die Ampel an der in Deutschland erstmaligen Drei-Parteien-Konstellation scheiterte, ist ein Problem, das die politische Stagnation der italienischen Multi-Parteien-Regierungen seit Dekaden vorführt.
Die Suggestionen der Rechten funktionieren auch bei anderen Fragen. Parteien wie FPÖ und AfD zweifeln den menschengemachten Klimawandel an. Dieser Trick erlaubt ihnen, den Klimaschutz der demokratischen Mitte-Parteien als ungeheuerlichen Plan hinzustellen, der den Menschen die Taschen leer macht. »Für den angeblichen Klimaschutz zerstören Sie die deutsche Wirtschaft«, warf Alice Weidel SPD und Grünen vor. Die FPÖ nennt CO2-Preise auf Benzin und Gas, die schädliche Emissionen verteuern, eine Umerziehungssteuer. Die FPÖ wurde bei der Wahl in Österreich stärkste Partei, obwohl Sintfluten wenige Tage zuvor mehrere Bundesländer unter Wasser setzten. »Österreicher wählen Klimaleugner, auch wenn sie dabei untergehen«, titelte die Zeitung Der Standard.
Die Rechten erzeugen eine alles grundierende Stimmung, wonach es die demokratische Mitte ist, die die Gesellschaft untergehen lässt, nicht der Klimawandel. Das erinnert an die Stimmung der 1920er-Jahre vor dem Aufstieg des Nationalismus, als Oswald Spenglers Buch »Der Untergang des Abendlandes« zum Bestseller wurde. Es ist eine Abstiegsstimmung, das Gefühl, um sein Stück vom wirtschaftlich schrumpfenden Kuchen kämpfen zu müssen – zum Beispiel gegen Migranten. Mit den ökonomischen Grunddaten hat das oft wenig zu tun. Zwar gab es zuletzt wirtschaftlich schlechte Jahre, doch die Mitte-Regierungen haben die Inflation abgefedert und in der Corona-Pandemie Massenarbeitslosigkeit verhindert. Vor der Bundestagswahl stuften nur 10 Prozent der Menschen die eigene Wirtschaftslage als schlecht ein. Doch die Rechten machen mit ihren Untergangsszenarien Eindruck. AfD-Wähler halten nicht nur die Inflation für weitaus höher als sie in Wahrheit ist, sondern auch die Arbeitslosigkeit und die Altersarmut.
Meister der Manipulation ist Donald Trump. Joe Bidens Amerika »ein Desaster aus Kriminalität, Chaos und Konjunkturcrash«? Am Ende seiner Amtszeit gab es jährlich 3.000 Morde weniger als am Ende von Trumps erster Amtszeit. Die Arbeitslosigkeit lag im Wahljahr so niedrig wie zuletzt vor einem Vierteljahrhundert. Zum Abschluss seines Wahlkampfs rief Trump im Madison Square Garden, 300.000 Kinder seien wegen Kamala Harris verschwunden, sie seien entweder »tot, Sexsklaven oder Sklaven«. Joe Biden habe alles Geld ausgegeben, um illegale Migranten ins Land zu bringen und deshalb nichts mehr für die Opfer des Hurrikans übrig. Trump schafft es, dass die Hälfte der Amerikaner keinen offiziellen Daten glauben – sondern seinen Gespinsten.
In George Orwells Diktatur-Roman 1984 lehrt die alles kontrollierende Partei, die Menschen sollen nicht dem trauen, was sie in der Realität sehen – sondern nur ihren Behauptungen. Trumps erste bekannte Lüge datiert aus dem Jahr 1984. Er rief unter falschem Namen beim Magazin Forbes an und überzeugte den Redakteur, Donald Trump auf die Reichenliste zu setzen – mit einem Vermögen, das er nicht besaß. Durch den erschwindelten Platz auf der Liste kam er an die Kredite für seine Geschäfte.
Sein erneuter Wahlsieg per Lügen dürfte in den nächsten Jahren Nachahmungseffekte auslösen – und Wahlen auf dem ganzen Erdball beeinflussen. Warum bei der Wahrheit bleiben, wenn es auch anders geht? Und wohin steuert die ökonomische, politische und militärische Weltmacht Nummer eins unter so einem Präsidenten?
Wenn Menschen rechts wählen, tun sie das oft aus ökonomischen Motiven, auch wenn ihre Wahrnehmung durch Desinformation verzerrt wird. Was in der öffentlichen Debatte bisher wenig beleuchtet wird: Was geschieht eigentlich ökonomisch, wenn die Rechten ihre Vorstellungen durchsetzen? Sinkt die Arbeitslosigkeit, sinkt die Inflationsrate, steigen die Einkommen? Rechtspopulisten versprechen den Menschen ja ein besseres Leben. Was Rechte an der Regierung bewirken, betrifft nicht nur die Bürger ihres Landes, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Vernetzung alle Menschen in Europa und Nordamerika – und dazu viele in der übrigen Welt. Ökonomische Folgen und die Konsequenzen für Frieden, Freiheit und Demokratie verstärken sich dabei gegenseitig. Der Aufstieg der Rechten beeinflusst unser ganzes Leben. In den nächsten Kapiteln möchte ich untersuchen, wie.
Analysiert man die Agenden der Rechten, lässt sich ein gemeinsamer Nenner finden. Den ökonomischen und politischen Vorstellungen der Rechten ist oft gemeinsam, dass sie sich gegen etwas richten. Sie strotzen vor Antipolitik: gegen Minderheiten wie Ausländer, Migranten, Homosexuelle oder Arbeitslose. Gegen die Importe ausländischer Firmen und ihre Beschäftigten. Gegen Steuern für Reiche. Gegen Institutionen demokratischer Gewaltenteilung wie Parlamente, politische Wettbewerber und eine unabhängige Justiz. Gegen scharfe Kontrollgesetze für Unternehmen und Banken. Gegen unabhängige Zentralbanken und Medien mit ihrer Kontrollfunktion. Gegen internationale Zusammenarbeit in der Europäischen Union, der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Welthandelsorganisation WTO oder der Nato. Gegen Klimaschutz. Gegen den Sozialstaat und gegen Gewerkschaften.
Aus den vielen Nein! schöpfen die Rechten ihre Agenda: Es ist eine Politik und Ökonomie des Hasses.
Bei den aufgezählten Positionen unterscheiden sich die Rechten in verschiedenen Ländern zum Teil deutlich. Doch das Nein ist auffallend oft zu beobachten. Donald Trump würde es in seinem Kanal Truth Social groß schreiben: NEIN! Was das NEIN zu Minderheiten wie Migranten und Arbeitslosen, Importen und internationalen Organisationen wie der EU angeht, speist es sich aus der Suche nach plakativ verwendbaren Sündenböcken. Was das NEIN zu demokratischen Institutionen angeht, speist es sich aus dem Anspruch, allein die Rechten verkörperten den Willen des Volkes: unabhängige Richter, Journalisten, Gewerkschafter und konkurrierende Politiker verwässern diesen angeblichen Willen nur. Was das NEIN zu Importen, Migranten, Klimaschutz, Gleichberechtigung und internationale Organisationen wie der EU betrifft, speist es sich aus dem nostalgischen Trip, den die Rechten versprechen – zurück in national geprägte Staaten, die vermeintlich ohne ausländische Konkurrenz, Zuwanderer und Umweltschutz auskamen und auf wirtschaftlichem Gebiet vermeintlich besser funktionierten.
Das Nein ist so dominant, dass es in den Schatten stellt, für was die Rechten eigentlich sind. Sie verfolgen eine Ökonomie des Hasses, keine Ökonomie der Verbesserung.
Ihr multiples Nein rührt an die Fundamente der modernen Welt. Das Nein zu demokratischen Institutionen könnte den Rückfall in Diktatur und Unterdrückung bedeuten. Das Nein zu Importen, internationalen Organisationen und demokratischen Institutionen stellt Pfeiler des Wohlstands infrage. Das Nein zu Gewerkschaften, Umverteilung und Sozialstaat könnte die Ungleichheit erhöhen. Das Nein zum Klimaschutz könnte eine stärkere Verheerung des Planeten mit Überflutungen, Dürren und Hitzewellen bedeuten. Das Nein zu Migranten könnte die alternden Gesellschaften ohne ausreichend Arbeitskräfte für ihre Firmen und Pflegekräfte für ihre Kranken und Alten hinterlassen.
Die Rechtspopulisten werfen ihr Dagegensein oft nicht als Argument in die Debatte, sondern als Knüppel. Die Philosophin Judith Butler sagt, ein zentrales Element von Donald Trumps Anziehungskraft bestehe darin, seinen Anhängern zu versprechen, »dass sie irrational sein dürfen – dass sie hassen dürfen«. So schüren Rechte Hass auf ausländische Firmen, unabhängige Richter, konkurrierende Politiker und Migranten. Zuwanderer »Tiere«, »Ungeziefer«, »Vergewaltiger«? Für die Autorin Kennedy stammt die rechte Agenda von Akteuren, bei denen Hass den Platz einnimmt, den bei anderen Menschen Empathie besetzt: »In den USA und in Europa haben einige der verhätscheltsten Monster der Welt beschlossen, dass wir alle mehr Trauma brauchen, um uns für Eigenschaften zu bestrafen, die sie nicht haben.« Wenn jemandem bei diesen Sätzen nicht nur rechte Politiker einfallen, sondern auch mächtige Sympathisanten wie Tesla-Chef Elon Musk, ist das womöglich kein Zufall. »Eine wesentliche Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie«, hat Musk gesagt, der reichste Mensch der Welt.
Viele rechte Politiker äußern das Dagegensein nicht als Teil einer zivilen Debatte. Es verlangt sie danach einzugreifen: Richter absetzen, Staatsangestellte feuern, Importe blockieren, Migranten deportieren.
Die Ökonomie des Hasses kollidiert mit einem marktwirtschaftlichen System, das auf einem gewissen Vertrauen aufbaut, schrieb ich 2017 zu Trumps Amtsantritt: »Wer mit jemandem ein Geschäft eingeht, weiß oft monatelang nicht, ob der andere ihm einwandfreie Ware liefert. Noch mehr Vertrauen bedarf es in der Globalisierung, in der Geschäfte in ferne Kulturen reichen. Wenn dauernd Misstrauen gegen Migranten oder ausländische Firmen angefacht wird, prägt das eine Gesellschaft. Es verfinstert das Denken.« Von Donald Trump zum Beauftragten für Staatsabbau ernannt, legte Tesla-Chef Elon Musk los und beschimpfte renommierte Institutionen auf das Wüsteste.
Die Ökonomie des Hasses transformiert Nationen, wie es der EU-Austritt in Großbritannien tat. Einst waren die Briten besonders weltoffen, für Freihandel, Globalisierung und Migration. Was außen liegt, galt erst mal als willkommen. Die Ökonomie des Hasses dreht das um: Was außen liegt oder anders aussieht, gilt erst mal als bedrohlich.
Der Ökonom Christoph Trebesch hat mit Kollegen die ökonomischen Auswirkungen populistischer Regierungschefs in 60 Ländern untersucht, vom Jahr 1900 bis 2020. Dazu zählen Linkspopulisten etwa aus Lateinamerika ebenso wie eine Vielzahl von Rechtspopulisten – von Adolf Hitler und Benito Mussolini über Silvio Berlusconi und Viktor Orbán bis zu Jair Bolsonaro. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Populisten haben die Wirtschaftsleistung ihres Landes im Schnitt um 10 Prozent reduziert, also das Einkommen der Menschen stark dezimiert. Sie haben außerdem die Schulden anschwellen lassen und die Inflation hochgetrieben. Oft zeigen sich diese Wirkungen nicht sofort, sondern erst nach einigen Jahren.
Was bedeuten diese Befunde für die Vorschläge der aktuellen Rechtspopulisten? Das will ich in den nächsten Kapiteln untersuchen: Wie wirkt sich das Nein zu Migranten aus, zu demokratischen Institutionen, freiem Handel, EU, Klimaschutz und so fort. Und dabei will ich mitanalysieren, wie sich das auswirkt, für das sich rechte Politiker einsetzen: Zum Beispiel für Steuersenkungen für Reiche, die deutsche Schuldenbremse und den Einfluss von superreichen Unternehmern wie Elon Musk auf die Politik.
Der Aufstieg der Rechten seit der Weltfinanzkrise verändert die Gesellschaften in Europa und Nordamerika. Im dritten Teil des Buchs, den Kapiteln 8 bis 12, versuche ich Vorschläge zu entwickeln, wie womöglich manche ihrer Wähler zurückzuholen sind. Dazu gehört der Blick auf die demokratischen Parteien der Mitte, wozu etwa in Deutschland das Spektrum von links wie die Linke über SPD und Grüne bis konservativ wie die Union und liberal wie die FDP zählen würde. Diese Parteien haben Fehler gemacht, die den Rechtsruck begünstigen. Etwa im Umgang mit der Migration. Oder durch die Übernahme neoliberaler Politik.
Es ist eine andere Politik möglich, die die Effizienzvorteile der Marktwirtschaft mit Empathie für die Menschen vereint. Dazu sollten Regierungen staatliche Leistungen mit Angeboten für die Verlierer des Wandels verbinden und einem genauso kümmernden wie zur Arbeit aktivierenden Sozialstaat. Mit Industriepolitik für Arbeitsplätze und Investitionen in die Infrastruktur, Wohnraum und die Verteidigung gegen Kriegsaggressoren wie Putin. Mit einer Stärkung niedriger und mittlerer Einkommen und Anreizen, Vermögen zu bilden.
Manche dieser Ansätze werden von Regierungen rund um den Globus zumindest teilweise verfolgt. Diese Ansätze gilt es nun überall konsequent aufzunehmen. Denn es ist klar, dass es entscheidende Jahre für die Menschen werden, für Frieden, Freiheit, Wohlstand – und Demokratie. Das Leben kann schneller zum autoritären Alptraum werden, als viele Menschen in der relativ gesicherten Existenz der Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg geglaubt haben.
TEIL II: WAS RECHTE ANRICHTEN
KAPITEL 2
WIE TRUMPS ZOLLINFERNO DER WELTWIRTSCHAFT SCHADET
Die indianischen Ureinwohner nannten den Berg »Denali«, das bedeutet in der athapaskischen Sprache »der Große«. Ein passender Name für den höchsten Berg der USA. Es passt zum Umgang der weißen Siedler mit der indigenen Bevölkerung, dass sie ihnen neben ihrem Land und oft ihrem Leben auch diesen Namen wegnahmen. 1897 fand ein Goldgräber, das 6.200 Meter aufragende Gebirgsmassiv in Alaska müsse McKinley heißen. Zu Ehren des damaligen Präsidenten, bekannt als Imperialist, der den USA die Philippinen, Guam und Puerto Rico einverleibte.
In den 1970er-Jahren begannen Versuche, dem Berg wieder den Namen Denali zu geben, aus Respekt vor den indianischen Traditionen. Es brauchte ein halbes Jahrhundert, bis dies auch wirklich geschah, unter dem ersten afroamerikanischen Präsidenten Barack Obama. Donald Trump brauchte nach seinem Amtsantritt 2025 wenige Stunden, um den höchsten Berg der USA per Dekret in Mount McKinley zurückzutaufen.
Donald Trump bewundert außer sich selbst nur wenige Menschen, William McKinley gehört dazu. Weil McKinley anders als die meisten US-Präsidenten fremde Länder unterwerfen wollte, glaubt der Stanford-Historiker Richard White, der ein Buch über die Zeit geschrieben hat: »William McKinley war ein Imperialist, und Trump scheint in seiner zweiten Amtszeit imperiale Ambitionen zu hegen.« Vorbild McKinley erklärte der Kolonialmacht Spanien den Krieg, nach einer Kampagne des Zeitungsbarons William Randolph Hearst (»Zur Hölle mit Spanien!«), die an heutige Hetzkampagnen im Netz erinnert. Dabei spielten wirtschaftliche Interessen eine Rolle.
»Die Vereinigten Staaten werden sich wieder als wachsende Nation verstehen, die unseren Wohlstand vermehrt und unser Territorium ausdehnt«, erklärte Trump in seiner Antrittsrede, zugleich nationalistisch wie neoimperial. Mit McKinley als Vorbild tut er etwas, das seit dem Zweiten Weltkrieg für einen westlichen Regierungschef unerhört ist: Anspruch auf das Gebiet anderer Staaten erheben. Er will den Gaza-Streifen »in Besitz nehmen« und dabei womöglich Palästinenser der nächsten Vertreibung aussetzen, um ihr zerbombtes Land zur »Riviera des Nahen Ostens« zu machen. Trump reklamiert Grönland, »das wir für unsere nationale Sicherheit brauchen«. Ein Argument, das nicht mehr weit von den Ansprüchen Wladimir Putins an Russlands Westgrenze und Xi Jinpings im Südchinesischen Meer entfernt ist, wie der Spiegel kommentierte. Trump schloss nicht aus, Soldaten zu schicken, um seinen Anspruch durchzusetzen.
Sein Umfeld relativiert manche seine Ankündigungen. Worauf er sie manchmal wiederholt. Der langjährige Immobilienunternehmer betrachtet den Rest der Welt offenbar bevorzugt als Immobilie, auf der fünftrangigerweise souveräne Staaten existieren – und Menschen leben. In Besitz nehmen, kaufen, greifen. Ein »zu groß« kennen seine Pläne nicht: Er möchte Kanada annektieren, das zweitgrößte Land des Planeten, so riesig wie ganz Europa. Die 40 Millionen Kanadier, enger Partner der Amerikaner, sollen ihren Staat opfern und zum US-Bundesland schrumpfen. Wie ernst muss die Weltbevölkerung all diese Ankündigungen nehmen? Niemand weiß es.
Trump sieht andere Länder gern unter der nationalistisch-neoimperialen Perspektive, wie sie den USA nützen könnten, selbst wenn das ihnen selbst nicht nützt – oder gar schadet. Damit geraten ihm schnell die Werte des Westens aus dem Blick: Demokratie statt Diktatur, Freiheit statt Unterdrückung, Frieden statt Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten die USA und weite Teile Europas, auf den Trümmern von Adolf Hitlers Vernichtungskrieg mit seinen Millionen Toten eine Freiheits- und Friedensordnung aufzubauen, auch als Gegenmodell zu Stalins dunklem Terrorreich. Die Vereinigten Staaten gingen dabei als Großmacht voran, die das freie Europa im Nato-Bündnis mit Atomwaffen und Armeen gegen eine kommunistische Invasion schützten. Unter Donald Trump ist nicht mehr sicher, ob die Vereinigten Staaten Europa noch gegen die Aggression Wladimir Putins beistehen. Trump hat in einem Recht: Die Europäer haben seit dem Ende des Ostblocks zu wenig in Verteidigung investiert, weil sie sich auf die Amerikaner verließen. Doch wenn er Änderungen fordert, geraten ihm die Werte des Westens aus dem Blick: Im Wahlkampf sagte er, wenn Nato-Länder ihre Ausgaben nicht ausreichend erhöhten, könne Russland mit ihnen »machen, was immer zur Hölle es will«.
Wie er vermeintlichen Nutzen für die USA über Freiheit und Frieden stellt, demonstriert Trump am folgenreichsten bei der Ukraine.
Nach der russischen Invasion begann der Westen mit umfangreicher Waffenhilfe, um die Freiheit der Ukrainer zu verteidigen – und ein mögliches Vorrücken Russlands weiter nach Westen zu verhindern. Trump bewegen nun mehr die Kosten, weniger die Ukrainer mit ihren Hunderttausenden Kriegsopfern: »Vielleicht sind sie irgendwann russisch, vielleicht sind sie irgendwann nicht russisch, jedenfalls haben wir das ganze Geld reingesteckt und ich will es zurück«, sagte er Fox News. In einer atemberaubenden Täter-Opfer-Umkehr behauptete er, die Ukrainer »hätten den Krieg nie anfangen sollen«. Und begann, ohne die Ukraine und die EU mit Russland zu verhandeln. Er demütigte Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus vor laufenden Kameras. Er presste dem Land, das gegen Russland auf westliche Hilfe angewiesen ist, ein Abkommen ab, das den USA Rohstofferträge sichert – »vielleicht sind sie irgendwann russisch, vielleicht sind sie irgendwann nicht russisch, jedenfalls haben wir das ganze Geld reingesteckt und ich will es zurück«.
Wenn Trump wie im Sommer 2025 mal einen härteren Kurs gegen Diktator Putin fährt, muss das nicht von Dauer sein. Trump nannte Putin schon smart, genial und einen Peace Keeper, einen Friedensstifter. Der britische Ex-Premier und Trump-Fan Boris Johnson bescheinigte Trump eine »homoerotische Faszination« für Putin. Wenn Trump vermeintlichen Nutzen für die USA über die westlichen Werte stellt, gefährdet er Freiheit, Frieden, Demokratie – oder opfert sie gar. In letzter Konsequenz drohen Hunderten Millionen Menschen zunächst in Europa und dann anderswo Unterdrückung und Krieg, wenn Diktatoren wie Wladimir Putin freie Hand bekommen. Das ist die existenzielle Dimension des aggressiven Nationalismus, den die Rechtspopulisten verfolgen.