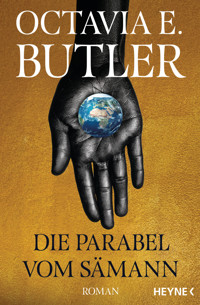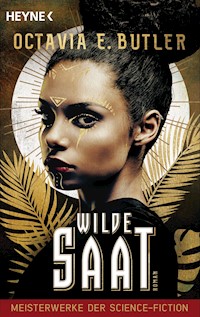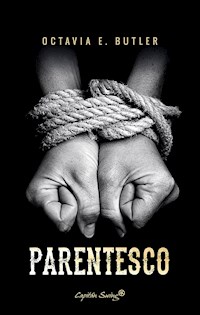13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Parabel
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der große Klassiker der amerikanischen Literatur erstmals auf Deutsch!
Wir schreiben das Jahr 2032. Lauren Olamina hat eine kleine Gemeinschaft in Nordkalifornien gegründet, in der sie nach den Regeln ihrer neuen Religion in Frieden lebt. Sie nehmen alle auf, die nach der Wahl des ultrakonservativen Präsidenten Jarret verfolgt werden. Jarret hat im Wahlkampf versprochen, Amerika wieder groß zu machen, doch in Wahrheit spaltet er mit seinen Reden und Taten das ohnehin zerrissene Land immer tiefer. Schnell wird Laurens Gemeinschaft – eine Minderheitenreligion, angeführt von einer Schwarzen Frau – zur Zielscheibe seines Hasses.
Jahre später studiert Laurens Tochter Ashs Vere die Tagebücher ihrer Mutter. Sie sucht in der Vergangenheit nach Antworten auf ihre Fragen – und will ihre Mutter verstehen lernen, die hin- und hergerissen war zwischen der Verantwortung für ihre Gemeinschaft und ihrer Bestimmung, die Menschheit als Ganzes in eine bessere Zukunft zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Amerika in nicht allzu ferner Zukunft. Lauren Olamina lebt mit der kleinen Religionsgemeinschaft, die sie gegründet hat, abgeschieden in den nordkalifornischen Bergen. Sie tun ihr Bestes, um mit den Dürren, Waldbränden und der Wasserknappheit umzugehen, die infolge des Klimawandels immer häufiger auftreten. Sie leben in Frieden nach den Regeln ihres Glaubens und nehmen jene bei sich auf, die sich nach Gemeinschaft sehnen.
Doch dann wird der ultrakonservative Andrew Steele Jarret zum Präsidenten der USA gewählt. Er verspricht, »Amerika wieder groß zu machen«, und spaltet das ohnehin zerrissene Land noch tiefer. Seine Anhänger verfolgen alle, die nicht in Jarrets Bild von einem weißen Amerika passen. Auch Laurens Gemeinde bekommt den Zorn der weißen Männer zu spüren – mit katastrophalen Folgen.
Jahrzehnte später entdeckt Laurens Tochter Asha Vere die Tagebücher ihrer Mutter. In der Vergangenheit sucht sie nach Antworten auf ihre Fragen: Sie will ihre Mutter verstehen lernen, die hin- und hergerissen war zwischen der Verantwortung für ihre Gemeinschaft und ihrer Bestimmung, die Menschheit als Ganzes in eine bessere Zukunft zu führen.
Mit Die Parabel der Talente, 1998 veröffentlicht, setzt Octavia E. Butler ihren Roman Die Parabel vom Sämann fort, der inzwischen ein moderner Klassiker der amerikanischen Literatur ist. Bis heute haben diese beiden Bücher nichts von ihrer Aktualität verloren.
Die Autorin
Octavia E. Butler (1947–2006) war die erste Schwarze Autorin, die sich in der Science-Fiction einen Namen machte. Sie kam in Pasadena, Kalifornien zur Welt. Obwohl bei ihr Dyslexie festgestellt wurde, machte sie einen Abschluss an der California State University in Los Angeles. Schon als Kind verfasste sie Science-Fiction-Kurzgeschichten. 1976 veröffentlichte sie ihren ersten Roman. Ihr mehrfach preisgekröntes Werk kreist immer wieder um Fragen der kulturellen und geschlechtlichen Identität. Bis zu ihrem Tod lebte und arbeitete Octavia E. Butler in Seattle, Washington. Heute gilt sie mit Meisterwerken wie Kindred, Die Parabel vom Sämann sowie dem Nachfolgeband Die Parabel der Talente weit über die Science-Fiction hinaus als eine der wichtigsten amerikanischen Autorinnen des 20. Jahrhunderts.
Mehr über Octavia E. Butler und ihre Werke erfahren Sie auf:
OCTAVIA E. BUTLER
DIEPARABELDERTALENTE
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Dietlind Falk
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
THE PARABLE OF THE TALENTS
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Arbeit an dieser Übersetzung wurdevon der Kunststiftung NRW gefördert
Deutsche Erstausgabe 03/2024
Redaktion: Michelle Stöger
Copyright © 1998 by Octavia E. Butler
Published by Arrangement with Octavia E. Butler Enterprises
Copyright © 2024 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com(triniguy1868, SvetaZi)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-29256-0V001
www.diezukunft.de
PROLOG
Hier sind wir also –
Energie,
Masse,
Leben,
Das Leben formt,
Geist,
Der den Geist formt,
Gott,
Der Gott formt.
Vergiss nicht –
Wir werden nicht
Zu einem Zweck geboren,
Sondern mit einem Potenzial.
AUS EARTHSEED:DIE BÜCHER DER LEBENDENVON LAUREN OYA OLAMINA
Sie werden eine Gottheit aus ihr machen.
Ich nehme an, das hätte ihr gefallen. So sehr sie es auch abgestritten und geleugnet hat: Sie hat von Anfang an hingebungsvolle, gehorsame Anhänger gebraucht – Jünger –, die ihr zugehört und jedes Wort geglaubt haben, das aus ihrem Mund kam. Und sie brauchte Massenevents, um sie zu beeinflussen. Das scheint auf alle Gottheiten zuzutreffen.
Ihr offizieller Name war Lauren Oya Olamina Bankole. Aber alle, die sie geliebt oder gehasst haben, haben sie nur Olamina genannt.
Sie war meine Mutter.
Sie ist tot.
Ich habe mir immer gewünscht, sie lieben zu können und zu glauben, dass das, was zwischen ihr und mir passiert ist, nicht ihre Schuld war. Wirklich. Doch stattdessen habe ich sie gehasst, gefürchtet, gebraucht. Nur vertraut habe ich ihr nie, und auch nicht verstanden, wie sie so sein konnte – so zielstrebig, aber in die falsche Richtung, für alle da, nur nicht für mich. Ich verstehe es immer noch nicht. Und jetzt, da sie tot ist, werde ich es vielleicht nie verstehen. Doch ich muss es versuchen, weil ich mich selbst verstehen muss und sie ein Teil von mir ist. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber das ist Fakt. Um zu verstehen, wer ich bin, muss ich verstehen, wer sie war. Das ist der Grund, weshalb ich dieses Buch schreibe und zusammenstelle.
Ich habe meine Gefühle schon immer geordnet, indem ich sie aufgeschrieben habe. Das hatten sie und ich gemeinsam. Meine Mutter entwickelte neben dem Bedürfnis zu schreiben auch noch den Drang zu zeichnen. In einer weniger geisteskranken Zeit wäre sie vielleicht Schriftstellerin geworden, so wie ich, oder Künstlerin.
Ich besitze einige ihrer Zeichnungen, auch wenn sie die meisten noch zu Lebzeiten verschenkt hat. Und ich besitze Kopien von allem, was von ihren gesammelten Schriften gerettet werden konnte. Sogar einige ihrer handgeschriebenen Notizhefte konnten auf Disk oder Cristal kopiert werden. Als junge Frau hatte sie bei Menschen, denen sie vertraute, und an abgelegenen Orten Geheimverstecke für Lebensmittel, Geld und Waffen angelegt, die sie noch viele Jahre später wiederfand. Das hat ihr nicht nur einige Male das Leben gerettet, sondern auch ihre Worte, ihre Tagebücher und Notizen sowie die Schriften meines Vaters bewahrt. Sie scheint ihm so lange damit auf die Nerven gegangen zu sein, bis er selbst zum Stift gegriffen hat, zumindest ab und an. Er schrieb gut, wenn auch nicht gerne. Ich bin froh, dass sie ihn dazu bekommen hat. Froh, ihn wenigstens auf diese Art kennengelernt zu haben. Ich frage mich, warum es mir bei den Schriften meiner Mutter nicht genauso geht.
»Gott ist Veränderung« war das Credo meiner Mutter, das sie in den ersten Versen von Earthseed: Das erste Buch der Lebenden festgehalten hat.
Alles, was du berührst,
Veränderst du.
Alles, was du veränderst,
Verändert dich.
Die einzig überdauernde Wahrheit
Ist die Veränderung.
Gott ist Veränderung.
Harmlose Worte, nehme ich an, und als Metapher nicht unwahr. Immerhin hat sie mit einer Art von Wahrheit angefangen. Mich wird sie hiermit zum letzten Mal berührt haben, mit ihren Erinnerungen, ihrem Leben, und ihrem gottverdammten Earthseed.
2032
Wir übergeben unsere Toten
Den Obstgärten
Und den Hainen.
Wir übergeben unsere Toten
Dem Leben.
EARTHSEED:DIE BÜCHER DER LEBENDEN
1
Finsternis
Formt das Licht
Wie das Licht
Die Finsternis formt.
Der Tod
Formt das Leben
Und das Leben formt
Den Tod.
Auch das Universum
Und Gott
Teilen diese Zweiheit.
Sie bedingen einander.
Gott
Formt das Universum
Und das Universum
Formt Gott.
EARTHSEED:DIE BÜCHER DER LEBENDENVON LAUREN OYA OLAMINA
Erinnerungen an andere Weltenvon Taylor Franklin Bankole
Ich habe gelesen, die Zeit des Aufruhrs, die von Journalisten nur »die Apokalypse« oder, noch zynischer, »die Syphilis« genannt wird, habe von 2015 bis 2030 gedauert – anderthalb Jahrzehnte Chaos. Aber das stimmt nicht. Die Syphilis war eine weit längere, qualvolle Episode. Das alles hat lange vor 2015 begonnen, vielleicht sogar vor der Jahrtausendwende. Und vorbei ist es auch noch nicht.
Ich habe auch gelesen, dass die Syphilis durch zufällig zeitgleich ablaufende klimatische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen ausgelöst worden sein soll. Es wäre ehrlicher zu sagen, sie wurde von unserer Weigerung ausgelöst, uns mit den offensichtlichen Problemen in diesen Bereichen auseinanderzusetzen. Problemen, die wir selbst angestoßen hatten: Und dann haben wir uns zurückgelehnt und zugesehen, wie sie sich zu Krisen entwickelten. Manche Menschen leugnen, dass es so war, aber ich bin Jahrgang 1970. Ich habe genug gesehen, um die Wahrheit zu kennen. Ich habe miterlebt, wie die Bildung zu einem Privileg der Reichen verkommen ist, statt als Grundpfeiler einer zivilisierten, fortdauernden Gesellschaft zu dienen. Ich habe mit angesehen, wie Bequemlichkeit, Profitgier und Untätigkeit zu vorgeschobenen Rechtfertigungen für immer umfassendere und riskantere Angriffe auf die Umwelt wurden. Ich musste zusehen, wie Armut, Hunger und Krankheit für immer mehr Menschen unvermeidbar wurden.
Insgesamt wirkte die Syphilis wie ein Dritter Weltkrieg auf Raten. Rund um die Erde waren damals schon kleinere, blutige Kriege im Gange. Unsinnige Angelegenheiten – eine Verschwendung von Ressourcen und Menschenleben. Man gab vor, die Waffen aus reinem Selbstschutz auf bösartige, ausländische Kräfte zu richten. Allzu oft wurde gekämpft, weil unfähige Staatschefs sich nicht anders zu helfen wussten. Staatschefs, die gelernt hatten, patriotische Unterstützung für ihre Kriege durch Angst, Misstrauen, Hass, Not und Gier zu schüren.
Mittendrin verloren die Vereinigten Staaten aus irgendeinem Grund eine gewichtige, nicht-militärische Auseinandersetzung. Sie verloren keinen bedeutsamen Krieg, und doch überlebten sie die Syphilis nicht. Vielleicht verloren sie aus den Augen, was sie einst hatten sein wollen, und stolperten dann blind voran, bis ihnen die Puste ausging.
Was jetzt von diesem Land übrig ist, was aus ihm geworden ist, erkenne ich nicht wieder.
Taylor Franklin Bankole war mein Vater. Seinem Schreibstil nach zu urteilen, war er ein aufmerksamer, etwas förmlicher Mann, der mit meiner merkwürdigen, dickköpfigen Mutter zusammenkam, obwohl sie beinahe jung genug war, um seine Enkelin zu sein.
Offenbar hat meine Mutter ihn geliebt und war glücklich mit ihm. Er und meine Mutter lernten sich während der Syphilis kennen. Beide waren obdachlose Vagabunden. Er war allerdings siebenundfünfzig und Arzt, seine Familie hatte eine Praxis – sie dagegen war ein achtzehnjähriges Mädchen. Beide hatten durch die Syphilis Schreckliches erlebt. Beide hatten ihre Nachbarschaft verloren – er in San Diego und sie in Robledo, einem Vorort von Los Angeles. Das schien als Gemeinsamkeit auszureichen. Sie lernten sich 2027 kennen und lieben, heirateten schließlich. Zwischen den Zeilen der Schriften meines Vaters lese ich, dass er sich um dieses seltsame Mädchen kümmern wollte, das ihm über den Weg gelaufen war. Er wollte sie vor dem damaligen Chaos beschützen, vor den Gangs, den Drogen, vor Sklaverei und Krankheit. Und natürlich schmeichelte ihm, dass sie ihn wollte. Er war auch nur ein Mann, und sicher hatte er genug vom Alleinsein. Als er und meine Mutter einander trafen, war seine erste Frau seit zwei Jahren tot.
Natürlich konnte er meine Mutter nicht beschützen. Das hätte niemand gekonnt. Sie hatte ihren Weg gewählt, lange bevor sie sich begegneten. Er machte den Fehler, in ihr eine junge Frau zu sehen. In Wahrheit war sie ein Sprengkopf, geladen und auf Position.
Aus den Tagebüchern von Lauren Oya OlaminaSonntag, 26. September 2032
Heute feiern wir den Tag der Ankunft. An diesem Tag vor fünf Jahren haben wir hier, in den Bergen des Humboldt County, unsere Gemeinschaft namens Acorn gegründet.
Wie durch eine Art perverser Würdigung dieses Festtages hatte ich gerade einen meiner wiederkehrenden Albträume. In den letzten Jahren sind sie selten geworden – vertraute Feinde mit fiesen Angewohnheiten. Ich kenne sie. Ihre Anfänge sind so sanft und unkompliziert … Dieser hier fing als Trip in die Vergangenheit an, nach Hause, um Zeit mit geliebten Geistern zu verbringen.
Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, erhebt sich aus der Asche. Aus irgendeinem Grund bin ich nicht überrascht, obwohl ich es vor Jahren niederbrennen sah. Obwohl meine Füße die Ruine durchschritten haben, die übrig blieb. Hier steht es nun wie eh und je, und ist voller Menschen – sämtlicher Menschen, die ich als kleines Mädchen kannte. Sie sitzen in den unteren Zimmern in Reihen aus alten metallenen Klappstühlen, auf hölzernen Küchen- und Esszimmerstühlen und stapelbaren Plastikstühlen, eine stumme Gemeinde der Vertriebenen und der Toten.
Der Gottesdienst hat schon angefangen, und natürlich predigt mein Vater. In seiner Robe sieht er aus wie immer: groß, breitschultrig, ernst, aufrecht – eine hohe Schwarze Mauer von einem Mann, dessen Stimme man nicht nur hören, sondern auf der Haut und bis in die Knochen spüren kann. Es gibt in diesen Räumen keinen Winkel, den mein Vater mit seiner Stimme nicht erreichen könnte. Hier gab es noch nie eine Lautsprecheranlage – er hat sie nicht nötig gehabt. Nun höre und fühle ich wieder seine Stimme.
Wie viele Jahre liegt das Verschwinden meines Vaters zurück? Oder besser gesagt: Wie lange liegt sein Tod zurück? Sicher wurde er umgebracht. Er war nicht die Art Mann, die seine Familie im Stich lässt, seine Gemeinde, seine Kirche. Zu jener Zeit, als er verschwand, kam man leichter gewaltsam ums Leben als heute. Am Leben zu bleiben, war hingegen so gut wie unmöglich.
Eines Tages ist er von zu Hause aufgebrochen, um in sein Büro am College zu fahren. Seine Kurse gab er am Computer und musste nur einmal pro Woche zum Campus, doch selbst bei einem Mal pro Woche war er einer zu großen Gefahr ausgesetzt. Die Nacht verbrachte er wie gewöhnlich im Büro. Menschen mit Arbeit machten sich am besten früh am Morgen auf den Rückweg. Er machte sich auf den Weg nach Hause und ward nie mehr gesehen.
Wir haben nach ihm gesucht. Sogar die Polizei haben wir bezahlt, um nach ihm zu fahnden. Alles umsonst.
Das war mehrere Monate bevor unser Haus niedergebrannt, bevor unsere Nachbarschaft zerstört wurde. Ich war siebzehn. Jetzt bin ich dreiundzwanzig und mehrere Hundert Meilen von jenem toten Ort entfernt.
Nur in meinem Traum ist alles plötzlich wieder gut.
Ich bin zu Hause, und mein Vater predigt. Schräg hinter ihm sitzt meine Stiefmutter an ihrem Klavier. Vor ihm, in dem großen, nicht ganz offenen, L-förmigen Raum aus Wohn-, Ess- und Familienzimmer, sitzen unsere Nachbarn, die Gemeinde. Für diesen Sonntagsgottesdienst haben sich noch mehr als die üblichen dreißig bis vierzig Gläubigen in unseren Wohnbereich gequetscht. Für eine Baptistengemeinde sind sie viel zu leise – zumindest für die Baptistengemeinde, in der ich groß geworden bin. Sie sind hier, aber irgendwie auch nicht. Es sind Schattenmenschen. Geister.
Nur meine eigene Familie fühlt sich echt an. Wie die meisten anderen sind sie tot, und doch sind sie lebendig! Meine Brüder sind hier und sehen so aus wie damals, als ich etwa vierzehn war. Keith, der am ältesten und fiesesten ist und als Erster gestorben, ist elf. Das bedeutet, dass Marcus, mein Lieblingsbruder und der Hübscheste aus der ganzen Familie, zehn ist. Ben und Greg, die beinahe aussehen wie Zwillinge, sind acht und sieben. Wir sitzen in der Nähe meiner Stiefmutter in der ersten Reihe, damit sie uns im Auge behalten kann. Ich sitze zwischen Keith und Marcus, damit sie sich während des Gottesdienstes nicht an die Gurgel gehen.
Als meine Eltern gerade nicht hinsehen, verpasst Keith Marcus über meinen Schoß hinweg einen heftigen Schlag auf den Oberschenkel. Marcus, der jünger und kleiner ist, aber auch dickköpfig und hart im Nehmen, schlägt zurück. Ich schnappe mir je eine Faust meiner Brüder und drücke zu. Ich bin größer und stärker als beide und hatte schon immer kräftige Hände. Die Jungs winden sich und versuchen, ihre Fäuste zu befreien. Einen Moment später lasse ich los. Lektion gelernt. Ein, zwei Minuten werden sie einander in Ruhe lassen.
In meinem Traum spüre ich ihre Schmerzen nicht wie in unserer Kindheit. Damals war ich für ihr Benehmen verantwortlich, weil ich die Älteste war. Ich musste sie im Zaum halten, obwohl es für mich vor ihren ständigen Schmerzen kein Entrinnen gab. Was mein Hyperempathie-Syndrom betraf, kannten mein Vater und meine Stiefmutter kein Pardon. Sie weigerten sich, mich als behindert zu betrachten. Ich war die Älteste, Punkt. Ich musste die Verantwortung tragen.
Trotzdem fühlte ich jede verdammte Schürfwunde, jeden Schnitt und jede Verbrennung, die meine Brüder tagtäglich ansammelten. Jedes Mal, wenn ich mitbekam, wie sie sich verletzten, spürte ich ihren Schmerz, als hätte ich mich selbst verletzt. Ich fühlte sogar Schmerzen, die sie nur vorspielten. Das Hyperempathie-Syndrom ist schließlich eine wahnhafte Störung. Keine Telepathie, keine Zauberei, kein übergreifendes spirituelles Bewusstsein. Nur die neurochemische Einbildung, der Schmerz und der Genuss der anderen wäre der eigene. Genuss ist selten, Schmerzen gibt es zuhauf, und Einbildung hin oder her – die Schmerzen sind die Hölle.
Warum fehlen sie mir jetzt?
Verrückt, Schmerzen zu vermissen. Das Ganze sollte mir vorkommen, als wären meine Zahnschmerzen endlich verschwunden. Ich sollte überrascht und glücklich sein. Stattdessen habe ich Angst. Ein Teil von mir ist weg. Die Schmerzen meiner Brüder nicht zu spüren ist so, als könnte ich ihre Hilfeschreie nicht hören, und das macht mir Angst.
Langsam verwandelt sich der Traum in einen Albtraum.
Plötzlich ist mein Bruder Keith nicht mehr da. Er ist einfach weg. Er war der Erste von uns, der verschwand, vor Jahren – ermordet. Jetzt fehlt er wieder. Stattdessen sitzt eine hochgewachsene, wunderschöne Frau neben mir, mit dunkelbrauner Haut und schmalen Gliedmaßen und langem, rabenschwarzem Haar, das glänzt. Sie trägt ein weiches, fließend grünes Seidenkleid, das sich an ihren Körper schmiegt und sie vom Hals bis zu den Füßen in ein verschlungenes Muster aus Falten und gerafftem Stoff hüllt. Eine Fremde.
Meine Mutter.
Die Frau von dem Foto meiner leiblichen Mutter, das mein Vater mir einmal geschenkt hat. Keith hat es aus meinem Zimmer gestohlen, als er neun war und ich zwölf. Er hat es in ein Stück einer alten Plastiktischdecke gewickelt und im Garten zwischen einer Reihe mit Kürbissen und Mais und Bohnen vergraben. Später hat er behauptet, es sei nicht seine Schuld gewesen, dass das Foto aufgeweicht und kaputt getrampelt worden war. Er hatte es nur aus Spaß versteckt. Er hätte ja nicht ahnen können, dass es kaputtgehen würde. So war Keith. Ich habe ihn grün und blau geschlagen. Ich tat mir selbst dabei weh, aber es war die Schmerzen wert. Das war die einzige Tracht Prügel, die er unseren Eltern nicht gepetzt hat.
Trotzdem war das Foto hinüber, mir blieb nichts als die Erinnerung daran. Und genau diese Erinnerung sitzt jetzt neben mir. Meine Mutter ist groß, größer als ich. Größer als die meisten Menschen. Sie ist nicht hübsch. Sie ist schön. Ich sehe ihr nicht ähnlich. Ich ähnle meinem Vater, was, wie er zu sagen pflegte, wirklich schade war. Mir ist es egal. Sie ist jedenfalls eine auffällig schöne Frau.
Ich starre sie an, aber sie dreht nicht den Kopf, um mich anzusehen. Zumindest in diesem Punkt entspricht mein Traum der Realität: Sie hat mich nie gesehen. Während ich zur Welt kam, starb sie. Zuvor hatte sie zwei Jahre lang die äußerst beliebte Überflieger-Droge Paracetco genommen. Es handelte sich um ein neu auf den Markt gebrachtes Medikament, das bei Menschen mit Alzheimer wahre Wunder wirkte. Die Pille stoppte den geistigen Verfall und gab den Patienten exzellente Kontrolle über ihr verbleibendes Gedächtnis und ihre intellektuellen Fähigkeiten zurück. Bei jungen, gesunden Menschen wirkte sie intelligenzsteigernd. Sie lasen zügiger, lernten besser auswendig und kamen schneller auf die korrekten Verbindungen, Kalkulationen und Schlussfolgerungen. Was dazu führte, dass Paracetco unter Studenten in etwa so beliebt wie Kaffee wurde. Wer im Wetteifern um die besser bezahlten Jobs mithalten wollte, musste sich nicht nur mit Computern auskennen, er kannte auch Paracetco.
Vielleicht hatte der Drogenkonsum meiner Mutter auch etwas mit ihrem Tod zu tun. Das weiß ich nicht sicher. Mein Vater auch nicht. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass die Droge bei mir Spuren hinterlassen hat, die nicht von der Hand zu weisen sind – in Form von Hyperempathie. Dank der süchtig machenden Eigenschaften von Paracetco – ein paar Tausend Menschen kamen bei dem Versuch eines Entzugs ums Leben – gab es einst Abermillionen wie mich.
Die Leute nennen uns Hyperempathen oder Hyperempatheure oder Teiler. Wenn sie höflich sein wollen. Wenn man bedenkt, wie verwundbar wir sind und wie hoch die Sterblichkeitsrate bei uns liegt, gibt es eigentlich noch ziemlich viele von uns.
Ich strecke die Hand nach meiner Mutter aus. Ganz gleich, was sie getan hat, ich will sie kennenlernen. Aber sie sieht mich nicht an. Sie dreht nicht einmal den Kopf. Und aus irgendeinem Grund erreiche ich sie nicht, kann sie nicht berühren. Ich versuche aufzustehen, kann mich jedoch nicht bewegen. Mein Körper gehorcht mir nicht. Ich kann nur dasitzen und zuhören, während mein Vater predigt.
Langsam dringt seine Predigt in mein Bewusstsein. Bisher war sie nur ein diffuses Murmeln im Hintergrund, doch nun höre ich, wie er aus dem 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums vorliest, in dem Jesus über das Himmelreich spricht: »›Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an; dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes.‹«
Mein Vater liebte Parabeln – Geschichten, bei denen man etwas lernte, deren Message oder Moral in den Köpfen der Menschen Bilder entspringen ließen. Er fand Parabeln aus der Bibel, aus Geschichtsbüchern oder Volkssagen, und natürlich predigte er auch Gleichnisse aus seinem eigenen Leben oder dem Leben der Menschen um ihn herum. Er flocht Geschichten in seine Sonntagspredigt, seinen Bibelunterricht und die Geschichtsvorlesungen, die er am Computer gab. Vielleicht hätte ich ohne ihn nie gelernt, Geschichten als wichtiges Werkzeug zu betrachten, um Menschen etwas beizubringen. Die Parabel, die er gerade vorlas, konnte ich Wort für Wort mitsprechen: Die Parabel der Talente. Einige Parabeln aus der Bibel kenne ich auswendig. Vielleicht kann ich deshalb mehr hören und verstehen. Zwischen Teilen der Parabel geht seine Predigt weiter, doch ich verstehe nicht richtig, was er sagt. Ich höre, wie seine Stimme rhythmisch anschwillt und abebbt, wiederholt und variiert, ruft und flüstert. Ich höre sie, wie ich sie immer gehört habe, nur kann ich die Worte nicht ausmachen – nur die Parabel höre ich deutlich.
»›Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn.‹«
Mein Vater war ein großer Verfechter von Bildung, harter Arbeit und Verantwortungsbewusstsein. »Dies sind unsere Talente«, pflegte er zu sagen, wenn meinen Brüdern schon die Augen schwer wurden und ich ein Seufzen unterdrückte, »Gott hat sie uns gegeben, und er wird uns danach beurteilen, was wir aus ihnen machen.«
Die Parabel geht weiter. Gott sagt zu jedem der beiden Knechte, die geschickt gehandelt und Profit gemacht haben: »›Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!‹«
Für den Knecht jedoch, der nichts mit seinem Talent angefangen, sondern es zur Sicherheit in der Erde vergraben hat, findet Gott härtere Worte: »›Du böser und fauler Knecht!‹«, beginnt er. Dann befiehlt er: »›Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.‹«
Als mein Vater diese Worte ausgesprochen hat, ist meine Mutter verschwunden. Ich habe nicht einmal ihr ganzes Gesicht gesehen, und nun ist sie fort.
Ich verstehe nicht. Ich habe Angst. Jetzt sehe ich, dass sich auch andere Menschen in Luft auflösen. Die meisten sind schon weg. Geliebte Geister …
Mein Vater ist fort. Meine Stiefmutter ruft ihm etwas auf Spanisch zu, wie es manchmal ihre Art war, wenn sie aufgeregt war. »Nein! Wie sollen wir jetzt überleben? Sie werden uns überfallen. Sie werden uns alle töten! Wir müssen eine höhere Mauer bauen!«
Dann ist sie weg. Meine Brüder sind auch weg. Ich bin allein – so allein wie in jener Nacht vor fünf Jahren. Das Haus liegt in Schutt und Asche um mich herum. Es verbrennt nicht und stürzt nicht ein, es zerfällt nicht einmal. Irgendwie ist es ganz plötzlich eine Ruine, aus der man den Nachthimmel sieht. Da sind Sterne, eine Mondsichel und ein schmaler Lichtstreifen, er bewegt sich, steigt in den Himmel empor wie entfliehende Lebenskraft. Die drei Lichtquellen lassen mich Schatten erkennen, groß, behände, bedrohlich. Ich fürchte die Schatten, sehe aber keinen Weg, ihnen zu entkommen. Die Mauer ist noch da, sie umgibt unsere Nachbarschaft, thront weit höher über mir, als sie es je gewesen ist. So viel höher … Sie sollte Gefahren von uns fernhalten. Das klappt seit Jahren nicht mehr. Genau wie jetzt. Die Gefahr ist drinnen eingeschlossen, genau wie ich. Ich will wegrennen, entkommen, mich verstecken, doch nun lösen sich meine eigenen Hände und Füße in Luft auf. Ich höre Donnergrollen. Ich sehe, wie der Lichtstreifen höher emporsteigt, heller erstrahlt.
Dann schreie ich. Ich falle. Ein zu großer Teil meines Körpers hat sich aufgelöst, ist verschwunden. Ich kann nicht mehr aufrecht stehen, kann mich nicht fangen, während ich falle und falle und falle …
Ich erwachte hier in Acorn in meiner Holzhütte, mein Körper hing halb aus dem Bett. Hatte ich laut geschrien? Ich wusste es nicht. Scheinbar kommen diese Albträume nur, wenn Bankole nicht da ist, also kann mir niemand sagen, wie laut ich träume. Ist auch besser so. Seine Praxis bringt ihn schon oft genug um den Schlaf, und gerade in dieser Nacht wird er wohl kein Auge zutun.
Es ist jetzt drei Uhr morgens, und gestern Abend wurden die Dovetrees kurz nach Einbruch der Dunkelheit von irgendeiner Gruppierung oder Gang überfallen. Sie leben ein Stück nördlich von uns. Gestern um diese Zeit lebten dort noch zweiundzwanzig Dovetrees – ein alter Mann und seine Frau mit ihren beiden Töchtern, fünf verheirateten Söhnen samt Frauen und Kindern. Abgesehen von den beiden jüngsten Ehefrauen und drei Kleinkindern, die sie auf der Flucht nach draußen zu fassen bekamen, sind all diese Menschen jetzt tot. Zwei der Kinder sind verletzt und eine der Frauen hat einen Herzinfarkt erlitten. Bankole hat sie früher schon behandelt. Er sagt, es handle sich um einen angeborenen Herzfehler, den man hätte operieren sollen, als sie noch ein Baby war. Doch die junge Frau ist erst zwanzig, wie die meisten Menschen hatten ihre Eltern zum Zeitpunkt ihrer Geburt vermutlich wenig bis gar kein Geld. Sie arbeiteten hart, ab einem Alter von acht bis zehn Jahren schufteten die stärksten ihrer Kinder mit. Entweder würde ihre Tochter mit dem Herzfehler leben oder sterben – eine OP war nicht infrage gekommen.
Nun hatte er sie beinahe das Leben gekostet. Bankole schlief heute Abend im Behandlungsraum in unserer Schule – oder vermutlich durchwachte er die Nacht und behielt die Frau und die beiden Kinder im Auge. Aufgrund meiner Hyperempathie kann er hier im Haus keine Patienten behandeln. Ich bekomme auch so genug Schmerzen von anderen mit, und das bereitet ihm Sorge. Ständig will er mir irgendwas geben, das mein Teilen unterdrückt und mich müde, langsam und dumm macht. Nein, danke!
Ich wachte also auf, allein und schweißgebadet, und konnte nicht mehr einschlafen. Seit Jahren hat mich kein Traum mehr so beschäftigt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das letzte Mal fünf Jahre her, da waren wir gerade hier angekommen, und es war derselbe verfluchte Albtraum. Ich nehme an, dass er mich wegen des Angriffs auf die Dovetrees erneut heimsucht.
So einen Überfall hätte es nicht geben dürfen. In den letzten Jahren ist es hier viel ruhiger geworden. Natürlich geschehen noch Verbrechen – Überfälle, Einbrüche und Entführungen gegen Lösegeld oder für den Menschenhandel. Viel schlimmer ist jedoch, dass die Armen noch immer für »Straftaten« wie Verschuldung, Landstreicherei oder Herumlungern zu Gefängnis oder Zwangsarbeit verurteilt werden können. In eine Gemeinschaft zu platzen und zu morden und alles anzuzünden, was man nicht stehlen kann, schien eigentlich nicht mehr angesagt zu sein. Seit mindestens drei Jahren ist mir nichts Derartiges mehr zu Ohren gekommen wie die Attacke auf die Dovetrees.
Sicher, die Dovetrees haben die Leute in der Umgebung mit selbstgebranntem Whiskey und Marihuana aus eigenem Anbau versorgt, aber das haben sie schon lange, bevor wir hierhergekommen sind, getan. Tatsächlich besaßen sie die besten Waffen in dieser Gegend, da ihr Geschäft nicht nur illegal, sondern äußerst lukrativ war. Schon vorher haben Leute versucht, sie auszurauben, aber das war höchstens den Dieben von der schnellen, lautlosen Sorte gelungen. Bis gestern.
Ich hatte Aubrey befragt, die unversehrte Dovetree-Frau, während Bankole ihren Sohn verarztete. Er hatte ihr bereits versichert, dass der Kleine überleben würde, und wir mussten herausfinden, was sie wusste, egal, wie sehr sie der Angriff verstört hatte. Die Häuser der Dovetrees lagen von hier aus gerade mal einen einstündigen Fußmarsch über die alte Holzfällerstraße entfernt, verdammt noch mal. Wer auch immer die Dovetrees überfallen hatte – vielleicht waren wir die Nächsten auf der Liste.
Aubrey erzählte mir, die Angreifer hätten merkwürdige Kleidung getragen. Wir sprachen im Klassenzimmer miteinander. Zwischen uns brannte auf einem der Tische eine einzelne Öllampe. Wir saßen einander gegenüber, und ab und an glitt Aubreys Blick hinüber zum Behandlungszimmer, wo Bankole sich um die Kratzer, Verbrennungen und Schürfwunden ihres Sohnes kümmerte. Sie sagte, bei den Angreifern habe es sich um Männer gehandelt, nur hatten sie schwarze, gegürtete Gewänder getragen – sie sprach von schwarzen Roben –, die ihnen bis an die Waden reichten. Darunter trugen sie gewöhnliche Hosen – entweder Jeans oder Camouflage-Hosen, wie Soldaten sie trugen.
»Sie waren wie Soldaten«, sagte sie. »Haben sich reingeschlichen, ohne einen Mucks zu machen. Wir haben sie erst gesehen, als sie das Feuer auf uns eröffneten. Und dann ging alles ganz schnell, zack, zack, zack. Sie haben alle Häuser gleichzeitig angegriffen. Das war wie eine Explosion – Schüsse aus zwanzig, dreißig Waffen, alle wurden im selben Moment abgefeuert.«
So operierte keine Gang. Gangster ballerten unkontrolliert drauflos, nicht auf Kommando. Und dann versuchten sie, voreinander auf dicke Hose zu machen, indem sie sich die hübscheste Frau krallten oder die besten Sachen abgriffen, bevor ihre Homies sie in die Hände bekamen.
»Erst haben sie uns ausgeschaltet, dann haben sie uns bestohlen und gebrandschatzt«, sagte Aubrey. »Dann haben sie sich unser Benzin geholt und sind sofort auf unsere Felder gegangen, um alles abzufackeln. Danach haben sie die Häuser und Scheunen durchsucht. Sie trugen große weiße Kreuze um den Hals – Kreuze wie aus der Kirche. Aber sie haben uns umgebracht. Sie erschossen sogar die Kinder. Sie haben alle getötet, die sie gefunden haben. Ich habe mich mit meinem Baby versteckt, sonst hätten sie uns auch getötet.« Wieder sah sie in Richtung Behandlungszimmer.
Dass sie Kinder töteten … das gab mir wirklich zu denken. Abgesehen von Psychopathen der übelsten Sorte, ließen Verbrecher die Kinder für gewöhnlich am Leben, um sie zu vergewaltigen und anschließend zu verkaufen. Und was die Kreuze betraf, trugen Gangmitglieder vielleicht Kreuze an Goldkettchen, aber das wäre einem Opfer höchstens aus allernächster Nähe aufgefallen. Außerdem rannte keine Gang in Einheitsrobe mit weißem Kreuz herum. Das hier war neu.
Oder es war zurück.
Ich dachte erst wieder darüber nach, als Aubrey schon in der Praxis war und an der Seite ihres Sohnes schlief. Bankole hatte dem Kind ein Schlafmittel gegeben. Ihr hat er auch etwas gegeben, also werde ich sie erst später am Morgen weiter aushorchen können. Ich kam nicht umhin, mich zu fragen, ob diese Leute mit ihren Kreuzen etwas mit dem Präsidentschaftskandidaten zu tun haben, den ich am meisten verabscheue – Andrew Steele Jarret, der für Texas im Senat sitzt. Die ganze Sache klingt nach seiner Anhängerschaft, als wollten sie eine hässliche Episode aus der Vergangenheit wiederbeleben. Hat der Ku-Klux-Klan Kreuze getragen – oder nur verbrannt? Die Nazis trugen Hakenkreuze, aber meines Wissens nicht um den Hals. Während der Inquisition gab es jede Menge Kreuze überall, genau wie vorher bei den Kreuzzügen. Jetzt also eine neue Gruppierung, die Kreuze trägt und Menschen abschlachtet. Jarrets Leute könnten dahinterstecken. Seine Rhetorik basiert auf der Behauptung, er wolle den Weg in eine frühere, »einfachere« Zeit weisen. Das Hier und Jetzt passt ihm nicht. Toleranz unter den Religionen passt ihm nicht. Die Lage der Nation passt ihm nicht. Er will uns alle zurück in die herrliche Zeit versetzen, in der alle zum selben Gott beteten, ihm auf dieselbe Art huldigten und der Meinung waren, ihre Sicherheit im Universum hinge einzig und allein davon ab, die ewig gleichen religiösen Rituale einzuhalten und alle Andersgläubigen dem Erdboden gleich zu machen. So eine Zeit hat es in diesem Land nie gegeben. Doch dieser Tage ist die Hälfte der Bevölkerung des Lesens nicht mehr mächtig, und die Vergangenheit für sie nur ein weiteres unbekanntes Territorium.
Hier und da haben Jarret-Anhänger schon Mobs gebildet und Frauen auf Scheiterhaufen verbrannt, die angeblich Hexen sein sollten. Hexen! Und wir haben 2032! Hexen sind für sie meist Muslime oder Juden, Hindus oder Buddhisten, in manchen Teilen des Landes auch Mormonen oder Zeugen Jehovas, manchmal sogar Katholiken. Hexen können auch Atheisten, »Kultanhänger« oder wohlsituierte Exzentriker sein. Letztere haben häufig niemanden, der für sie einstehen würde, und besitzen viel, das zu stehlen sich lohnt. »Kultanhänger« ist natürlich ein fabelhafter Überbegriff für jeden, dessen Religion in keine Schublade passt und trotzdem nicht Jarrets Vorstellungen vom Christentum entspricht. Jarrets Anhänger haben wohl schon Unitarier verprügelt und rausgeschmissen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jarret verurteilt die Scheiterhaufenaktionen, allerdings mit derart milden Worten, dass seine Anhänger raushören können, was sie wollen. Und was Prügeleien, Teeren und Federn und die Zerstörung »gotteslästerlicher Teufelsanbeterkirchen« angeht – darauf hat er eine einfache Antwort: »Schließt euch uns an! Unsere Tür steht allen offen, jeder Nationalität, jeder Rasse! Lasst eure sündenreiche Vergangenheit hinter euch, und werdet einer von uns. Make America Great Again.« Dank seines Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatzes hatte er beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Komm zu uns und du wirst gedeihen, doch wenn du ein halsstarriger Sünder bleiben willst, Pech gehabt, dann können wir für nichts garantieren. Vizepräsident und Gegenkandidat Edward Jay Smith nennt Jarret einen Demagogen, einen Rattenfänger und Heuchler. Damit hat er natürlich recht, nur ist Smith so ein ausgelutschter grauer Schatten von einem Mann. Jarret dagegen ist groß und gut aussehend, ein schwarzhaariger Hüne mit klaren, tiefblauen Augen, denen die Leute leicht verfallen. Seine Stimme scheint aus seinem gesamten Körper heraus zu dröhnen, genau wie einst die Stimme meines Vaters. Leider ist es sogar so, dass auch Jarret früher einmal als Baptistenprediger angefangen hat. Die Baptisten hat er allerdings schon vor Jahren hinter sich gelassen, um seine eigene Konfession »Christian America« zu gründen. Er hält keine gewöhnlichen CA-Predigten in CA-Kirchen oder auf den Netzkanälen mehr, wird aber weiterhin als Kirchenoberhaupt anerkannt.
Dass Analphabeten sich leichter von Aussehen und Stimme eines Kandidaten beeinflussen lassen als von dessen Wahlversprechen, scheint unvermeidbar. Und selbst diejenigen, die lesen können und gebildet sind, scheinen sich von gutem Aussehen und verführerischen Lügen stärker beeinflussen zu lassen, als sie es sollten. Zweifelsohne werden die neuen Foto-Urnen auf den Netzkanälen ihr Übriges tun, um Jarret einen noch größeren Vorteil zu verschaffen.
Für Jarrets Anhänger sind Alkohol und Drogen buchstäblich Teufelszeug. Gut möglich, dass einige seiner fanatischeren Anhänger hinter der Gang mit den Kutten und Kreuzen stecken, die Dovetree zerstört haben.
Und wir sind Earthseed. Wir sind »dieser eine Kult da«, »die Spinner in den Bergen«, »diese Verrückten, die zu ihrem Veränderungsgott beten.« Laut einiger Gerüchte, die mir ebenfalls zu Ohren gekommen sind, sind wir auch »diese satanistischen Heiden aus den Bergen, die Kinder bei sich aufnehmen. Und was, glaubst du, machen sie wohl mit denen?« Dass der Menschenhandel mit verkauften oder verwaisten Kindern im ganzen Land floriert, und das auch jeder weiß, scheint keine Rolle zu spielen. Völlig egal. Allein die Andeutung, ein merkwürdiger Kult könne Kinder »aus unlauteren Motiven« aufnehmen, reicht bei manchen Menschen aus, um ihren Verstand aussetzen zu lassen.
Genau diese Art Gerücht könnte unserem Ansehen sogar bei Leuten schaden, die keine Jarret-Anhänger sind. Es ist mir nur wenige Male zu Ohren gekommen, trotzdem ist es beängstigend.
Jetzt gerade hoffe ich einfach nur, dass die Leute, die Dovetree angegriffen haben, irgendeine neue Gruppierung sind, organisiert und Furcht einflößend, aber aufs Plündern aus. Ich hoffe es wirklich.
Aber ich glaube es nicht. Eigentlich bin ich mir sicher, dass Jarret-Anhänger ihre Finger im Spiel hatten. Und ich denke, das sollte ich heute bei unserer Versammlung auch sagen. Jetzt sind alle noch erschüttert wegen Dovetree, also wird es einfacher sein, sie zum Handeln zu bewegen: Wir sollten den Ernstfall häufiger proben und weitere Geheimverstecke mit Geld, Lebensmitteln, Waffen, wichtigen Unterlagen und Wertgegenständen anlegen. Mit einer Gang werden wir fertig. Die haben wir schon mit weit weniger in die Flucht geschlagen, als wir jetzt im Ärmel haben. Aber gegen Jarret haben wir keine Chance. Ganz besonders nicht gegen Präsident Jarret. Sollte dieses Land wirklich verrückt genug sein, Präsident Jarret aus ihm zu machen, könnte er uns auslöschen, ohne überhaupt zu wissen, ob wir tatsächlich existieren.
Wir haben jetzt neunundfünfzig Mitglieder – vierundsechzig, falls die Dovetree-Frauen und -Kinder bleiben möchten. Bei diesen Zahlen kann man uns nur allzu leicht auslöschen. Ein Grund mehr, nehme ich an, für meinen Traum.
Mein »Talent«, um auf die Parabel der Talente zurückzukommen, ist Earthseed. Und auch wenn ich es nicht im Erdboden vergraben habe, habe ich es hier in den Bergen versteckt, damit es in etwa so schnell wachsen kann wie unsere Küstenmammutbäume. Was hätte ich sonst tun sollen? Wäre ich im Rattenfangen ähnlich begabt wie Jarret, könnte Earthseed als Bewegung mittlerweile groß genug sein, um tatsächlich als Zielscheibe herzuhalten. Wäre das so viel besser?
Vielleicht zerbreche ich mir viel zu sehr den Kopf. Ich hoffe es. Der Horror bei den Dovetrees und meine Hoffnungen für meine eigenen Leute reiben meine Nerven auf und machen mich ratlos. Und vielleicht – vielleicht – geht meine Fantasie mit mir durch.
2
Chaos
Ist Gottes gefährlichstes Gesicht –
Formlos, grollend, hungrig.
Forme das Chaos –
Forme Gott.
Handle.
Ändere das Tempo
Oder die Richtung der Veränderung.
Ändere ihr Ausmaß.
Mische die Samen der Veränderung neu.
Wandle die Wirkung der Veränderung um.
Ergreife die Veränderung.
Nutze sie.
Passe dich an und wachse.
EARTHSEED:DIE BÜCHER DER LEBENDEN
Die ursprünglichen dreizehn Siedler von Acorn waren meine Mutter, das versteht sich ja von selbst, sowie Harry Baiter und Zahra Moss, die ebenfalls aus ihrer damaligen Nachbarschaft in Robledo hatten fliehen müssen. Dann waren da noch Travis, Natividad und Dominic Douglas, eine junge Familie und die ersten Highway-Konvertiten meiner Mutter. Sie trafen sich, als beide Gruppen in Kalifornien auf dem Weg durch Santa Barbara waren. Auf meine Mutter wirkten sie sympathisch, sie erkannte, dass sie Gefahren so gut wie schutzlos ausgeliefert waren – damals war Dominic erst wenige Monate alt – und brachte sie dazu, sich ihr, Harry und Zahra auf dem langen Trek nach Norden, in ein besseres Leben, anzuschließen.
Als Nächstes kamen Allison Gilchrist und ihre Schwester Jillian hinzu – Allie und Jill. Doch Jill wurde kurz darauf am Highway getötet. Etwa zur selben Zeit warf meine Mutter ein Auge auf meinen Vater und umgekehrt. Sie waren beide nicht schüchtern und ließen auf ihre Gefühle bereitwillig Taten folgen. Mein Vater schloss sich der wachsenden Gruppe an. Aus Justin Rohr wurde Justin Gilchrist, nachdem Bankole ihn heulend neben dem Leichnam seiner Mutter aufgegabelt hatte. Justin war damals etwa drei Jahre alt, und er und Allie fanden sich zu einer weiteren kleinen Familie zusammen. Als Letztes kamen zwei aus Ex-Sklaven bestehende Familien hinzu, die sich schließlich zu einer großen Teiler-Familie zusammenfügten. Es waren Grayson Mora und seine Tochter Doe sowie Emery Solis mit ihrer Tochter Tori.
Das war’s: vier Kinder, vier Männer und fünf Frauen.
Ihre Überlebenschancen waren gleich null. Dass sie es in der erbarmungslosen Welt der Syphilis trotzdem geschafft haben, könnte man gut und gerne als Wunder bezeichnen – auch wenn Earthseed den Glauben an Wunder natürlich nicht unbedingt gutheißt.
Dass die Gruppe praktisch im Niemandsland siedelte – weit weg von jeder Stadt oder asphaltierten Straße –, hielt vermutlich die meiste Brutalität der damaligen Zeit von ihr fern. Das Grundstück gehörte meinem Vater. Als die dort ankamen, gab es nur einen einzigen verlässlichen Brunnen, einen halb zerstörten Garten, einige Obst- und Nussbäume sowie einige Haine aus Eichen, Kiefern und Küstenmammutbäumen. Nachdem die Gruppenmitglieder ihr Geld zusammengelegt und damit Handkarren, Samen, kleine Zuchttiere, Werkzeuge und andere Lebensnotwendigkeiten besorgt hatten, waren sie beinahe autark. Earthseed verschwand zwischen den Hügeln und wuchs, sei es durch Geburten innerhalb der Gruppe oder aufgenommene Waisenkinder oder Not leidende Erwachsene, die konvertierten. Sie suchten verlassene Farmen und Siedlungen nach allem ab, was sich noch gebrauchen ließ, und betrieben Handel auf den umliegenden Märkten und mit ihren Nachbarn. Das wichtigste Gut, das innerhalb der Gruppe die Runde machte, war Wissen.
Jedes Mitglied von Earthseed lernte lesen und schreiben, die Mehrheit sprach sogar zwei Sprachen – Spanisch und Englisch, denn die waren am nützlichsten. Wer sich der Gruppe anschloss, gleich, ob Kind oder Erwachsener, musste umgehend mit diesen Basics beginnen und ein Fachgebiet wählen. Wer sein Fachgebiet beherrschte, brachte es sogleich dem Nächsten bei. Darauf bestand meine Mutter, und vernünftig war es allemal. In einer Zeit, da Zehnjährige zu Kinderarbeit gezwungen werden konnten, waren öffentliche Schulen selten geworden. Bildung war nicht mehr umsonst, aber trotzdem gesetzlich vorgeschrieben. Nur kümmerte sich niemand mehr darum, die Gesetze durchzusetzen, genau wie sich niemand um den Schutz arbeitender Kinder kümmerte.
Die wichtigsten Fähigkeiten innerhalb der Gruppe besaß mein Vater. Als er meine Mutter heiratete, praktizierte er bereits seit dreißig Jahren als Arzt. An ihrem neuen Wohnort war er in mehrfacher Hinsicht eine Kuriosität: Er war gut ausgebildet, besaß Berufserfahrung und war Schwarz. Schwarze fand man in dieser Gegend kaum. Die Menschen begegneten ihm mit Argwohn. Was trieb er hier? Warum ging er nicht in eine etablierte Kleinstadt und verdiente dort mehr Geld? Hier gab es unzählige kleine Städte ohne praktizierenden Arzt. War er kompetent? War er ehrlich? War er sauber? Konnte man ihm Frauen und Töchter anvertrauen? Mein Vater schrieb diesbezüglich keine einzige Zeile auf, nur meine Mutter hielt alles fest.
Irgendwo schreibt sie: »Bankole bekam auf den diversen Märkten und bei gelegentlichen Treffen mit Nachbarn dieselben Gerüchte zu hören wie ich, zuckte aber nur die Achseln. Er hatte genug damit zu tun, sich um unsere Gesundheit und gelegentliche Arbeitsunfälle zu kümmern. Die anderen hatten ihre Erste-Hilfe-Koffer, ihr Satellitentelefon und, mit etwas Glück, ein Auto oder einen Truck. Häufig waren diese fahrbaren Untersätze alt und unzuverlässig, aber bei manchen Menschen taugten sie noch was. Ob sie Bankole riefen oder nicht, war ihnen überlassen.
Schließlich verbesserte das Pech des einen das Geschick des anderen: Jean Hollys Blinddarm entzündete sich, beinahe hätte sie einen Durchbruch erlitten. Die Hollys, unsere östlichen Nachbarn, hielten es für ratsam, Bankole eine Chance zu geben.
Nachdem Bankole der Frau das Leben gerettet hatte, nahm er sich ihre Familie zur Brust. Er sagte ihnen klipp und klar, was er davon hielt, dass sie so lange gewartet hatten, ihn zu rufen, bis eine Mutter von fünf kleinen Kindern beinahe gestorben wäre. Höflich und ruhig redete er auf sie ein, bis sie sich auf ihren Stühlen wanden. Die Hollys lernten ihre Lektion – er wurde zu ihrem Hausarzt.
Die Hollys empfahlen ihn schließlich bei ihren Freunden, den Sullivans, weiter, und die wiederum empfahlen ihn ihrer Tochter, die bei den Gamas eingeheiratet hatte, und die Gamas empfahlen ihn den Dovetrees, weil die alte Mrs. Dovetree eine geborene Gama war. So lernten wir unsere nächsten Nachbarn, die Dovetrees, kennen.«
Apropos Kennenlernen. Mehr denn je wünschte ich, ich hätte meinen Vater kennenlernen können. Er scheint eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen zu sein. Und vielleicht hätte es mir auch gutgetan, die damalige Version meiner Mutter kennenzulernen: So jung, so bemüht, konzentriert, und überaus menschlich. Vielleicht hätte ich diese beiden Menschen gemocht.
Aus den Tagebüchern von Lauren Oya OlaminaMontag, 27. September 2032
Ich weiß nicht genau, wie ich den heutigen Tag in Worte fassen soll. Eigentlich hatten wir nach der ungemütlichen gestrigen Versammlung und der entschlossenen Jubiläumsfeier einen ruhigen Tag geplant, an dem wir die Gegend nach Wildpflanzen und anderen nützlichen Dingen absuchen wollten. Offenbar glauben einige wenige Mitglieder, Jarret wäre genau das, was dieses Land gerade braucht – nur seinen religiösen Bullshit könne er sich schenken. Die Sache ist, dass man Jarret nicht ohne seinen religiösen Bullshit bekommt, das ist ein Doppelpack, und vielleicht versteckt sich darin noch viel Schlimmeres. Jarrets Anhänger sind hellauf begeistert von seinen großen Reden à la »Make America Great Again«. Er scheint sich mit diversen anderen Ländern anlegen zu wollen. Alles könnte auf einen Krieg hinauslaufen. Es gibt nichts Besseres als einen Krieg, um die Leute um Flagge, Vaterland und ihren großen Anführer zu scharen.
Und dennoch: Gerade die Peraltas und die Faircloths scheinen uns in absehbarer Zeit verlassen zu wollen.
»Von meinen Kindern sind vier noch am Leben«, sagte Ramiro Peralta gestern bei der Versammlung. »Wenn jemand wie Jarret an die Macht kommt, der hart durchgreift, haben sie vielleicht eine Chance, zu überleben.«
Er ist ein guter Mann, unser Ramiro, aber seine Suche nach Lösungen, nach Ordnung und Stabilität gestaltet sich zunehmend verzweifelt. Ich habe Verständnis dafür. Früher hatte er sieben Kinder und eine Frau. Seine Frau und drei ihrer Kinder sind in einem Feuer ums Leben gekommen. Während einer schrecklichen Choleraepidemie in Los Angeles hatte ein wütender, verängstigter, ungebildeter Mob beschlossen, der Epidemie ein Ende zu setzen, indem das Viertel in Brand gesteckt wurde, in dem die Krankheit angeblich ausgebrochen war. Diese Begebenheit behielt ich bei meiner Reaktion im Hinterkopf. »Eins solltest du bedenken, Ramiro«, sagte ich. »Jarret hat keine Antworten! Davon, dass Menschen gelyncht, Kirchen angezündet und Kriege übers Knie gebrochen werden, bleiben deine Kinder auch nicht am Leben, oder?«
Ramiro Peralta wandte sich nur wütend von mir ab. Er und Alan Faircloth warfen sich quer durch unseren Versammlungssaal, der auch als Klassenzimmer fungiert, einen Blick zu. Beide haben Angst. Sie sehen ihre Kinder an – Alan hat auch vier – und haben Angst, und dann schämen sie sich ihrer Angst, ihrer Machtlosigkeit. Und sie sind müde. Es gibt Millionen wie sie – Menschen, die einfach nur verängstigt und müde sind und das ganze Chaos satthaben. Sie wollen, dass irgendwer irgendwas unternimmt. Die Dinge ins Lot bringt. Jetzt!
Unsere Versammlung war jedenfalls stürmisch und unsere Jubiläumsfeier von Unbehagen geprägt. Interessant, dass die beiden Männer sich vor Edward Jay Smiths angeblicher Inkompetenz mehr fürchten als vor Jarrets himmelschreiender Tyrannei.
Ich war an diesem Morgen also mehr als bereit für einen Tag, an dem ich mit Freunden umherstreifen, nachdenken und Stecklinge sammeln konnte. Wir verlassen Acorn noch immer ausschließlich in Dreier- oder Vierergruppen, da in den Bergen sowohl auf als auch abseits der Straßen Gefahren lauern können. Seit über fünf Monaten haben wir auf unseren Erkundungsgängen keine Probleme mehr gehabt, was traurigerweise eine ganz eigene Gefahrenquelle bedeuten kann: Überfälle und Gangs sind gefährlich, weil sie nicht selten den Tod bringen. Ruheperioden sind gefährlich, weil man dadurch träge und unachtsam wird – wofür man früher oder später auch mit dem Leben bezahlt.
Um ehrlich zu sein, waren wir trotz des Dovetree-Überfalls unvorsichtiger als sonst, da wir unseren Zielort gut kannten: ein ausgebranntes, verlassenes Farmhaus weit weg von den Dovetrees, wo wir einige nützliche Pflanzen entdeckt hatten. Im Speziellen gab es Aloe Vera, gut geeignet, um Verbrennungen und Insektenstiche zu verarzten, und riesige Agaven. Es handelte sich um eine herrliche, mehrfarbige Agavenart, blaugrüne Blätter mit gelbweißem Rand. Sie musste dort, wo sich ehemals der Vorgarten des Hauses befunden hatte, schon seit Jahren immer größer geworden sein und sich fleißig fortgepflanzt haben, eine der größeren, hartnäckigen Agavensorten. Jede Pflanze sah für sich genommen aus wie ein Schopf aus steifen, faserigen, fleischigen Blättern, bei den älteren Exemplaren waren sie teils über einen Meter lang. Jedes einzelne Blatt besaß nicht nur eine lange, harte, messerscharfe Spitze, sondern auch noch einen gezackten Dornenrand, der gut und gerne durch menschliches Fleisch säbeln konnte. Genau das war der Grund, weshalb wir es auf die Pflanzen abgesehen hatten.
Bei unserem ersten Besuch hatten wir einige der jüngeren Pflanzen mitgenommen, die kleinsten Ableger. Nun wollten wir so viele größere Exemplare ausgraben, wie in unseren Handkarren passten. Er war schon mehr als zur Hälfte mit Dingen beladen, die wir wenige Meilen von den Agaven entfernt im morschen Schuppen einer eingestürzten Holzhütte gefunden hatten. Wir hatten verstaubte Töpfe, Pfannen und Eimer gefunden, alte Bücher und Zeitschriften, verrostetes Werkzeug, Nägel, Ketten und Stacheldraht. Alles war vom Zahn der Zeit und der Feuchtigkeit angegriffen, doch das meiste konnten wir säubern und reparieren oder zumindest in nützliche Einzelteile zerlegen oder nachbauen. Aus jedem unserer Arbeitsschritte lernen wir etwas. Wir sind sehr gut darin geworden, Handwerkszeuge herzustellen oder zu reparieren. Wir haben bis jetzt überlebt, weil wir ständig dazulernen. Wer bei uns kauft, weiß genau, dass er bei uns nicht übers Ohr gehauen wird.
Auch verlassene Gärten und Felder zu durchforsten, lohnt sich. Wir sammeln jedes Kraut, Gemüse und Obst, jede nusstragende Pflanze, überhaupt sämtliche Pflanzen, von denen wir wissen oder annehmen, sie könnten nützlich sein. Stachelige Wüstenpflanzen, die keinerlei Pflege bedürfen und mit dem hiesigen Klima klarkommen, können wir immer gebrauchen. Dank ihnen wächst unsere Dornenhecke.
Kaktus für Kaktus, Dornenbusch für Dornenbusch haben wir Acorn in den Hügeln mit einer natürlichen Stachelmauer umgeben. Fest entschlossene Eindringlinge wird sie natürlich nicht abhalten. Das vermag keine Mauer. Autos und Trucks können hindurchbrettern, wenn ihre Fahrer Schäden in Kauf nehmen, aber hier in den Bergen gibt es kaum noch Fahrzeuge, die was taugen, und wenn, dann sind sie zu schade für eine Kollision. Außerdem sind die meisten Kraftstoffe teuer.
Auch Eindringlinge ohne Fahrzeug könnten sich durch die Hecke schlagen, wenn der Spaß es ihnen wert ist. Aber das Unterfangen würde sie Zeit und Nerven kosten. Es würde sie wütend machen, sie könnten sich durch den Lärm verraten, den sie verursachen. Wenn die Hecke erst einmal dicht genug ist, wird sie Besucher dazu bringen, sich Acorn über die einfachsten Routen zu nähern, und die werden vierundzwanzig Stunden am Tag bewacht.
Und auf Besucher sollte man immer ein Auge haben.
Also werden wir Agaven ernten.
Wir näherten uns der Farmhausruine. Sie stand auf einem kleinen Hügel mit Blick über die Felder und Gärten. Es sollte unser letzter Halt sein, bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten. Beinahe wäre es der letzte Halt unseres Lebens geworden.
Nahe der Ruine stand ein altes graues Offroad-Mobil. Zunächst hatten wir es gar nicht gesehen. Es wurde von dem größeren zweier Kaminschlote verdeckt, die wie Kopf- und Fußsteine aus der Ruine ragten, als läge hier das abgebrannte Haus begraben. Ich erwähnte meinen Eindruck Jorge Cho gegenüber. Jorge war zwar noch jung, begleitete uns aber auf der Tour, da er ein gutes Auge für nützliche Dinge besaß, die andere als Schrott abgetan hätten.
»Was sind Kopf- und Fußsteine?«, fragte er mich. Hatte er noch nie von gehört. Er ist achtzehn und genau wie ich dem Großraum Los Angeles entflohen, nur hätte unsere Jugend nicht unterschiedlicher verlaufen können. Während sich meine gebildeten Eltern um mich kümmerten und mich unterrichteten, war er auf sich allein gestellt gewesen. Er spricht Spanisch und bruchstückhaftes Koreanisch, aber kein Englisch. Er war sieben, als seine Mutter an der Grippe starb, und zwölf, als ein Erdbeben seinen Vater das Leben kostete. Das alte Backsteinhaus, in dem die Familie unerlaubterweise lebte, brach zusammen. Mit nur zwölf Jahren war Jorge plötzlich für seine beiden jüngeren Geschwister verantwortlich, ein Mädchen und einen Jungen. Irgendwie schaffte er es, sie durchzubringen und Spanisch zu lernen, Lesen und Schreiben. Gelegentlich half ihm ein freundlicher alter Säufer dabei. Er arbeitete hart, nahm gefährliche, häufig illegale Jobs an. Er sammelte Sperrmüll, und wenn gar nichts mehr half, klaute er. Er hielt sich und seine beiden Geschwister am Leben, drei koreanischstämmige Kids in einem Elendsviertel, in dem hauptsächlich mexikanische und mittelamerikanische Illegale wohnten. Für Allgemeinwissen war keine Zeit geblieben. Wir bringen den Chos jetzt bei, wie man Englisch liest und schreibt und spricht, denn so werden sie mit mehr Menschen kommunizieren können. Außerdem lernen sie von uns Geschichte, Landwirtschaft, Schreinerei und andere Dinge – zum Beispiel, was Fuß- und Kopfsteine sind.
Neben Jorge gehörten noch Natividad Douglas und Michael Kardos zu unserer Sammler-Crew. Jorge und ich sind Teiler, Natividad und Michael nicht. Es ist zu gefährlich, ein Team zusammenzustellen, das überwiegend aus Teilern besteht. Wir sind zu verwundbar. Egal, wer verletzt wird, wir leiden mit. Aber fifty-fifty ist in Ordnung, und wir vier konnten gut zusammenarbeiten. Eigentlich ist es gar nicht unsere Art, gleich im Viererpack nachlässig zu werden, aber heute brachten wir es irgendwie zustande.
Kamin und Schornstein, die das Offroad-Mobil zunächst verdeckten, hatten vormals die Rückwand eines großen Wohnzimmers gebildet. In dem Kamin hätte man eine ganze Kuh grillen können. Die Struktur war jedenfalls gerade groß genug, um einen mittelgroßen Offroader zu verbergen.
Wir sahen ihn in dem Moment, als er das Feuer auf uns eröffnete.
Wir waren natürlich bewaffnet, trugen Schnellfeuergewehre und unsere Faustfeuerwaffen bei uns, aber das war nichts gegen die Panzerung und Schlagkraft eines halbwegs vernünftig ausgestatteten Offroaders.
Wir warfen uns auf den Boden, während die Einschläge des Kugelhagels um uns herum Dreck und Gestein in die Luft sprengten. Rückwärts krochen wir den Hügel hinunter, auf dem das Haus stand. Die Hügelkuppe war unser einziger Schutz. Uns blieb nichts anderes übrig, als ganz unten liegen zu bleiben und zu versuchen, unsere Körper aus der Schusslinie herauszuhalten. Uns aufzusetzen oder gar aufzustehen wagten wir nicht. Es gab kein Entkommen. Vor uns prasselten Patronen auf den Boden ein, dann hinter uns, überall, wo der Neigungswinkel es zuließ.
In unmittelbarer Nähe standen keine Bäume – zwischen uns und dem Offroader wuchs noch nicht einmal ein Busch. Wir befanden uns in einem ehemaligen Wüstengarten, in dem Teil, der am spärlichsten bepflanzt war. Unsere Agaven hatten wir noch nicht erreicht – und kämen auch nicht mehr hin. Als Deckung hätten sie ohnehin nicht ausgereicht. Einziger Schutz für ein paar von uns wäre vielleicht eine junge, nicht gerade kugelsichere Washingtonpalme gewesen, an der wir auf dem Weg hierher vorbeigekommen waren. Sie hatte ihre grünen Wedel in alle Richtungen ausgestreckt und war nicht hoch gewesen, eher wie ein dichter Busch, doch sie befand sich auf der Nordseite des Hauses, während wir an der Südseite festsaßen. Auch der Offroader parkte auf der Südseite. Die Palme würde uns nicht helfen. Und alles, was um uns herum wuchs, waren ein paar Aloe-Vera-Pflanzen und Grasbüschel, eine Kaktusfeige, eine winzige Yucca-Palme und etwas Unkraut.
All das bot uns keinen Schutz. Hätten die Leute in dem Offroader ihr Equipment ausgereizt, hätte uns selbst die Kuppe des Hügels nicht retten können. Wir wären längst tot. Ich fragte mich, wie um alle Welt sie uns bei unserer Ankunft verfehlt hatten. Wollten sie uns nur verjagen? Ich glaubte es nicht. Dafür hielt der Kugelhagel zu lange an.
Endlich stellten sie das Feuer ein.
Reglos lagen wir da, stellten uns tot, horchten auf das Dröhnen eines Motors, auf Schritte, Stimmen, irgendein Geräusch, das darauf hindeutete, dass sie Jagd auf uns machten – oder unsere Angreifer den Rückzug antraten. Doch wir hörten lediglich einen leise heulenden Windstoß und raschelnde Blätter. Ich lag da und konnte an nichts anderes denken als an die hohen Kiefern, die ich auf dem steilen Hügelrücken gleich hinter dem Haus gesehen hatte. Ich sah sie ganz deutlich vor meinem inneren Auge und konnte nicht widerstehen, ich hob den Kopf, um sie zu suchen und nachzusehen, ob sie in etwa so weit von uns entfernt waren, wie mir vorschwebte. Die vom Unkraut überwucherten, einstmaligen Felder umgaben die Farm und erhoben sich bis hinauf in die Hügel. Darüber thronten die Kiefern, hinter denen wir Deckung hätten suchen können, und Schutz, doch sie waren viel zu weit weg. Ich seufzte.
Dann hörten wir ein weinendes Kind.
Alle hörten es – einige kurze Schluchzer. Dann Stille. Es klang nach einem sehr kleinen Kind – kein Baby, aber ein erschöpftes, hilfloses, verlassenes Kleinkind.
Wir sahen einander an. Uns allen lagen Kinder am Herzen. Michael hat zwei, Natividad drei. Bankole und ich lassen seit einiger Zeit die Verhütung weg. Ich bin froh, dass Jorge noch keine unserer Frauen geschwängert hat, aber für seine jüngeren Geschwister war er sechs Jahre lang der Ziehvater. Er weiß so gut wie wir, was für Gefahren Kindern drohen, wenn sie niemand beschützt.
Ich hob den Kopf gerade eben hoch genug, um einen kurzen Blick auf den Offroader und seine Umgebung zu werfen. Einem gepanzerten, bewaffneten und verschlossenen Offroader konnte kein weinendes Kind entgehen. Das Weinen hatte ganz normal geklungen, nicht so, als wäre es durch die Lautsprecher des Fahrzeugs verzerrt oder verstärkt nach außen gedrungen.
Eine der Türen des Trucks musste also offen stehen. Sperrangelweit.
Durch die Gräser und das Unkraut sah ich nicht viel, traute mich jedoch nicht, den Kopf noch weiter nach oben zu recken. Ich sah nur den Schornstein im Sonnenlicht, daneben den Offroader, die Gräser auf den Feldern dahinter und …
Eine Bewegung?
Etwas bewegte sich weit weg in den Gräsern, und zwar auf uns zu.
Natividad zerrte mich zurück auf den Boden. »Was stimmt denn nicht mit dir?«, flüsterte sie auf Spanisch. Wegen Jorge war es die beste Wahl, solange wir in Schwierigkeiten steckten. »Da sitzen ein paar Verrückte in dem Offroader! Willst du sterben?«
»Da kommt was auf uns zu«, sagte ich. »Es sind mehrere. Durch die Felder.«
»Ist mir egal! Du bleibst unten!«
Natividad ist eine meiner besten Freundinnen, aber manchmal, wenn wir unterwegs sind, kommt es mir so vor, als hätte ich meine Mutter dabei.
»Vielleicht soll uns das Geheule anlocken«, sagte Michael. »Kindergeschrei wird häufig als Köder benutzt.« Ein argwöhnischer Mann, dieser Michael. Er traut niemandem. Er und seine Familie leben jetzt seit zwei Jahren bei uns, und ich glaube, es hat sechs Monate gedauert, bis er uns akzeptiert und eingesehen hat, dass wir seiner Frau und seinen Zwillingen nichts tun werden. Und das, obwohl wir sie aufgenommen und geholfen haben, als wir seine Frau in der verfallenen Hütte, in der sie hausten, gefunden haben, in den Wehen liegend, mutterseelenallein. Die Ruine lag nahe einem Fluss, Wasser hatten sie also, und auch ein paar alte Töpfe. Aber ihre einzigen Waffen waren eine Kleinkaliberpistole ohne Munition und ein Messer. Sie waren völlig ausgehungert, ernährten sich von Pinienkernen, Wildkräutern und dem gelegentlichen Nagetier, das Michael einfing oder mit einem Stein erschlug. Tatsächlich war er, als bei Noriko die Wehen einsetzten, gerade auf Nahrungssuche.
Michael willigte nur ein, sich uns anzuschließen, da er fürchtete, seine Frau und seine Babys könnten Hunger leiden, trotz seiner Gelegenheitsjobs, obwohl er bettelte und klaute und plünderte. Alles, was wir von ihnen verlangten, war, dass sie ihren Beitrag zu den anfallenden Arbeiten leisteten, um die Gemeinschaft am Laufen zu halten, und dass sie Earthseed respektierten und keine anderen Glaubensrichtungen predigten. Für Michael klang das altruistisch, und Altruisten traute er nicht über den Weg. Er rechnete jeden Tag damit, uns dabei zu erwischen, wie wir Menschen in die Sklaverei oder den Sexhandel verkauften. Erst als er verstanden hatte, dass wir wirklich nach dem lebten, was wir predigten, entspannte er sich nach und nach. Earthseed ist und bleibt der Schlüssel zu unserer Gemeinschaft. Michael hielt unseren Lebensstil für anständig und unsere Bestimmung für durchgeknallt, sah jedoch ein, dass wir seiner Familie nichts Böses wollten. Und seine Familie war der Schlüssel zu ihm. Als er sich erst einmal an uns gewöhnt hatte, richteten er und Noriko und die Mädchen sich bei uns ein und machten Acorn zu ihrem Zuhause. Es sind gute Menschen. Und Michaels Argwohn hat auch Vorteile. Dank ihm bleiben wir die meiste Zeit auf der Hut.
»Ich glaube nicht, dass das Weinen eine Falle ist«, sagte ich. »Hier stimmt was nicht. So viel steht fest. Die Leute da im Offroader sollten entweder zusehen, dass sie uns abknallen, oder umdrehen und abhauen.«
»Und wir sollten sie nicht hören«, sagte Jorge. »Egal, wie laut deren Kind schreit. Davon sollten wir nichts mitbekommen.«
Nun meldete sich Natividad zu Wort. »Wie konnten ihre Waffen uns verfehlen?«, sagte sie. »Die werden in so einem Offroader eigentlich per Computer gesteuert. Zielautomatik. Man schießt höchstens vorbei, wenn man die Waffen unbedingt manuell bedienen will. Vielleicht haben sie auch vergessen, ihre Verteidigungsanlage mit dem PC zu koppeln oder wollten uns nur einen Schrecken einjagen. Aber wenn man in so einem Ding sitzt und auf Ernst macht, verfehlt man sein Ziel nicht mehrfach.« Natividad wusste dank ihres Vaters mehr über Waffen als der Rest von Earthseed zusammen.
»Ich glaube nicht, dass sie absichtlich an uns vorbeigeschossen haben«, sagte ich. »Hat sich zumindest nicht so angefühlt.«
»Finde ich auch«, sagte Michael. »Was ist dann da drüben los?«
»Scheiße, was da drüben los ist?«, flüsterte Jorge. »Die Schweine knallen uns bei der geringsten Bewegung ab, das ist da los!«
Wieder erklangen Schüsse. Ich presste mich an den Boden und lag da, reglos, die Augen geschlossen. Diese Idioten im Offroader hatten vor, uns zu töten, völlig egal, ob wir uns bewegten oder nicht, und ihre Chancen auf Erfolg standen hervorragend.
Dann begriff ich plötzlich, dass sie diesmal nicht auf uns schossen.
Jemand schrie. Durch das stakkatoartige Gewehrfeuer des Offroaders hindurch hörte ich, wie sich jemand die Seele aus dem Leib schrie. Ich bewegte mich keinen Millimeter. Die einzige Möglichkeit, die Schmerzen eines anderen nicht zu teilen, war, nicht hinzusehen.