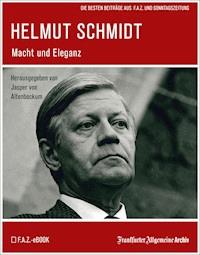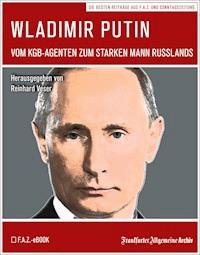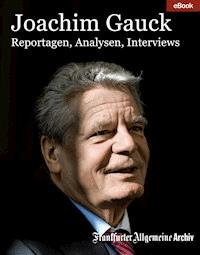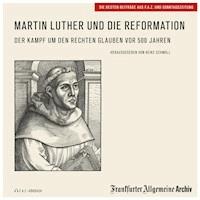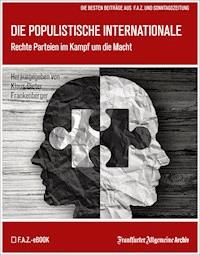
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit den Ausprägungen der europäischen "Populismen", ihrer Genese in den europäischen Staaten, den politischen Köpfen hinter den einzelnen Bewegungen und letztlich mit deren Konzepten und Erfolgsaussichten beschäftigt sich dieses F.A.Z.-eBook.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die populistische Internationale
Rechte Parteien im Kampf um die Macht
F.A.Z.-eBook 48
Frankfurter Allgemeine Archiv
Herausgeber: Klaus-Dieter FrankenbergerRedaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
Karikaturen: Greser & LenzInfografik: F.A.Z / Heumann / BrockerZuständiger Bildredakteur: Henner Flohr
Projektleitung: Olivera Kipcic
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb und Vermarktung: [email protected]© 2017 Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Titel-Grafik: © Fotolia.com / freshidea
ISBN: 978-3-89843-454-6
Vorwort
Der neue Populismus
Die Krise der politischen Eliten und Institutionen bedroht die politische Ordnung
Von Klaus-Dieter Frankenberger
In nahezu jedem Land des Westens regen sich mehr oder weniger starke populistische Kräfte. In einzelnen Fällen sind sie sogar so stark geworden, dass sie Präsidentenwahlen entschieden, wie in den Vereinigten Staaten, oder in Schicksalsfragen einer Nation den Ausschlag gegeben haben, wie in Großbritannien. Die kommende Präsidentenwahl in Frankreich wird schon jetzt von der bangen Sorge beherrscht, ob der Anführerin des mal rechtspopulistisch, mal rechtsextrem genannten Front Nation, Marine Le Pen, der Griff nach der Macht gelingen könne. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem sich die Unterzeichnung der Römischen Verträge zum sechzigsten Mal jährt, stünde dann für Europa, für Deutschland, wenn es denn so käme, vieles, vielleicht sogar alles auf dem Spiel. Der Politikwissenschaftler Peter Graf Kielmansegg spricht von der Hochkonjunktur eines aggressiven Populismus.
Diese Konjunktur hat mit der Glaubwürdigkeitskrise der politischen Elite und der politischen Institutionen zu tun. Man könnte fast ein Gesetz aufstellen: Je geringer das Vertrauen in die politischen Repräsentanten und die maßgeblichen Parteien, desto größer die Chance für populistische Gruppen, in die öffentliche Arena einzudringen – insbesondere dann, wenn es ein Thema gibt, das sich für populistische Mobilisierungsstrategien eignet. In Deutschland ist es das Flüchtlingsthema, in Großbritannien war es das durch Zuwanderung und Arbeitnehmerfreizügigkeit zusätzlich aufgeladene EU-Thema. Populistische Gruppen und Parteien nehmen für sich in Anspruch, für »das Volk« zu sprechen, dessen Interessen und Anliegen von den Herrschenden vermeintlich missachtet würden. Und wer für »das Volk« spricht, hat recht – siehe Donald Trump. In diesem Monopolanspruch kommt ein besorgniserregender Antiparlamentarismus und ein nicht weniger unguter Antipluralismus zum Ausdruck.
Was verbindet sie? Die Anführer einiger – gemeinhin als populistisch bezeichneter – europäischer Parteien bei einer gemeinsamen Veranstaltung in Koblenz im Januar 2017. F.A.Z.-Foto / Helmut Fricke.
Dennoch kann die politische Auseinandersetzung nicht darin bestehen, diesen Kräfte einfach »populistisch« zu nennen und sich davon eine stigmatisierende Wirkung zu versprechen. Erstens wird das keinen Erfolg haben und zweitens sind die Anliegen, die unter der Überschrift »Populismus« vorgebracht werden, nicht von vornherein – und eigentlich überhaupt nicht – illegitim. Nur führt in der komplizierten, komplexen Welt von heute die autoritäre Vereinfachung nicht zum Ziel. Aber »Brexit« und die Wahl Donald Trumps sind Alarmrufe, dass Globalisierung und supranationale Integration im Rahmen der EU auf einen Widerspruch stoßen, der seinen Ausdruck in Elitenverdruss findet und sich zu Revolten steigern kann, welche etablierte politische Ordnung kollabieren lassen. Der neue Populismus kann nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
I. Vom Wesen desPopulismus
Populismus ohne Grenzen
Im demokratischen Kontext weist eine erfolgreiche populistische Bewegung immer auf eine Schwäche des repräsentativen Systems hin. Was aber ist die Ursache des jüngsten Prozesses politischer Entfremdung?
Von Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg
Populismus – kein Wort unserer politischen Sprache hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine vergleichbare Karriere gemacht. Es ist in aller Munde. Man gebraucht es mit einer Selbstverständlichkeit, als sei jenseits allen Zweifels klar, worüber man rede und was man von der Sache zu halten habe. Die Politik hat das Wort zu einer Stigmatisierungswaffe gemacht. Es grenzt aus. Mit Populisten redet man nicht, und über ihre Themen redet man am besten möglichst wenig. Wenn man das Wort Populismus durch das Wort Rechtspopulismus ersetzt, wie es weithin geschieht, wird die Sache besonders einfach. Die eine Stigmatisierung bekräftigt die andere. Die Wissenschaft bemüht sich immerhin um einen beschreibenden Begriff. Aber es ist eine Bemühung, bei der oft eine starke Antipathie die Feder führt.
Ein unbefangener Beobachter würde wohl erstaunt darüber sein, dass Populismus im demokratischen Diskurs inzwischen eindeutig negativ konnotiert wird. Was ist Demokratie, könnte er fragen, anderes als institutionalisierter Populismus? Wie kann man für Demokratie und gegen Populismus sein, wenn man es denn ernst meint mit dem Wortsinn hier wie dort? Und er könnte auf die Gefahren hinweisen, die dem demokratischen Diskurs drohen, wenn ein Wort wie Populismus zur Waffe der Stigmatisierung wird. Das Etikett ersetzt das Argument. Man braucht sich auf eine Debatte nicht mehr einzulassen, man brandmarkt. Der Raum demokratischer Auseinandersetzung engt sich ein. Stigmatisierte Stimmen und stigmatisierte Themen haben draußen zu bleiben.
Der unbefangene Beobachter würde aber auch zur Kenntnis nehmen, dass gegenwärtig in vielen westlichen Demokratien problematische politische Bewegungen Zulauf haben, die populistisch zu nennen nicht unbegründet ist. Sie nehmen prononciert für sich in Anspruch, für »das Volk« zu sprechen. Dabei ziehen sie gegen den etablierten demokratischen Betrieb in einer Sprache zu Felde, die man durchaus demagogisch nennen darf. Spätestens seit dem Brexit-Votum und der Trump-Wahl sind die Besorgnisse, die sich mit dem Phänomen verknüpfen, groß.
Die Sache, so scheint es, ist mit raschen, einfachen Antworten nicht erledigt. Das Volk begegnet uns zweimal – als gutes Volk, das sich selbst regieren soll, und als bedenkliches Volk, dessen Ressentiments man nicht umwerben, anfachen, aufnehmen sollte, auch und gerade in der Demokratie nicht. Über diese Paradoxie unseres Redens vom Volk einfach hinwegzugehen ist unangebracht. Zwar mag die elementare Ambivalenz in der Beurteilung des Volkes als einer politischen Größe ihre guten Gründe haben, die im Gegenstand selbst liegen. Aber man muss die gedankliche Herausforderung, die darin besteht, dass wir die Herrschaft des Volkes gutheißen, eine bestimmte Art des Werbens um das Volk, der Orientierung am Volk, als Populismus etikettiert, aber verwerfen, jedenfalls wahrnehmen und sich ihr stellen. Lässt sich stimmig machen, was dem Beobachter, der nicht blind dem gängigen Sprachgebrauch verpflichtet ist, als unstimmig auffallen muss?
Die Wissenschaft hat es seit den neunziger Jahren an Bemühungen um analytische Klärung nicht fehlen lassen. Die einschlägige Literatur füllt inzwischen Regale. Bei aller Unterschiedlichkeit der Akzentuierungen lassen sich durchaus Konvergenzen des wissenschaftlichen Urteils erkennen. Gegen den politischen Sprachgebrauch, dem Populismus einfach ein Kampfbegriff ist, wird in der Wissenschaft häufig die Ambivalenz des Phänomens betont. Populistische Bewegungen, das ist der Kern fast jeden Definitionsversuchs, sehen sich als Repräsentanten des wahren, des einfachen Volkes; als Anwälte derer, die nicht gehört werden. Sie verleihen, so ihr Selbstverständnis, dem Volk eine Stimme gegen die Mächtigen, die Etablierten, die Regierenden.
Populisten, heißt das, haben vor allem ein klares Feindbild. Sie propagieren mit ihrem Feindbild nicht nur Politikerverachtung, sondern auch Politikverachtung, insofern sie die Komplexität des demokratischen politischen Prozesses negieren. Und die Komplexität der Probleme ebenso. Einfache Lösungen für Probleme, die alles andere als einfach sind, sind ein Markenzeichen des Populismus. Der Anspruch, für das Volk zu sprechen, ist zudem oft ein Alleinvertretungsanspruch: »Nur wir sprechen für das Volk.« Populismus, diese Sicht hat Jan-Werner Müller in seinem jüngst erschienenen Essay zum Thema stark gemacht, ist antipluralistisch.
Aber das ist für viele Analytiker des Populismus nur die eine Seite der Bilanz. Erfolgreiche populistische Bewegungen erinnern für sie immer auch daran, dass die dominanten Eliten bestimmte Gruppen der Bevölkerung vernachlässigen, bestimmte Themen ignorieren. Sie können als Warnsignal verstanden werden. Populismus wird aus dieser Sicht zu einem – nicht eben sympathischen, aber doch notwendigen – Mechanismus demokratischer Selbstkorrektur.
Wendet man das Argument noch mehr ins Positive, so lautet es: Demokratien geben ein Versprechen ab, das einzuhalten ihnen prinzipiell unmöglich ist. Populismus erinnert an dieses Versprechen, will dabei freilich die Menschen glauben machen, es sei ohne weiteres einlösbar, wenn man nur wolle. Von diesem Verständnis lässt sich leicht eine Brücke schlagen zu einem älteren amerikanischen Sprachgebrauch: Jene politischen Bewegungen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten explizit als Populisten auftraten, wurden durchaus als demokratiekonform wahrgenommen.
So oder so – konstitutiv für den Populismus ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht eine bestimmte politische Programmatik, nicht eine eigentümliche Organisationsform, nicht die Verankerung in einem besonderen Milieu. Konstitutiv für den Populismus ist ein Gestus, ebender Gestus des Aufbegehrens im Namen »des Volkes« gegen »die da oben« – ein Gestus, mit dem tendenziell ein exklusiver Repräsentationsanspruch erhoben wird.
Hat die Wissenschaft damit geleistet, was sie in dieser Sache zu leisten vermag? Man mag die Frage beantworten, wie man will – eines Begriffes, der in den sorgenvollen Selbstdiagnosen der westlichen Demokratien seit geraumer Zeit eine so zentrale, aber eben auch eine so problematische Rolle spielt wie der des Populismus, wird man sich immer wieder neu vergewissern müssen. Angesichts der Tendenz der politischen Sprache, ihn ausufernd und stigmatisierend zu gebrauchen, gilt es vor allem, die pathologische Dimension des Populismus möglichst präzise zu erfassen. Die Wissenschaft hat eine Verantwortung für das, was man die Hygiene der politischen Sprache nennen könnte.
Jeder Populismus-Begriff, jede Bewertung des Phänomens Populismus, jede kritische Bewertung zumal, setzt ausgesprochen oder stillschweigend eine bestimmte Vorstellung von Demokratie voraus. Demokratiekonzeptionen können eindimensional oder mehrdimensional sein. Eindimensional sind die Vorstellungen angelegt, die deduktiv aus einer einzigen normativen Prämisse entwickelt werden. Die normative Prämisse, die eindimensionalen Demokratiekonzeptionen zugrunde liegt, ist in der Regel die der Volkssouveränität. Demokratie ist Herrschaft des Volkes und sonst nichts. Mehrdimensionale, komplexe Konzeptionen beruhen auf einer Mehrzahl normativer Prämissen, die nicht im Verhältnis prästabilierter Harmonie zueinander stehen. Komplexe Demokratiekonzeptionen, so kann man es auch formulieren, institutionalisieren Differenz.
Die Verknüpfung des konstitutionellen Gedankens mit dem der Demokratie institutionalisiert Differenz, insofern sie der Idee der Volksherrschaft das Postulat ihrer Einhegung, ihrer Verrechtlichung gegenübergestellt. Das repräsentative Prinzip institutionalisiert Differenz, insofern es das eine Volk in Repräsentanten und Repräsentierte auseinandertreten lässt und im Wahlakt, aber auch im ständigen Dialog, wieder zusammenführt; das pluralistische Verständnis von Demokratie institutionalisiert Differenz, etwa in einem Parteiensystem, insofern es an die Stelle des einen, mit sich selbst einigen Volkes die Anerkennung der Vielheit und Vielheit der Gruppen, der Weltanschauungen und der Interessen setzt, in die das eine Volk sich gliedert.
Vor diesem gedanklichen Hintergrund lässt sich, sehr grundsätzlich und sehr abstrakt, eine erste Aussage zur Bestimmung des Populismus machen: Im Populismus begegnet uns das Aufbegehren eines eindimensionalen Demokratieverständnisses gegen eine komplexe demokratische Wirklichkeit.
Es liegt nahe, mit dem nächsten Schritt bei der repräsentativen Verfasstheit der Demokratie anzusetzen und das pathologische Moment im Populismus als eine spezifische Fehlentwicklung im repräsentativ-demokratischen Prozess zu deuten. Ausgangspunkt der Argumentation ist ein Modell rationaler politischer Kommunikation in der repräsentativ verfassten Demokratie. Die repräsentative Demokratie ist mit der für sie grundlegenden Arbeitsteilung zwischen Amtsträgern und Bürgern eine Demokratie des Dialogs. Kommunikation zwischen den Bürgern und ihren politischen Repräsentanten, wie immer medial vermittelt, ist ihr Lebenselixier. Dabei hängt alles daran, dass in dieser Kommunikation Mindeststandards der Rationalität gewahrt bleiben.
Das heißt: Der kommunikative Prozess der repräsentativen Demokratie muss darauf angelegt sein, mit vernünftigen Gründen zu überzeugen. Dazu gehören zuerst der Respekt vor den Fakten und der Respekt vor dem Gegenüber. Es gehören dazu die Bereitschaft, zuzuhören und Argumente zu wägen. Es gehört dazu ein Mindestmaß an Distanz zu den eigenen Positionen im Meinungsstreit. Aus ihr resultiert die Fähigkeit, im Dialog zu lernen.
Natürlich entspricht die politische Wirklichkeit nicht diesem Modell idealer Kommunikation. Der Wettbewerb um Macht wird mit harten Bandagen ausgetragen. Auch ist – das ist eine anthropologische Konstante – Offenheit für das Argument selbst im besten Fall nur näherungsweise gegeben. Dass Menschen zur Vermeidung kognitiver Dissonanz neigen, das heißt, Fakten und Argumente zu neutralisieren versuchen, die ihre Wahrnehmung der Welt und ihre Überzeugungen in Frage stellen könnten, gehört zu den wichtigsten Einsichten der Psychologie. Dennoch ist es ein grundlegender Unterschied, ob sich ein Kommunikationsprozess grundsätzlich am Ideal so verstandener Rationalität orientiert oder nicht. Das gilt auch für jenen Dialog, der für die repräsentativ verfasste Demokratie konstitutiv ist und der uns deswegen hier interessiert.
Von diesem Modell her lässt sich nun Populismus als eine Strategie politischer Mobilisierung verstehen, die den repräsentativ-demokratischen Dialog in einer bestimmten Weise pervertiert, ihn in sein Gegenteil verkehrt. Der Populist tritt nicht in ein Gespräch mit dem Bürger ein, er erklärt sich zum Sprecher des Volkes. Sprecher des Volkes kann nur sein, wer sich mit ihm eins weiß. Es geht um Konsonanz, nicht um Dialog. Und Konsonanz stellt sich her als wechselseitige Bestärkung der Vor-Urteile – jenes Meinens also, das gegen jedes Argument abgeschirmt ist. Kurz gefasst: Politische Mobilisierung unter Ausschaltung des Verstandes ist das Programm der populistischen Strategie. Die oft beobachteten Eigentümlichkeiten populistischer Agitation – die Schwarzweißkontraste, die Feindbilder, die extremen Vereinfachungen – lassen sich einem solchen Programm ohne weiteres zuordnen.
Populistisch darf man diese Mobilisierungsstrategie nicht nur deshalb nennen, weil sie vorgibt, für »das Volk« – ein Singular – gegen »die Mächtigen« – der Sache nach auch ein Singular – zu sprechen. Populistisch darf man sie auch deshalb nennen, weil sie immer den Teil für das Ganze erklärt. Denen, auf die sie zielt, wird gesagt: »Ihr seid das Volk!«, mag es sich auch noch so offensichtlich nur um einen Teil eines vielgestaltigen Ganzen handeln. Die Botschaft »Ihr seid das Volk« schließt die Botschaft ein: »Ihr habt recht! Und weil ihr recht habt, braucht ihr nicht zuzuhören! Ihr dürft die politische Klasse verachten.«
Je präziser und schärfer die populistische Mobilisierungsstrategie als eine Pervertierung des Kommunikationsideals beschrieben wird, auf das sich die repräsentativ verfasste Demokratie gründet, desto größer wird freilich die Gefahr, zu übersehen, dass es auch so etwas wie einen alltäglichen Populismus gibt. Von ihm gehen auf die Dauer vermutlich die größeren Gefahren für die Demokratie aus. Die populistische Versuchung ist allgegenwärtig in der Demokratie. Jeder Politiker, der den Populismus anprangert, sitzt im Glashaus. Denn der Wettbewerb um Wählerstimmen erzeugt notwendig die Tendenz, dem Wähler – und auch sich selbst, gutgläubig tut sich der Populist natürlich leichter – die Komplexität der Wirklichkeit zu ersparen; es ihm bequem zu machen; sich nicht an seine Urteilskraft zu wenden, sondern seine – oft nicht zu Ende gedachten – Interessen zu bedienen. Das geschieht durch Handeln wie durch Unterlassen. Und solches Handeln und Unterlassen ist, um es noch einmal zu sagen, demokratischer Alltag – das wird in der Fixierung auf den radikalen Populismus leicht vergessen.
Die Beispiele sind Legion, mit Variationen von Land zu Land. Um einige wenige deutsche Aktualitäten zu benennen: die Weigerung in den Koalitionsvereinbarungen der amtierenden großen Koalition, sich in der Rentenpolitik den demographischen Realitäten ernsthaft zu stellen; das immer neue Ausweichen derer, die den Bruch mit der Atomenergie durchgesetzt haben, vor der Notwendigkeit, ein Lager für den atomaren Restmüll zu finden; die Verheißung einer Automaut, die nur Ausländer trifft, so als gebe es die EU nicht; die Wohlfahrtsstaatsphantasien der Linken, die der Frage den Rücken kehren, welche Wirtschaftsordnung die zu verteilenden Reichtümer erwirtschaften kann. Und fast überall, wo demokratisch regiert wird, die Flucht in die Staatsschulden. Stets wird um des Machterhalts oder Machterwerbs willen dem Wähler eine unangenehme Wahrheit erspart, in der Regel auf Kosten der Zukunft. Auch das ist eine Art der Verweigerung des für die repräsentativ verfasste Demokratie konstitutiven vernünftigen Dialogs zwischen Repräsentanten und Repräsentierten, ein gleichsam sanfter, unauffälliger Populismus. Dieser Populismus tritt nicht als Mobilisierungsstrategie auf, die Vor-Urteile anfacht, sondern als Praxis des Beschweigens störender Wirklichkeiten. So oder so ist es die Suche nach einer Art des Einklangs mit dem Wähler, dem »Volk«, die ihm die unangenehme Konfrontation mit der Realität erspart. Jenes Gespräch, ohne das in der repräsentativ verfassten Demokratie nicht verantwortlich regiert werden kann, wird nicht geführt.
Mit dem alltäglichen Populismus und seinen Unwahrhaftigkeiten müssen Demokratien leben. Sie können mit ihm freilich nur leben, wenn er den demokratischen Wettbewerb nicht durch und durch korrumpiert – das würde die Systemfrage aufwerfen. Er muss, heißt das, in seiner Fragwürdigkeit ständig Gegenstand öffentlicher Beobachtung und öffentlicher Kritik bleiben. Die, die immer nur vom Populismus der anderen reden, müssen daran erinnert werden, dass sie im Glashaus sitzen und mit Steinen um sich werfen.
Populismus als eine Strategie politischer Mobilisierung, die das Ideal des argumentierenden Dialogs zwischen Repräsentanten und Repräsentierten radikal negiert, ist hingegen kein Alltagsphänomen. Warum populistische Bewegungen dieser Art derzeit Hochkonjunktur haben, bedarf der Erklärung. Hat diese Hochkonjunktur damit zu tun, dass die Komplexität der modernen Welt und der Probleme, die sie der Politik aufgibt, immer weniger vermittelbar wird? Immer weniger vermittelbar auch deshalb, weil das Internet, in einem triumphalen globalen Siegeszug zu dem Kommunikationsmedium schlechthin geworden, ein anarchisches Medium ist, in dem selbst elementare Rationalitätsstandards des politischen Dialogs nicht mehr aufrechtzuerhalten sind? Lässt sich die Hochkonjunktur des aggressiven Populismus darauf zurückführen, dass die politischen Eliten ihre Glaubwürdigkeit – wodurch? – zu sehr beschädigt haben? Wird sie getragen von einem Aufstand derer, die sich als von den neuen Verteilungsmustern der globalen Ökonomie unerträglich benachteiligt wahrnehmen?
Wie immer die Antwort auf solche Fragen ausfällt, eine populistische Konjunktur setzt offenbar eine Konstellation voraus, in der drei Faktoren aufeinandertreffen: Es bedarf einer Thematik, die sich für die populistische Mobilisierungsstrategie eignet. Es bedarf politischer Unternehmer, die auf die populistische Mobilisierungsstrategie setzen. Und es bedarf einer Wählerschaft, die, in Teilen jedenfalls, auf eine solche Strategie reagiert, einer Wählerschaft, die populistisch »disponiert« ist. Populistisch disponiert sind Wähler, die davon überzeugt sind, dass die Politik ihre Anliegen ignoriere, anhaltend und ganz und gar; die sich durch niemanden mehr im politischen Prozess repräsentiert sehen. In vielen westlichen Demokratien hat sich diese Konstellation offenkundig im vergangenen Jahrzehnt herausgebildet.
Häufig spielt einer der drei Faktoren eine Schlüsselrolle. Er setzt als Katalysator einen Prozess in Gang, der die beiden anderen Faktoren aktiviert. Donald Trump dürfte ein Beispiel dafür sein, dass der politische Unternehmer den entscheidenden Part spielt. Im Fall des Brexit, wenn man die Brexit-Bewegung denn als populistisch einstufen will, dürfte der Thematik Schlüsselbedeutung zukommen; ähnlich in Deutschland, wo das Flüchtlingsthema die AfD stark gemacht hat. Bei der 5-Sterne-Bewegung in Italien bietet sich die Vermutung an, dass eine weitverbreitete, in der allgemeinen Verachtung der politischen Klasse wurzelnde populistische Disposition sich gleichsam von selbst entzündet hat.
So oder so, fast immer weist eine erfolgreiche populistische Bewegung – jedenfalls im demokratischen Kontext – auf eine Schwäche des repräsentativen Systems hin, sei es, dass eine politische Klasse insgesamt ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, sei es, dass die etablierten Parteien gemeinsam ein bestimmtes Thema hartnäckig tabuisieren oder dass sie gemeinsam politisch relevanten Einspruch gegen ihre Politik hartnäckig ignorieren. Die Rede ist von Prozessen politischer Entfremdung.
Die Frage bleibt: Warum gerade jetzt? Es gibt ein Mobilisierungsthema, dem offensichtlich eine Schlüsselbedeutung für die gegenwärtige Populismus-Konjunktur zukommt, wohin wir auch blicken. Es ist das Thema Entgrenzung. Wir leben, das zeigt sich vielfältig, in einer Epoche rapide fortschreitender Entgrenzung. Grenzen – in mehr als einem Sinn – verlieren immer mehr ihre Bedeutung. Und damit, so nehmen viele Menschen es wahr, ihre bergende, sichernde Funktion. Die Unruhe, die diese Wahrnehmung auslöst, durchschneidet die vertrauten politischen Fronten auf eigentümliche Weise. Die Linke steht gegen den Freihandel auf. Sie sieht ihn als Bedrohung des sozialen und des ökologischen Fortschritts, der in den begrenzten Räumen europäischer Nationalstaaten, allenfalls der Europäischen Union, erkämpft worden ist und verteidigt werden muss. Schützende Grenzen werden gebraucht, um die europäischen Errungenschaften zu erhalten. Die Völkerwanderungen des 21. Jahrhunderts sind eher ein »rechtes« Thema. Auch hier geht es um die bergende und sichernde Funktion der Grenze, gerichtet freilich gegen die Millionen Menschen auf globaler Wanderschaft, Flucht oder der Suche nach Lebenschancen.
Die öffentliche politisch-moralische Wertung des Aufstandes gegen die Entgrenzung hier und dort fällt denn auch ganz unterschiedlich aus. Offene Grenzen werden als zwingendes moralisches Gebot verstanden und propagiert, soweit es um Migration geht. Offene Grenzen werden mit dem gleichen hohen moralischen Ton verworfen, wenn es um grenzüberschreitendes Wirtschaften geht. Und zwar am entschiedensten von ebendenen, denen jede auf die Migrationsbewegungen bezogene Grenzdebatte Anathema ist. Der überzeugte Zuspruch für den Freihandel, den es natürlich auch gibt, hat ausschließlich pragmatischen Charakter.
Dass der Aufstand gegen Entgrenzung sich in zwei Bewegungen artikuliert, die nichts miteinander zu tun haben wollen, ja gegeneinander gerichtet sind, ist nicht erstaunlich. Es stellen sich an den verschiedenen Fronten der Entgrenzungsdebatte ja offensichtlich Fragen unterschiedlichen – vor allem moralischen – Gewichts. Aber das ändert nichts daran, dass die Betroffenen, jene, die sich als betroffen wahrnehmen, das Einer-grenzenlosen-Welt-ausgesetzt-Sein in allen seinen Aspekten als Bedrohung empfinden, von der konkreten Bedrohung des Arbeitsplatzes bis zur viel unbestimmteren Bedrohung der eigenen Lebenswelt, der Identität des Gemeinwesens, das man als das eigene betrachtet. Entgrenzung als Bedrohung, das ist die eine Erfahrung. Dass die Eliten – die Rede ist von Deutschland – den Betroffenen Entgrenzung, jedenfalls soweit es um Migrationsbewegungen geht, als zwingendes Gebot der Vernunft wie der Moral präsentieren, so zwingend, dass man über die, die es nicht begreifen, nur verächtlich sprechen kann, ist die andere. In dieser Doppelerfahrung bildet sich jenes Gefühl der Ohnmacht heraus, das dann populistisch mobilisierbar ist.
Was ist das für eine Ohnmacht? Die Frage bringt eine elementare Asymmetrie in den Blick. Über die offenen Grenzen einer Freihandelswelt kann man streiten. Sie mögen ein Gebot ökonomischer Vernunft sein, sie sind – außer in ganz bestimmten Konstellationen – sicher keines der Moral. Man kann auf der einen wie der anderen Seite stehen, ohne stigmatisiert zu werden. Über offene Grenzen in der Welt der neuen Völkerwanderungen darf man, jedenfalls in Deutschland, nicht streiten. Will sagen: Man kann die Vernunft und die Moral einer Politik faktisch weitgehend offener Grenzen (dass es sich immer noch so verhält, würde sich im nächsten Ernstfall schnell erweisen) hierzulande nicht ernstlich in Frage stellen, ohne Stigmatisierung zu riskieren. Eine ganz große Koalition – alle im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der CSU gehören dazu, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, viele Feuilletons, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände – grenzt den Raum der als legitim akzeptierten Auseinandersetzung über die Flüchtlingspolitik dieses Landes eng ein. Das heißt nicht, dass diese Auseinandersetzung nicht geführt wird. In den Leserbriefspalten etwa begegnet man ihr seit dem Herbst des Schicksalsjahres 2015 in außerordentlicher Heftigkeit. Wohl aber heißt es, dass sie nicht in einer der Demokratie bekömmlichen Weise geführt wird und geführt werden kann.
Niemand kann bestreiten, dass es um Fragen von fundamentaler Bedeutung für die Zukunft des Gemeinwesens geht. Niemand sollte bestreiten, dass Fragen dieser Art in der Demokratie offen und kontrovers diskutiert werden müssen. In einer offenen und kontroversen Diskussion muss die Auffassung, dass keine Demokratie mit einer Politik faktisch offener Grenzen dauerhaft als Demokratie überleben kann, ihren Platz und ihre Repräsentanz im Parteiensystem haben. Die Strategie, die notwendige Auseinandersetzung unter einem erzwungenen, moralisch begründeten Konsens zu ersticken und sie, wo sie doch aufbricht, als Auseinandersetzung zwischen dem »hellen« und dem »dunklen« Deutschland zu definieren, hat das nicht zugelassen. Sie hat es unvermeidlich gemacht, dass der Populismus sich des Themas bemächtigte und mit diesem Thema stark wurde.
Der Begriff Strategie will selbstverständlich nicht leugnen, dass die deutsche Flüchtlingspolitik reaktiv war und ist. Er will darauf verweisen, dass die Reaktion auf eine dramatische Herausforderung mit einer Argumentation unterfüttert wurde und weiterhin wird, die nicht zwingend war, sondern gewählt wurde.
Für die Brisanz des Themas hatte die politische Klasse bei der Wahl ihrer Argumentation offensichtlich überhaupt kein Gespür. Kein Gespür dafür, heißt das letztlich, dass das Bedürfnis nach Grenzen anthropologisch tief verwurzelt ist. Es ist nicht nur ein Bedürfnis nach Sicherheit. Es ist vor allem ein Bedürfnis, in einer Welt zu leben, die einem vertraut ist, der man sich zugehörig fühlen kann. Die große Frage, vor der die Politik steht, lautet: Wie geht man mit diesem dem Menschen als Menschen eigenen Verlangen in einer Welt um, in der die einfache Schließung von Grenzen keine vernünftige, für ein Land wie Deutschland nicht einmal eine verfügbare Option ist? Es mit Verachtung zu strafen ist die unklügste und gefährlichste aller Antworten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.02.2017