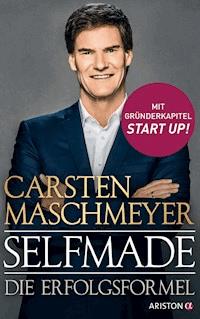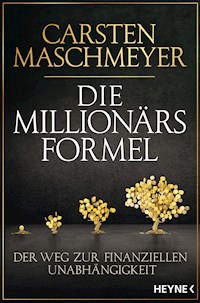18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Höhle-der-Löwen-Star Carsten Maschmeyer über den ultimativen Weg zum Erfolg Die meisten Menschen streben nach Erfolg. Doch wie erlangt man persönliches Glück, energievolle Gesundheit, finanzielle Unabhängigkeit und ein erfülltes Leben in einer Welt, die sich in einem radikalen Umbruch befindet? Die Antwort ist ganz einfach: indem man sich auf die Veränderung einlässt. Und ein Teil von ihr wird! Carsten Maschmeyer ist Fernsehstar, Bestsellerautor, Erfolgsratgeber sowie einer der bekanntesten Unternehmer und Investoren Deutschlands. Er hat es aus einfachsten Verhältnissen zum Milliardär geschafft. In seinem neuen Buch zeigt er auf, wie es jedem Menschen mithilfe der »Philosophie der Veränderung« gelingen kann, seine Träume endlich zu verwirklichen. Wie aus jeder Krise auch eine Chance werden kann. Dabei gibt Maschmeyer auch tiefe Einblicke in sein eigenes Leben und macht erstmalig öffentlich, mit welchen schweren Rück- und Schicksalsschlägen er selbst zu kämpfen hatte. Er zeigt auf, wie jeder alles ändern kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
CARSTEN MASCHMEYER
DIE SECHS ELEMENTE DES ERFOLGS
So verändern Sie Ihr Leben
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Originalausgabe, 3. Auflage 2021
© 2021 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Transparenzhinweis: Im Buch werden viele Start-ups erwähnt. Wenn Carsten Maschmeyer in eines davon investiert ist, wird explizit darauf hingewiesen.
Projektleitung: Georg Hodolitsch, Friederike Thompson
Redaktion: Anke Schenker, Judith Engst
Korrektorat: Silvia Kinkel, Anne Horsten
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: © Thomas von Aagh
Abbildungen im Innenteil: bearbeitet von Tobias Prießner
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-478-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-909-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-910-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter:
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
INHALT
PROLOG
Einleitung
I. ELEMENT:Arbeit
Warum Arbeit ein Element Ihres Erfolgs ist
1. Grundlagen
Ihre Arbeit erfüllt Sie nicht? Bringen Sie sie in Einklang mit Ihren privaten Interessen!
Ihr Job fühlt sich unbefriedigend an? Finden Sie Wertschätzung!
Das Arbeitsklima ist vergiftet? Reinigen Sie es!
2. Performance
Sie haben nur wenige Kontakte? Werden Sie zu einem Netzwerker!
Im Team gibt es Stimmungsbrecher? Sorgen Sie für gute Laune!
Sie sind ein Ego-Spieler? Werden Sie zum Super-Teamplayer
Sie wollen vor anderen gut aussehen? Lassen Sie lieber das Unternehmen glänzen!
3. Gründung
In Ihrem Unternehmen gibt es Hierarchien? Reißen Sie sie nieder!
Ihr Team besteht aus gleichen Charakteren? Bauen Sie es um!
Sie haben Vorbilder? Suchen Sie sich lieber Mentoren!
II. ELEMENT:Finanzen
Warum Finanzen ein Element Ihres Erfolgs sind
1. Ansparen
Sie wollen Ihre Finanzlage ändern? Dann fassen Sie einen Entschluss!
Sie verdienen Geld?Lassen Sie auch Ihr Geld nun Geld verdienen!
Sie wollen mehr Geld zurücklegen? Erhöhen Sie Ihre Einnahmen!
Sie wollen Kosten senken? Werden Sie zum Finanzdetektiv
Sie können es sich nicht leisten, zu sparen? Sie können es sich nicht leisten, nicht zu sparen!
Sie haben ein Konto? Machen Sie drei Konten daraus!
2. Investieren
Sie legen Ihr Geld zurück? Investieren Sie es besser!
Möglichkeit 1: Aktiensparen
Sie wollen in Aktien investieren? Dann denken Sie langfristig!
Sie haben keine Ahnung von Aktien? Dann machen Sie sich zu einem Experten!
Aktien sind oldschool? Nutzen Sie die moderne Technik!
Möglichkeit 2: Altersvorsorge
Sie wollen heute Vermögen aufbauen? Denken Sie jetzt besser an morgen!
Möglichkeit 3: Immobilien
Sie wollen die Niedrigzinsen nutzen? Investieren Sie in die eigenen vier Wände
Möglichkeit 4: Kryptowährung
3. Durchhalten
Sie geraten in Versuchung, Ihr Erspartes auszugeben? Entwickeln Sie eine Motivationsroutine!
Sie haben Geld übrig? Reinvestieren Sie es!
Sie wollen vorankommen? Gehen Sie Ihrem finanziellen Erfolg entgegen
III. ELEMENT:Freunde und Familie
Warum Freunde und Familie ein wichtiges Element unseres Erfolgs sind
1. Freundschaften
Sie arbeiten zu viel? Freundeszeit ist Entschleunigungszeit!
Sie genießen Freundschaften? Fangen Sie an, sie auch zu managen!
Es fällt Ihnen schwer, Kontakt zu Freunden zu halten? Entwickeln Sie eine Freundschaftskommunikation!
Sie haben wenig Zeit? Finden Sie den Rhythmus einer Freundschaft
Sie verstehen Ihre Freunde manchmal nicht? Lernen Sie, was Achtsamkeit heißt!
Das Wochenende mal zu Hause bleiben? Entwickeln Sie lieber Freundschaftsroutinen
Es geht nicht weiter? Wann Sie sich wirklich von Freundschaften verabschieden sollten
2. Liebe
Was die beiden Phasen einer Liebe unterscheidet
Sie lieben Ihren Partner? Dann halten Sie Augenhöhe in Ihrer Beziehung!
Zu wenig Zeit für den Partner? Entwickeln Sie Rituale, die die Liebe braucht
Sie haben sich wenig zu sagen? Entwickeln Sie eine Gesprächsroutine!
Ihre Beziehung ist zur Gewohnheit geworden? Brechen Sie aus!
IV. ELEMENT:Mentale Stärke
Warum mentale Stärke ein Element Ihres Erfolgs ist
Träume
Leben Sie nicht nur, träumen Sie auch!
Sie setzen sich kleine Ziele? Setzen Sie sich Mega-Ziele!
Akzeptieren Sie Ihre Lebensumstände nicht, optimieren Sie sie!
Mut
Die Welt geht unter? Bleiben Sie trotzdem positiv!
Sie haben Angst? Lernen Sie, ein Mut-Mensch zu werden!
Resilienz
Sie lernen aus Erfolgen? Aus Misserfolgen aber noch mehr!
Sie leiden? Setzen Sie Ihr Leid ins richtige Verhältnis
Es gibt keine Rückschläge! Es gibt nur Chancen
V. ELEMENT:Zeitmanagement
Warum Zeitmanagement ein Element Ihres Erfolgs ist
Organisation
Sie leben von Tag zu Tag? Definieren Sie lieber Ihre Ziele!
Sie haben Angst vor Ihren Schwächen? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken!
Sie haben viel zu tun? Schaffen Sie sich Freiräume!
Management
Sie sind gebildet? Dann bilden Sie sich weiter!
Strukturen schränken Sie ein? Bilden Sie eine Flexi-Struktur!
Die Zeit rinnt Ihnen davon? Werden Sie Herrscher über Ihre Zeit!
Ihre Zeit ist begrenzt? Werden Sie zum Zeitjongleur!
Lesen Sie keine Nachrichten! Selektieren Sie Nachrichten!
Sie sagen gerne Ja? Lernen Sie, Nein zu sagen!
Sie reagieren? Agieren Sie lieber!
VI. ELEMENT:Gesundheit
Warum Gesundheit ein wichtiges Element Ihres Erfolgs ist
1. Ernährung
Sie essen gerne? Essen Sie nun auch das Richtige!
Sie essen gesund? Trinken Sie noch gesünder!
Essen Sie nicht mehr wahllos – Entwickeln Sie ein Ernährungskonzept!
Sie sind strikt bei der Ernährung? Schummeln Sie auch mal!
2. Sport
Sie machen Sport, um sich besser zu fühlen? Machen Sie Sport, um jünger zu werden!
Sie machen Sport? Machen Sie ihn regelmäßig!
Die zwei Grundsportarten für Ihre perfekte Fitness
Sie kennen Ihren Körper? Lernen Sie ihn noch besser kennen!
3. Schlaf
Sie schlafen einfach? Entwickeln Sie besser eine Schlafhygiene!
Die Veränderungen in der Zukunft
Epilog
PROLOG
Und hier war ich. Am Tiefpunkt meines Lebens. Ganz unten. Und mir selbst so fremd wie nie zuvor. Das hier war die Hölle. Meine ganz persönliche Hölle. Ich lag in meinem Bett, eingerollt in eine Decke, und betrachtete mein neues Leben. Ein Leben, das nicht mehr viel mit dem Leben zu tun hatte, das ich noch vor einigen Wochen führte. Das Zimmer hier war klein, vielleicht zehn Quadratmeter, es gab einen Nachttisch, eine Dusche und ein Waschbecken. Einen Kleiderschrank hatte ich auch noch. Und ein Regal. Es diente als Abstellplatz. Zumindest in der Theorie. Ich betrachtete es von meinem Bett aus: Mein Regal war leer. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, ein paar Fotos aufzustellen, um dem kargen Raum eine etwas persönlichere Note zu geben. Fotos von meiner Veronica. Von meinen Kindern. Von meiner Familie. Bestimmt hätte mir der Anblick etwas Kraft gegeben in diesen Stunden, die wohl die schwersten Stunden meines Lebens waren. Doch ich hatte keine Fotos mitgenommen. Hatte mich das nicht getraut. Denn an diesem Ort war ich nicht Carsten Maschmeyer. An diesem Ort war ich Herr Saphir. Und wenn Herr Saphir nun ein Foto von Veronica Ferres und Kindern auf dem Regal stehen hätte, nun, das würde nicht nur komisch aussehen, dachte ich. Das würde das Versteckspiel, das ich hier praktizierte, wohl auch ziemlich schnell auffliegen lassen.
Vielleicht wäre das alles gar nicht nötig gewesen, dachte ich in diesem Moment; vielleicht hätte ich mich gar nicht hinter einer falschen Identität verstecken müssen. Aber die Wahrheit war: Ich schämte mich. Ich schämte mich ungeheuerlich für das, was bei mir in den vergangenen Jahren schiefgelaufen war. Es war mir fürchterlich peinlich, dass ich jetzt wimmernd im Bett einer Klinik lag und kaum noch Kontrolle über mich selbst hatte. Der ach so erfolgreiche Carsten Maschmeyer, der es von unten nach ziemlich weit oben geschafft hatte – wenn die Menschen mich so sehen würden.
Ich war in einer katastrophalen Verfassung: innere Unruhe, Zittern, Krampfanfälle, Schwindelgefühle. Immer wieder erschrak ich vor mir selbst. Was war nur aus mir geworden? Nein, ich wollte nicht, dass irgendwer wusste, wie es wirklich um mich bestellt war. Ich wollte den letzten Rest meiner Würde nicht auch noch verlieren. Darum hatten sich der Professor und sein Ärzteteam darauf eingelassen, dass ich hier anonym einchecken durfte.
Ich schloss die Augen und atmete dreimal tief durch. Dann richtete ich mich langsam auf, lehnte mich an die Wand und nahm das Klemmbrett mit Stift und Zettel, das der Professor mir am Morgen mitgebracht hatte. »Füllen Sie bitte diesen Fragebogen aus. Wir müssen herausfinden, welche Ursachen Sie in diesen Zustand gebracht haben könnten«, hatte er mich gebeten. »Versuchen Sie, die Fragen auf den zwölf Seiten zu beantworten. Bis ganz zurück in die Kindheit. Und vor allem die Frage, welches Ereignis in den letzten Jahren der Auslöser gewesen sein könnte. Das sind für uns nützliche Hinweise.«
Der Auslöser. Gab es den wirklich? Diesen einen Auslöser, der mich hierhergebracht hatte? Wo sollte ich anfangen? Ich versuchte, den Stift zu greifen. Ihn festzuhalten. Es gelang mir nicht. Meine Hände zitterten. Vor meinen Augen verschwamm alles, ich hatte Probleme, etwas zu erkennen. Ich biss mir auf die Lippen, zwang mich, den Fokus zu halten. »Konzentrier dich, Carsten, konzentrier dich«, sprach ich mir selber gut zu. Ich setzte mich auf die Bettkante, ordnete meine Gedanken, so weit es ging, und probierte schließlich zu schreiben. Aber das klappte nicht. Ein unleserliches Gekrakel. Als der Professor meinen gescheiterten Versuch bemerkte, schickte er eine Ärztin zu mir, die das alles mündlich mit mir durchgehen würde. Wir setzten uns also in einen kleinen Besprechungsraum, und ich fing an zu erzählen. Wie und warum ich hierhergelangt war – und immer mehr wurde mir bewusst: Ich war gekommen, um noch eine lange Zeit zu bleiben.
Eigentlich, dachte ich, eigentlich fing alles ja ganz harmlos an. Mit einem völlig unverdächtigen Gespräch. Ich saß vor Jahren bei meinem Hausarzt und erzählte ihm von meinem Schlafproblem. Nun, um genau zu sein, erzählte ich ihm von meiner Arbeit, aber das eine hatte ganz offensichtlich etwas mit dem anderen zu tun. Ich war überlastet. Wirklich überarbeitet. Arbeitete jeden Tag sehr lange, kam oft erst spät in der Nacht nach Hause, lag dennoch häufig hellwach in meinem Bett und konnte nicht richtig einschlafen.
»Was kann man da denn machen?«, fragte ich den Doktor, der mit einem Lächeln abwinkte.
»Gar kein Problem«, sagte er. »Kommt häufig vor.« Das kenne er ja auch. Er habe dagegen ein ganz einfaches und wirkungsvolles Rezept: Stilnox. Ein Medikament, das so ähnlich wirkt wie Valium. Das sagte er mir damals allerdings nicht. Er drückte mir einfach nur eine 20er-Packung mit Schlaftabletten in die Hand und erklärte mir, wie es funktionierte. »Eine halbe Tablette zerkauen und unter der Zunge auflösen, schon schlafen Sie schnell und fest ein.« Aber er schickte gleich noch eine Warnung hinterher. »Nicht zu oft nehmen! Wenn Sie die Tabletten zu viele Tage hintereinander einnehmen, dann besteht die Gefahr, dass Sie sich daran gewöhnen, abhängig werden und nicht mehr ohne können.«
Ich nickte, nahm die Packung mit nach Hause und probierte es aus. Eine halbe Stilnox. Zerkauen. Unter der Zunge auflösen. Zack, ich schlief ein. Es funktionierte ganz wunderbar.
Die Warnung meines Arztes nahm ich mir zu Herzen. Ich wollte es nicht übertreiben, kein Risiko der Gewöhnung eingehen. Am nächsten Tag nahm ich nichts, erst ein paar Wochen später, als ich mal wieder nach einem viel zu langen Arbeitstag abends erschöpft war, aber trotzdem überdreht und hellwach im Bett lag. Das kam schließlich häufiger vor. Und in solchen Situationen griff ich fortan zu den kleinen Wunderpillen. Und so wurden die Tabletten meine Begleiter. Ich griff zu, wenn ich abends lange nicht einschlafen konnte. Oder während eines langen Überseefluges. Zu manchen Zeiten seltener, zu anderen Zeiten öfter. Bis ich irgendwann das Gefühl hatte, nur noch mit meiner halben Pille einschlafen zu können.
Also griff ich täglich zu. Nach ein paar Monaten konnte ich auch trotz der Einnahme einer halben Stilnox-Tablette nicht mehr einschlafen. Also nahm ich zusätzlich eine weitere halbe Tablette. Insgesamt also eine ganze. Ich redete mir ein, ist nicht schlimm, ist ja immer noch nur eine. Die normale Dosis. Und so ging es weiter, bis die Tabletten für mich zu einer Art Erlösung wurden aus der Schlaflosigkeit, aus den Einsamkeitsängsten und Angstgefühlen.
»Sie sprechen von Einsamkeit und Angstgefühlen …«, unterbrach mich die Ärztin.
Ich nickte.
»Wann hat das begonnen? Woher kam das?« Eine gute Frage. Ich massierte meine Schläfen und dachte nach. Ich war mir sicher, dass es mit meiner Arbeit begonnen hatte. Ich arbeitete viel, wahrscheinlich zu viel. Hatte oft 16-Stunden-Tage, kaum Wochenenden und litt wohl an einer Art psychischer Erschöpfung, ohne dass ich das wirklich wahrgenommen hatte. Ein Burn-out. Offenkundig die ersten Anzeichen einer Depression. Aber ich konnte und wollte davon nichts wissen. Wenn ich spürte, dass es mir nicht gut ging, dann flüchtete ich einfach in noch mehr Arbeit.
Eine Zeit lang fühlte sich das noch gut an. Ich hatte sowieso immer einen Stapel unerledigter Dinge auf meinem Schreibtisch. Ich hatte viel zu tun. Hatte beim AWD, den ich einst gegründet hatte (heute Swiss Life), eine Doppelrolle als CEO und Vertriebschef auszufüllen. Beides waren für sich genommen schon Fulltime-Jobs. Dazu kam die Verantwortung für mehr als 10.000 Mitarbeiter und deren Familien, die ich als größter Aktionär und gefühlter Inhaber hatte. Auch den Druck an der Börse bekam ich zu spüren. Ich wollte keinen Aktionär enttäuschen, vor allem diejenigen nicht, die als Mitarbeiter und Kunden Anteilseigner waren. Immer wenn der Börsenkurs mal nachließ, hatte ich ein schlechtes Gewissen – so als wäre ich nicht fleißig genug gewesen. Dann arbeitete ich noch unermüdlicher. Eigentlich war klar, dass ich mich längst in einem Workaholic-Kreislauf befand, aus dem es vermeintlich kein Entkommen gab. Ich bildete mir ein, keine Schwäche zeigen zu können.
Eine Zeit lang ging das zunächst noch gut. Ich ignorierte alle Warnzeichen. Über Jahrzehnte war ich mittlerweile vom Erfolg verwöhnt. Ich hatte den AWD gegründet, der mit über 1 Milliarde Euro im MDAX bewertet gewesen war. Ich war finanziell reich und nun endlich in der Lage, mir all das leisten zu können, was ich mir immer erträumt hatte. Ich, der Junge, der als Halbwaise aus einfachsten Verhältnissen stammte. Außerdem hatte ich noch mit meiner ersten Frau und unseren beiden gemeinsamen Söhnen eine tolle Familie, die ich über alles liebte, ich hatte großartige Freunde, auch wenn ich sie zu selten sah. Nein, ich war einfach nicht in der Lage, meine Schwächen zu erkennen. Ich betäubte sie mit noch mehr Arbeit und nachts mit noch mehr Schlaftabletten.
»Und wann«, riss mich die Ärztin aus meinen Erinnerungen, »wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, dass etwas nicht stimmte?«
Ich richtete mich auf meinem Stuhl auf. Das konnte ich ziemlich genau beantworten.
2007 war das Jahr, in dem es begann, endgültig aus den Fugen zu geraten. 2007 hatte ich den AWD an die Swiss-Life-Versicherungen verkauft und nicht ansatzweise bemerkt, dass der für den Deal zuständige Manager Manfred Behrens ein heimliches Motiv für den Kauf gehabt hatte: mich zu verdrängen, um selbst AWD-Chef zu werden. Als die Schweizer im Spätsommer 2008 dann meine letzten 10 Prozent Aktien durch Ziehen der Option erworben hatten und somit 100 Prozent der Unternehmensanteile besaßen, machte er Ernst. Mein AWD war nicht mehr mein AWD. Ich wurde als Vorstandschef geschasst. Ich war raus. Einfach so. Zur Beruhigung der Mitarbeiter bot man mir ein Verwaltungsratsmandat in der Muttergesellschaft Swiss Life an. Das bedeutete im Durchschnitt quartalsweise eine vier- bis sechsstündige Sitzung in Zürich. Das war keine operative Aufgabe und füllte mich nicht im Ansatz aus. Stattdessen Langeweile, Leere – ich fühlte mich überflüssig. Das war quasi eine Vollbremsung von hundert auf null und auch emotional nicht so erfüllend wie zuvor, als ich ein Unicorn, also ein mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertetes Unternehmen, aufgebaut und zu immer neuen Rekorden gesteuert hatte.
Und dann begann der wahre Abstieg, denn erst jetzt begriff ich, wie sehr ich eigentlich für die Firma gelebt hatte. Denn nicht nur der AWD war weg. Auch meine Ehe war mittlerweile in die Brüche gegangen, meine Freunde hatte ich komplett vernachlässigt. Dabei fürchtete ich auch ihre möglicherweise unangenehmen Reaktionen, wenn ich mich nach so langer Zeit mal wieder meldete, nach dem Motto: »Ach, gibt’s dich noch?« oder »Was willst du denn auf einmal?«
Und so schritt ich eines Abends durch mein großes, wunderschönes Haus, das ich für viel Geld ganz nach meinen Vorstellungen hatte bauen lassen, und ging von Zimmer zu Zimmer. Meine Frau war weg, mit ihr auch die Kinder. Ihre Zimmer waren leer. Ich war leer. Aus meinem Traumhaus war ein Palast der Einsamkeit geworden – und ich erkannte, was ich so oft schon gehört hatte, aber erst jetzt so richtig begreifen konnte: Geld allein macht nicht glücklich. Es tat mir weh, abends an diesem Ort zu sein, der sich nicht mehr wie ein Zuhause anfühlte. Also griff ich weiterhin zu meinen Schlaftabletten und steigerte die Dosis. Wenn ich schon so rumhing, dachte ich, dann wenigstens nicht im wachen Zustand.
Und so betäubte ich mich. Tag für Tag. Ich flüchtete mich mit Tabletten in den Schlaf. Längst reichte eine ganze Tablette nicht mehr zum Einschlafen. Aus einer ganzen Tablette wurden eineinhalb Tabletten. Ein paar Monate später wachte ich nach drei Stunden trotzdem wieder auf und begann den nächsten Fehler, ich schmiss einfach noch eine ganze nach. Ich wollte schlafen. Ich wollte nicht wach sein. Nicht hier, nicht in diesem Haus, in dem noch so viele Erinnerungen waren. So schlich sich das ein. So fing ich an, langsam abhängig zu werden. Ohne zu realisieren, was genau mit mir passierte.
Den ersten Warnschuss bekam ich von einem mir vertrauten Arzt bei einem Check-up. Er untersuchte mich einmal komplett, von der Knochenbeschaffenheit bis zu meinem Reaktionsvermögen. Irgendwann unterbrach er die Untersuchung. »Herr Maschmeyer«, sagte er, legte den Kopf schräg und schaute mich an. »Sie sind um die 50.« Ich nickte. »Aber Sie haben ein Reaktionsvermögen wie ein Greis. Was nehmen Sie?«
Ich verstand zunächst nicht, was er meinte. Ich fühlte mich doch eigentlich halbwegs normal.
»Was ich nehme?«
»Trinken Sie?«, fragte er.
»Nein«.
»Haben Sie gestern Abend getrunken?«
»Nein.«
Dann erzählte ich ihm, dass ich hin- und wieder Schlaftabletten nahm. Ich erklärte ihm, dass ich die Tabletten bräuchte, da ich sonst wach bleiben würde und keine Ruhe fand.
»Das, was Sie mit den Tabletten bekommen, ist kein Schlaf«, warnte mich der Arzt. »Das ist eine Art Narkose. Verzichten Sie darauf. Das macht Sie kaputt. Bleiben Sie lieber wach, das hilft Ihnen mehr. Hören Sie auf mit dem Teufelszeug. Wenn Sie die Tabletten-Einnahme nicht bald stoppen, werden Sie so abhängig, dass Sie immer süchtiger werden und so viele Tabletten schlucken, dass Sie Ihr Gehirn schädigen!«
Aber ich nahm die Warnungen nicht wirklich ernst. Ich machte weiter. Die Wirkung lies wieder nach, und ich steigerte die Dosis erneut. Ich war nun schon bei drei Tabletten pro Nacht.
Wer solch ein Schlafmittel nimmt, der setzt einen Mechanismus im Gehirn in Gang, der die Aktivität besonderer Nervenzellen unterdrückt. Auf diese Weise wird der gesamte menschliche Organismus gedämpft und das Einschlafen gefördert. Doch je öfter man zugreift, desto schwächer wird die sedierende Wirkung, sodass man die Dosis Mal für Mal steigern muss. Genau das passierte mir, und wenn ich noch hätte komplett klar denken können, hätte mir auffallen müssen, dass ich eigentlich nur noch zwischen Couch, Esstisch und Bett pendelte.
Verlassen von der Familie, aus der von mir gegründeten Firma gefeuert, hatte ich keine Aufgabe und fühlte mich nicht mehr gebraucht. Meine beiden Söhne sah ich kaum noch. Der ältere studierte in London, der jüngere ging noch in Nizza zur Schule. So sehr ich die beiden vermisste, so sehr war ich auch froh, nicht ihren Fragen ausgesetzt zu sein, warum ich fast nur noch im Bett lag. Ich hatte immer mehr das Gefühl, dass mein Leben keinen Sinn mehr machte. Diese Gedanken wurden immer stärker, und schließlich waren sie so intensiv, dass es mir selber unheimlich wurde. Ich erkundigte mich nach einem Health Spa mit alternativer Medizin, das Hilfesuchenden bei Tabletten- und Alkoholmissbrauch bereits geholfen hatte. In Asien solle es ein tolles Heilzentrum geben. Bestimmt könnte man mir dort besser helfen, dachte ich. Die arbeiteten viel mit ganzheitlichen Heilmethoden. Heilfasten, Massagen, ganz gesundes Essen und sogar Detox-Kuren gab es dort. Detox klang für mich sehr nützlich, waren meine Schlaftabletten letztendlich doch toxisch.
Also flog ich nach Thailand, ins Chiva Som International Health Resort. Dort probierte ich alles: Yoga, Pilates, jede Form der Ernährungsumstellung, Meditation, Akkupunktur, verschiedene Massagen, um zur Ruhe zu kommen. Auch machte ich eine mehrtägige Liquid-Reinigungsservice-Kur, bei der ich nur Säfte, Tee und Wasser bekam. Und so schaffte ich es dort tatsächlich, die Dosis ein wenig zu verringern. Rückblickend frage ich mich, ob es vielleicht auch an der Zeitverschiebung lag, dass ich mit der Einschlafdosis von zwei Tabletten auskam und durchschlief, weil dort 8 Uhr morgens bei uns noch 2 Uhr nachts war.
Als ich nach zwei Wochen im Flieger zurück nach Deutschland saß, war der hoffnungsvolle Effekt aber leider schon wieder verpufft: Der Nachtflug war unruhig, es ruckelte ständig, und ich konnte nicht einschlafen. Ich ließ gute Vorsätze gute Vorsätze sein und nahm meine zwei Stilnox, zerkaute sie, ließ sie unter der Zunge zergehen und schlief ein. Ich hatte ja gerade meine Dosis über die Dauer von zwei Wochen stark reduziert, machte ich mir vor. Nach drei bis vier Stunden war ich wieder wach. Und legte eine Pille nach. Es war ja auch zu leicht, denn ich hatte mir angewöhnt, im Handgepäck eine komplette Packung dabeizuhaben. Diese Angewohnheit behielt ich auch bei, als ich mir eingeredet hatte, meine Detox-Kur hätte einen positiven Effekt gehabt. Im Nachhinein frage ich mich, wie ich mich selbst so täuschen konnte. Sogar für den Fall, dass mich eine Stewardess beobachtet hätte, hatte ich eine Lösung: Ich war darin geübt, die Pillen wie ein Tic-Tac-Bonbon einzunehmen, ganz beiläufig, sodass es keiner merkte.
Zurück zu Hause war wieder alles so wie zuvor. Einsamkeit, Schlafprobleme und Sorgen, die ich mit dem künstlichen Schlaf, mit der Flucht aus der Wirklichkeit, die mir die Tabletten bescherten, einfach betäubte. Ich war jetzt regelmäßig bei drei bis vier Stück pro Nacht. Ein paar Monate danach erhöhte ich meine Dosis erneut. Auf mindestens vier Tabletten pro Nacht. Die Folge war, dass ich mich ständig müde fühlte. »Das ist eine ganz logische Folge dieser Tabletten«, erklärte mir die Ärztin. »Am nächsten Tag sind Sie schläfrig, da sich der Körper in der Nacht nicht wirklich entspannen konnte, sondern sein System nur künstlich herunterfuhr.« Ich schaute mich in dem kleinen Zimmer um. Betrachtete die Buchrücken, die im Regal standen. Mir wurde in dem Moment noch einmal bewusst, wie wenig Ahnung ich eigentlich von dem hatte, was ich mir in den letzten Jahren angetan hatte. »Auf diese Weise wird die natürliche Tiefschlafphase ausgesetzt, sodass es langfristig zu einer Veränderung des natürlichen Schlafmusters und einer Verschlechterung der Schlafqualität kommt. Also das genaue Gegenteil von dem, was Sie eigentlich wollen.« Das alles wusste ich nicht.
Der einzig positive Strohhalm, den ich in dieser Zeit hatte, das war die beginnende Liebe zu Veronica. Wir waren räumlich 600 Kilometer voneinander getrennt. Doch auch das war gar nicht so einfach. Sie befand sich gerade in einer nicht ganz leichten Trennungsphase, lebte mit ihrer Tochter in München und ich in Hannover, und sie drehte einen Film nach dem anderen. Der Druck, diese wunderschöne Liebe nicht zu zerstören, die zudem der Öffentlichkeit ausgesetzt war; die Angst, diese wundervolle Frau zu enttäuschen oder gar ihre Reputation zu beschädigen, wuchs ins Unermessliche.
Eine häufige Folge von belastenden Lebenssituationen in Verbindung mit den Nebenwirkungen von Schlaftabletten sind Depressionen. Und eine solche begann sich nun bei mir zu entwickeln. Ein paar Monate später schluckte ich auch mittags schon eine Tablette und legte mich dann zu einem langen Mittagsschlaf hin. Eineinhalb Jahre später spürte ich aber auch abends kaum noch einen Effekt. Und setzte die Dosis noch höher. Nachts war ich nun schon bei zweimal drei Tabletten, mittags bei zwei. Macht pro Tag acht. Noch ein paar Monate später war es nun so weit, dass ich alle paar Stunden ein paar Pillen nachschmiss. Auch vormittags und nachmittags. Was ich nicht wusste: Es ging mir gar nicht mehr um Schlaf. Ich hatte zwar den zwanghaften Wunsch nach Schlaf, es war aber die Abhängigkeit. Mein Gehirn schrie nach immer mehr und immer öfter. Wenn ich meinen Stoff nicht nahm, dann fing ich an zu zittern.
In den weniger werdenden klaren Momenten ahnte ich, dass das Ganze schwer krankhaft war. Neben dem Arzt, der mir – heute im Nachhinein für mich schwer vorstellbar – regelmäßig die Tabletten verschrieb, konsultierte ich eine Psychologin, die mir schon mit guten Gesprächen direkt nach dem Auszug meiner Ex-Frau geholfen hatte. Ich hatte vermeintlich Glück, sie verstand meinen Kummer, meine Ängste und besorgte mir ebenfalls Schlaftabletten von derselben Sorte. Ich hatte ihr natürlich verheimlicht, wie hoch meine Gesamtdosis bereits war, sodass sie keine Ahnung hatte, was sie eigentlich anrichtete. Und meine Abhängigkeit nahm weiter zu.
Der Teufelskreis beschleunigte sich. Die Folge war: Ich fuhr so gut wie gar nicht mehr in mein Büro, das ein vermögensverwaltendes Family Office war, ich wollte keinen sehen oder treffen. Hatte Angst vor allem. Fühlte mich nur scheinbar sicher im Bett, wenn ich mich mit dem Dreckszeug wegschoss, hatte das starke Bedürfnis, mich gleich morgens nach dem Frühstück wieder zu einem »Schläfchen« hinzulegen. Ich war nur noch müde und taumelte durchs Leben.
Einer meiner Ärzte – derjenige, der mir auch regelmäßig Schlaftabletten verschrieb – redete auf mich ein, unbedingt zu probieren, den Konsum zu verringern, weil er überzeugt war, dass es für mich sonst ein böses Erwachen geben würde. Meine Lebensgefährtin Veronica hatte meine Abhängigkeit schon längst bemerkt, hatte sich mit mir hingesetzt, geredet, diskutiert, geweint … nach Lösungen gesucht. Ich war erleichtert und froh, dass sie meine Probleme offen ansprach, denn insgeheim war mir schon lange klar, dass sie wusste, was los war.
Ich machte einen erneuten Entzugsversuch. Versteckt in einem Schweizer Hotel. Veronica begleitete mich. Auch mein Arzt und die Psychologin waren dorthin gekommen. Das Ziel war, die Dosis langsam herunterzusetzen, den Konsum zu reduzieren und das Gift langsam auszuschleichen. Veronica stand mir bei. Doch noch immer war meine Abhängigkeit stärker, als es ihre Liebe und ihr Zuspruch in dieser Phase hätten je sein können. Und so versteckte ich meine heimlich mitgebrachten Tabletten auch vor ihr, vor Veronica – der Frau, die ich liebte. Sie sprach mit meinem Arzt und meiner Psychologin, um zu erfahren, was sie zusätzlich tun könne, um mich zu unterstützen.
Vergeblich. Der Entzug war viel härter, als ich gedacht hatte. Einen Tag hielt ich die Reduzierung aus, am zweiten Tag fiel ich völlig zusammen. Mein Körper gehorchte mir nicht mehr. Ich fing an zu zittern, verkrampfte mich. Bekam Anfälle. Schaute wieder und wieder auf die Uhr. Ich zählte die Minuten bis zu meiner nächsten Dosis, die von Mal zu Mal reduziert werden sollte. Es klappte nicht. Ich kam von dem Teufelszeug einfach nicht weg. Ich brach den Entzug ab, indem ich mich aus meinen heimlich mitgebrachten Vorräten bediente und die Dosis aufstockte. Auch die Angst, meine große Liebe zu verlieren, wuchs und half mir nicht gerade, von den Tabletten loszukommen.
So versuchte ich, mich mit den Tabletten zu arrangieren. Redete mir ein, so schlimm sei das alles nicht und irgendwann würde ich von alleine reduzieren können. Doch ich hatte ein Problem: Irgendwie musste ich für genügend Pillen sorgen, weil ich sie brauchte. Damals hatte ich einen Hausangestellten, der es schaffte, mir große Mengen von dem verschreibungspflichtigen Medikament zu beschaffen. Irgendwann waren wir so weit, dass er große Packungen wahrscheinlich direkt bei einem Pharmalieferanten kaufte. Dies war für mich eine große Beruhigung: Denn – so dachte ich in meinem schlafmittelumnebelten Hirn – das Problem, an genügend Stoff zu kommen, war gelöst.
Und so verging ein weiteres Jahr. Mehrere Entzugsversuche scheiterten. Veronica und ich waren nun schon länger ein Paar. Das gab mir die einzige restliche Zuversicht. Wenn ich an sie dachte, fühlte ich mich besser. Ich wollte sie aber nicht enttäuschen und durfte mich bei dem häufigen Tablettenkonsum also nicht erwischen lassen. Deswegen besuchte ich sie kaum noch. Und wenn wir uns dann trafen, habe ich Übelkeit vorgetäuscht, um mich auch tagsüber hinlegen zu können. Aber auch wenn ich versuchte, Veronica meine Tablettenabhängigkeit zu verheimlichen – sie bekam es immer deutlicher mit. Unsere Beziehung war auf der Kippe. Sie litt immer mehr an meinem Verleugnen der Realität. Es wurde ja auch immer offensichtlicher. Wenn wir mal mit Freunden essen gingen und dazu auch noch Wein tranken, redete ich teilweise wirres Zeugs daher, vergaß sofort wieder das Gesagte und konnte den Gesprächen nicht konzentriert folgen. So offensichtlich, dass auch meine wenigen Freunde und Geschäftspartner, die ich traf, anfingen, sich Sorgen zu machen. Auch wenn mich niemand direkt darauf ansprach, es wurde getuschelt. Einige sagten mir (leider erst im Nachhinein), ich wäre nur noch ein wandelndes Gespenst gewesen. Hätte völlig neben mir gestanden. Wäre gar nicht mehr bei der Sache gewesen. Und so war es auch. Selbst wenn ich einen Termin hatte, nahm ich meine Schlaftabletten. Wenn ich sie in den Mund nahm, tarnte ich sie als Pfefferminzbonbons. Veronica brach es das Herz, zu sehen, wie ich immer weniger Herr meiner Selbst wurde. Ich war nur noch darauf bedacht, mich abzuschießen. Längst war ich bei einer täglichen Gesamtdosis von Schlaftabletten im zweistelligen Bereich angekommen.
Doch ich war immer noch nicht bereit, es mir einzugestehen: Ich war schwer abhängig. Ein Suchtkranker, der immer wieder neue Strategien entwickelt, um eine Abhängigkeit kleinzureden oder zu verheimlichen, weil es mir peinlich war und ich nicht erwischt werden wollte. Veronica sagte ich immer wieder, dass ich ab jetzt reduzieren und bald die Finger ganz davon lassen würde. Aber ich konnte nicht. Und irgendwann fand Veronica eine Riesenmenge an Packungen in meiner Nachttischschublade. Das war im wahrsten Sinne des Wortes zu viel. Alarmiert suchte sie weiter und fand auch im Badezimmer und in der Küche die vielen »Vorräte«, von denen ich dachte, sie gut versteckt zu haben. Spätestens jetzt wusste sie, dass da etwas total schiefläuft.
Veronica war einerseits richtig wütend, dass ich sie in dieser Sache so oft belogen hatte, und andererseits in großer Sorge um meine Gesundheit. Es kam zum Riesenknall: »Liebst du mich nicht?«, »Warum schießt du dich laufend ab?«, »Willst du dich umbringen?«, »Wer besorgt dir das Scheißzeug?«, »Pack jetzt alles aus, sonst siehst du mich nie wieder«. Nach einer Weile und vielen beschwichtigenden Beteuerungen meinerseits wurde Veronica konstruktiv und lösungsorientiert. »Hör zu, Carsten, du machst jetzt einen ernsten Entzug. Ich werde das gemeinsam mit dir durchstehen, hörst du? Ob wir nach dieser Sache noch als Mann und Frau zusammenfinden werden, das weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt für dich bedingungslos da sein, wie eine Schwester für ihren Bruder da ist. Egal was passiert.«
Das hatte gesessen. Ich wusste, dass ich meinen letzten Lichtblick, nämlich Veronica, verlieren würde, wenn ich jetzt die Situation nicht wirklich ändern würde. Ich liebte sie. Veronica fing sofort an, sich zu erkundigen, und fand in München auf Empfehlung von Dr. Müller-Wohlfahrt den international renommierten Wissenschaftler und Arzt Professor Florian Holsboer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, der schon zahlreichen Prominenten in ähnlichen Situationen geholfen hatte. Holsboer, der in der Behandlung von Depression und Angst eine Koryphäe ist, weiß auch, wie man mit Medikamentenabhängigkeit umgeht.
Ich vertraute Veronicas Empfehlung und fuhr nach München. Der Professor, ein freundlicher, sympathischer und vertrauenswürdiger Herr, unterzog mich einem ausführlichen Untersuchungsgespräch. Holsboer saß vor einem riesigen Bücherregal mit jeder Menge Fachliteratur und strahlte eine natürliche Autorität aus. Er stellte mir ein paar Standardfragen, die ich so ehrlich wie möglich zu beantworten versuchte. Nur bei der Frage nach der Dosis, die ich mittlerweile zu mir nahm, konnte ich einfach nicht die Wahrheit sagen. Ich schämte mich zu sehr.
Nach der Besprechung führte er mich durch die Krankenstation. Es war ein großer abgetrennter Bereich, in dem auch Suchtkranke saßen. Die meisten teilten sich ein Doppelzimmer. Die Klinik roch nach Linoleum und Desinfektionsmittel. Keine sonderlich schöne Vorstellung, hier eine längere Zeit verbringen zu müssen. Als ich alles gesehen hatte, brachte mich der Professor wieder in sein Arbeitszimmer. Er blickte mich ernst an. »Die Wahrheit ist: Ich wollte Ihnen nicht nur die Station zeigen«, sagte er. »Ich wollte vor allem sehen, wie Sie gehen.«
Ich verstand nicht ganz und schaute ihn fragend an. »Wie meinen Sie das?«
»Ihr Zustand, Herr Maschmeyer, Ihr Zustand ist besorgniserregend. Sie haben bereits jetzt neurologische Ausfallerscheinungen. Sie sprechen undeutlich und verwaschen. Sie laufen unkoordiniert. Sie können keine Treppen steigen, ohne sich am Handlauf festzuhalten. Das alles, weil Sie durch die vielen Schlaftabletten die natürlichen Prozesse zwischen den Nervenzellen unterdrücken.« Er machte eine Pause. Es war für mich gleichermaßen peinlich und erschütternd. Was war nur aus mir, einem ehemals fitten Sportler, der nie geraucht und nur selten Alkohol getrunken hat, geworden? Dann sagte er ruhig, aber streng: »Herr Maschmeyer, Sie sind Anfang 50. Wenn Sie so weitermachen, können Sie im Ernstfall an einer Atemlähmung sterben.« Ich konnte nicht glauben, was der Professor da sagte. »Das Gehirn des Menschen ist das Wundervollste, aber auch das Komplexeste, was die Natur geschaffen hat. Und das beschädigen Sie systematisch mit diesen Medikamenten. Noch ein Vierteljahr so weiter, und die Verletzungen der Hirnzellen und ihrer Verknüpfungen bleiben für immer. Sie sind dann nicht mehr derselbe, die Persönlichkeit ist eine andere, sie ist flacher. Ihr Denkapparat ist für immer geschädigt. Das kann man nicht mehr ›rauswaschen‹ und ungeschehen machen, das wird dann nicht mehr gut: Was dann kaputt ist, ist kaputt. Wollen Sie das wirklich? Ich glaube nicht, dass Sie das wollen, sonst wären Sie nicht zu mir gekommen!«
Ich stöhnte und schrie innerlich. Das konnte doch nicht sein. Das war ein absoluter Albtraum. Ich erkannte, dass ich schwer abhängig war. Mir war klar, dass ich ein riesiges Problem hatte, aber diese Prognose hätte ich nicht erwartet. Das war mein Moment des Erwachens. Als mir Professor Holsboer vorzeichnete, was mich erwartete, wusste ich, dass ich jetzt die Notbremse ziehen musste. Dass jetzt der Moment war, zu handeln. Ich musste mein Leben ändern, wenn ich es behalten wollte. Und zwar tiefgreifender ändern, als ich es mir je hätte vorstellen können! Ich entschied mich noch im selben Moment dafür, mich in das Max-Planck-Institut einweisen zu lassen. Am Tiefpunkt meines Lebens. Ganz tief unten. Und ich war mir selbst so fremd wie nie zuvor, aber gewillt, dafür zu kämpfen, dass sich alles ändert, dass dieser Tag der erste Tag meines neuen Lebens wird.
EINLEITUNG
Wenn Sie dieses Buch in den Händen halten und heute 30 Jahre alt sind, dann bleiben Ihnen bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung noch 18.250 Tage auf dieser Welt. Wenn Sie 40 Jahre alt sind, dann haben Sie noch 14.600 Tage übrig – Halbzeit! Und wenn Sie 50 sind, dann sind es noch 10.950 Tage. Das ist nicht mehr sehr viel. Aber es ist noch genügend Zeit, einen Teil von Ihrem Leben zu verändern. Vielleicht sogar Ihr ganzes Leben. In den dunkelsten Stunden meines Lebens, in denen ich mich wochenlang in einer Entzugsklinik aufhielt, da wurde mir deutlich bewusst, dass das möglich ist. Dass es machbar ist, sein Leben jederzeit noch einmal ganz neu auszurichten. Müssen Sie, um all Ihre Träume und Ziele realisieren zu können, reich geboren sein? Müssen Sie auf einer Elite-Universität gewesen sein? Geht das nur als Single? Oder bedingt es einen starken Partner an Ihrer Seite? Müssen Sie am Anfang Ihres Berufslebens stehen? Müssen Sie ein großes Talent oder gar eine Gründerin oder ein Gründer sein? Nein! Nein! Nein! Sie müssen einfach nur bereit sein, die Veränderungen zu akzeptieren. Sie zuzulassen.
Jeder neue Morgen bietet Ihnen die Möglichkeit, eine bessere Version Ihrer Selbst zu werden. Jeder einzelne Tag gibt Ihnen die Gelegenheit, glücklicher und zufriedener zu sein. Reicher an Geld und Liebe und Freundschaften zu werden. Reicher an Erfahrungen, Erlebnissen und auch an Weisheit. Jeder neue Tag ist eine neue Chance, ein erfolgreicheres Leben zu führen.
Dieses Buch ist ein Buch über Erfolg. Es ist aber auch ein Buch über Glück. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Glück nicht ohne Erfolg und Erfolg nicht ohne Glück vorstellbar ist. Doch was heißt das eigentlich – Erfolg? Erfolgreich zu sein bedeutet, seine selbstgesetzten Ziele zu verwirklichen. Wer es schafft, heute mehr zu sein, als er gestern noch war, der wird neues Selbstbewusstsein entwickeln und eine tiefe innere Befriedigung verspüren. Mit diesem Buch will ich Ihnen helfen, erfolgreich zu sein. Sie morgen zu einer besseren Version ihres heutigen Ichs zu machen. Ich bin überzeugt, dass wirklicher, ganzheitlicher Erfolg auf sechs Elementen basiert. Das sind die sechs Erfolgselemente. Arbeit. Finanzen. Freunde und Familie. Mentale Stärke. Zeitmanagement und Gesundheit. Wer es schafft, diese sechs Elemente positiv in sein Leben zu integrieren, der wird in der Lage sein, echtes Glück und wirkliche Zufriedenheit zu erfahren. Sie können sich die sechs Elemente auch als Säulen vorstellen, auf denen Ihr Lebensglück steht. Oder wie ein Haus mit solidem Fundament. Wenn das Fundament nicht stabil ist, droht alles einzustürzen. Wenn Sie aber auf meinen Bauplan vertrauen, dann wird Ihr Lebenshaus nicht nur fest und sicher stehen. Sie werden sich in diesem Haus auch für lange Zeit sehr wohlfühlen. So sind die sechs Elemente das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen. Mit meinem heutigen Wissens- und Kenntnisstand, den ich in diesem Buch mit Ihnen teilen möchte, hätte ich selber weniger gesundheitliche Rückschläge erleiden müssen, hätte schon sehr viel früher ein glückliches Familienleben geführt, hätte mit Geldanlagen von Anfang an mehr Erfolg erzielt, im Job und im Umgang mit Mitarbeitern nicht so viele Fehler gemacht und meine Arbeit in kürzerer Zeit sogar noch viel effizienter geschafft. Diese sechs Elemente werden Ihre sechs Richtigen sein. Nicht im Lotto. Sondern im Leben.
In diesem Buch werde ich Ihnen zeigen, wie Sie in Ihrem Job vorwärtskommen; wie es Ihnen gelingt, um sich herum ein positives und motivierendes Arbeitsklima zu schaffen. Ich werde Ihnen erläutern, wie es Ihnen mit dem Reichwerde-Prinzip gelingen wird, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Ich werde Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihre mentale Stärke so erfolgreich trainieren, dass Sie zu einem Mut-Menschen werden, ganz ohne Angst vor Rückschlägen und mit einer gesunden Widerstandskraft gegen die Widrigkeiten des Lebens. Ich werde Ihnen zeigen, was die Grundlagen eines gesunden Lebenswandels sind, und Ihnen die tiefe Bedeutung von Freundschaft und Familie näherbringen. Schließlich werde ich Ihnen Tipps geben, wie Sie mit weniger Arbeit bessere Ergebnisse erzielen und es Ihnen gelingt, in einem stressigen Alltag mehr Zeit für sich zu gewinnen. Und ich will erklären, wie Sie es schaffen, Strategien zu finden, um alle Elemente in Ihr Leben zu integrieren.
Wenn alle sechs Elemente zusammenspielen, dann entsteht so etwas wie eine chemische Reaktion, die eine immense Energie freisetzt – der Antrieb für Ihr neues, besseres Leben. Um die Kraft der sechs Elemente freizusetzen, brauchen Sie eine entscheidende Kompetenz – den Willen und die Bereitschaft, sich zu verändern. Denn nur wer bereit ist, sich zu verändern, ist auch in der Lage, besser zu werden. Darum ist dieses Buch, das Sie hier in den Händen halten, nicht nur ein Buch über Erfolg und Glück. Es ist in allererster Linie auch ein Buch über die Kraft der Veränderung. Sich weiterzuentwickeln und zu verändern ist die größte Leistung, die höchste Belohnung des Lebens.
Und glauben Sie mir, ich weiß, was das bedeutet. Oft, leider viel zu oft, musste ich selbst lernen, mich zu verändern, und das meist auf die harte Tour. Es gab auch Momente, da hätte ich mich ändern müssen – und habe es dann doch erst viel später getan, als es notwendig gewesen wäre. Auf diese Erfahrungen bin ich nicht stolz. Und doch haben mich auch Rückschläge dazu gebracht, neue Perspektiven zu finden, auf meine Umgebung und auch auf mich selbst. Ich habe gelernt: Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein wichtiger Teil davon. Der Weg, den ich gegangen bin, ist zu einem Teil meiner Geschichte geworden. Diese Geschichte will ich nun mit Ihnen teilen. Wie ich Fehler gemacht habe, wie ich bereit wurde, Änderungen zu akzeptieren und selbst zu gestalten. Wie ich mir ein Mindset angeeignet habe, mit dem ich mir eine Flexibilität bewahre, auf alle Eventualitäten zu reagieren. Vielleicht hilft Ihnen dieses Buch, meine Fehler nicht zu wiederholen und dennoch aus meinen Erkenntnissen lernen zu können.
Ich habe diese Zeilen im ersten Halbjahr 2021 geschrieben. Zu einer Zeit, in der die Corona-Pandemie die gesamte Welt im Griff hatte. Ich bin überzeugt, dass diese Zeit eine Zäsur war. Und dass die Welt sich von nun an noch schneller und noch radikaler verändern wird, als sie es in den letzten Jahren sowieso schon getan hat. Es wird künftig von größter Bedeutung sein, sich auf Veränderungen einzustellen, um auch in der zukünftigen, der neuen Welt zu bestehen, in der viele Karten neu gemischt werden. Wenn Sie bereit sind, Änderungen zu akzeptieren und Veränderungen als Grundprinzip Ihres Denkens und Handelns annehmen, dann werden Sie in dieser neuen Welt zu den absoluten Gewinnern gehören.
Ich werde Ihnen nun auf den folgenden Seiten die einzelnen sechs Elemente vorstellen, werde darstellen, warum diese Elemente so zentral für Ihren Erfolg sind, und Ihnen schließlich praktische Tipps geben, mit denen es Ihnen gelingt, diese neue Struktur in Ihr Leben und in Ihren Alltag zu integrieren. Hin und wieder werde ich Ihnen ergänzend dazu einige clevere Start-up-Ideen vorstellen, die Ihnen den Alltag ein gutes Stück weit erleichtern können. Zum Abschluss des Buches werden wir dann noch einen gemeinsamen Blick auf diese neue veränderte Welt werfen, unsere unmittelbare Zukunft. Denn dieser Blick wird uns zeigen, warum der Mut zur Veränderung von so zentraler Bedeutung in einer Welt ist, die sich gerade massiv im Umbruch befindet.
Wenn Sie mehr aus Ihrem Leben machen wollen, dann verlassen Sie sich nicht auf Ihr Glück. Dann vertrauen Sie nicht auf Ihr Schicksal. Dann vertrauen Sie auf sich selbst. Erfolg fordert Regeln. Erfolgreiche Menschen hatten nicht mehr Glück. Sie haben ihr inneres Potenzial stärker genutzt. Und wie das geht, werde ich Ihnen zeigen.
Der beste Moment, Ihr Leben zu verändern – der ist jetzt!
Carsten Maschmeyer, München im September 2021
I. ELEMENT:
ARBEIT
Das hier war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. »Arzt!«, hatte ich geantwortet und mir nicht viel dabei gedacht. Die Frage war ja ganz klar gestellt. »Was wollen Sie werden, Maschmeyer?« Hätte ich gewusst, was eine klare, ehrliche Antwort hier für Ärger nach sich ziehen würde, ich hätte wohl eher »Notfallsanitäter« gesagt. Aber nun war es zu spät. Arzt. Das Wort war ausgesprochen. Und es sorgte für ziemliche Verstimmung bei meinem Gegenüber. Vor mir stand ein großer, breit gebauter Mann in Uniform, dessen Gesicht gerade ziemlich rot anlief. Das war Oberfeldwebel Quast. Oberfeldwebel Quast war mein direkter Vorgesetzter bei der Bundeswehr, und er war in der Kaserne für genau zwei Dinge bekannt: Erstens war er ein Tyrann, der absolut keine Gnade kannte, und zweitens hasste er Abiturienten. Er hasste sie abgrundtief. Und er liebte es, an ihnen seine offenbar ganz stark ausgeprägte sadistische Ader auszuleben. Das wusste ich allerdings nicht. Noch nicht. Aber weil ich nun einmal frisch vom Gymnasium kam und auf die Frage nach meinen beruflichen Zielen eine naiv-ehrliche Antwort gegeben hatte, sollte sich das ganz bald ändern.
»Arzt also«, entgegnete Quast höhnisch. »Maschmeyer, der Wichtigtuer! Ein Arzt will er werden.« Ja, ich wollte Arzt werden. Das war gar nicht so abwegig. Schließlich machte ich Dienst in einer Sanitätsakademie.
Quast passte das gar nicht. Er wusste, dass Abiturienten bei der Bundeswehr eine Art Abkürzung nehmen konnten, wenn sie sich nur für zwei Jahre als Zeitsoldat verpflichteten und für die Reserveoffizierslaufbahn anmeldeten. Dass sie relativ schnell befördert wurden, während er, Quast, bereits seit 20 Jahren dabei war und noch immer auf dem Posten eines Oberfeldwebels festhing. Aus seiner Sicht waren Typen wie ich also eine Provokation. »Hält sich wohl für was Besseres, der Maschmeyer, hm?«, setzte er noch einmal nach.
Und da er es einfach nicht bleiben ließ und ich mit den Gepflogenheiten bei der Bundeswehr noch nicht so wirklich vertraut war, machte ich gleich den nächsten Fehler. »Darf ich eine Frage stellen, Herr Oberfeldwebel?«
»Fragen Sie, Rekrut!«
»Was haben Sie da für ein Abzeichen, Herr Oberfeldwebel?«
»Fallschirmspringerabzeichen in Gold.«
»Kriegt da jeder so ein Abzeichen?«
»Nein. Ab 50 Sprüngen«, entgegnete er stolz.
»Wissen Sie eigentlich«, setzte ich vor versammelter Mannschaft nach, »dass pro Fallschirmsprung eine gewisse Anzahl an Gehirnzellen stirbt?«
Das war natürlich nicht gerade klug. Eigentlich war das auch gar nicht meine Art. Aber nach meinem recht guten Abitur, sportlichen Siegen und Anerkennung durch meine Freundin hatte ich neues Selbstbewusstsein aufgebaut. Es tat mir zumindest in dieser Situation nicht sonderlich gut.
Von diesem Moment an war klar, dass Oberfeldwebel Quast und ich keine Freunde mehr werden würden. Und das ließ er mich auch spüren. Etwa beim Stubendienst. Wir waren damals mit acht Männern auf einer Mannschaftsstube untergebracht. Während die anderen schon schlafen durften, musste der Stubendienst als Einziger noch wach bleiben, in Uniform, und Rapport erstatten, wenn der diensthabende Vorgesetze zur Inspektion kam. Es war ein einstudiertes Routine-Ritual. Eigentlich. Doch nicht, wenn Oberfeldwebel Quast den Nachtdienst hatte. Er kam in die Stube, ich stellte mich vor ihm auf, salutierte und spulte die einstudierte Formel ab: »Stube 17, gelüftet und gereinigt. Alle im Bett.«
Eigentlich hätte Quast jetzt genickt, salutiert und mir zu verstehen gegeben, dass ich mich ebenfalls schlafen legen dürfte. Eigentlich. Aber da ich nun einmal Quasts Lieblingsopfer war, legte er bloß seinen Kopf schräg und schaute mich mit einem süffisanten Grinsen an.
»Alles klar, Maschmeyer, die Stube ist gelüftet und gereinigt, ja? Das wollen wir jetzt mal sehen.« Er ging zwei Schritte an mir vorbei, zog sich ein Tempotaschentuch aus der Uniform, öffnete das Fenster und wischte über den Innenrahmen. Dann hielt er mir das dunkel gefärbte Taschentuch wie eine Trophäe vor die Nase. »Ich denke die Stube ist gereinigt, Maschmeyer? Gehört das Fenster etwa zum Nachbarhaus? Ich komme in einer Stunde wieder.«
Ich atmete schwer durch, holte mir Eimer und Lappen und putzte die Fenster noch einmal gründlich von außen und von innen inklusive Rahmen. Nach einer Stunde kam Quast wieder. Ich nahm Haltung an und salutierte: »Stube 17, gelüftet und gereinigt. Alle im Bett.«
Quast schaute mir ein paar Sekunden in die Augen. Dann zog er ein weißes Wattestäbchen aus der Uniform und steckte es ins Schlüsselloch. Als er es mir anschließend unter die Nase hielt, war es grau. So sehr ich Quast auch verachtete, nötigte er mir auch ein klein wenig Respekt ab. Er kannte alle, wirklich alle Tricks, um einen Menschen zu erniedrigen, dachte ich.
»Maschmeyer«, setzte er an. »Die Tür gehört wohl nicht zum Zimmer? Ich komme in einer Stunde wieder.«
Das hat er dann noch einmal wiederholt. Wahrscheinlich wollte er dann irgendwann auch selber einmal schlafen gehen. Die Nacht jedenfalls war sehr kurz. Für uns beide.
Ein paar Tage später erwartete mich dann auch schon die nächste Schikane. Wir hatten einen Befehl auszuführen, der wirklich keinen Sinn ergab. Also beging ich den Fehler, ihn zu hinterfragen. Für Oberfeldwebel Quast ein Sakrileg! Der arrogante Maschmeyer schon wieder. Jetzt stellt er auch noch Befehle der Unteroffiziere infrage. Ich bereute meine Aussage schon in dem Moment, in dem ich sie gemacht hatte. Mensch, Carsten, warum kannst du denn nicht einmal im richtigen Moment deine viel zu große Klappe halten? Aber da war es auch schon zu spät.
»Maschmeyer«, brüllte mich Quast an, und ich erkannte schon an der Rotfärbung seiner Haut, dass es mich dieses Mal ganz besonders hart treffen würde. »Haben Sie Briefpapier auf der Stube?« Ich nickte. »Dann werden Sie heute Abend einen Brief an Ihre Eltern schreiben, dass Sie dieses Wochenende nicht nach Hause kommen werden! Sonderdienst! Und jetzt«, schnaufte er und schmiss mir eine ABC-Gasmaske vor die Füße, »jetzt laufen Sie in Höchstgeschwindigkeit zurück in die Kaserne und richten dort aus, dass wir gerade Mittagspause machen. Anschließend kommen Sie sofort zurück, verstanden?«
Ich salutierte und setzte die blöde Maske auf, unter der ich beinahe erstickt wäre. Zurück zur Kaserne. Na super. Wir waren auf einem Übungsgelände, rund fünf Kilometer von der Kaserne entfernt. Das würde ein strammer Lauf werden. »Und Maschmeyer«, rief mir Quast noch hinterher, »vergessen Sie Ihren Rucksack nicht.« Ich stöhnte lautlos in meine ABCMaske hinein, ging zurück, schulterte meinen 20-Kilo-Rucksack und lief dann los. Als ich endlich außer Sichtweite war, setzte ich meine Maske ab und bereute meine große Klappe.
Für mich waren diese Momente eine Qual. Ich habe mich gefragt, wie man Menschen nur so behandeln kann. Wenn ich an meine Bundeswehrzeit denke, dann denke ich an Angst, Bestrafung, Sonderdienst und Nachtschicht. Und an das Gefühl, ausgeliefert und wehrlos zu sein. Meinen Kameraden und mir war damals klar, dass wir keine Chance hatten, etwas gegen die Schikanen zu tun. Die Oberen hielten zusammen. Das war eiserner Grundsatz. Wer versuchte, sich zu beschweren, der hatte es noch einmal wesentlich schwerer, als er es im Zweifel sowieso schon hatte. Es gab keinen Ausweg. Also galt: Zähne zusammenbeißen und durch.
Für mich war meine Zeit bei der Bundeswehr eine Fortsetzung dessen, was ich zu Hause mit meinem Stiefvater erlebt hatte. Dort herrschte die ganze Zeit eine sehr autoritäre Stimmung. Es wurde gedroht und gestraft – oft von meiner Mutter in Form von Missachtung. Dabei waren die Bestrafungen gar nicht mal das große Problem. Sie waren unangenehm, ja, aber sie waren durchzustehen und nicht von langer Dauer. Viel schlimmer für mich war das permanente Klima der Angst. Das Gefühl zu haben, dass jeder Fehler sofort sanktioniert wurde. Die gesamte Schikane und Mobberei, die schlug mir doch recht stark aufs Gemüt. Und das schien sich nun beim Bund zu wiederholen. Aber irgendwie hielt ich durch. Ich wusste ja, dass es nicht mehr lange war. Dass es absehbar war. Ich musste nur noch ein paar Monate bei der Bundeswehr durchhalten. Dann nichts wie weg.
Und in solchen Momenten dachte ich darüber nach, wie ich mein Leben in Zukunft leben will. Und da wurde mir eine Sache ganz klar: Ich will niemals wieder irgendwo sein, wo ein solches Klima der Angst und der Unterdrückung herrscht. Wahrscheinlich ist man als Soldat eine Art Angestellter, ein Angestellter auf dem untersten nur vorstellbaren Hierarchielevel. Das würde ich nie wieder haben wollen. Egal wo ich arbeite, dachte ich, aber ich werde in keinem Unternehmen angestellt sein, in dem man so mit seinen Mitarbeitern umgeht. Und wenn ich eines Tages vielleicht sogar einmal selber Chef sein werde, dachte ich, dann werde ich alles ganz anders machen. In meiner Firma sollen die Angestellten und Mitarbeiter Spaß haben. Sie sollen mit einem guten Gefühl ins Büro kommen, nicht mit Bauchschmerzen. Ich würde es anders machen, versprach ich mir, ich würde meine Mitarbeiter mit Lob, Anerkennung und Komplimenten motivieren. Positives Verhalten durch Zustimmung und leistungsgerechte Bezahlung bestärken, statt schlechtes Verhalten durch Bestrafung korrigieren. Das wäre mein Weg, dachte ich. Wenn ich eines Tages mal in der Position wäre, ein Chef zu sein, dann würde ich alles ganz anders machen.
Warum Arbeit ein Element Ihres Erfolgs ist
Mir wurde durch meine negativen Erfahrungen bei der Bundeswehr schon sehr früh bewusst, wie wichtig ein gutes Arbeitsklima ist. Denn das Unternehmen, für das Sie arbeiten, ist nicht einfach nur das Unternehmen, für das Sie arbeiten. Ihr Job ist in der Regel ein sehr großer und nicht zu unterschätzender Bestandteil Ihres Lebens. Sie sehen Ihre Kollegen in den allermeisten Fällen öfter als Ihre besten Freunde und werktags von Ihrer wachen Zeit länger als Ihre Familie. Ihre Arbeit ist Ihr soziales Umfeld. Entsprechend ist der Erfolg im Arbeitsleben für Ihr Wohlbefinden ein zentrales Element. Egal ob Sie Chef oder Angestellter sind, wenn Sie im Job Ärger haben, dann werden Sie diesen Ärger mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Ihr Privatleben tragen. Wenn Sie sich im Büro nicht wohlfühlen, dann fühlen Sie sich als Mensch ganz allgemein nicht wohl. Die Zeit, die Sie mit Ihrem Job verbringen, ist niemals losgelöst von Ihrem privaten Leben. Wenn Sie erfolgreich im Leben sein wollen, brauchen Sie also auch ein Arbeitsklima, in dem Sie sich wohlfühlen.
Im folgenden Kapitel möchte ich Ihnen nun also zeigen, wie Sie es schaffen können, das erste Element Ihres Lebens stabil aufzustellen – Ihre Arbeit. Zunächst einmal werden wir die Grundlagen für ein gutes Arbeitsleben beleuchten. Es gibt drei Voraussetzungen, die erst einmal erfüllt sein müssen, damit Sie überhaupt die Chance haben, ein positives Arbeitsumfeld aufzubauen. Im zweiten Schritt werde ich Ihnen dann konkrete Tipps an die Hand geben, wie Sie Ihre Leistung, Ihre Performance, bei der Arbeit verbessern können, um die Einkommensleiter noch ein Stückchen weiter hinaufzuklettern. Im letzten Teil schließlich werde ich all den Menschen noch ein paar Tipps an die Hand geben, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen; die selber zu Gründern werden möchten und somit wiederum Einfluss darauf nehmen, die Grundvoraussetzungen für ein gutes Arbeitsleben anderer Menschen zu schaffen.
1. Grundlagen
Ihre Arbeit erfüllt Sie nicht? Bringen Sie sie in Einklang mit Ihren privaten Interessen!
Nach meiner Bundeswehrzeit entschied ich mich, meine Ankündigung gegenüber Oberfeldwebel Quast wahrzumachen. Ich würde Arzt werden. Das hatte ich nicht nur dem Feldwebel gesagt, sondern es auch meiner Mutter versprochen, die Zeit ihres Lebens unbedingt wollte, dass etwas Besonderes aus ihrem Sohn wird. Arzt, das war für sie besonders genug. Ein guter, ein angesehener Job, mit dem man viel Geld verdienen konnte.
Also hatte ich mir viel Mühe gegeben, ein ordentliches Abitur hinzulegen, und wartete während der Bundeswehrzeit auf einen hoffentlich positiven Bescheid der Zentralen Vergabestelle für Studienplätze. Mitten während meiner Bundeswehrzeit bekam ich dann zuerst einen Platz in Berlin, wo ich aber damals, im Jahr 1979, nicht hinwollte, und ein halbes Jahr später an der Medizinischen Hochschule Hannover. Mit dieser schönen Perspektive verging die restliche Bundeswehrzeit leichter und schneller. Um mir mein Studium finanzieren zu können, musste ich allerdings irgendwie an Geld kommen. Finanzreserven hatte ich entgegen meiner Planung durch Blödsinn mit Autos (dazu mehr im Geldkapitel) leider nicht. Aber die Bücher, die Miete und die Lebenshaltungskosten zahlten sich schließlich nicht von allein. Ich musste arbeiten.
Neben der Bundeswehr oder später, neben dem Studium, zu arbeiten war für mich nichts Außergewöhnliches. Ich habe schon früh angefangen, Geld zu verdienen. Notgedrungen. Ich stamme aus ziemlich armen Verhältnissen. Es wurde nur das Nötigste gekauft, alles gespart für später. Die damals typische Denke der Kriegsgeneration. Also versuchte ich schon immer, mir zu meinem doch sehr dürftigen Taschengeld irgendwie etwas dazuzuverdienen. Anfangs habe ich noch das Essensgeld, dass ich für die Schule bekam, umfunktioniert. Statt mir davon Essensmarken zu kaufen, um mittags eine warme Mahlzeit in der Schulkantine zu bekommen, habe ich das Geld gespart und mir mit knurrendem Magen lieber ein paar coole Schallplatten gekauft. Rock und Pop war meine heimliche Leidenschaft, und für die neueste Platte der Rolling Stones nahm ich auch ein paar Tage ohne Mittagessen in Kauf. Diese Leidenschaft sollte ein klein wenig mein Schicksal bestimmen. Denn dank meiner Liebe zur Musik sollte ich bald meinen allerersten richtigen Job bekommen. Ich ging damals abends dann und wann zu einem alten Kulturverein. Das »Zyklus 66« war in Hildesheim ziemlich bekannt, immer wieder gab es hier gute Konzerte, für die ich mir den Eintritt meistens nicht leisten konnte. Eines Tages bekam ich zufällig mit, dass jemand gesucht wurde, der die Plakate für die kommenden Veranstaltungen in der Stadt, zum Beispiel an Bauzäunen, anklebte. Plakatkleber! Das war doch genau das Richtige für mich. Ich meldete mich sofort! Und so verdiente ich mit 15 Jahren mein erstes Geld. Für ein kleines Plakat bekam ich 40 Pfennig, und wenn es größere waren, waren es 50 Pfennig. Heute wären das umgerechnet 25 Cent.
Der Job war relativ einfach: Ich fuhr mit meinem Fahrrad quer durch die Stadt – links am Lenker hing ein Eimer mit Kleister, rechts eine Plastiktüte mit Plakaten – und wenn ich einen Bauzaun oder ein leer stehendes Gebäude entdeckte, dann pappte ich die Plakate dran. Damals habe ich eine entscheidende Lektion gelernt. Ich habe den Wert von leistungsorientierter Bezahlung verstanden. Ich verdiente mein Geld nicht damit, möglichst lange mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, sondern ich verdiente mein Geld damit, so viele Plakate wie möglich aufzuhängen. Wenn ich also besonders schnell war, dann konnte ich auch mehr Geld in der Stunde verdienen. Das war ein System, das mir gefiel.