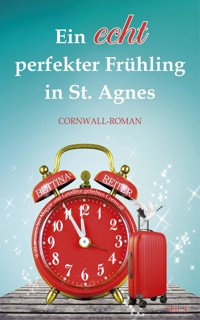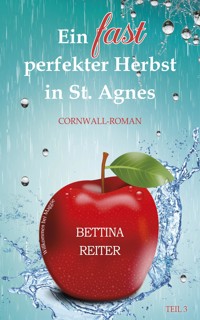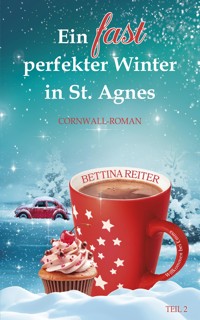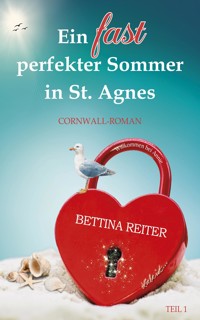5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter von White Manor
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein Anwesen, umrankt von Liebe, Hass und Intrigen: »Die Töchter von White Manor – Schicksalsjahre« von Bettina Reiter als eBook bei dotbooks. Eine Frauensaga aus der Grafschaft Kent, dem wunderschönen Garten Englands, im 17. Jahrhundert … Dem Schein nach hat Mary-Ann alles, was ihre Familie sich für sie gewünscht hat: einen einflussreichen Mann, Ansehen, eine glückliche Ehe. Nur ihre Zofe Victoria ahnt, dass Mary-Ann in einem goldenen Käfig gefangen ist – das Einzige, was für ihren jähzornigen Ehemann James zählt, ist ein männlicher Erbe. Erst, als Mary-Ann dem charismatischen John van Hoven begegnet, wagt sie, auf ein anderes Leben zu hoffen … Und auch Victoria wird vor eine verhängnisvolle Wahl gestellt, als eine dunkle Wahrheit das Leben beider Frauen erschüttert und wie ein Sturm über White Manor heraufzieht! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Schicksalsroman »Die Töchter von White Manor – Schicksalsjahre« von Bettina Reiter ist der erste Band ihrer Upstairs-Downstairs-Saga, die Fans von »Downton Abbey« und »Poldark« begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Frauensaga aus der Grafschaft Kent, dem wunderschönen Garten Englands, im 17. Jahrhundert … Dem Schein nach hat Mary-Ann alles, was ihre Familie sich für sie gewünscht hat: einen einflussreichen Mann, Ansehen, eine glückliche Ehe. Nur ihre Zofe Victoria ahnt, dass Mary-Ann in einem goldenen Käfig gefangen ist – das Einzige, was für ihren jähzornigen Ehemann James zählt, ist ein männlicher Erbe. Erst, als Mary-Ann dem charismatischen John van Hoven begegnet, wagt sie, auf ein anderes Leben zu hoffen … Und auch Victoria wird vor eine verhängnisvolle Wahl gestellt, als eine dunkle Wahrheit das Leben beider Frauen erschüttert und wie ein Sturm über White Manor heraufzieht!
Über die Autorin:
Bettina Reiter wurde 1972 geboren und arbeitet im sozialen Bereich. Neben dem Schreiben malt und fotografiert sie leidenschaftlich gerne. Sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Tirol.
Die Website der Autorin: www.bettina-reiter-autorin.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Bettina Reiter ihre »White Manor«-Saga mit den Bänden »Schicksalsjahre« und »Sturmwellen«.
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe Dezember 2021
Dieses Buch erschien bereits unter dem Titel »Erben der Schuld« 2008 im Sieben Verlag und 2014 bei dotbooks.
Copyright © der Originalausgabe 2008 Sieben Verlag
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2014, 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/faestock, Toivo-Media, Vasya Kobelev, Ratana21
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-95520-700-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »White Manor 1« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Bettina Reiter
Die Töchter von White Manor – Schicksalsjahre
Roman
dotbooks.
Für meinen Papa
Danke für deinen letzten Rat,
für deinen Stolz und für deine Liebe
Prolog
Der bestialische Gestank des Krieges lag in der Luft. Es roch nach Fäulnis, Verwesung und Seuchen. Vereinzelt sah man Rauchschwaden gen Himmel steigen. Zahllose Feuer brannten die letzten Reste einstiger Prachtbauten Londons bis auf die Grundmauern nieder. Plötzlich ließ eine Explosion die Stadt erzittern. Eine Stadt, von der nichts mehr übrig war. Der frühere Glanz war erloschen und einem Bild des Grauens gewichen.
Inmitten des Durcheinanders irrten Menschen ziellos umher und schrien nach ihren Angehörigen oder Freunden. Andere wiederum suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Mit bloßen Händen gruben sie, verzweifelt weinend und doch noch hoffend. Einige saßen jedoch mit ausdruckslosem Blick da und wiegten ihre toten Kinder in den Armen.
Doch auf einmal wichen Aufruhr und Geschrei einer beinahe gespenstischen Stille, als wolle eine höhere Macht den Gepeinigten ein kurzes Aufatmen gönnen. Nur das Wimmern einer Frau war zu hören. Manche schauten in die Richtung, aus der das Wehklagen kam und nickten mit ihren Köpfen, als würden sie der wortlosen Anklage zustimmen. Aber auch das Wimmern wurde leiser und verlor sich hinter dem verbliebenen Mauerwerk eines eingestürzten Hauses, wo die Frau lag. Einige Strähnen ihrer langen dunkelblonden Haare klebten in ihrem verhärmten Gesicht, das von Ruß bedeckt war. Helle Linien zeugten von Tränen.
Plötzlich schrie sie aus Leibeskräften und legte ihre Hand schützend auf den gewölbten Leib. Dabei atmete sie schwer und ruhelos.
»Oh Gott, weshalb tust du mir das an?«, schluchzte sie und merkte, wie die Kräfte sie allmählich verließen. Verzagt schloss sie die Augen, um einen kurzen Moment auszuruhen. Dabei dachte sie an den Vater ihres Kindes, der sofort die Flucht ergriffen hatte, als sie ihm die Schande beichtete. Nur sein geheucheltes Heiratsversprechen war zurückgeblieben. Dennoch hatte sie die Hoffnung nie aufgegeben, dass er sich eines Tages zu ihnen bekennen würde, aber er war bei der Schlacht in Somerset gefallen. Und nun hatte sie niemanden mehr. Nach Hause konnte sie keinesfalls und hier draußen tobte der Krieg. Ihre Lage war völlig aussichtslos.
Aber sie hatte keine Zeit, um weiter darüber nachzudenken. Wieder durchfuhr sie die Pein, als hätte ihr jemand einen Dolch in den Leib gerammt. Sie stöhnte auf und wischte sich über die erhitzte Stirn. Als die Wehe endlich vorüber war, ließ sie sich erschöpft auf ihr karges Lager zurückfallen und griff neben sich. Die Klinge des Messers fühlte sich kalt an. Ihre Hand zitterte, als sie sich dreimal bekreuzigte. Eine Todsünde, dessen war sie sich bewusst, aber auch der letzte Ausweg aus diesem Elend.
»Einst habe ich deinen Vater geliebt«, flüsterte sie heiser. Ihre eigene Stimme kam ihr fremd vor, doch das zärtliche Streicheln über ihren Bauch war umso vertrauter. Sie schluchzte, beschämt über ihr Vorhaben, auch wenn es keine andere Möglichkeit gab. Und wem war sie Rechenschaft schuldig, versuchte sie ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Auch sie selbst würde aus dem Leben scheiden. Der Einzige, dem sie Abbitte leisten musste, war Gott. Er würde hart mit ihr ins Gericht gehen, denn sie würde als Mörderin vor ihm stehen.
Die nächste Wehe war stärker als alle zuvor. Sie hörte das Knirschen ihrer Zähne, bis der Schmerz wieder nachließ. Aber die Abstände der Wehen wurden immer kürzer. Und dann, als sie es kaum noch aushalten konnte, hörte sie den Schrei ihres Kindes.
Erschöpft durchtrennte sie die Nabelschnur und ließ das Messer fallen, weil es sich wie glühendes Eisen anfühlte. Dennoch starrte sie ständig auf die Waffe, während sie mit dem Saum ihres Kleides notdürftig über ihr Kind wischte und das weinende Bündel dann hastig in ein zerschlissenes graues Tuch wickelte.
Da lag es nun, ihr Kind, ihr Fleisch und Blut. Bereit, es anzusehen und als kleines Wunder zu bestaunen, aber sie konnte es nicht. Noch immer schweratmend blickte sie um sich und nahm erst jetzt wahr, dass die kalte Nacht bereits dem Morgen gewichen war. Der Himmel hatte sich glutrot verfärbt, dennoch wirkte alles trostlos.
Bis sie den innerlichen Kampf aufgab. Das Herz siegte über die Vernunft, sie konnte nicht anders als ihr Kind zu betrachten. Es war jener Moment, vor dem sie sich am meisten gefürchtet hatte. Ahnend, dass die Liebe zu ihrem Kind stark sein würde. Doch die Wirklichkeit war nicht in Worte zu fassen und verscheuchte die drohenden Schatten.
Vorsichtig nahm sie ihr Kind in die Arme, streichelte über das kleine Gesicht und liebkoste es immer wieder. Die Zeit verlor sich, bis ihr bewusstwurde, dass sie nicht länger daran festhalten durfte, denn bereits jetzt schien ihr Vorhaben unmöglich geworden zu sein.
Abermals lag ihre Hand auf dem Messer. Einen winzigen Augenblick noch, dann umfasste sie es und fuhr mit der Klinge bedächtig über ihr Kleid, um die Blutspuren der Geburt zu beseitigen. Fast hätte sie laut gelacht. Wozu reinigte sie die Klinge?
Um Zeit zu gewinnen, hämmerte es in ihrem Inneren, denn wie kannst du dein eigenes Kind töten?
Unmerklich drückte die Frau ihr Kind fester an sich. Das Weinen wurde lauter, auch die andere Stimme in ihr. Tu es! Was kannst du deinem Kind schon bieten außer Schande und Armut? Also tu es, tu es doch endlich!
Tränen traten aus ihren Augen, als sie die Waffe gegen ihr Kind richtete. Die silberne Klinge war dem Hals so nahe, dass die Spitze die zarte Haut berührte. Doch plötzlich brach sich das Sonnenlicht im glänzenden Metall und blendete die Frau. Voller Abscheu warf sie das Messer weit von sich. Sie konnte ihr Kind nicht töten. Niemals! Sie liebte es schon zu sehr, um wieder von ihm getrennt zu sein. Gott hatte ihr ein Zeichen gesandt, und ihr Kind vor dem sicheren Tod bewahrt.
Aber tat er nicht dasselbe für sie? Auch sie hatte überlebt. Nach allem, was hinter ihr lag. Nach allem, was sie aufgeben musste, glich es einem Wunder. Doch sie hätte ihr feudales Leben jederzeit mit dieser Armut eingetauscht und auch wenn sie keiner darauf vorbereitet hatte, würde sie es schaffen. Mit, und vor allem für ihr Kind.
»Ich liebe dich, mein kleiner Engel.« Zärtlich küsste sie ihr Kind auf die Stirn. »Nie werde ich mir verzeihen können, was ich dir beinahe angetan hätte. Aber ich verspreche dir, dass du ein schönes Leben haben wirst, einerlei was es mich kostet!«
»Na, wen haben wir denn da?«, vernahm sie plötzlich eine zynische Stimme. Ihre Nackenhaare sträubten sich, da sie ahnte, wer vor ihr stand. Der alte Ripley, der gerade noch ihre Gedanken beherrscht hatte und den sie in der Hölle zurückgelassen wähnte.
Ein tiefer Atemzug, dann hob sie entschlossen den Blick. Ripley harrte grinsend neben ein paar Mauerbrocken. Kalte Schauer rieselten über ihren Rücken.
»Was wollen Sie?« Ihre Stimme zitterte und sie hoffte inständig, dass er sie nicht erkannte. Gleichzeitig wusste sie, dass dies nur der Wunsch einer Verzweifelten war. »Ich habe weder Geld noch Brot. Bei mir gibt es nichts zu holen!«
»Da wäre ich mir nicht so sicher!« Er kam näher. Sie versuchte aufzustehen. Sie musste flüchten, sofort! Wer wusste, was Ripley mit ihr vorhatte. Aber als sie sich endlich mühsam erhoben hatte, stand er dicht vor ihr. »Wir haben uns lange nicht mehr gesehen«, raunte er. Sein fauliger Atem schlug ihr entgegen. »Du hast dich gut versteckt, aber nicht gut genug.«
Ein Knall zerriss plötzlich die Luft. Entsetzt starrte sie in Ripleys verhasstes Gesicht. Nahm die rauchende Faustbüchse in seiner Hand wahr. Fühlte den grellen Schmerz in ihrem Bauch und hörte ihr Kind wimmern, während sie rückwärts taumelte, bis ihr die Mauer Einhalt gebot.
Sie wollte etwas sagen, aber ihrer Kehle entrang sich nur ein gurgelnder Laut. Tränenblind presste sie ihr Kind an sich, das sie nicht mehr beschützen würde können, und nur mit letzter Kraft ließ sie sich behutsam zu Boden gleiten. Darauf bedacht, ihr Kind nicht fallenzulassen. »Ich liebe … dich, mein … Engel.« Schluchzend umschlang sie ihr Kind.
Sekunden später sackte ihr Kopf zur Seite.
Ripley senkte seine Faustbüchse und riss ihr das weinende Bündel aus den Armen. »Das wird dem Meister gefallen«, murmelte er hämisch und durchsuchte die Frau nach Wertsachen, aber er fand nichts Lohnendes. Wütend darüber versetzte er ihr einen Stoß mit dem Fuß. »Weiber«, zischte er, während das Kind unter seiner harten Umklammerung immer lauter brüllte. »Sei still, du Balg.« Er sah sich nach allen Seiten um, als er die Zufluchtsstätte der jungen Frau verließ. Dann hastete er vorwärts, denn er wollte seine Beute so schnell wie möglich abliefern.
Kapitel 1
England, 24. Juli 1643
Mary-Ann stand auf der Veranda im ersten Stock. Sie hatte sich bereits für das Abendessen umgezogen und hoffte, dass James mit der Wahl ihrer Robe zufrieden sein würde. Doch es war fraglich, ob ihr Mann das Dinner mit ihr einnehmen würde, denn er hatte bereits zur nachmittäglichen Teestunde mit Abwesenheit geglänzt und wie so oft tappte sie über seinen Verbleib im Dunkeln. Aber als Besitzer eines der größten Landsitze Kents war sie es gewohnt ihn mit seiner Arbeit zu teilen, wenn auch ungern. Viel lieber wäre sie mit ihm durch die wunderschöne Natur spaziert, so wie damals, als er ihr den Hof gemacht hatte.
Der laue Abend, über dem die flirrende Hitze des Sommertages lag, kündigte sich mit einem tiefen Rot am Horizont an. Noch immer war kein Windhauch zu spüren und Mary-Ann wurde erneut bewusst, wie sehr sie die Landschaft rund um White Manor liebte. Besonders die zahlreichen Eschen hatten es ihr angetan, deren zylindrische Kronen sich ausladend zum Himmel streckten und deren Starrheit an unbewegliche Wächter erinnerte. Hoheitsvoll umsäumten sie das weiß getünchte, barocke Herrenhaus mit den kunstvoll verzierten Säulen, das sich majestätisch von der übrigen Landschaft abhob und inmitten eines riesigen Parks lag. Dessen Farbenvielfalt ergab einen fast exotischen Kontrast zum umliegenden Weideland, auf dem eine Schafherde graste.
Nicht weit davon entfernt, jenseits des im zarten Abendlicht glitzernden Baches, befand sich die Pferdekoppel. Prachtvolle Hengste lagen träge auf der Erde. Manche schüttelten unablässig ihre Mähnen, um die zahlreichen Fliegen zu vertreiben. Auch die übrige Gegend war ländlich, erhob sich in sanften Kreidehügeln und das kräftige Grün des riesigen Waldstücks, dem Andredsweal, schien bis zum Horizont zu reichen.
Gern wäre Mary-Ann länger im Geiste über den Grund und Boden ihres Mannes gewandelt, aber es war Zeit hinunterzugehen, da sie James um nichts in der Welt warten lassen wollte. Eilig raffte sie ihr Kleid und begab sich ins Esszimmer, das sie einer leisen Ahnung nach leer vorfand. Enttäuscht setzte sie sich und besah sich das edle Essbesteck, das ihnen ihr Bruder William zur Hochzeit geschenkt hatte. Die Handhabung der Gabel war noch immer ungewohnt. William hatte damals berichtet, dass sie zwar in Italien bereits zur guten Sitte gehörte, doch im übrigen Europa nach wie vor belächelt wurde. James hatte sich anfangs gegen das Benutzen einer Gabel gesträubt, aber inzwischen fand auch er Gefallen daran, sich am Essen nicht mehr die Finger schmutzig zu machen.
Schwere Schritte hallten plötzlich durchs Foyer. Das musste James sein und als er eintrat, lächelte Mary-Ann, doch er würdigte sie keines Blickes, sondern setzte sich ihr an der langen Tafel gegenüber. Das Hausmädchen trug die Suppe auf und zündete die Kerzen auf dem Leuchter an, der nahe der Tischkante stand. Die flackernden Flammen zischten auf kläglich verbliebenen Stumpen. Wachs fiel auf den Mahagonitisch. Eine der Kerzen ging aus. Der Docht glühte kurz auf, dann zog feiner Rauch kräuselnd in die Höhe und der typisch beißende Geruch verteilte sich im Raum. Nur das Ticken der italienischen Wanduhr und das Klappern von Besteck waren zu hören.
Plötzlich legte James den Silberlöffel beiseite, griff zur Serviette und betupfte sich die Mundwinkel, den Blick starr auf Mary-Ann gerichtet. »Hast du mir etwas zu sagen?« Er knüllte die Serviette zusammen. Seine Fingerknöchel traten weiß hervor.
»Es tut mir leid«, antwortete Mary-Ann leise und legte ebenfalls den Löffel ab, obwohl ihr Teller noch halbvoll war. Sie hielt den Blick gesenkt. »Ich habe heute meine Monatsblutung be…«
»Schweig!« Er warf das Mundtuch achtlos auf den Tisch.
»Es tut mir leid, James«, wiederholte sie mit dünner Stimme, hob den Kopf ein wenig und schaute ihn an. Dabei rollte ihr eine Träne über das Gesicht.
»Es tut mir leid«, äffte er sie nach und schlug so kräftig mit der Faust auf den Tisch, dass das vor ihm stehende Kristallglas umkippte und klirrend zerbarst. Der Rotwein ergoss sich über die Tafel und tröpfelte monoton zu Boden. »Du machst mich zum Gespött der Leute!«
Mary-Ann, die unter seinem Schlag zusammengezuckt war, faltete ihre zitternden Hände im Schoß und schwieg.
Grollen war in der Ferne zu hören.
»Ich werde mich bemühen, James«, versprach sie, konnte aber seinem Blick nicht standhalten und fixierte ihre Hände.
»Das ist zu wenig! Ich will endlich Ergebnisse sehen, hast du mich verstanden?«
»Ja«, wisperte sie und bemerkte, dass sich die Tür öffnete. Hastig wischte sie sich über die Augen und blickte hoch. Victoria, das Hausmädchen, trat neuerlich ein. Mary-Ann spürte ein wenig Trost in der Gegenwart ihrer Vertrauten.
»Hol ein neues Glas!«, befahl James und lehnte sich mit verschränkten Armen zurück. Er schaute Victoria nach, die hinauslief, um gleich darauf mit dem Gewünschten wiederzukehren. Sie stellte das Glas vor James ab, griff zur bauchigen Kristallkaraffe und schenkte ihm ein. Er lehnte sich vor, nahm das Glas und trank es in einem Zug leer. Dann hob er es Victoria wortlos entgegen, die ihm nachschenkte.
Mary-Ann hatte die Szene verfolgt und sah Victoria nun dabei zu, wie sie die Scherben einsammelte. James nippte an seinem Glas und beobachtete das Hausmädchen ebenfalls. Vorsichtig legte Victoria die Splitter in die eingenähte Tasche ihrer Schürze. Die weiße Haube war verrutscht und gab den Blick auf ihr braunes, zu einem Zopf geflochtenes, Haar frei. James trommelte mit seinen Fingern unablässig auf den Tisch.
An Victorias Hals zeigten sich rote Flecken. Emsig wischte sie den verschütteten Wein fort und trug das Geschirr ab. James hatte die Stirn gefurcht, aber er schwieg und griff wieder zum Glas. Mary-Ann war froh über diesen Aufschub, denn Privatgespräche führte er niemals im Beisein des Dienstpersonals. Er hasste nichts so sehr wie unliebsame Zuhörer, obwohl sie davon überzeugt war, dass man ihn sogar bis zu den Stallungen hören konnte, wenn er in Rage war. Konversation während des Essens war ebenso verpönt. Lediglich zwischen den Gängen war ein Gespräch erlaubt, allerdings nur dann, wenn er selbst das Wort ergriff.
Victoria servierte den zweiten Gang und zog sich danach diskret zurück. Mary-Ann sah kurz zu ihrem Mann, der schon zu essen begonnen hatte. Der zartrosa gegarte Truthahn mit einer knusprigen Kruste verströmte einen verlockenden Duft. Doch sie aß weder davon noch von den Kartoffeln, sondern stocherte lustlos darin herum. Ihr Versagen schmerzte zu sehr und schlug ihr schon seit geraumer Zeit auf den Magen. Einerseits fühlte sie sich verletzt, andererseits haderte sie mit sich selbst. Wieder einmal enttäuschte sie ihren Mann. Seine Wut, seine Beschimpfungen, all das verdiente sie. Dabei hatte ihre Liebe einst so schön begonnen.
Erneut schielte Mary-Ann zu James, der sich ganz seiner Mahlzeit widmete. Er war ein attraktiver Mann mit seinen dunkelblonden, leicht gewellten Haaren, die ihm bis zur Schulter reichten. Von Anfang an war sie von seinem Äußeren angetan gewesen. Er hatte etwas Weltmännisches, Erfahrenes ausgestrahlt. Zum ersten Mal hatten sie sich bei einem Empfang in ihrer Heimatstadt Leeds getroffen, kurz nach ihrem zwanzigsten Geburtstag.
James war geschäftlich dort gewesen, da er eine große Tuchfabrik besaß. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie er sie zum Tanz aufgefordert hatte. Ausgerechnet sie! Wohl war ihr bewusst gewesen, dass es auf diesem Fest eigens für unverheiratete Töchter aus gutem Hause, schönere und jüngere Mädchen gab. Bis zu seinem Erscheinen hatte sich kein einziger Mann für sie interessiert, als wäre sie eine Aussätzige gewesen.
Die Mädchen hatten James reihenweise angehimmelt, doch nicht einer schenkte er Aufmerksamkeit, sondern war zielstrebig auf sie zugegangen, um sie zum Tanz aufzufordern. Als sie in seinen Armen gelegen hatte und in seine blauen Augen eintauchte, war es um sie geschehen.
Nach diesem denkwürdigen Abend hatte er ihr den Hof gemacht. Es war kaum zu glauben. Weshalb fiel die Wahl dieses imposanten, zuvorkommenden Mannes ausgerechnet auf sie? Sogar sein Charakter entsprach den Vorstellungen des Mannes, von dem sie immer geträumt hatte. James teilte ihre Vorliebe für das Reiten und Pferde im Allgemeinen, gab sich gern musischen Künsten hin und fand es amüsant, wenn sie sich über Politik äußerte. Als er kurze Zeit später bei ihrem Vater um ihre Hand anhielt, hatte sie geglaubt vor Glück zerspringen zu müssen.
Ein klirrendes Geräusch riss Mary-Ann aus ihren Gedanken. James hatte sein Besteck auf den Teller geworfen. Sie bemerkte, dass sie ihn immer noch ansah. Kurz trafen sich ihre Blicke, dann schaute sie aus dem Fenster. Das Wetter hatte umgeschlagen. Es regnete bereits. Auch das Donnern kam näher.
James griff zum Kristallglas und leerte es. Nachdem er es wieder abgestellt hatte, wischte er sich mit der zerknüllten Serviette über den Mund und erhob sich. Wortlos verließ er das Esszimmer. Mary-Ann wusste, dass er sich ins Arbeitszimmer zurückzog, um seine obligatorische Zigarre zu rauchen.
Nach einigen Momenten erhob sie sich in ihrer schweren grünen Brokatrobe mit dem weit ausladenden Reifrock und trat zum Fenster. Bedrohlich türmten sich schwarze dichte Wolken am Himmel auf. Blitze entluden sich über das Land. Ein lauter, unheilvoller Donner ließ Mary-Ann zusammenzucken, bevor sie instinktiv zurückwich. Sie hatte seit jeher Angst vor dieser Naturgewalt und begann zu frösteln.
Doch auf einmal wurde sie sich des Tumults im Foyer bewusst. Angestrengt horchte sie. James schien sich über etwas aufzuregen, aber sie konnte nur Wortfetzen verstehen, weil ein tosender Donner seine Stimme übertönte. Ob sie hinausgehen sollte? Womöglich war James in Gefahr, denn in diesen Zeiten kam es öfter zu Plünderungen und Übergriffen. Andererseits empfand James selbst das Zusehen als Einmischung.
Schließlich siegte ihre Angst über die Bedenken. Entschlossen raffte Mary-Ann ihren Rock und eilte hinaus. James und Robert standen sich gegenüber. Der Stalljunge hatte einen hochroten Kopf.
»Wie zum Teufel konnte das passieren, du Taugenichts!«, schrie James, dessen lärmende Worte im Widerhall des großen Foyers verstummten. »Du wirst sie sofort suchen und Gnade dir Gott, wenn du erfolglos bist.« James riss Robert die Reitgerte aus der Hand. Der Stalljunge verzog sein Gesicht und stieß einen Wehlaut aus. In diesem Moment holte James aus. Robert verfolgte seine Drohgebärde, schaute ängstlich nach oben und erstarrte. Mary-Ann wich zurück und drückte sich an die Wand. Dann peitschte die Reitgerte mit geballter Kraft auf den Knaben ein und hinterließ binnen Sekunden eine tiefrote Strieme im kreidebleichen Gesicht.
»Das lass dir eine Warnung sein! Nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dich erwartet, wenn du versagst.« James ließ die Reitgerte fallen, schritt ins Arbeitszimmer und schmetterte die Tür hinter sich zu.
Mary-Ann bemerkte die Tränen in Roberts Augen. Sie sah, wie er seine Hände ballte, aber schließlich bückte er sich nach der Reitgerte und verließ das Haus. Eine Weile blieb sie reglos stehen und starrte vor sich hin. Der Junge tat ihr furchtbar leid. James war so wütend gewesen. Aber sie durfte und konnte sich nicht mehr einmischen. Ihr Mann hatte sie gewaltsam gelehrt die Augen zu schließen und nicht hinzusehen.
Doch das änderte nichts daran, dass sie sich in Momenten wie diesem schuldig fühlte. Wie so oft fragte sie sich, wessen Schläge schlimmer waren: Die des Handelnden oder jene des feigen Zuschauers?
»Geht es Ihnen nicht gut?« Victoria stand plötzlich vor ihr. »Madame? Soll ich Ihnen etwas holen?«
»Nein, Victoria, mir fehlt nichts.« Mary-Ann löste sich aus ihrer Lähmung und begab sich wieder in das Esszimmer. Victoria folgte ihr und machte sich daran den Tisch abzuräumen.
»Verzeihen Sie, Madame, dass ich mich nicht früher um meine Arbeit kümmern konnte, aber wir haben Rosalind gesucht«, entschuldigte sie sich und stellte das Geschirr auf das Sideboard.
Mary-Ann saß inzwischen auf der bequemen roten Chaiselongue nahe dem offenen Kamin, in dem ein paar verkohlte Scheite lagen. Angestrengt lauschte sie dem aufkommenden Wind, dessen drohendes Pfeifen dem unheimlichen Murmeln dunkler Gestalten glich, die an den Fenstern rüttelten, um sich gewaltsam Einlass zu verschaffen.
Ein Blitz zuckte.
»Schon gut, Victoria«, sagte sie schnell, presste sich in den weichen Stoff und schloss die Augen. Als das Grollen vorüber war, suchte sie Victorias Blick, die jedoch in ihre Arbeit vertieft war und die Wachsreste vom Tisch entfernte.
»Weißt du was Robert getan hat? James hat ihn … geschlagen.«
»Geschlagen?« Victoria hielt in ihrer Arbeit inne und schaute auf. Die roten Flecken am Hals hoben sich von ihrer Elfenbeinhaut ab. Ihre Wangen waren ebenfalls gerötet.
»Madame«, sprach sie leise, »Robert hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Er war auf der Weide, um Ingols beim Zusammentreiben der Schafe zu helfen. Als er zurückkam, war der Zuchthengst verschwunden.«
Mary-Ann fuhr sich mit der Hand an den Mund. Sie wusste, dass der Hengst ein Vermögen wert war, weil sie vor Monaten zufällig Zeugin eines Gespräches zwischen James und dem Stalljungen gewesen war. Ihr Mann hatte damals gedroht, Robert das Fell über die Ohren zu ziehen, falls dem Pferd auch nur das Geringste passieren würde.
»Und Rosalind ist auch nirgends zu finden, Madame.«
»Rosalind?« Mary-Ann dachte an das dünne rothaarige Mädchen, das seit zwei Jahren auf White Manor als Küchenmagd arbeitete. »Vielleicht sucht sie nach dem Hengst?«, mutmaßte sie dann.
»Mit Verlaub«, Victoria kam ein wenig näher, »Rosalinds Sachen sind ebenfalls fort. Das kann kein Zufall sein.«
»Du meinst, sie hat James bestohlen?« Fassungslos sah Mary-Ann Victoria nicken. »Aber weshalb soll sie diese Ungeheuerlichkeit getan haben?«
»Ich weiß es nicht.« Victorias Lippen wurden zu einem schmalen Strich.
»Hast du James von deinem Verdacht erzählt?«
»Nein, Madame.« Victoria wirkte plötzlich gehetzt. »Es ist nur ein Gemunkel unter dem Gesinde, damit sollte der Herr nicht belästigt werden. Ich bitte um Verzeihung, dass ich Sie damit behelligt habe.«
Mary-Ann erhob sich. »Wie auch immer, James wird diese Angelegenheit sicher klären können.« So oder so, dachte sie und hatte wieder Mitleid mit dem Jungen. »Vielleicht löst sich alles in Wohlgefallen auf. Ich bin müde und werde mich zurückziehen. Richte Melly aus, dass mein Mann morgen auf die Jagd gehen möchte. Sie soll alles vorbereiten.«
»Sehr wohl, Madame.«
***
Kurze Zeit später hastete Mary-Ann die breite Marmortreppe hinauf, eilte durch den langen Gang, dessen Wände zahlreiche Gemälde schmückten, und öffnete die letzte Tür. Ein knarrendes Geräusch war zu hören. Sie betrat die Schlafkammer, zog die Tür hinter sich zu und lehnte sich aufatmend gegen das Holz. Dieser Raum schenkte ihr wenigstens für einige Stunden Sicherheit und Geborgenheit. Auch das Grollen wurde leiser.
Nachdem sich Mary-Ann etwas gesammelt hatte, betrachtete sie wehmütig die Porzellanfiguren, die ihr Bruder aus Italien mitgebracht hatte. Wie Zinnsoldaten standen sie der Reihe nach auf dem kleinen Rosenholztischchen nahe dem Fenster. Eine Gondel aus Venedig, Kathedralen von Florenz und Mailand nebst einer Nachbildung der Sixtinischen Kapelle, die ihr Bruder in Rom erstanden hatte. Woher die restlichen Sakralbauten stammten, hatte sie längst vergessen. Aber ihre Buntheit brachte Farbe in das Zimmer und das Kerzenlicht ließ die Glasuren zart schimmern.
William! Wie es ihm wohl ging?
Mary-Anns Herz zog sich zusammen. Sie hatte lange keine Nachricht mehr von ihm erhalten. Die letzte war Ende des vergangenen Jahres gekommen. William schrieb, er habe Befehl erhalten, sich mit Hoptons Truppen zu vereinen. Von Cornwall aus wollten sie in das feindliche Gebiet marschieren. Inständig hoffte sie, dass William wohlauf war.
Seufzend löste sie sich aus ihrer Haltung und wandelte durch das Zimmer. Ihr Kleid raschelte bei jedem Schritt, bis sie einhielt und abwesend über die Teakholzkommode strich, die ein Geschenk ihres Vaters war. Kurz versank sie in die Betrachtung und setzte sich schließlich auf die Kante des Himmelbettes, dessen Stützen mit Gold verziert waren. Schwere rote Gardinen waren daran festgebunden.
Mary-Ann beugte sich vor und griff zur kleinen Figur auf dem Nachttisch. Sie stellte einen Mann mit schwarzer Maske dar, ebenfalls ein Geschenk ihres Bruders.
»Das hier ist James«, hatte er ihr damals erklärt. »Du wirst sehen, er wird seine Maske schneller fallenlassen, als es dir lieb ist.« Sie hatte William nur ausgelacht. Mit so viel Hoffnung war sie in diese Ehe gegangen und wollte James eine gute Gemahlin sein. Er hatte in der Vergangenheit sehr viel gelitten. Ein Jahr vor ihrer Hochzeit waren seine Eltern kurz hintereinander verstorben. Danach verschwand seine Schwester spurlos, die sie nur einmal gesehen hatte, und James hatte sich schwere Vorwürfe gemacht, nicht besser auf sie aufgepasst zu haben. Alle Hebel setzte er in Bewegung, aber was er auch versuchte, sie blieb verschollen und er litt unter dieser Tragödie vermutlich mehr als er zugeben wollte. Nach ihrer Heirat hatte er nie wieder darüber gesprochen, doch dieser furchtbare Verlust war sicherlich einer der Gründe, weshalb er unbedingt eine eigene Familie wollte. Und was tat sie?
Abrupt stellte Mary-Ann die Figur zurück, erhob sich und versuchte die Resignation zu verdrängen, die wie eine Schlinge ihren Hals zuschnürte. Auf einmal hatte sie das Gefühl zu ersticken und öffnete die breiten Flügeltüren, die von ihrer Kammer auf die Veranda im ersten Stock führten. Das Unwetter hatte sich verzogen. Der Regen war versiegt, die Luft kühl und klar.
Um Atem ringend trat Mary-Ann an die Brüstung, legte ihre zitternden Hände auf den breiten Sims und schaute zum Park hinunter. Ein Anblick, der sie allmählich beruhigte und dieses diffuse Herzrasen dämpfte.
Das sanfte Plätschern des Brunnens war zu hören. In seiner Nähe befand sich der Pavillon, der zu ihren Lieblingsplätzen gehörte. Von schützenden Hecken umgeben, widmete sie sich dort meistens der Stickerei, um die Langeweile zu bekämpfen.
Auch zur knorrigen Wintereiche oben auf dem Hügel hatte es sie von Anfang an oft gezogen. In der sicheren Entfernung von White Manor fiel es ihr leichter, ihrem Kummer nachzugeben. Zu Beginn hatte sie Heimweh geplagt, dann überwog James’ zunehmende Gewalt gegen sie. Die Kinderlosigkeit kam erschwerend hinzu.
Doch beide Orte hatte Mary-Ann lange nicht mehr aufgesucht. James zog es vor, sie im Haus zu halten. Wie einen Hund, dem man Gehorsam beibrachte, wenn er nicht gehorchte. Ihr Teint leide unter der Sonne, wurde James nicht müde zu erklären und führte weitere, lächerliche Gründe an. Doch am meisten schmerzte es Mary-Ann, dass sie auf ihre Stute Fee verzichten musste. Auf die langen Ausritte, die sie früher unternommen hatten. Aber wenigstens wurde ihr Pferd regelmäßig von Robert bewegt.
Oh ja, sie vermisste vieles, doch sie wollte nicht undankbar sein, denn ihr fehlte es im Grunde an nichts. Ihr Mann brachte sie in dieses wunderschöne Haus und sorgte für sie, selbst die Gewänder ließ er beim teuersten Schneider Kents anfertigen. Und wie dankte sie es James? Mit Unfähigkeit! Kein Wunder, dass sich sein Wesen so verändert hatte. Aus seiner hofierenden Zärtlichkeit waren Schläge geworden. Aus liebevollen Blicken zorniges Funkeln. Obwohl sie oft große Angst vor ihm hatte, versuchte sie es im Nachhinein immer als das zu sehen, was es letztendlich war: Ein Ausbund seiner Verzweiflung, denn seit vier Jahren waren sie verheiratet und sie hatte James noch immer kein Kind geschenkt. Und trotz ihres Versagens, ihm diesen einen Wunsch zu erfüllen, wurde er nicht müde mit ihr zu schlafen …
Das Schuldbewusstsein ließ ihr Gesicht förmlich brennen. Sie belog James und das belastete sie zusätzlich. Bislang konnte sie der geschlechtlichen Liebe nichts abgewinnen. Dennoch spielte sie ihm Leidenschaft vor, um wenigstens in dieser Sache seinen Anforderungen Genüge zu tragen. Aber lag darin die Wurzel allen Übels? Sperrte sich ihr Körper, der nach jedem Beischlaf schmerzte, wegen ihrer Heuchelei gegen sein Kind? Oder war das die Strafe Gottes für diese Heimlichkeit, die eine Sünde war? Hatte sie nicht vor dem Herrn und Schöpfer geschworen, ihren Mann zu ehren?
Verzagt schaute Mary-Ann zum Firmament. An einer Stelle hatten sich die dichten Wolken auseinandergeschoben und gaben ein Stück blassblauen Himmel frei. Vielleicht würde alles gut werden. Schließlich liebte sie James und er liebte sie. Und genau wie ihr Mann sehnte auch sie sich verzweifelt nach einem Kind. Oft stellte sie sich vor, wie anders ihr Leben verlaufen würde und auch jetzt lächelte sie, weil sie im Geiste helles Kinderlachen hörte. Hoffnung erfasste Mary-Ann, wie stets, wenn sie sich diesen Phantastereien hingab. Sobald sie James ein Kind geschenkt hatte, würde sich alles zum Besseren wenden. Er könnte wieder zu jenem Mann werden, der er einst gewesen war und sich endlich mit der Vergangenheit aussöhnen.
***
James saß hinter dem wuchtigen Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer und schaute sich stolz im prunkvollen Zimmer um. Das dunkle Edelholz war aufwändig mit Ornamenten verziert, die in goldenen Arabesken mündeten. Ein schwerer Kronleuchter hing von der Decke. Das Licht der Kerzen brach sich in den tropfenförmigen Kristallen, die den Lüster schmückten. Ein großes Bücherregal erstreckte sich fast über eine ganze Wandseite. Es war die Sammlung seines Großvaters, der sie jedoch einzig dem Zweck zufolge angeschafft hatte, um vielseitiges Interesse und Bildung auszustrahlen.
Des Lesens wegen hätte man die Bücher von James aus gerne verbrennen können. Darin ähnelte er seinem Vater nicht im Geringsten, der es sich allabendlich vor dem Kamin gemütlich gemacht hatte, um sich seichten Geschichten zu widmen. Eine Unart, die sein Großvater ebenfalls verurteilt hatte wie die geschmacklosen Gemälde über dem Kamin, die von James’ Vater im Laufe der Jahre angeschleppt worden waren. Kitschige Landschaften in schillernden Farben, die eine heile Welt darstellten. Aber die gab es nicht, schon gar nicht in diesen Zeiten. Wohl oder übel musste sich James jedoch mit den Malereien abfinden, da ihm jeder Penny zu schade wäre, um die kahlen Wände neu zu schmücken.
Lediglich das Gemälde seines Großvaters rief unbändigen Stolz in ihm hervor. Es war ein exorbitantestes Portrait und befand sich an der Wand hinter ihm. Lächelnd drehte sich James um.
Der Maler hatte seinen Großvater dargestellt, als würde er jeden Moment zum Leben erwachen. Die grauen schulterlangen Haare umrahmten das markante Gesicht mit der tiefen Falte über der Nasenwurzel. Er war eine imposante Erscheinung gewesen, mit bestechend blauen Augen, zu denen James seit jeher bewundernd aufgeschaut hatte und die ihn stets voller Liebe betrachteten.
James Oliver White, es gab niemanden, der ihn nicht gefürchtet hatte. Er nahm sich was er wollte, und wie er es wollte. Einerlei, ob es sich um Geschäftliches oder Huren handelte. Schon früh hatte ihn sein Großvater in riskante Transaktionen eingeweiht und er war der Einzige gewesen, an den er nie Hand anlegte. James erinnerte sich noch gut daran, wie er als Achtjähriger einmal auf dem Schoß seines Großvaters gesessen und aufmerksam dessen Rat angehört hatte.
Du musst dich in alle Richtungen verbiegen können, nur so kommst du ans Ziel. Sei hart, dann fürchtet man dich. Sei weich, dann achtet man dich. Menschen sind einfacher zu manipulieren als du glaubst, mein Junge. Dann hatte sich sein Großvater zu ihm gebeugt. Sein Flüstern war kaum zu verstehen gewesen. Und hüte dich vor den satanischen Gefühlen, die aus gesunden Männern elende Versager machen. Du siehst ja selbst, was aus deinem Vater geworden ist. Er macht keinen Hehl daraus, wie sehr er deine Mutter liebt und beraubt sich damit jeder Männlichkeit. Wer liebt, wird blind und willensschwach. Das möchtest du doch nicht, oder?
Worte, die sich in James eingebrannt und bis heute nicht an Gültigkeit verloren hatten. Noch oft hatte ihm sein Großvater vor Augen geführt, was er damit meinte. Wenn er Großmutter Elisabeth geschlagen hatte, was James besonders imponierte. Oder lächelnd davon erzählte, dass er seinem Erzeuger damit gedroht habe, ihn eines Tages umzubringen. Und da waren noch die Komplizen seines Großvaters gewesen, die James bis auf einen zwar nie zu Gesicht bekommen hatte, die sein Ahne jedoch bei vielen Gelegenheiten erwähnte. Insbesondere, wenn er über gemeinsame Vergehen sprach. Ein paar Mal hatte man seinen Großvater sogar des Mordes bezichtigt, doch nie konnte man seiner habhaft werden.
In der Öffentlichkeit nahm sein Großvater hingegen ein anderes Wesen an. Er trat höflich, galant und umgänglich auf. James hatte sich damals geschworen, genauso zu werden wie er.
Als sein Lehrmeister starb, war er gerade sechzehn Jahre alt geworden. Dieser Tag blieb bislang der einzige in James’ Leben, an dem er geweint hatte, denn sein Großvater hinterließ eine große Lücke, doch weder die Eltern noch seine Schwester hatten sich bei der Beisetzung bemüht, ihm den nötigen Respekt zu erweisen. Nicht einmal die Hand des aufgebahrten Leichnams küssten sie und machten keinen Hehl aus ihrer Erleichterung.
Das hätten sie nicht tun dürfen!
»Du hast dich nicht in mir getäuscht, Großvater. Ich bin dein wahrer Sohn und ruhe nicht eher, als bis ich dich gerächt habe.« Dieser Schwur war schon lange Teil seines Selbst und es gab nur noch ein Hindernis, dann war sein Blutdurst gestillt. In Kürze würde er alles in die Wege leiten.
»Aber Zeit ist Geld, nicht wahr, Großvater?« Statt in Erinnerungen zu schwelgen, sollte er sich lieber um die Bilanz kümmern. Flugs griff James zur Schreibfeder und wandte sich den Unterlagen vor sich zu. Seit Jahren hatte es keine Missernte mehr gegeben. Der Preis für Getreide war hoch, die Löhne für das Überangebot an Arbeitskräften niedrig. Für die Feldarbeit waren Arbeiter zuständig, die in einer Baracke am Fluss hausten. So konnte er das Personal im Haus auf ein Minimum reduzieren.
Hinzu kamen die Schaf- und Pferdezucht, wobei er Letztere eher aus Leidenschaft betrieb als nach Gewinn zu streben. Und dann war da noch seine Tuchfabrik in Leeds, die ihm ein Vermögen einbrachte. Die Fabrik wurde von einem Verwalter geführt. Bis jetzt konnte er mit dessen Arbeit äußerst zufrieden sein, auch wenn er sich lieber selbst darum gekümmert hätte. Doch Leeds lag viel zu weit fort und damals hatte er die Tuchfabrik nur zu einem Zweck gekauft. Eigentlich wollte er sie nach Erreichen seines Zieles wieder abstoßen, aber die guten Umsätze hatten ihn eines Besseren belehrt. Ja, er hätte zufrieden sein können, aber er war es nicht. Es musste etwas geschehen und zwar bald!
Wütend dachte James an die Werften in Dover und Liverpool. Sie hätten längst in seinem Besitz sein sollen. Sein verhasster Vater! Er war ein Weichling sondergleichen gewesen.
Fluchend warf James die Schreibfeder auf die Unterlagen. Tinte spritzte auf das Papier. In der nächsten Sekunde fegte er alles mit einem Handgriff vom Tisch und erhob sich so abrupt, dass der Stuhl umkippte. Doch James kümmerte sich nicht weiter darum, sondern stapfte mit ausladenden Schritten zum Fenster, wo er sich mit den Händen am Sims abstützte, auf dem der goldene Brieföffner lag. Dieses scheußliche Ding hatte ihm Mary-Ann geschenkt.
Plötzlich wurde James von Hitze erfasst, als würde er über glühende Kohlen laufen. Zugleich durchströmte ihn ein Kribbeln. Verärgert nestelte er am Kragen. »Nein!«, schalt er sich und verscheuchte die Empfindungen. Mary-Ann war nichts anderes als eine Frau. Sie hatte zu dienen und zu gehorchen, genau wie die Huren in London, Dover oder wie seine Großmutter Elisabeth. Es gab nur eine Schwäche in seinem Leben und die war auch jene seines Großvaters gewesen: Sophie. In zwei Tagen würde er sie wiedersehen.
James versuchte sich ihr Gesicht und ihren Körper vorzustellen. Doch einzig Mary-Ann lag in ihrer unschuldigen Nacktheit vor ihm. Zur Hölle mit seiner Frau!
***
Victoria hielt die Laterne in die Höhe, um den Weg zu den Stallungen auszuleuchten. Es war schon kurz vor Mitternacht, aber von Robert fehlte nach wie vor jede Spur. Sie machte sich große Sorgen um ihn. Hoffentlich war er nicht in das Unwetter geraten. Dann wäre er völlig durchnässt, was ihm sicherlich schaden würde, da sein Körperbau eher dem einer zarten Frau als dem eines Burschen glich, der bereits volljährig und ein junger Mann hätte sein sollen. Zudem kränkelte er häufig, was wohl an den fehlenden Reserven lag. Außerdem neigte er zu Wutausbrüchen, die Victoria jedoch nicht ernst nahm. Vielmehr glaubte sie, dass er seine mangelnde Körperlichkeit mit überschäumendem Gemüt ausgleichen wollte. Deshalb fand auch das Gesinde seine säbelrasselnden Gebärden eher zum Lachen als zum Fürchten.
»Robert?«, rief Victoria, als sie bei den Stallungen angekommen war. Prüfend sah sie sich um. Das Tor stand einen Spalt offen. Robert hatte vergessen, den Riegel in die Halterung zu schieben. Wenn das White gesehen hätte!
Doch der Gedanke an ihren strengen Dienstherrn verflog sofort, als Victoria den Pferdestall betrat und den Geruch sowie das vertraute Schnauben der Tiere wahrnahm. So oft es ihre Zeit erlaubte, stahl sie sich hierher, denn Pferde waren die anmutigsten und liebenswertesten Geschöpfe, die sie kannte. Bedauerlicherweise hatte sie nie Reiten gelernt und dachte unweigerlich an ihre Herrin, während sie zu Fees Verschlag trat. Die Stute wieherte. Umsichtig stellte Victoria die Laterne auf die unebene Erde, dann streichelte sie dem Pferd über das seidig weiche Fell.
»Ja, so ist es gut.« Victoria genoss die Zutraulichkeit der Stute und vergrub ihr Gesicht in der weichen Mähne. »Du vermisst bestimmt deine Herrin.«
Es war länger her, dass Mrs. White einen Ausritt unternommen hatte. Dabei war sie eine ausgezeichnete Reiterin. Aber leider hatte sie sich sehr verändert. Melly, die schon lange auf White Manor arbeitete, erzählte gern davon, wie stolz die Herrin einst hier angekommen war. Anfangs sei sie völlig anders gewesen. Aber Victoria wunderte dieser Wandel nicht, da White seine Frau denkbar schlecht behandelte. Er schreckte nicht einmal davor zurück, sie zu schlagen. Trotzdem kam niemals ein böses Wort über ihre Lippen.
Welch trauriges Schicksal, dass diese wunderbare Frau dazu verdammt war, ein tristes Leben an der Seite eines Tyrannen zu führen. Und es war schlimm dabei zusehen zu müssen, wie sie sich ängstlich seinem Willen unterwarf und nur noch ein Schatten ihres Selbst war.
»Bestimmt tut sie dir auch leid, Fee.« Die Stute scharrte mit den Vorderbeinen. Victoria streichelte sie noch einmal, griff nach der Laterne und richtete sich auf. Im selben Moment hörte sie ein knarrendes Geräusch. Erschrocken drehte sie sich nach allen Seiten um. Es war nicht zu deuten, woher der Laut gekommen war. Entweder vom Tor oder jemand war durch die Hintertür gekommen.
»Robert? Bist du das?« Keine Antwort. Victoria lauschte angestrengt. Da, schon wieder! »Robert, wenn du das bist, dann zeig dich auf der Stelle!«
Kalte Angst kroch in ihr hoch. Das schale Licht der Laterne reichte nicht aus, um alles zu überblicken. Sie fürchtete die Dunkelheit und wusste, dass irgendwer im Stall war! Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie herumwirbelte, um zum Tor zu rennen. Dabei prallte sie mit jemandem zusammen, der dicht hinter ihr gestanden haben musste. Mit einem Aufschrei fiel die Gestalt der Länge nach hin. Das Licht in der Laterne flackerte. Mutiger, als sich Victoria fühlte, wagte sie sich einen Schritt vor. Diese schmutzigen Schuhe, die zerrissene Kniebundhose, das war …
»Robert!« Sein Gesicht lag zwar im Halbdunkel, doch sie wusste, dass er es war. Erleichtert, aber auch erzürnt, fuhr sie ihn an: »Du dummer Junge hast mich zu Tode erschreckt.« Er blieb weiterhin stumm, aber trotz ihrer Schelte streckte ihm Victoria die Hand entgegen.
»Was soll das? Ich kann alleine aufstehen!«
»Sieh an, du hast ja doch eine Zunge, um zu reden.«
Robert rappelte sich hoch und rieb sich am Gesäß. Er stand mit dem Rücken zu ihr. Victoria ahnte, dass sie ihn beleidigt hatte, aber er verdiente es nicht anders. Dann bemerkte sie einen neu angebrachten Haken an Fees Verschlag, an den sie die Laterne hing. Rasch hob sie Roberts Hut auf und entfernte die Strohhalme, aber als sich der Stalljunge zu ihr umdrehte, hielt sie entsetzt inne. Ein Feuermal zog sich quer über sein Gesicht.
»Du meine Güte, Robert, hat er das getan?«
»Ja!«, presste der Stalljunge hervor und ballte seine Hände zu Fäusten. »Eines Tages werde ich zurückschlagen.«
»Daran darfst du nicht einmal denken!«, er würde dich zu Tode prügeln, spann Victoria im Geiste den Faden weiter. »Was ist mit Rosalind? Hast du sie gefunden?«, fragte sie schnell, um ihn von seiner Wut abzulenken.
»Nein.« Roberts Stimme klang plötzlich weinerlich. Victoria zog ihn am Ärmel seines Hemdes näher. Tränen schimmerten in seinen Augen. Mitgefühl stieg in ihr hoch. Er hatte vermutlich Angst vor White und das zu Recht, sollte er den Hengst nicht gefunden haben. Die Folgen waren gar nicht auszudenken. »Rosalind ist auf und davon«, stammelte Robert. »Sie hat tatsächlich den Hengst genommen. Ich habe ihn an der Lichtung beim Andredsweal gefunden, er war an einem Baum festgezurrt. Rosalind hat es sich wohl anders überlegt und das Pferd zurückgelassen.«
»Woher willst du wissen, dass sie es war?«
»Ich weiß es eben«, trotzte er, aber dann begann er haltlos zu weinen. Sein jäher Ausbruch überforderte sie im ersten Moment. Was bewegte ihn derart, dass er heulte wie ein Mädchen?
»So traurig ich es auch finde, dass Rosalind gegangen ist …«, du lieber Himmel, was sollte sie nur sagen? »Aber sie ist alt genug, um zu wissen, was sie tut. Jedenfalls wird sich der Herr weniger um sie scheren als um das edle Pferd. Du solltest froh sein, dass noch einmal alles gut gegangen ist. Um deinetwillen.«
Robert senkte den roten Lockenkopf. »Aber … ich … sie … als sie hier angefangen hat, da …« Er schaute sie Hilfesuchend an. Sein Feuermal unterschied sich kaum mehr von seiner übrigen Gesichtsfarbe.
»Du hast sie wohl sehr gemocht?« Jetzt war ihr alles klar.
»Ich habe sie … ich meine …«
»Schon gut, Robert«, besänftigte sie ihn und nahm ihn in die Arme. Er weinte herzzerreißend an ihrer Schulter. Wie verzweifelt musste er sein? Vermutlich war er zum ersten Mal in seinem Leben verliebt und Rosalind hatte ihn ohne ersichtlichen Grund verlassen. Oder wusste er mehr?
Victoria sah das schüchterne, sommersprossige Mädchen vor sich, das gut mit Robert zusammengepasst hätte. Aber vor einigen Monaten hatte sie sich verändert und kaum noch gesprochen. Einige Spekulationen kamen ihr in den Sinn, aber es war besser nicht daran zu denken, was Melly und sie hinter Rosalinds Veränderung vermuteten. Doch der Verdacht lag nahe, dass sich einer der Arbeiter an ihr vergangen hatte.
Roberts sachter Widerstand holte Victoria aus ihren unheilvollen Gedanken. Verlegen befreite er sich aus ihren Armen, zog ein Papierstück aus der Tasche seiner Kniebundhose und hielt es ihr entgegen.
»Was ist das?« Sie forschte in seinem Gesicht.
Robert zuckte nur die Schultern und wich ihrem Blick aus. Er schämte sich vermutlich seiner Tränen. »Hab ich beim Hengst gefunden, aber ich kann’s nicht lesen.«
Victoria nahm es an sich und warf einen Blick darauf. Robert kratzte sich am Hinterkopf, nahm ihr den Hut aus der Hand und stülpte ihn sich über die verzottelten Locken. »Muss den Hengst in den hinteren Stall bringen«, murmelte er und verschwand.
Sie nahm es nur am Rande wahr, denn sie starrte noch immer auf diese Zeichen, die für sie nicht zu entziffern waren. Robert war nicht der Einzige, der nicht lesen konnte. Nur Melly wusste von dieser Schmach.
Schnell haschte Victoria nach der Lampe und lief hinüber zum Herrenhaus, inständig hoffend, Melly noch in der Küche anzutreffen. Sie musste unbedingt wissen, ob Rosalind das geschrieben und wenn, was sie geschrieben hatte.
Als Victoria auf den hinteren Eingang zulief, der direkt in die Küche führte, stellte sie erleichtert fest, dass ihre mütterliche Freundin noch da war.
»Melly!« Victoria blieb keuchend vor dem klapprigen Holztisch stehen und stellte die Laterne darauf ab.
»Heiliger Vater im Himmel, was ist geschehen? Hat Robert wieder etwas angestellt?«, jammerte Melly sogleich, schob einen Topf zurück und walzte auf sie zu. Victoria schüttelte den Kopf. Ihr Herzschlag beruhigte sich allmählich. »Was dann?« Melly griff mit ihren prallen Fingern nach einem Stück Brot, schob es sich in den Mund und kaute darauf herum, ohne Victoria aus den Augen zu lassen. »Hast du etwas von Rosalind gehört?«
»Robert hat den Hengst bei der Lichtung am Andredsweal gefunden, aber von ihr ist weit und breit keine Spur. Melly!« Victoria klopfte der Köchin auf die Finger, weil sie erneut nach einem Stück Brot greifen wollte. Immer, wenn sie sich Sorgen machte, aß sie so viel wie drei ausgewachsene Männer. »Du platzt bald aus allen Nähten, wenn du so weitermachst.«
»Das tue ich schon jetzt, Kindchen«, nuschelte Melly und schlug sich auf die ausladende Hüfte. »Aber erzähl weiter.«
»Kannst du mir sagen, was hier geschrieben steht?«, fragte Victoria, statt zu antworten und legte das Stück Papier auf den Tisch. »Robert hat es beim Hengst gefunden. Vielleicht ist es wichtig.«
Melly nahm das Papier und kniff die blauen Augen zusammen, deren Weiß immer ein wenig ins Gelbliche stach. Dann ließ sie sich auf den nächstbesten Stuhl plumpsen. Ein ächzendes Geräusch war zu hören. Die Köchin zog sich die Haube vom Kopf. Ihr schütteres graues Haar war nassgeschwitzt.
»Heiliger Vater im Himmel!« Der Zettel entglitt ihrer Hand. Leicht wie eine Feder landete er auf dem Tisch, doch Victoria hatte das Gefühl, als wiege er schwer wie Stein.
»Was ist?« Victoria konnte die Spannung kaum noch aushalten.
»Wir hatten recht! Das arme Kind!«
Victoria war, als würde eine kalte Hand nach ihrem Herzen greifen. »Soll das etwa heißen, dass sie wirklich …?«
»Seo a-nis, so ist es.« Melly, die ursprünglich aus Schottland stammte und darum manchmal in den gälischen Dialekt verfiel, schaute sie aus tränenblinden Augen an, nahm einen Zipfel der Kittelschürze und wischte sich damit über die fleischigen Wangen. Dann fasste sie erneut nach dem Zettel. »Verzeiht mir, ich kann mit dieser Schande nicht länger leben. Hütet euch vor J.W. Er ist ein Teufel und Vergewaltiger.«
»J. W.?« In Victoria arbeitete es, bis sie die Erkenntnis wie ein Blitzschlag traf. »James White!« Sie spürte einen Würgereiz. Rosalind war von ihm geschändet worden, nicht von einem der Feldarbeiter! Fassungslos suchte sie Mellys Blick, aber die wich ihr aus. Eine dunkle Ahnung beschlich Victoria. »Du verheimlichst mir doch etwas. Sag die Wahrheit. Wusstest du es? Ist das öfter passiert? Bitte, ich muss es wissen!«
Die Köchin griff nach ihrer Hand. »Der Vater im Himmel möge mir verzeihen, aber ich hätte meinen Arsch darauf verwettet, dass er es war. Ich bin nun fast dreißig Jahre hier. Viele Mädchen sind gekommen und gegangen. Alle aus demselben Grund. Zuerst wegen dem Großvater, dann wegen dem Enkel. Ich habe deshalb nichts gesagt, weil ich dich nicht beunruhigen wollte, doch jetzt schäme ich mich dafür. Ich hätte dich warnen sollen!« Melly schüttelte den Kopf. »Ich habe sogar versucht mit Rosalind zu reden, aber ich bin nicht zu ihr durchgedrungen. Sie hatte Todesangst und die habe ich um dich auch.«
»Mach dir um mich keine Sorgen, ich bin es gewohnt mich zu verteidigen. Kein Mann wird ungefragt Hand an mich legen. Auch Mister White nicht.« In Victoria waren keinerlei Zweifel.
»Als ob du eine Wahl hättest.« Melly beugte sich zu ihr und beschwor sie: »Du solltest flüchten, solange es noch geht.«
»Wohin? Hinaus in den Krieg?« Victoria entzog ihr die Hand und spürte das übliche Brennen am Hals. Sobald sie sich aufregte, bekam sie diese roten Flecken. »Dorthin zurück, wo ich herkomme? Nein, Melly. Ich habe früh lernen müssen, mich durchzuschlagen, denn ich hatte Eltern, die sich keinen Deut um mich scherten. Ich war nur dazu da, von früh bis spät zu arbeiten, um ihnen ihren Rausch zu finanzieren. Deshalb bin ich von Zuhause fortgelaufen.« Victoria unterbrach sich. All die Erinnerungen, die sie so lange aus ihrem Herzen verbannt hatte, kamen wieder hoch, mitsamt den Gefühlen. »Und nach der Stelle bei Tho… beim Grafen, bin ich hierhergekommen. Es geht mir endlich einigermaßen gut. Das will ich nicht verlieren.«
»Dann kann ich nicht mehr tun, als für dich zu beten.«
»Hör mir bloß mit deinem Gott auf! Wo war er denn, als Rosalind ihn brauchte? Wo war er, als ich ihn brauchte?« Melly mochte eine gottesfürchtige Frau sein, aber Victoria wollte damit absolut nichts zu tun haben. Es gab keinen Gott! Wenn, dann musste man sich selbst helfen.
Melly schaute sie traurig an. Im gleichen Moment bereute Victoria ihren heftigen Ausbruch. Sie liebte diese Frau mit dem großen Herzen und um nichts in der Welt wollte sie sie absichtlich verletzen. »Es tut mir leid, Melly.« Victoria gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich habe es nicht so gemeint. Bete du nur weiter diesen Gott an, aber verzeih mir, wenn ich deinen Glauben nicht teilen kann. Dafür hat er mir zu übel mitgespielt.« Sie wusste, dass es verbittert klang, doch so fühlte sie nun mal.
Melly tätschelte ihre Hand und lächelte unter Tränen. »Eines Tages wirst du dich an diesen Augenblick erinnern und zwar dann, wenn auch du die Gegenwart unseres allmächtigen Vaters spürst.«
»Amen.« Victoria übersah den strafenden Blick. »Ich bin froh, dass Rosalind auf und davon ist. Man kann nur hoffen, dass sie irgendwann dieses schlimme Erlebnis vergisst.«
»Eine solche Demütigung folgt einem wie ein Schatten durch das ganze Leben. Egal, ob es hell oder dunkel ist, er ist ständig da«, sagte Melly leise und erhob sich, um wieder zur Feuerstelle zu gehen. Sie zog den Topf herunter, goss das dampfende Wasser in einen Eimer und warf Wäsche hinein. Dann nahm sie einen großen Holzlöffel, tunkte ihn ins Wasser und rührte geschäftig um. Victoria ahnte, dass Melly über sich selbst gesprochen hatte und es brach ihr das Herz. Aber sie fragte nicht nach, sondern stand ebenfalls auf und nahm die Laterne. Sie wusste, dass Melly allein sein wollte, sobald sie sich in ihre Arbeit vertiefte. Und das war im Moment alles, was sie für sie tun konnte.
***
Es war schon weit nach Mitternacht, als Victoria ihre Kammer aufsuchte. Nur ein einfaches Holzbett, ein Nachttisch und ein Schrank, auf dem eine mit Sprüngen gespickte weiße Waschschüssel stand, befanden sich darin.
Sie stellte die Laterne ab, trat zur Schüssel und wusch ihr erhitztes Gesicht mit dem kalten Wasser. Danach griff sie zu einem Tuch und tupfte sich trocken. Dabei schaute sie in das mit Fingerabdrücken übersäte Spiegelfragment, das sie einmal gefunden hatte. Es lehnte an der Wand.
Was war Melly zugestoßen? Hatte sie dasselbe, grausame Schicksal erfahren wie Rosalind? War das der Grund, warum die mütterliche Freundin oft bis spät abends in der Küche werkte und Pflichten erfüllte, die sie auch tagsüber verrichten hätte können? Raubte ihr dieses Geheimnis den Schlaf?
Und Rosalind. Sie war noch so jung. Wie entsetzlich musste sie sich gefühlt haben. White, ein Vergewaltiger! Ob die Herrin etwas ahnte? Sie war heute so schweigsam gewesen, als sie ihr bei der allabendlichen Vorbereitung zur Nachtruhe geholfen hatte. Sie waren Vertraute und sprachen über viele Dinge. Nur ein Thema hatte sie niemals berührt: Die Ehe mit Mister White. Wie konnte er nur so heimtückisch sein und sich mit Gewalt nehmen, was ihm nicht zustand?
Da war Thomas ganz anders gewesen.
Der Gedanke an ihn kam unvermittelt. Plötzlich verschwamm ihr Spiegelbild. Reglos verharrte Victoria in sich. Thomas war die Liebe ihres Lebens. Sie hatte für ihn und seine Ehefrau gearbeitet und deren Kinder betreut. Unsterblich war sie in diesen Mann verliebt gewesen und war es immer noch. Kaum glaubend, dass er ihre Zuneigung erwidert hatte.
Anfangs hatte sie gegenüber seiner Frau große Skrupel gehegt, aber Thomas schien so unglücklich zu sein. Oft hatte er gesagt, dass er sich wünschte, sie wäre seine Ehefrau. Und das, obwohl der Standesunterschied ihre Welten trennte wie der Ozean die Kontinente.
Thomas war ein Graf, sie nur die Kinderfrau. Aber das hatte ihn nicht interessiert. Er behandelte sie wie seinesgleichen, zumindest wenn sie unter sich waren. Und diesen Respekt hatte sie ihm mit Liebe und Hingabe gezollt. Bis die Familie England für immer verlassen wollte. Thomas war der Meinung gewesen, dass eine Trennung das einzig Richtige sei, denn ihre Liebe würde letztendlich unerfüllt bleiben. Er hatte völlig recht. Niemals konnte er sich offiziell zu ihr bekennen, sie würde lediglich die heimliche Geliebte bleiben. Das wollte er ihr ersparen. Wie sehr musste er sie geliebt haben! Und diesen wundervollen, gütigen Mann musste sie ziehen lassen, obwohl es ihr das Herz zerriss. Davon würde sie sich wohl nie mehr erholen und manchmal glaubte sie der Sehnsucht nicht mehr standhalten zu können. Sollte sie ihm in die Kolonie folgen? Wie würde er reagieren, wenn sie plötzlich vor ihm stünde?
Freudig schlug ihr Herz gegen die Brust, als sie sich vorstellte, wie er sie lachend in die Arme nahm und sich überschwänglich mit ihr im Kreis drehte. Vielleicht sollte sie wirklich …
Nein, das waren bloß Luftschlösser! Es wäre in Afrika nicht anders als hier. Und obgleich ihr Herz ganz tief mit seinem verbunden war, sie hatten keine Zukunft.
Wehmütig öffnete Victoria die oberste Schublade des Schrankes, in der sich greifbare Erinnerungen befanden. Wie Thomas’ Hemd, das sie herausnahm und sich an die Wange hielt. Sein Duft haftete dem weichen Gewebe noch immer an. Sie spürte ihn so nahe.
Wieder traten Tränen in ihre Augen, während sie das Hemd zurücklegte und sich weitere Erinnerungsstücke anschaute. Unter ihnen einige seiner Kinder, die ihr Thomas überlassen hatte, denn so sehr sie an ihm hing, so sehr hatte sie auch seine Sprösslinge vergöttert. Bekümmert befühlte sie den kleinen Bären, die Puppe und das Fläschchen aus Kuhhorn und Leder, das sie oft in der Hand gehalten hatte, um die Kinder zu füttern.
Seine Frau hatte nicht gestillt und behauptet, das Saugen an den Brüsten wäre eine ekelhafte, unreine Angelegenheit, sowohl für Mütter als auch für Ammen. Diese Abneigung den Kindern gegenüber hatte Victoria endgültig in Thomas’ Arme getrieben. Und dann hatte sie damit begonnen, seine Frau sowohl in der aufrechten Haltung als auch in ihrer sprachlichen Gewandtheit nachzuahmen. Sie wollte Thomas um jeden Preis gerecht werden und alles, was sie an ihre Vergangenheit erinnerte, hinter sich lassen. Doch das war leichter gedacht als getan …
Grob wischte sie die Tränen fort und schob die Lade zu. Sie musste aufhören, sich mit diesen Andenken zu vergiften. Es war Zeit, ein neues Leben zu beginnen und diesen ohnehin schrecklichen Tag nicht zusätzlich schwerer zu machen. Außerdem steckte ihr die Müdigkeit in den Gliedern.
Gähnend band sie die Schürze ab, öffnete die Knöpfe ihres grauen Kleides, streifte es über ihre Schultern und ließ es mitsamt der Schürze zu Boden gleiten. Als sie sich auch ihrer restlichen Kleidung entledigt hatte, sammelte sie alles auf und legte es fein säuberlich über das Bettende.
Dann öffnete sie den Zopf und bürstete ihr Haar, das über ihren nackten Rücken floss. Dabei schloss sie die Augen und glaubte, Thomas’ Hände auf ihrem Körper zu spüren. Kurz gab sie sich ihren Gefühlen hin, aber plötzlich entsann sie sich wieder und öffnete die Augen. Eigentlich wollte sie nicht mehr an ihn denken und außerdem war sie in Whites Haus! Kälte umfasste sie plötzlich, während sie nach ihrem braunen Nachtgewand griff und hineinglitt. Der Stoff kratzte und ihre empfindliche Haut begann zu jucken, sobald sie unter die Decke geschlüpft war. Aber auch wenn ihre Lider schwer waren, drehten sich Victorias Gedanken weiterhin im Kreis. Was hatte White Rosalind nur angetan, fragte sie sich bang, während sie sich an den Armen kratzte. Sollte er es bei ihr versuchen, würde sie ihn eigenhändig umbringen!
***
Nahe Bristol
Nur vereinzelt brannten Lagerfeuer vor den unzähligen Zelten, über die sich ein sternenklarer Nachthimmel wölbte. Die meisten Soldaten schliefen bereits, lediglich einige saßen beisammen oder wuschen sich am nahen Bach. Leises Gemurmel war zu hören. Es stank nach Schweiß.
William saß mit einigen Männern am fast heruntergebrannten Feuer. Müde fuhr er sich durch die feuerroten Haare, die ihm schon viel Häme eingebracht hatten. Da war Fuchs noch das harmloseste Wort und er assoziierte es mit Schlauheit. Also machte ihm diese Bezeichnung weniger aus, zumal sein Vater dieselbe Haarfarbe hatte und sich die gleichen dummen Aussagen anhören musste, was dieser jedoch mit mehr Humor nahm als William, der insgeheim seine Schwester beneidete. Mary-Ann hatte das Glück, sämtliche Vorzüge ihrer Mutter erhalten zu haben. Weizenblondes, lockiges Haar, ein feingeschnittenes Gesicht und die grünen Augen. Nur die etwas zu groß geratenen Ohren des Vaters hatten sich durchgesetzt. Doch sie verstand es geschickt, sie unter ihrem langen Haar zu verstecken.
Ohne jeglichen Hunger stopfte William den zähen Brei in sich hinein, aber um bei Kräften zu bleiben, musste er etwas essen, weil der Krieg ihm und den anderen viel abverlangte. Seine Freunde schienen jedoch mehr Appetit zu haben. Habit, den sie auch Rabbit nannten – da er bereits neun Kinder gezeugt hatte –, stellte den Teller mit zufriedenem Gesicht auf die Erde und rieb sich den Bauch. Cleve verschlang seine Mahlzeit ebenfalls. Er war ein ziemlicher Eigenbrötler, dem sein eigenes Leben gleichgültig war, doch nicht das der anderen. Bei der Schlacht in Somerset hatte er William sogar das Leben gerettet, als man versuchte, ihn hinterrücks abzustechen.
Und dann war da noch George, kaum fünfundzwanzig Jahre alt, aber schon ergrautes Haar wie ein Greis. Er war ein ängstlicher Bursche und die meisten wunderten sich, dass er bis jetzt überlebt hatte. Oft machten sie sich sogar darüber lustig, dass er sich vermutlich bis zum Ende jedes Gefechts in irgendeinem Schlupfwinkel versteckte.
»Dieser Krieg ist so sinnlos! Können die nicht einfach miteinander verhandeln, ohne sich die Köpfe einzuschlagen?«, fragte George kauend. Reste des Breis hingen in seinem Vollbart.
»Du würdest lieber mit Worten kämpfen, das ist uns klar«, sagte Habit lachend und zog sich das Hemd aus. Sein dicker Bauch war übersät mit Wunden, die sich teilweise entzündet hatten. »Aber das geht eben nicht immer und wir sollten froh sein, dass wir auf der richtigen Seite kämpfen.«
»Tun wir das?«, brummte Cleve und aß den letzten Bissen. Dann leckte er seinen Teller aus und verstaute ihn im Lederbeutel, der neben ihm lag.
William war auch fertig und stellte seinen Teller ins Gras. Morgen würden sich unzählige Ameisen darauf tummeln. Für die kleinen Plagegeister war die Welt in bester Ordnung. Er hingegen dachte daran, wie alles begonnen hatte.