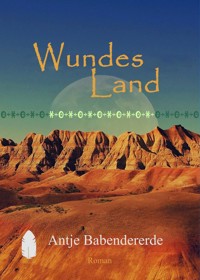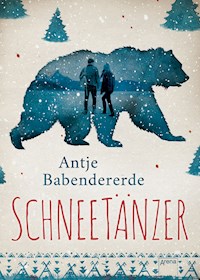Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Julia ist 15 Jahre alt, als ihr Vater stirbt. Sie kann nicht glauben, dass der wichtigste Mensch in ihrem Leben plötzlich nicht mehr da sein soll. Auf seinen Spuren reist sie zurück in eine ihr fremde Vergangenheit. Tief in der Wüste von Nevada trifft sie auf sein früheres Leben - und auf den stillen Simon, dessen Art sie von Anfang an berührt. Noch wissen die beiden nicht, welches Unheil ihre Liebe bringen wird.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antje Babendererde
Die verborgene Seite des Mondes
Antje Babendererde,
geboren 1963, wuchs in Thüringen auf. Nach einer Töpferlehre arbeitete sie als Arbeitstherapeutin in der Kinderpsychiatrie. Seit 1996 ist sie freiberufliche Autorin mit einem besonderen Interesse an der Kultur, Geschichte und heutigen Situation der Indianer. Ihre einfühlsamen Romane zu diesem Thema für Erwachsene wie für Jugendliche fußen auf intensiven Recherchen und USA-Reisen und werden von der Kritik hoch gelobt. Die verborgene Seite des Mondes ist Antje Babendererdes fünfter Jugendroman.
Veröffentlicht als E-Book 2010 © 2007 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Frauke Schneider Umschlagtypografie: KCS GmbH · Verlagsservice & Medienproduktion, Stelle/Hamburg E-Book-Erstellung: CMS – Cross Media Solutions GmbH, Würzburg Quellennachweis: Anita Endrezze-Danielson, Warum ein Stein nicht von selber singt, aus: Auch das Gras hat ein Lied. Indianertexte der Gegenwart. Ausgew. u. übertr. v. K. Reicheis und G. Bydlinsky. Verlag Herder, Freiburg 5. Auflage 1998 ISBN 978-3-401-80027-1
www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Für Okaadaak, die eine mutige, junge Frau ist.
Warum ein Stein nicht von selber singt
Wenn du einen blauen Stein an dein Ohr hältst, hörst du den uralten Fluss, dessen Herz er einst war, den heißen Wind, dem er als Zunge diente, und die Erde, die ihm einen Feuermund versprach.
Ein gefleckter Stein stammt aus dem Traum eines galoppierenden Appaloosa-Schecken. Die Herde singt die Lieder ihrer Graszeremonie und die Traumsterne fliegen von ihren Hufen auf in den gesprenkelten Himmel.
Ein schwarzer Stein hat die Seele des Bären eingefangen in seinem letzten Schlaf. Sein Lied umkreist den Stein, verleiht ihm Illusion von Pelz.
Alle gelben Steine hüten die Geheimnisse der Eulen. Alle grünen Steine sind der Atem von Pflanzen, die nachts vor Freude singen.
Ein roter faustgroßer Stein ist die Liebe zwischen Mann und Frau, der Einklang ihrer Körper im Gras.
Ein grauer Stein ist von Natur aus traurig. Er ist ein Wort aus der Sprache, die den Toten gehört. Behalte ihn. Eines Tages wirst du ihn verstehen.
Anita Endrezze-Danielson
1.
Tränen kamen schon seit einer Weile nicht mehr. Mit trockener Kehle schluchzte Julia in das Kissen auf ihrem Bett. Ihr ganzer Körper tat weh vor Kummer und dem heftigen Wunsch die Zeit zurückzudrehen, nur für ein paar Stunden. Aber sie wusste, dass das unmöglich war.
Manche Dinge sind unwiderruflich. Unfassbar und doch für immer.
Ihr Vater war tot. Ein betrunkener Autofahrer hatte ihn am helllichten Tag auf einer Landstraße überfahren. Seine Verletzungen waren so schwer gewesen, dass sein Herz auf dem Weg ins Krankenhaus aufgehört hatte zu schlagen. Julia und ihre Mutter Hanna waren eben erst von dort zurückgekommen. John hatte ganz friedlich ausgesehen, so, als würde er schlafen. Aber das tat er natürlich nicht. Julia war fünfzehn und kannte den Unterschied zwischen schlafen und tot sein. Der Tod war unwiderruflich.
Nur allmählich drang die Tatsache, dass ihr Vater gestorben war, zu ihr durch. Julia wünschte, auch ihr Herz würde aufhören zu schlagen, damit sie nicht mehr denken musste, nicht mehr fühlen. Alles war ihr zu viel, sogar das Atmen. Doch der Muskel in ihrer Brust schlug kraftvoll weiter, ihrem Wunsch zum Trotz.
Die Vorhänge in ihrem Zimmer waren zugezogen. Der Mai ging zu Ende und draußen schien warm die Sonne. Julia hörte das fröhliche Geschrei der Kinder auf dem Spielplatz hinter dem Haus. Voller Verzweiflung hielt sie sich die Ohren zu. Sie wollte nichts hören, nichts mehr sehen. Schon gar nicht das Licht der Sonne.
Ihr Vater hatte heiße Sommer geliebt, denn er war in der Halbwüste Nevadas aufgewachsen. Und weil nach vielen dunklen Regentagen zum ersten Mal wieder die Sonne schien, war er am Morgen aus der Stadt geflüchtet, um in den kastanienbewachsenen Hügeln wandern zu gehen.
Dort war er nie angekommen.
Irgendwann fehlte Julia die Kraft, sich die Ohren zuzuhalten. Gedämpfte Stimmen drangen aus dem Flur in ihr abgedunkeltes Zimmer. Irgendwer sprach mit ihrer Mutter. Die Tür ging auf, aber Julia wollte nicht wissen, wer hereingekommen war. Sie wollte in Ruhe gelassen werden, sich in den Kokon ihrer Trauer einspinnen.
Jemand setzte sich auf ihr Bett. Eine Hand strich tröstend über ihre Schultern, ihren Kopf. Julia spürte, wie ihr Körper sich verkrampfte. Sie wollte nicht berührt werden. Sie rutschte zur Seite und setzte sich auf, das Kissen wie ein Schutzschild vor ihrem Körper. Ihre Großmutter war gekommen, Hannas Mutter.
»Julia«, sagte sie, »es tut mir so leid.«
Julia mochte ihre Großmutter, aber die hatte ihren Vater nicht gemocht.
»Warum musste es ausgerechnet ein Indianer sein, Hanna?«, hatte sie bei jeder Gelegenheit zu ihrer Tochter gesagt. Zum Beispiel, wenn John mal wieder nicht pünktlich nach Hause gekommen war, obwohl Hanna und er zusammen ausgehen wollten.Warum musste es ausgerechnet ein Indianer sein?
Julias Vater John Temoke war vom Volk der Western Shoshone, die in Zentralnevada beheimatet sind. Julia wusste, dass ihr Vater sein Land und sein altes Leben vermisst hatte. John hatte nie geklagt, aber man konnte seine Sehnsucht in den Bildern erkennen, die er gemalt hatte. Und manchmal war diese Sehnsucht auch in seinem Blick gewesen. Ein Blick der oft weit fort schweifte, an einen Ort fern wie der Mond.
Julia hatte gedacht, dass sie keine Tränen mehr hätte, doch ohne Vorwarnung schossen sie in ihre Augen und machten sie blind. Ihr Körper wurde von neuen, rauen Schluchzern geschüttelt. Sie würdeihren Vater nie wieder lachen hören, ihn nie wieder um Rat fragen können, nie wieder mit ihm durch den Wald streifen, nie wieder in seinen Armen Trost finden.
Nie wieder würde jemand sieVogelmädchennennen.
DiesesNie wiederbeherrschte Julia vollkommen. Bis dahin hatte sie nicht gewusst, was Verlust eigentlich bedeuten konnte.
Nach einer Weile stand die Großmutter kopfschüttelnd auf und verließ das Zimmer, ohne die Tür zu schließen. Julia lauschte einen Moment auf die Stimmen ihrer Mutter und ihrer Großmutter in der Küche. Dann verließ sie ihr Bett, schlich aus dem Zimmer und ging über den Flur zu der schmalen Treppe, die zur Dachkammer hinaufführte.
Terpentingeruch hüllte sie ein, als sie das kleine Atelier ihres Vaters betrat. Das helle Sonnenlicht, das durch die schrägen Dachfenster fiel, tat ihr in den Augen weh. Sie schloss die Tür hinter sich und drehte den Schlüssel herum. Niemand sollte sie stören. Julia wollte allein sein mit den Bildern ihres Vaters. Denn hier war er noch da, war ganz wirklich und die zurückliegenden Stunden waren nur ein böser Traum.
An den weißen Wänden der Dachkammer hingen und standen die Gemälde ihres Vaters. Er hatte nie Menschen oder Gesichter gemalt, nur Landschaften, die Landschaften seiner Sehnsucht. Olivgrüne kahle Hügel, Pappeln, dunkelgrün im Sommer und golden im Herbst. Und immer wieder das weiße Ranchhaus mit der blauen Tür und den blauen Fensterrahmen. Er hatte es aus verschiedenen Perspektiven gemalt und in vielen Variationen.
In Julias Vorstellung hatten dieses Haus und seine Umgebung etwas Geheimnisvolles. Es war die Ranch ihrer indianischen Großeltern. Doch weder die Ranch noch ihre indianischen Verwandten hatte Julia jemals kennengelernt.
Ach Pa, dachte sie, warum hast du mich nie mitgenommen?
Diese Frage hatte sie ihrem Vater zuletzt vor drei Jahren gestelltund wie immer eine ausweichende Antwort bekommen. Dass seine Mutter Ada stur sei und weder Hanna noch ihre Enkeltochter sehen wolle. »Es ist meine Schuld, Julia. Eigentlich ist sie auf mich böse.«
Julia war gekränkt gewesen und hatte aus Trotz nicht weiter nachgefragt. Der Vater hatte aufgehört, ihr von der Ranch und seinen Bergen zu erzählen, und Julia hatte versucht, nicht mehr daran zu denken.
Inzwischen hatte sie sich alle Bilder angesehen, nur eines war noch übrig. Zögernd ging sie zur Staffelei, die mit einem Tuch verhängt war. Ihr Vater hatte schon einige Zeit an diesem Bild gearbeitet und ein Geheimnis darum gemacht. Vielleicht hatte es ein Geschenk für sie werden sollen. Mit zitternden Händen zog Julia das Tuch von der Staffelei.
Ein unfertiges Porträt kam darunter zum Vorschein. Schräge Augen mit einem neugierigen Blick. Geschwungene Lippen, die noch keine Farbe bekommen hatten. Das spitze Kinn. Ein dicker Zopf, nur angedeutet. Ihr Vater hattesiegemalt. Er, der sich mit dem Pinsel nie an Gesichter gewagt hatte.
Julia setzte sich auf den Boden, lehnte den Kopf zurück an die Wand und betrachtete das Bild. Das Wesentliche hatte ihr Vater eingefangen, aber sie fragte sich, ob sie das wirklich war. Hatteersie so gesehen? Wer war sie überhaupt? Sie fühlte sich genauso unfertig, wie dieses Porträt es war. Ihr Vater hatte sie unfertig zurückgelassen. Was sollte sie jetzt nur tun?
Ihr Blick trübte sich, die Farben des Bildes verschwammen und sie holte tief Luft. Es klopfte an der Tür.
»Julia, bist du da drin?«
Sie antwortete nicht. Ganz langsam glitt sie zur Seite und legte sich auf den Boden.Ich bin nirgendwo, dachte Julia.
Etwas hatte sich ereignet, das spürte Simon sofort. Ada redete kaum während des gemeinsamen Frühstücks. Stumm fütterte sieden Jungen. Auch Boyd sagte kein Wort. Beide schienen über Nacht um Jahre gealtert zu sein.
Tommy schrie. Er biss sich in die Unterarme, bis es blutete, und seine Granny schimpfte deswegen mit ihm. Das tat Ada nur selten. Irgendetwas musste passiert sein. Als Simon am vergangenen Abend das Ranchhaus verlassen hatte, um in seinen Wohnwagen zu gehen, war alles wie immer gewesen. Aber er wusste nur zu gut, dass Dinge sich auch über Nacht ändern konnten.
Simon spürte die Trauer der beiden alten Menschen, die sich wie eine dunkle, schwere Decke über die Ranch gelegt hatte. Dass er keine Ahnung hatte, was los war, verunsicherte ihn. Wie schnell konnte man etwas falsch machen; wie schnell jemanden verletzen, wenn er schon verwundet war. Das hatte er oft genug am eigenen Leib zu spüren bekommen.
Doch er wagte es nicht, einen der beiden Alten nach dem Grund zu fragen. Er hatte Angst, dass etwas geschehen war, das sein Leben verändern könnte.
Ada kümmerte sich um den Abwasch, wie jeden Vormittag. Simon schraubte den Sauger auf die Flasche für das Kälbchen und begab sich auf den Weg zur Koppel. Pepper, sein junger Mischlingshund, folgte ihm. Simon ließ Pipsqueak trinken und schmuste eine Weile mit dem winzigen Kälbchen. Dann schleppte er vier der schweren Heuballen vom Stapel zum Zaun, kappte die Verschnürung mit einem Messer und verteilte das Heu mit der Heugabel an die Kühe.
Dreizehn Jungtiere waren es.Nur dreizehn. Viel zu wenig, um den Bestand zu erhalten. Draußen auf der umzäunten Weidefläche der Ranch standen noch fünfundsiebzig Kühe–zu wenig, um zwei oder drei davon für Lebensmittel und Benzin zu verkaufen. Zu wenig, um über den nächsten Winter zu kommen.
Die beiden Alten wussten nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Und doch schufteten sie jeden Tag, taten, was getan werden musste, als wäre alles in bester Ordnung. Ada war oft unterwegs. In Städten wie New York, San Francisco oder Washington sprach sie vor den Menschen über die Ungerechtigkeit, die ihrem Volk widerfuhr, seit die Weißen ins Land gekommen waren.
War die alte Frau zu Hause auf der Ranch, kümmerte sie sich um den Jungen, ihren Gemüsegarten, den Haushalt. Simon und Boyd versorgten die Tiere, füllten den Holzvorrat hinter dem Haus auf oder reparierten irgendwelche Fahrzeuge und Maschinen. Fast täglich fuhr der alte Mann mit dem Fourwheeler, einer Art vierrädrigem Motorrad, die Zäune der Ranch ab und besserte Schadstellen aus. Simon half ihm dabei, er mochte diese Arbeit. Sie war nicht schwer und er wusste auch ohne Worte, was zu tun war.
Als Simon an diesem sonnigen Vormittag mit Boyd den Holzzaun flickte, sah er Tränen über die dunklen Wangen des alten Mannes rollen.
Die Tränen machten Boyd blind und er schlug mit dem Hammer ins Leere. Simon zog sich der Magen zusammen, als eine unbestimmte Angst sich in ihm ausbreitete. Er legte Boyd eine Hand auf den Arm. Einen Augenblick verharrten sie so, reglos im Schweigen. Dann wischte sich der alte Mann mit den Hemdsärmeln über das nasse Gesicht, klopfte Simon auf die Schulter und arbeitete weiter.
Es war Abend, bevor Simon endlich erfuhr, was geschehen war. John, der einzige Sohn der beiden, war in Deutschland bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Er hinterließ seine deutsche Frau und eine Tochter. Julia. Im Wohnzimmer des Ranchhauses hing ein Foto von ihr und ihrem Vater. Simon hatte schon oft davorgestanden. Julia war ein pummeliges Mädchen mit einer Zahnspange. Das hatte sie nicht davon abgehalten, dem Fotografen ein strahlendes Lächeln zu schenken.
Simon wusste, dass die beiden Alten noch eine Tochter hatten, die in Alaska lebte. Sie hieß Sarah und war Tommys Mutter. Seit Simon für Ada und Boyd arbeitete, hatte sie sich nicht ein einzigesMal auf der Ranch blicken lassen. Niemand kam, um den beiden Alten zu helfen. Beide Kinder hatten es vorgezogen, diesen Ort so weit wie nur möglich hinter sich zu lassen. Jason, Johns Sohn aus erster Ehe, lebte zwar mit seiner Mutter in Eldora Valley, nur zwanzig Kilometer von der Ranch entfernt, aber sein Interesse an körperlicher Arbeit hielt sich in Grenzen. Lieber fuhr er den ganzen Tag mit seinem aufgemotzten Zweisitzer herum. Auch deshalb war Ada so verbittert. Und nun war der einzige Sohn der beiden, ihre große Hoffnung, tot.
Simon spürte mit seinem ganzen Körper, dass sich etwas verändern würde. Er wusste nicht was, aber es machte ihm Angst.
Die vier Tage bis zur Beerdigung verbrachte Julia in einer Art Dämmerzustand. Geräusche drangen nur gedämpft zu ihr. Die Umgebung kam ihr fremd vor und sie bewegte sich wie in einem Wattenebel.
Julia aß kaum; was sie auch anrührte, es schmeckte nach nichts. Sie sprach nur das Nötigste, denn Worte zu formen, glich einem Kraftakt. Genauso wie Zähne putzen, kämmen und anziehen. Wer sollte jetzt ihren Zopf flechten? Ihr Vater hatte das gern getan, während Hanna der Meinung war, sie sei zu alt dafür und könne es selbst.
Nachts weinte Julia lautlos und schlief am Morgen vor Erschöpfung ein. Ihre Freundin Ella kam und wollte sie ablenken, indem sie einen verrückten Vorschlag nach dem anderen machte. Aber Julia nahm sie gar nicht richtig wahr. Als Ella es ein zweites Mal versuchte, bat Julia ihre Mutter, die Freundin wegzuschicken. Sie wollte nicht, dass jemand sie so sah, nicht einmal Ella. Sie fühlte sich wund und dunkel und müde.Ohne Haut.
Die Beerdigung ihres Vaters erlebte Julia wie hinter Glas. Als ob das alles nichts mit ihr zu tun hätte. Als ob nicht John Temoke in die Erde versenkt würde, sondern irgendein Fremder.
So vieles war mit ihrem Vater gestorben. Ihr Mut, ihre Zuversicht und ein Teil ihres Selbstvertrauens, das er ihr mit seiner Liebe geschenkt hatte. Ihre Unbeschwertheit und die Möglichkeit sich jemandem anzuvertrauen, der so war wie sie. Nun hatte sie keine Chance mehr, von ihrem Vater etwas über die indianische Hälfte in ihr zu erfahren. Sie hatte nicht nur ihn verloren, sondern auch einen Teil von sich.
Am Tag nach der Beerdigung rief ihre Mutter sie zu sich ins Wohnzimmer. Hanna saß auf der Couch, das Gesicht rot und verquollen. In den Händen zerknüllte sie ein Taschentuch.
Seit dem Tod des Vaters fühlte Julia sich außerstande, ihre Mutter zu umarmen. Wenn die Eltern sich gestritten hatten, dann meist deshalb, weil Hanna etwas an John auszusetzen hatte. Er dagegen hatte ihr nie Vorwürfe gemacht oder sie gebeten, ihm zuliebe eine andere zu werden. Julia war oft darüber erstaunt gewesen, wie ihr Vater ihre Mutter ertragen konnte.
Seit dem Unfall hatte jeder auf seine Weise versucht, mit dem Schmerz fertig zu werden. Hanna hatte Julia in Ruhe gelassen, darüber war sie froh gewesen.
Sie setzte sich ans andere Ende der Couch, weit genug weg von ihrer Mutter, und betrachtete sie. Hanna war klein und zierlich, aber immer voller Energie und Selbstbewusstsein gewesen. All die Jahre hatte sie hart gearbeitet und die Familie ernährt, während John zu Hause geblieben war, Bilder gemalt und sich um Julia gekümmert hatte. Jetzt sah Hanna blass und zerbrechlich aus. Für einen Augenblick spürte Julia Mitleid mit ihrer Mutter, das bisher in ihrem dunklen Kummer keinen Platz gefunden hatte.
»Ich habe mit deinen Großeltern in Nevada gesprochen«, sagte Hanna. »Sie wollen dich kennenlernen.«
Julia starrte auf den Teppich. Hannas Worte drangen nur langsam zu ihrem Verstand vor.Sie wollen dich kennenlernen.Ihre indianischenGroßeltern wollten sie sehen. Jetzt, wo ihr einziger Sohn tot war. Dabei hatten sie jahrelang nichts von ihr wissen wollen!
John war alle zwei Jahre nach Nevada geflogen, um seine Kinder aus erster Ehe und seine Eltern zu besuchen. Hanna und Julia hatte er nie mitgenommen, sie wären auf der Ranch nicht willkommen gewesen.
Jedes Mal hatte es nach seiner Rückkehr ein wenig länger gedauert, bis er nicht mehr traurig und niedergeschlagen war. In den letzten drei Jahren hatte ihr Vater kaum noch von seinem Zuhause und seinen Eltern gesprochen, obwohl Julia wusste, wie sehr er beides vermisste.
»In zwei Wochen findet das Sommertreffen der Shoshoni in den Bergen statt und deine Großmutter hat uns dazu eingeladen«, sagte Hanna. »Es soll eine Abschiedszeremonie für deinen Vater geben.« Sie holte tief Luft. »Wenn du es möchtest, fliegen wir.«
Julia war so durcheinander, dass sie nicht wusste, was sie wollte. Nevada war immer ihr Traum gewesen. Sie hatte mit ihrem Vater dorthin fliegen wollen, damit er ihr alles zeigte. Was sollte sie jetzt dort–ohne ihn?
Julia kannte nur Fotos von ihren Großeltern und einige alte Zeitungsausschnitte, die John ihr gezeigt hatte. Sie wusste, dass Ada und Boyd Temoke unablässig für die Rechte der Ureinwohner kämpften. In einem der Zeitungsartikel bezeichnete der Journalist die beiden Alten als das Rückgrat des Widerstandes gegen den Landraub und gegen Atomtests und Goldabbau auf Western-Shoshone-Land.
Julia hob den Kopf und sah ihre Mutter an. »Kann ich darüber nachdenken?«
»Sicher kannst du das. Aber nicht zu lange, ich muss den Flug buchen.«
»Ich sage dir morgen Bescheid, okay?« Julia stand auf, um das Wohnzimmer zu verlassen. Doch an der Tür drehte sie sich nocheinmal um. »Warum wolltest du damals eigentlich unbedingt nach Deutschland zurück? Wieso bist du nicht mit Pa auf der Ranch geblieben?«
Hanna sah ihre Tochter traurig an. »Warum ich nicht bleiben wollte? Ach Julia, du weißt so wenig, du kannst dir das alles gar nicht vorstellen. Die Ranch . . .«, sie stockte. »Anfangs war es nicht so schwer zu ertragen. Ich war in deinen Vater verliebt. Sehr verliebt. Und ich habe tatsächlich geglaubt, man könnte sich an alles gewöhnen, wenn man es nur will.«
»Aber es hat nicht funktioniert.«
»Nein. Du kennst die Ranch nicht. Diese Einsamkeit. Der Müll überall, die Armut. Es gibt noch nicht mal warmes Wasser.«
Julia zog die Mundwinkel nach unten. »Das sind doch alles bloß Äußerlichkeiten.«
»Äußerlichkeiten?Du hast ja keine Ahnung. Kein normaler Mensch kann es da aushalten.«
»Sie tun es. Meine Großeltern leben dort. Und Pa hat es auch dort ausgehalten, bis er dich kennenlernte.«
»Mein Gott Julia! Warum verachtest du mich so sehr dafür, dass ich dich nicht in einer Blechkiste aufwachsen sehen wollte?«
Weil Pa dann vielleicht noch leben würde, dachte Julia.
»Wie komme ich eigentlich dazu, mich vor dir rechtfertigen zu müssen?« Es sah so aus, als wollte Hanna aufspringen, doch dann sackte sie wieder in sich zusammen. »Ich konnte einfach nicht bleiben«, flüsterte sie.
Julia sah ihre Mutter schweigend an.
»Glaub mir, es waren nicht nur der Müll und diese Primitivität dort draußen, die mir zu schaffen gemacht haben. Es war viel mehr.« Hanna rieb sich das Gesicht mit den Händen, als hätte sie Schmerzen. »Ich habe furchtbar unter der Ablehnung deiner Großmutter gelitten. Ada ist voller Bitterkeit und Groll. Sie ist der Überzeugung, alle Weißen wären Außerirdische. Sie meint, irgendwann vor langerZeit wären unsere Vorfahren von einem anderen Planeten auf die Erde gekommen und dort vergessen worden. Deshalb würden wir auch keine Verantwortung für Mutter Erde empfinden. Weil sie nicht unsere wahre Heimat ist. An Adas Einstellung hat sich bis heute nichts geändert und ich fürchte, sie ist nicht besonders glücklich darüber, mich wiederzusehen.«
Julia machte ein paar Schritte auf ihre Mutter zu. »Aber um dich geht es hier doch gar nicht.«
Hanna blickte auf. »Ich habe Angst, Julia.«
»Angst wovor? Vor zwei alten Leuten?«
»Vor dem Krieg, den sie führen.«
»Welchen Krieg?«, fragte Julia mit gerunzelter Stirn.
Ihre Mutter stand auf und ging zum Fenster. »Du weißt, wie engagiert deine Großeltern sind. Sie setzen sich für den Umweltschutz ein, sie demonstrieren gegen die Goldmine auf dem Land der Shoshoni, gegen Waffentests.« Sie drehte sich um. »Aber dein Vater hat dir nie erzählt, was das in Wahrheit bedeutet, oder?«
Julia schüttelte stumm den Kopf.
Ihre Mutter begann im Zimmer auf und ab zu laufen. »Er hat dir die alten Geschichten über sein Volk erzählt; über die Schönheit des Landes und die Bedeutung der traditionellen Bräuche. Und bestimmt hat er dir auch von den alten Verträgen erzählt, in denen die Shoshoni der US-Regierung die Nutzungsrechte ihres Landes eingeräumt haben. Aber dass die US-Regierung diesen Vertrag gebrochen hat und was diese Tatsache heute bedeutet, darüber weißt du nichts.« Hanna machte eine resignierte Geste. »Deine Großeltern weigern sich, Weidegebühren zu zahlen, weil dieses Land nach dem Vertrag von Ruby Valley immer noch Western-Shoshone-Land ist. Also erscheinen alle paar Jahre Vertreter des Bureau of Land Management mit LKWs und Hubschraubern auf der Ranch. Eskortiert von Sheriffs und der Bundespolizei fangen sie Pferde und Rinder ein, die zur Ranch deiner Großeltern gehören. Ohne Rücksicht auf Verlustejagt das BLM die Tiere, fängt sie ein und versteigert sie. Das Geld wird einbehalten.«
»Aber das ist Diebstahl«, sagte Julia aufgebracht. »Du hast gesagt, die Tiere gehören zur Ranch.«
Hanna hob die Schultern. »Zur Schuldentilgung, behauptet das BLM. Deine Großeltern haben Schulden, Julia. Nicht gezahlte Weidegebühren für mehr als dreißig Jahre, weil die Tiere angeblich unberechtigt auf Staatsland weiden. Benzinkosten für Hubschrauber, Behördenfahrzeuge, Arbeitslohn für die Männer, die das Vieh eintreiben . . . Ich glaube, inzwischen sind es fünf Millionen Dollar.«
Fünf Millionen Dollar.»Aber . . .?« Julia schwieg erschüttert.
»Warum dein Vater dir das nie erzählt hat? Er wollte nicht, dass du ihn für jemanden hältst, der seine Familie im Stich lässt. Deinen Großeltern steht das Wasser bis zum Hals, Julia. Sie schaffen es nicht mehr alleine, die Ranch zu bewirtschaften. Die Familie ist zerstritten und deine Großmutter misstraut jedem Fremden, der Hilfe anbietet. Ada und Boyd hatten gehofft, dein Vater würde eines Tages die Ranch übernehmen, stattdessen ist er mit mir fortgegangen. Während sie um ihre Existenz kämpften, hat er Landschaftsbilder gemalt. In ihren Augen war dein Vater ein Versager.«
Julia sah weg. Am liebsten hätte sie sich die Ohren zugehalten.
Warum hatte ihr Vater ihr all diese Dinge verschwiegen? Warum war er nicht hier, um ihre Fragen zu beantworten?
»Er war ein Versager, weil er sich entschieden hatte, mit uns in Deutschland zu leben?«, flüsterte sie schließlich.
Hanna gab keine Antwort, sie weinte lautlos.
Julia spürte, wie ihr schwindelig wurde. Sie atmete heftig, um die Übelkeit zu vertreiben, die dunklen Wellen aus Trauer, Angst und Enttäuschung.
Tief verletzt und verwirrt stand sie auf, um aus diesem Raum zu fliehen, der ihr die Luft zum Atmen nahm.
»Julia?«
Sie blieb in der Tür stehen, wandte sich um und sah ihre Mutter fragend an.
»Auch wenn du mir das jetzt vielleicht nicht glaubst«, sagte Hanna. »Aber ich habe deinen Vater sehr lieb gehabt.«
2.
Der Highway 80 war ein endloses graues Band, das sich durch gras-bedeckte Ebenen und sanfte Hügel zog. Bäume gab es kaum. Julia konnte ihren Blick nicht von der Landschaft lösen. Schon seit einer ganzen Weile durchfuhren sie breite Längstäler und Ortschaften, die so merkwürdige Namen wie Winnemucca oder Battle Mountain trugen. Das nördliche Nevada war ein ungastlicher Landstrich–und doch auf spröde Weise schön. Jedenfalls in Julias Augen.
Hanna hatte die Entscheidung ihrer Tochter, nach Nevada zu fliegen und der Zeremonie beizuwohnen, ohne Widerspruch akzeptiert. Julia wusste, dass es ihre Mutter große Überwindung gekostet haben musste. Doch sie würden nicht lange bleiben. Nach dem Wochenende wollten sie zu Hannas Freundin Kate nach San Francisco weiterreisen, um dort drei Wochen Urlaub zu verbringen.
»Wir brauchen Abstand«, hatte ihre Mutter gesagt. »Urlaub wird uns guttun.«
Aber Julia wusste, dass kein Abstand dieser Welt etwas an ihrem Schmerz ändern würde. Ganz im Gegenteil. Im Kokon ihrer Trauer fühlte sie sich geborgen. Und wenn sie erst auf der Ranch waren, würde endlich jemand da sein, mit dem sie ihren tiefen Kummer teilen konnte.
Sie waren in Frankfurt gestartet, mit Zwischenlandung in Atlanta. Und obwohl Julia ihren Vater in Deutschland in seinem dunklen Grab zurückgelassen hatte, kam es ihr so vor, als würde sie ihm entgegenfliegen. Tief in ihrem Innersten erwachte etwas, das in den vergangenen Jahren geschlafen hatte. Es waren die Stimmen ihrer Ahnen. Julia wollte wissen, was das bedeutete: Indianerin zu sein. Die Vorfahren ihres Vaters waren Sammler und Jäger gewesen. Ihr
Lebensraum, das Große Becken, erstreckte sich von den Gebirgszügen der Sierra Nevada über die Kaskaden Kaliforniens und Oregons im Westen bis zu den Rocky Mountains im Osten.Beckendeshalb, weil die Flüsse in diesem Gebiet den Ozean nicht erreichen, sondern sich im Wüstensand verlieren.Newe Sogobia, wie die Shoshoni ihr Land nennen, ist eines der dürrsten und heißesten Gebiete Nordamerikas.
Früher waren die Shoshoni in kleinen Familiengruppen durchs Land gezogen. John hatte Julia erzählt, dass sie große und schlanke Leute waren, scheu, aber von fröhlichem Wesen. Sie hatten sich von Wildpflanzen, Samen und Wurzeln ernährt, hatten Piniennüsse geerntet und Kleintiere gejagt. Die Frauen waren unterwegs pausenlos mit ihren Grabestöcken auf Nahrungssuche gewesen, weshalb die Shoshoni von den Weißen auch verächtlichDiggersgenannt wurden–Wühler.
Die Erinnerung an die Gespräche mit ihrem Vater kam mit einem so wilden Schmerz daher, dass Julia tief durchatmen musste, um nicht laut aufzustöhnen. In diesem Augenblick hätte sie gerne gewusst, wie lange es dauern würde, bis es nicht mehr so wehtat.
Unterdessen tauchten am fernen Horizont schneebedeckte Berge auf.
»Die Ruby Mountains«, sagte Hanna und zeigte durch die Windschutzscheibe des Mietwagens nach vorn. »Dort ist der Vertrag von Ruby Valley unterzeichnet worden.«
Julia musste daran denken, was ihr Vater über den Vertrag von Ru-by Valley erzählt hatte, der von der US-Regierung im Jahr 1863 mit den Shoshoni geschlossen worden war. Man hatte den Indianern Schutz vor den Übergriffen weißer Siedler zugesichert und im Gegenzug bekam die US-Regierung das Recht zugesprochen, Bergbausiedlungen zu errichten und Bodenschätze abzubauen.
Alles veränderte sich. Eine Eisenbahnlinie durchzog das Land, Poststationen und Telegrafenleitungen wurden errichtet. John hatte Julia erklärt, dass mit diesem Vertrag kein Land verkauft, sondern ausschließlich Nutzungsrechte erteilt worden waren. Doch hundert Jahre später hatten die Weißen den Vertrag einfach gebrochen und das Land an sich gerissen.
Julia atmete tief durch. Warum hatte er ihr damals nicht die ganze Wahrheit erzählt? Was es mit diesem Vertragsbruch wirklich auf sich hatte; was erheutebedeutete? Warum war es ausgerechnet ihre Mutter gewesen, die ihr vom BML erzählen musste, von den bewaffneten Bundespolizisten und von dem riesigen Schuldenberg, auf dem ihre Großeltern angeblich saßen?
Hanna bog vom Highway auf eine kaum befahrene Landstraße ab. Nach knapp zwanzig Kilometern, die sie durch baumloses Grasland fuhren, erreichten sie schließlich Eldora Valley, eine Siedlung, die größtenteils aus gesichtslosen Billighäusern und kastenförmigen Wohntrailern bestand.
»Das ist der letzte Ort vor der Ranch«, sagte Hanna. »Danach kommt nur noch Wüste.«
Julia erfuhr, dass die Bewohner des Ortes vorwiegend Minenarbeiter waren, die in der nahen Columbus-Goldmine arbeiteten. Eldora Valley hatte ein Postamt, einen Lebensmittelladen, ein modernes Schulgebäude mit grünem Blechdach, eine Polizeistation und es gab jede Menge unbebaute Grundstücke.
Es schien so, als wollte niemand für immer an diesem trostlosen Ort bleiben.
Hanna bog von der Hauptstraße und hielt vor einem flachen Gebäude mit einer Zapfsäule davor. »Sam’s Grocery Store«, las Julia auf dem abgeblätterten Schild. Es war die einzige Tankstelle weit und breit und auch der einzige Lebensmittelladen in der Gegend, wie Hanna erklärte.
Während ihre Mutter tankte, verschwand Julia nach drinnen in den Laden, um auf die Toilette zu gehen. Als sie wieder herauskam, hatte ihre Mutter schon gezahlt und den Laden verlassen. Julia liefihr hinterher. Doch in der Schwungtür stieß sie mit einem jungen Mann zusammen.
»He, pass doch auf, verdammt noch mal!«, herrschte er sie an und bedachte sie mit einem verärgerten Blick. Er war einen Kopf größer als Julia und trug ein rotes Kopftuch, unter dem kurze Strähnen schwarzen, glatten Haares hervorschauten. Seine Augen wirkten wie schwarze Halbmonde und er hatte ein breites Gesicht mit hohen Wangenknochen.
Der Junge rief Sam, dem Besitzer des Ladens, etwas zu und lief durch die Regalreihen. Es war nicht der erste Indianer, den Julia sah, seit sie in Reno gelandet waren, doch sie konnte ihren Blick nicht von ihm wenden. Dieser Junge war nicht irgendein Indianer–er war ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.
Julia stürzte nach draußen, wo ihre Mutter mit einem Wischer die Frontscheibe des Leihwagens von toten Insekten säuberte. Ihrem verstörten Blick nach zu urteilen, war es Hanna wie Julia ergangen, als sie den jungen Indianer gesehen hatte.
Ein silberner Zweisitzer mit breiten roten Streifen auf der Kühlerhaube und der Heckklappe stand auf dem kleinen Parkplatz vor dem Laden. Vermutlich gehörte er diesem Jungen, ihrem...Es fiel Julia schwer, den Gedanken zu Ende zu denken.
Sie stieg zu ihrer Mutter in den Wagen und Hanna startete den Motor. Als sie den Wagen wendete, kam der Junge wieder aus dem Laden, zwei Coladosen unter dem Arm. Er steckte sich eine Zigarette an und sah ihnen mit einem so grimmigen Blick hinterher, dass Julia ein kalter Schauer über den Rücken rann.
Eine Schotterpiste führte durch die mit graugrünen Beifußbüschen bewachsene Ebene. Sie fuhren direkt auf eine Bergkette zu, auf deren sanften Kuppen Reste von Schnee lagen, die mit Wolken-schatten gesprenkelt waren. Die Cortez Mountains.
Seit sie die Siedlung verlassen hatten, kam es Julia so vor, als würden sie in ein endloses Nichts fahren, das aus verschiedenen Grüntönen bestand. Die Berge sahen aus, als wären sie von einem Tuch aus olivgrünem Samt überzogen, mit Flecken von dunkelgrünen Büschen. Die Beifußsträucher links und rechts der Straße schimmerten silbrig grün im Sonnenlicht.
Julia war jetzt hellwach und konnte ihre Ankunft kaum erwarten, während ihre Mutter immer schweigsamer und stiller wurde, als würde sie erst in diesem Moment begreifen, worauf sie sich eingelassen hatte.
Nach gut einer halben Stunde machte die Piste einen scharfen Knick nach links und sie fuhren über ein Viehgitter. Julia hielt Ausschau nach der Ranch, doch zunächst entdeckte sie nur einen kleinen Schrottplatz mit ausgedienten Fahrzeugteilen. Auf der gegenüberliegenden Seite, eingezäunt von einem Koppelzaun, reihten sich im Halbrund zwei windschiefe Holzhütten und ein verbeulter rosafarbener Wohnwagen aneinander.
Julia zeigte auf die Hütten. »Was ist das?« Fragend sah sie ihre Mutter an.
»Keine Angst, wir sind noch nicht da. Das ist bloß das Camp«, erklärte Hanna. »Als ich deinen Vater kennenlernte, haben dort Aussteiger und Hippies gewohnt, alles Leute, die deinen Großeltern den Sommer über auf der Ranch geholfen haben.«
»Sieht verlassen aus«, stellte Julia fest.
»Ja, wahrscheinlich kommt keiner mehr.«
Nach zwei weiteren Kilometern erreichten siedie Ranch. Ein Begriff, der Julia jetzt reichlich übertrieben vorkam. Vor ihr lag eine bunte Ansammlung weit verstreut stehender Behausungen, klappriger Fahrzeuge und Landmaschinen. Dazwischen undefinierbare Gerätschaften, die mit Sicherheit schon vor langer Zeit ausgedient hatten. Das Ganze war umfriedet von verschiedenartigen Zäunen und kleinen Gattern mit Wellblechdächern. Hinter einem Koppelzaun grasten ein paar braune und schwarze Rinder.
Hanna fuhr langsam, als wollte sie die Ankunft noch ein wenig hinauszögern. Julia erinnerte sich an das weiße Haus mit den hübschen blauen Fensterrahmen auf den Gemälden ihres Vaters und fragte sich plötzlich, was sie hier eigentlich suchte. Denn was sie sah, entsprach nicht im Entferntesten ihren Vorstellungen, die sie sich all die Jahre gemacht hatte.
Sie kamen an einem alten, von Unkraut umwucherten Wohntrailer vorbei, der mit türkisfarbenem Wellblech verkleidet war. Das Dach hatte jemand mit alten Autoreifen beschwert. Vor dem Trailer standen ein riesiger ausgedienter Kühlschrank und ein altes Sofa mit rotem Kunstlederbezug. Eine grob zusammengezimmerte Treppe führte zum Eingang, der von Wellblechteilen auf einem Holzgerüst überdacht war.
Rechter Hand, ungefähr hundert Meter entfernt, sah Julia im Schatten mächtiger Pappeln eine alte Blockhütte. Daneben blinkte ein silberfarbener Wohnanhänger zwischen Büschen hervor, der Ähnlichkeit mit einem UFO hatte.
Nachdem sie zwei große Sonnenkollektoren passiert hatten, tauchte ein riesiger offener Wellblechschuppen auf. Davor standen ein Traktor mit Frontlader und eine Heuballenpresse. Diverse andere Fahrzeuge, deren rostige Karossen bereits mit dem Boden verwachsen und größtenteils von Unkraut überwuchert waren, bildeten eine Blechinsel auf dem Vorplatz.
Hanna parkte vor einem hüfthohen Drahtzaun, auf dem Wäschestücke zum Trocknen hingen, und sie stiegen aus. Hinter dem Zaun wuchs saftig dunkelgrünes Gras. Unter Pappeln mit niedrigen Kronen duckte sich ein breites, weiß gestrichenes Holzschindelhaus mit einem Teerpappendach.
Julia sah die blaue Tür und die blauen Fensterrahmen. Doch was war mit dem Rest? Sämtliche Fenster hatten keine Scheiben mehr, sondern waren mit durchsichtiger Plastikfolie bespannt. Ein ausgetretener Bretterpfad führte vom Tor zur Haustür, ein weiterer zu einem Klohäuschen, dessen Holztür sperrangelweit offen stand. Esneigte sich gefährlich nach rechts und machte den Eindruck, als würde es jeden Moment zusammenbrechen.
Julia stand da und versuchte zu verarbeiten, was sie sah. Ein bunter Rausch aus Eindrücken, Bildern und zwiespältigen Empfindungen stürzte auf sie ein. Das alles kam ihr merkwürdig unwirklich vor. So, als hätten sie sich verfahren und würden gleich wieder umkehren. Das konnte unmöglich der Ort sein, nach dem ihr Vater sich gesehnt hatte–den er so oft gemalt hatte.
Sie blinzelte, weil die Sonne sie blendete. Jetzt, wo Julia nicht mehr im klimagekühlten Auto saß, merkte sie auch, wie heiß es war.Brütend heiß.
Hanna schob die Hände in die Vordertaschen ihrer Jeans. »Hier hat sich nichts verändert in den letzten sechzehn Jahren«, sagte sie. »Nur dass noch mehr Hütten und Schrottautos dazugekommen sind.«
Ihre Mutter sagte das nicht herablassend. Julia spürte, wie traurig Hanna war, aber offensichtlich auch sehr erleichtert. Sie war es gewesen, die damals auf die Rückkehr nach Deutschland gedrängt hatte. John war aus Liebe zu ihr mitgegangen. Hätte Hanna anders entschieden, wäre Julia an diesem sonderbaren Ort aufgewachsen. Und für einen winzigen Moment fühlte sie so etwas wie Dankbarkeit.
Plötzlich tat es einen dumpfen Schlag in ihrem Rücken und Julia hörte einen Laut, der ihr trotz der Hitze eine Gänsehaut verursachte. Sie erstarrte. Es war ein dunkles Heulen und Wüten aus tiefster Kehle, und sie fragte sich, ob es überhaupt menschlich war.
»Ahrg-ah-a-mah.«
Langsam drehte sie sich um. Auch Hanna starrte in die Richtung, aus der der Krach kam.
Nur ein paar Meter von ihnen entfernt stand ein aufgebockter grüner Pick-up-Truck ohne Räder. Und auf dem Fahrersitz saß ein menschliches Wesen, wie Julia noch keines zuvor gesehen hatte: dunkle Haut, ein länglicher Schädel wie von einem Schraubstock zusammengedrückt, kurzes schwarzes Stoppelhaar und ein offener Mund mit vorstehenden Zähnen. Eine bizarre Grimasse, abstoßend und furchterregend.
Beide Augäpfel waren von einem milchigen Schleier überzogen und diese blinden Augen starrten Julia an. Ein drahtiger Arm mit knotigen Muskeln baumelte zum offenen Fenster hinaus. Die kräftige Hand schlug erneut gegen das Türblech, dass es krachte.
Julia zuckte zusammen. Wieder das tierische Geheul.
»Darf ich vorstellen«, sagte Hanna, »dein Cousin Tommy.«
Nicht ohne einen Schauer der Abscheu starrte Julia auf das Wesen, zu keinem klaren Gedanken fähig. Im selben Augenblick schoss ein brauner Pick-up um die Ecke des großen Schuppens und hielt neben ihrem Leihwagen. Ein alter Mann stieg aus, stämmig und breitschultrig. Er trug klobige Arbeitsschuhe und zerbeulte braune Cordhosen, die von breiten Hosenträgern gehalten wurden. Kräftige braune Arme schauten aus aufgekrempelten Hemdsärmeln hervor. Das kurz geschnittene Haar des Mannes stand silbergrau vom mächtigen Schädel, die dunkle Haut seines Gesichts war die eines Menschen, der ein Leben lang im Freien gearbeitet hat. Um seine Augen zogen sich helle Lachfältchen.
Das war Boyd Temoke, Julias Großvater. Sie kannte ihn von den Fotos, die ihr Vater ihr gezeigt hatte. »Hallo, Hanna«, sagte er und reichte ihrer Mutter die Hand. »Willkommen auf der Ranch.« Dann erschien ein freundliches Lächeln auf seinem dunklen Gesicht. »Und du musst Julia sein, meine Enkeltochter.«
Er sagte das mit unerwarteter Wärme und Julias Anspannung löste sich ein wenig. Ihre Hand verschwand in seiner großen Pranke und sie erwiderte, so gut sie konnte, seinen kräftigen Händedruck. »Hallo, Grandpa«, sagte sie schüchtern. Da nahm Boyd sie fest in die Arme. Der Duft von Heu, Kühen und Motoröl stieg ihr in die Nase, aber auch der eines alten Mannes. Merkwürdigerweise störte es Julia nicht, dass ihr Großvater sie umarmte.
»Willkommen auf der Ranch, Julia. Ich hoffe, Tommy hat euch nicht zu sehr erschreckt. Er hat keinen guten Tag heute. Ada ist am Vormittag in die Stadt gefahren und noch nicht zurück. Tommy vermisst seine Granny, er mag es nicht, wenn sie weg ist. Aber vielleicht hat er ja auch Hunger. Lasst uns ins Haus gehen, damit ich ihn füttern kann.«
Ein alter Mischlingshund mit braun-schwarzem Fell kam schwanzwedelnd auf sie zu.
»Das ist Loui-Loui«, sagte Boyd. »Der ist so alt wie ich.« Er grinste.
Der Hund stupste Julia mit der feuchten Schnauze am Bein und sie streichelte sein langhaariges Fell, das staubig und voller Kletten war. »Hallo Loui-Loui«, sagte sie. »Ich bin Julia.«
Hanna begann die Lebensmittel auszuladen und ins Haus zu tragen. Der alte Mann öffnete die Fahrertür des Trucks und ging in die Knie, damit Tommy die Arme um seinen Hals legen konnte. Huckepack trug er den behinderten Jungen ins Haus.
Erst jetzt sah Julia, dass Tommy hochgezogene knochige Schultern und dünne, verwachsene Beine hatte. Seine Füße, mit denen er niemals Schritte machen würde, glichen verdrehten Klumpen. Tommys ganzer Körper schien unter einer unheimlichen Spannung zu stehen, als ob seine verzerrten Gliedmaßen jeden Augenblick in ihre natürliche Lage schnellen wollten.
Boyd und Hanna verschwanden im Haus. Julia schnappte sich eine Kiste mit Lebensmitteln und lief ihnen hinterher. Im kleinen Flur hinter der Eingangstür standen Müllsäcke und es roch unangenehm nach vollgepinkelten Windeln. Jacken hingen an der Wand und staubige Schuhe standen in einem Holzregal.
Drinnen herrschte diffuses Dämmerlicht, wofür die Plastikfolie vor den Fenstern verantwortlich war. Wohnraum und Küche waren durch einen breiten, offenen Durchgang verbunden. Der alte Mann schaltete in beiden Räumen das Licht an. Es kam aus verstaubten Glühbirnen, die an Kabeln von der Decke baumelten.
In der Küche stand ein uralter gusseiserner Holzherd mit Töpfen und Pfannen darauf. Die Hängeschränke an der Fensterfront und über der Spüle waren aus lackiertem Sperrholz gezimmert und sahen schäbig aus. Teile der Deckenverkleidung hatten sich gelöst und die Isolierung aus gelbgrauen Glasfasermatten hing an einigen Stellen lose herunter. Überall in den Ecken entdeckte Julia klebrige graue Spinnweben.
Vielleicht merkt man das alles nicht mehr, wenn man viele Jahre so lebt, dachte sie voller Unbehagen. Aber was war mit ihrem Vater gewesen? Wie musste er sich gefühlt haben, wenn er hierhergekommen war?
Der alte Mann ließ Tommy auf einen Küchenstuhl gleiten, dessen Vinylbezug mit grauem Klebeband geflickt war.
»Wenn ihr Hunger habt oder Durst«, sagte er, »im Kühlschrank ist etwas zu essen und in der Kanne ist Kool Aid.« Er deutete auf eine alte Plastikkanne mit einer knallroten Flüssigkeit.
Julia hatte Durst und fragte ihren Großvater, wo sie ein Glas finden konnte. Boyd reagierte nicht. Er hatte für Tommy ein Babygläschen mit Bananenbrei geöffnet und fütterte ihn. Tommy sperrte den Schnabel auf wie ein hungriges Vogeljunges. Er rieb sich mit den schmutzigen Händen über die blinden Augen, brabbelte und machte gurgelnde Geräusche, die Julia immer wieder zu ihrem schwerbehinderten Cousin hinsehen ließen. Dabei entdeckte sie auch, dass seine braunen Unterarme von hellen Narben und verkrusteten Bisswunden übersät waren.
Noch einmal fragte sie den alten Mann nach einem Glas.
Da legte Hanna ihr eine Hand auf die Schulter. »Er kann dich nicht hören, Julia. Dein Großvater ist fast taub. Hat Pa dir das nicht erzählt?« Sie öffnete einen der Hängeschränke und reichte Julia ein sauberes Marmeladenglas ohne Deckel. Irritiert sah Julia ihre Mutter an.
Hanna zuckte mit den Achseln. »Hier ist einiges anders, als du eserwartet hast. Nimm es, wie es ist. In ein paar Tagen sind wir wieder weg.«
Der Großvater hatte Tommy fertig gefüttert und der Junge glitt vom Stuhl. Unerwartet flink robbte er mit seinen verkrüppelten Beinen über den abgewetzten Linoleumboden ins Wohnzimmer. Dort bekam er eine neue Windel, dann brachte ihn der alte Mann wieder nach draußen in seinen Pick-up, der offensichtlich Tommys Lieblingsplatz war.
Nachdem sich ihr Monster-Cousin nicht mehr in der Nähe aufhielt, entspannte Julia sich ein wenig. Sie ging ins Wohnzimmer, das mit dunklen Holzmöbeln bestückt war, die mindestens schon hundert Jahre auf dem Buckel hatten. Eine Kommode, eine Anrichte und ein wuchtiger Schrank. Die übrige Einrichtung bestand aus einer durchgesessenen Couch, zwei speckigen Sesseln, einem niedrigen Tisch und einem Fernseher. Die Vorhänge an den Fenstern waren zerschlissen vom Alter und starrten vor Schmutz. Auf dem durchgetretenen Teppich lagen Zeitungsstapel und Kleidungsstücke. Es roch muffig, als wäre wochenlang nicht gelüftet worden.
Doch da hingen diese Fotos an den Wänden, die Julia magisch anzogen und die sie sich der Reihe nach genau ansah. Die sepiafarbenen zuerst: Männer und Frauen in altmodischer Kleidung, mit stoischen Gesichtern. Vermutlich waren das ihre Vorfahren, die stumm auf sie herabsahen.
Julia betrachtete das Hochzeitsfoto ihrer Großeltern und staunte, wie gut der alte Mann einmal ausgesehen hatte. Adas Gesicht hatte etwas Hartes, aber wenn sie lachte, strahlten ihre Augen voller Wärme.
Schließlich die schwarz-weißen Fotos: Ihre Großmutter Ada zusammen mit Robert Redford. Ein anderes mit dem Dalai-Lama.Wow. Ihr Vater hatte also keine Märchen erzählt. Granny Ada war eine Frau, die ziemlich herumkam in der Welt.
Auf den anderen, den bunten Fotos, das mussten weitere Familienmitglieder sein. Julia erkannte ihren Vater. Eines zeigte ihn mit seiner ersten Frau Veola und zwei kleinen, dunkelhäutigen Kindern, einem Mädchen und einem Jungen. Jason und Tracy, ihre Halbgeschwister.
Ein Foto jüngeren Datums zeigte John und Jason. Es musste vor drei oder vier Jahren aufgenommen worden sein, als Jason ungefähr in ihrem jetzigen Alter war. Vater und Sohn standen Seite an Seite, berührten einander aber nicht. Jason blickte grimmig drein und nun wusste Julia ganz sicher, was sie schon die ganze Zeit vermutet hatte: Der Junge in Sams Laden war ihr Halbbruder Jason gewesen.
Es gab auch ein Foto von ihr selbst, zusammen mit ihrem Vater. Julia erinnerte sich noch an den Tag, als es aufgenommen worden war. Damals war sie dreizehn gewesen, hatte mit Babyspeck und Pickeln zu kämpfen gehabt und diese verhasste Zahnspange getragen. Ihr Vater strahlte dennoch voller Stolz. Er stand hinter ihr und hatte beide Arme um sie gelegt. Es war in Italien aufgenommen, während sie zu dritt Urlaub am Meer gemacht hatten.
Das war Erinnerung, war Vergangenheit. Julia kämpfte gegen die Tränen, die in ihr aufstiegen. Alles, was mit ihrem Vater zu tun hatte, würde von nun an Vergangenheit sein. Etwas Abgeschlossenes ohne Zukunft.
Mit dem Handrücken wischte sie die Tränen fort, als sie hörte, dass draußen auf dem Vorplatz ein Auto hielt. Kurz darauf stand ihre Großmutter in der Küche, bepackt mit Einkaufstüten. Ada war kleiner, als Julia sie sich vorgestellt hatte. Ihr widerspenstiges graues Haar hatte sie kurz geschnitten, was zu ihrem ledrigen Gesicht passte. Es war ein hartes Gesicht mit klaren braunen Augen und tiefen Falten um den breiten Mund.
Während Ada Hanna die Hand schüttelte und sie willkommen hieß, beobachtete Julia die alte Frau sehr genau. Es war ein frostiges Willkommen, das sah Julia an der Körperhaltung ihrer Großmutter, die Ablehnung und Misstrauen ausdrückte. Trotzdem gab sie sicheinen Ruck und ging auf sie zu. »Hi, Grandma«, sagte sie. »Ich bin Julia.«
Völlig unerwartet riss Ada sie in ihre Arme und Julia war verblüfft darüber, wie kräftig ihre Granny war. Ein tiefer Seufzer kam aus der Brust der alten Frau. Dann schob sie Julia von sich und sagte mit heiserer Raucherstimme: »Du siehst deinem Vater verdammt ähnlich.«
Das stimmte. Julias Haut war zwar nicht so dunkel wie die ihres Vaters, aber sonst hatten sich seine Gene durchgesetzt und sie war froh, ihm zu ähneln. Julia hatte Johns Nase, kurz und mit kräftigen Nasenflügeln, und seine vollen Lippen. Auch die Form seiner Augen hatte sie geerbt: kleine Halbmonde, die äußeren Winkel leicht nach unten gezogen.
Sacajawea, hatte ihr Vater sie immer genannt,Vogelmädchen. Sacajawea, eine junge Shoshoni, hatte 1805 die Expedition von Lewis und Clark begleitet und dafür gesorgt, dass die beiden weißen Forscher auf ihrer Reise nicht verhungert waren. Das Gesicht des Mädchens war auf einer messingfarbenen Dollarmünze abgebildet und John hatte behauptet, die Ähnlichkeit mit Julia wäre unverkennbar.
Von ihrer Mutter hatte sie nur die ungewöhnliche Augenfarbe. Ein bläuliches Grün, wie dunkler Türkis, mit winzigen goldenen Sprenkeln darin.
Ada schob Julia zur Seite und das Mädchen glaubte, Tränen in den Augen ihrer Großmutter zu sehen. Geschäftig verstaute die alte Frau Mitgebrachtes in der Küche, las Zettel, die auf dem Resopaltisch lagen, und plauderte, als wären Hanna und Julia alte Bekannte, die eben mal kurz vorbeigekommen waren.Wie war der Flug? Seid ihr müde? Hungrig? Kann mir mal einer helfen, die Kiste auf den Schrank zu heben?
Julia wusste nicht, ob sie ihre Granny fürchten, sie bewundern, oder Mitleid mit ihr haben sollte. Adas harsches Wesen wirkte einschüchternd auf sie, aber instinktiv spürte Julia, dass unter der harten Schale offene Wunden lagen, die nie verheilt waren.
Schließlich setzte sich Ada, zündete eine Zigarette an und rauchte schweigend, wobei sie ihre weiße Schwiegertochter eindringlich musterte.
»Musste mein Sohn leiden, bevor er starb?«, fragte sie.»Nein. Er war sofort tot.«»Und seine Organe?«Julias Augen weiteten sich vor Entsetzen und sie sah ihre Mutter
fragend an. »John ist als ganzer Mensch begraben worden.« Die alte Frau nickte. »Das ist gut.« Sie drückte die halb aufgerauch
te Zigarette in den Aschenbecher und erhob sich. »Also dann kommt. Ich will euch zeigen, wo ihr schlafen werdet.«
3.
Ada stieg mit ihnen in den Leihwagen und führte sie zu dem türkisfarbenen Trailer, der noch vor der Einfahrt zum Hof stand. Auch aus der Nähe machte der Blechkasten den Eindruck, als sollte er samt umherstehendem Unrat in den nächsten Tagen von der Sperrmüllabfuhr geholt werden.
Doch drinnen hatte sich jemand große Mühe gegeben, die Zimmer bewohnbar zu gestalten. Größter Raum war die Küche mit einer Schlafcouch, einem alten Sessel, einer Aluspüle auf Holzbeinen und diversen kleinen Schränken.
Linker Hand führte ein schmaler Gang in einen angrenzenden Raum mit einem frisch bezogenen Bett und einem Nachtschränkchen. Vom Gang aus kam man in eine Abstellkammer und in ein ebenso kleines Bad mit Toilette, Waschbecken und Badewanne. Die Einrichtung schien uralt zu sein, aber Julia gefiel es im Trailer. Vielleicht war sie auch einfach nur erleichtert, nicht im Ranchhaus schlafen zu müssen.
Ada erklärte ihnen, dass es keinen Strom und auch kein fließend Wasser gab. Waschbecken, Spüle, Wanne und Toilette–alles nur Attrappe. Für Notfälle stand im Bad ein Eimer mit Deckel. Ein anderer Eimer, der immer wieder aufgefüllt werden musste, enthielt Wasser zum Waschen.
Ada überreichte Julia und Hanna zwei große batteriebetriebene Lampen und offenbarte ganz nebenbei, dass die Tür des Trailers nicht verschließbar war. Wo eigentlich das Schloss sein sollte, befand sich ein kreisrundes Loch. Sie erklärte der entgeisterten Hanna, wie man die Tür mit einem verbogenen Draht geschlossen halten konnte.
»Sollte es stürmisch werden«, warnte Ada sie, »schiebt ihr am besten von innen einen Stein vor.«
Hanna nickte stumm.
»In einer Stunde gibt es Abendessen«, sagte die alte Frau. »Hilfe ist immer willkommen.«
Nach dem Essen, das aus Kartoffeln, gebackenen Bohnen und Hamburgern bestanden hatte, saßen Julia und Hanna mit den beiden Alten in der Küche, während Tommy nebenan auf dem Teppich hockte und zusammenhanglos vor sich hin brabbelte. Boyd knabberte an der Schokolade, die Julia ihm aus Deutschland mitgebracht hatte, und trank Kool Aid dazu.
Ada erzählte, dass Tommy der Sohn von Sarah war, Johns Schwester. Sarah hatte mit ihrem Mann eine Zeit lang in der Nähe des Atomwaffentestgebietes bei Las Vegas gelebt, bei einem kleinen Ute-Stamm. Obwohl die Sprengungen auf dem Testgelände seit vierzig Jahren per Gesetz unter der Erdoberfläche stattfinden mussten, gelangte dabei immer wieder Strahlung in die Luft.
»Durch den Druck, der bei den Explosionen entsteht, schießen Millionen von Gammastrahlen und radioaktiven Jodpartikeln in die Atmosphäre, vermischen sich mit Regenwolken und gehen wer weiß wo nieder«, schimpfte Ada voller Missbilligung. »Weht der Wind aus Richtung Westen, bekommt das Reservat der Ute-Indianer alles ab. Als Tommy zur Welt kam, gaben ihm die Ärzte keine drei Jahre. Sie rieten Sarah, ihn in ein Heim zu geben, was sie aus Verzweiflung auch tun wollte. Aber ich konnte das nicht zulassen«, die alte Frau schüttelte den Kopf, »nicht bei meinem Enkelsohn. Deshalb habe ich den Jungen bei mir aufgenommen und ihm alles gegeben, was er braucht. Inzwischen ist Tommy vierundzwanzig.« Sie seufzte. »Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, dass meine Kinder ihr Land und ihr eigen Fleisch und Blut im Stich lassen.«
Hanna überhörte den Vorwurf. »Wie geht es Veola und den Kindern?«, fragte sie mit tapferer Stimme.
Julia horchte auf.
»Veola lebt mit Jason in Eldora Valley. Sie arbeitet für unsere OrganisationShoshone Rights


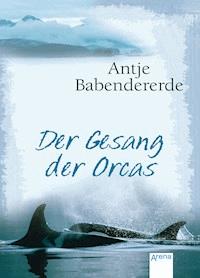


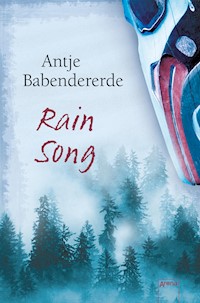

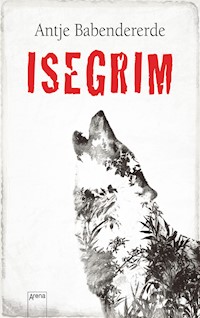
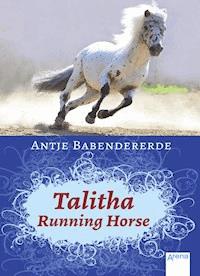

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)