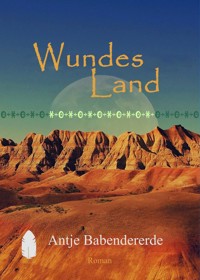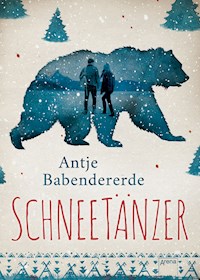0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: digi:tales
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Leonie verbringt die Ferien zusammen mit ihrem Vater in einem ärmlichen Holzhaus am Fuße der Rocky Mountains, wo es nichts gibt als Berge und unendliche Grasmeere. Und Indianer natürlich. Darauf hat sie absolut keine Lust! Bis sie auf den geheimnisvollen Chas trifft - Chas, der so ganz anders ist als die Jungs, die Leonie kennt. Doch es scheint, als wolle der stolze Indianer absolut nichts von ihr wissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Digitale Originalausgabe
Impressum
digi:tales Ein Imprint der Arena Verlag GmbH
Digitale Originalausgabe © Arena Verlag GmbH, Würzburg 2019 Covergestaltung: Frauke Schneider Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in deutscher Sprache erstmals 2009 unter dem Titel Findet mich die Liebe? im Arena Verlag erschienen E-Book-Herstellung: Arena Verlag GmbH 2019 ISBN: 978-3-401-84068-0 www.arena-verlag.dewww.arena-digitales.deFolge uns!www.facebook.com/digitalesarenawww.instagram.com/arena_digitaleswww.twitter.com/arenaverlagwww.pinterest.com/arenaverlag
Inhalt
Findet mich die Liebe?
Ich begegnete Chas gleich an meinem ersten Abend in Montana.
Nach der langen Reise war ich erschöpft und schlecht gelaunt und fragte mich zum hundertsten Mal, was ich hier eigentlich wollte – in einem ärmlichen Holzhaus am Fuße der Rocky Mountains. Wir saßen in der Küche von George Blackeye, einem Schwarzfußindianer und Freund meines Vaters.
Paps ist Fotograf und Reisebuchautor und sein Steckenpferd sind die nordamerikanischen Indianer. Früher hatte ich ihn immer beneidet, weil er überall in der Welt herumkam und tolle Leute kennenlernte. Ich brannte darauf, ihn zu begleiten, aber er nahm mich nie mit, weil ich noch zu klein war. Jetzt war ich fünfzehn und er hatte mich mitgenommen.
Leider.
Denn lieber hätte ich mit meinen Freunden am Balaton in der Sonne gelegen und wäre mit etwas Glück den Titel »Leonie die Ungeküsste« losgeworden. Stattdessen würde ich sechs lange Wochen in Montana verbringen, wo es nichts weiter gab als Berge, unendliche Grasmeere und big sky – den großen Himmel. Und Indianer natürlich.
Das alles hier hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Paps hatte mir Fotos gezeigt, auf denen war Georges Haus neu und hatte einen frischen hellblauen Anstrich. Davon war nicht mehr viel übrig. Jetzt blätterte die Farbe von der Holzverkleidung und es stand eine Menge Kram vor dem Haus, so als würde die Sperrmüllabfuhr am nächsten Tag hier vorbeikommen.
Mein Blick wanderte durch die von Dunstschwaden durchzogene Küche. Der große Holztisch war mit angeschlagenen Tellern gedeckt, die Tassen, aus denen wir unseren Begrüßungstee tranken, sahen aus wie vom Trödelmarkt. Während mein Vater und George erregt über Politik diskutierten, schwieg ich, obwohl Nita, Georges Tochter, mir immer wieder aufmunternde Blicke zuwarf.
Nita war älter als ich. Sie hatte ein schmales Gesicht und glänzend schwarze Augen. Auf dem uralten Gasherd hatte sie Fladenbrote in heißem Fett ausgebacken. Dazu gab es eine Mischung aus gebratenem Rinderhack und dunklen Bohnen, klein geschnittenem grünem Salat, Zwiebeln und Tomaten mit geriebenem Käse. Indian Taco nannte sich das Ganze. Erst beim Essen merkte ich, wie hungrig ich war.
Gerade wollte ich Nita fragen, ob ich einen Nachschlag bekommen konnte, als er plötzlich im Türrahmen stand. Ich war die Erste, die ihn überhaupt wahrnahm. Wie ein Geist stand er da und starrte mich an. Auf seinem dunkelroten Sweatshirt war ein Wolf abgebildet, der denselben grimmigen Blick hatte wie er.
»Hi Chas«, sagte Nita und George hörte auf einmal auf zu reden. Jetzt wandte auch Paps seinen Blick zur Tür.
Der Junge rührte sich nicht. Er sagte auch nichts. Ich schätzte ihn auf sechzehn oder siebzehn. Seine zu Zöpfen geflochtenen Haare verschwanden auf seinem Rücken.
»Mein Sohn Chas«, sagte George. Und an die stumme Gestalt in der Tür gewandt, fragte er: »Willst du unsere Gäste nicht begrüßen?«
Die funkelnden schwarzen Augen schienen in der Familie zu liegen, daher vielleicht auch der Name Blackeye. In Chas' finsterem Blick konnte ich die unverhohlene Abneigung erkennen, die er uns entgegenbrachte, und mit einem Mal kam ich mir ganz komisch vor, wie ein Eindringling in eine fremde Welt.
Dabei stand der Junge einfach nur da und musterte uns stumm. Ich fühlte mich zunehmend unwohl in meiner Haut. Schließlich, es kam mir wie eine Ewigkeit vor, drehte er sich um und verschwand, so plötzlich, wie er gekommen war.
Ich öffnete den Mund, um zu fragen, was zum Teufel das denn zu bedeuten hatte. Doch dann sah ich, wie Papa mich mit einem warnenden Blick bedachte, und schwieg.
Nach dem Essen zogen sich mein Vater und George ins Wohnzimmer zurück und
Nita kümmerte sich um den Abwasch. Misstrauisch betrachtete ich die uralte Spüle und konnte mir nicht vorstellen, dass aus dem rostigen Hahn sauberes Wasser kommen sollte.
»Kann ich dir helfen?«, fragte ich Nita.
»Nett, dass du fragst«, sagte sie, »aber heute mache ich das allein. Du siehst müde aus. Geh doch noch einen Augenblick an die frische Luft«, schlug sie mir stattdessen vor. »Nach der langen Fahrt musst du ja ganz kribbelig sein.« Dabei lächelte sie mich so warm an, dass mir das erste Mal seit unserer Ankunft etwas leichter ums Herz wurde.
Weder Nita noch ihr Vater hatten das merkwürdige Gebaren von Chas kommentiert. Beide hatten nur einen stummen Blick getauscht und George hatte unmerklich den Kopf geschüttelt. Daraufhin hatte
mein Vater rasch das Thema gewechselt.
Was für Probleme George auch mit seinem Sohn hatte: Ich war neugierig geworden. Aber ich wusste von Paps, dass Neugier keine Tugend war bei den Blackfeet. Deshalb musste ich mich gedulden.
»Okay, dann schau ich mich draußen mal um«, sagte ich, in der Hoffnung, diesen Jungen vielleicht irgendwo zu entdecken.
Durch den dunklen Flur trat ich ins Freie und atmete die würzige Luft des nahen Waldes. Die Sonne verschwand langsam hinter dem grauen Felsmassiv der Rockys und der Himmel über dem Gebirge wechselte gerade von Feuerrot zu Lavendelfarben. Das sah wirklich irre aus. Wie auf einer von diesen kitschigen Postkarten. Aber es war echt.
Ich ließ meinen Blick umherschweifen. Von Chas Blackeye keine Spur. Ein ausgetretener Pfad führte am Haus vorbei zu einer Koppel, auf der drei Pferde standen. Die Tiere, die jetzt neugierig auf mich zukamen, sahen aus wie Zauberwesen. Eine braune Stute mit weißem Hinterteil. Die andere hatte am ganzen Körper weiße Flecken, wie Schneeflocken. Am schönsten aber war der graue Hengst, dessen Hinterteil weiß war mit großen grauen Punkten drauf, wie bemalt. Überhaupt sahen diese Pferde aus, als hätte jemand einen großen Pinsel angesetzt und seiner Fantasie freien Lauf gelassen.
Der Hengst kam auf mich zu und schnaubte neugierig. Er scharrte mit den Hufen und schüttelte seine kurze Mähne. Ich streckte zögerlich meine Hand nach ihm aus, wagte es aber nicht, ihn zu streicheln. Er war stark und groß und ich wusste nicht, was er über mich dachte.
»Keine Angst«, sagte plötzlich eine Stimme hinter mir und ich fuhr erschrockenherum. Es war Nita, ich hatte sie nicht kommen gehört.
»Er heißt Spirit und gehört Chas«, sagte sie lächelnd. »Er macht einen ziemlich wilden Eindruck, aber im Grunde ist er ein lieber Kerl.«
Ich nickte und fragte mich, ob sie damit das Pferd oder ihren Bruder meinte.
»Es tut mir leid, dass Chas vorhin so unhöflich war«, sagte Nita. Ich sah sie an. Vielleicht wurde meine Frage, die ich nicht gestellt hatte, gleich beantwortet.
»Seit unsere Mutter vor zwei Jahren gestorben ist, hat er sich verändert. Er will nicht mehr zur Schule gehen und diesen Sommer ist er gegen den Willen unseres Vaters ins Tipicamp gezogen. Er lebt dort bei unserem Großvater John Old Wolf, einem Medizinmann.«
»Er ist in ein Tipicamp gezogen?«, fragte ich erstaunt.
»Ja, in unser Sommerlager oben in den Bergen. Einige aus unserem Volk leben dort unser altes Leben. Chas hätte am liebsten, dass alles wieder so wie früher ist, bevor die Weißen kamen.«
»Er ist ganz schön wütend, oder?«, fragte ich. Chas' funkelnder Blick wollte mir nicht aus dem Kopf gehen.
Sie zuckte mit den Achseln. »Chas ist auf jeden und alles wütend und am meisten wohl auf sich selbst. Mein kleiner Bruder wirft unserem Dad vor, dass er den falschen Weg geht, um die Traditionen zu wahren. Deshalb war er auch so unfreundlich. Er hält nichts davon, dass Weiße Bücher über uns Indianer schreiben und uns fotografieren, wenn wir Powwowkleidung tragen.«
»Verstehe«, sagte ich. »Aber mein Vater meint es gut. Er will, dass die Menschen in Deutschland die Schönheit des Landes sehen und Lust bekommen hierherzureisen.« Hey, wie kam es nur, dass ich meinen Vater plötzlich verteidigte?
Nita legte mir die Hand auf die Schulter. »Das weiß ich. Mein Dad hat Onkel Peter sehr gern und ich mag ihn auch.«
Onkel Peter? Jetzt musste ich lachen und Nita lachte mit. Aber gleich darauf wurde sie wieder ernst.
»Ich habe Angst um Chas«, sagte sie leise.


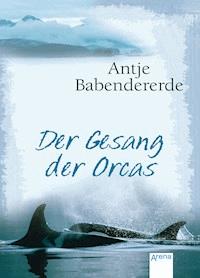
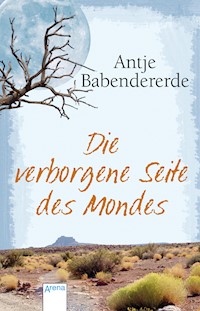


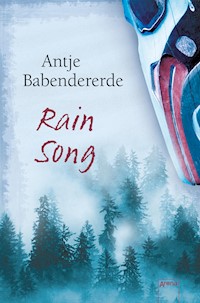

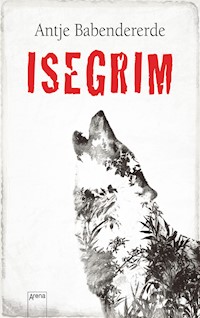
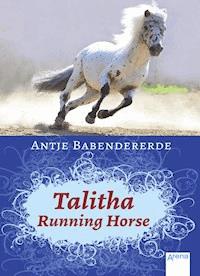

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)