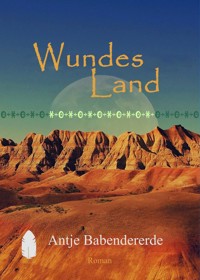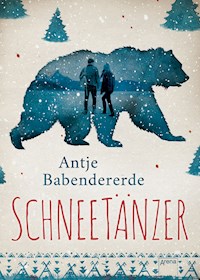Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein einsamer Strand am Pazifik, ein Ozean ohne Grenzen, ein Ort voller Magie. Das ist La Push für Smilla, die mit ihren Freunden im Indianerreservat ihr Camp aufschlägt. Doch warum begegnen ihnen die Einheimischen so feindselig? Als Smilla sich in den schwer durchschaubaren Conrad verliebt, kippt die Stimmung in der Clique und sie erfährt, was letzten Sommer an diesem Strand geschehen ist.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Antje Babendererde
Indigosommer
Roman
Antje Babendererde, geboren 1963, wuchs in Thüringen auf. Nach einer Töpferlehre war sie als Arbeitstherapeutin in der Kinderpsychiatrie tätig. Seit 1996 ist sie freiberufliche Autorin mit einem besonderen Interesse an der Kultur, Geschichte und heutigen Situation der Indianer. Ihre einfühlsamen Romane zu diesem Thema für Erwachsene wie für Jugendliche fußen auf intensiven Recherchen und USA-Reisen und werden von der Kritik hoch gelobt. »Indigosommer« ist Antje Babendererdes sechster Jugendroman.
Veröffentlicht als E-Book 2010 © 2009 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Frauke Schneider
The wave changed instantly by the rock, the rock changed by the wave returning over and over.
Adrienne Rich
. . . the place you have left forever is always there for you to see whenever you shut your eyes.
Jan Myrdal
Surfer in einem Internetforum über La Push und die Quileute
Indian Pisser
This place sucks, it’s full of savages, forget about the tomahawk, watch out for a flying beer bottle or a piece of water logged drift wood. Drove into town to get beer from the »market«, saw a lady takin’ a leak on the bus bench, pants around her ankles, I think she was takin’ a crap, but she wouldn’t fess up to it. If you’re brown go to town, if you’re white take a flight.
Bob and Doug McKenzie
Nightmare
1. Kapitel
Hey, lass dich anschauen, Midget«, sagte Alec. »Du siehst toll aus, beinahe hätte ich dich nicht wiedererkannt.« Er grinste und ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg. Midget, Zwerg, so hatte er mich damals schon genannt.
»Du hast dich auch ganz schön verändert«, bemerkte ich. Meine Zunge fühlte sich taub und mein Englisch ziemlich eingerostet an. Seit zwanzig Stunden war ich unterwegs, war hundemüde und gleichzeitig völlig aufgedreht.
Alecs Grinsen wurde breiter, er schüttelte seinen Kopf mit den blonden Dreadlocks. »Die habe ich seit einem halben Jahr.«
»Steht dir«, sagte ich.
Meine Zähne hatten einen pelzigen Belag und ich bereute, mir nicht wenigstens einen Kaugummi in den Mund gesteckt zu haben, bevor ich aus dem Flieger gestiegen war.
Alec zuckte mit den Achseln. »Finden Mom und Dad nicht.«
Ich blickte an ihm vorbei, ließ meinen Blick suchend durch die Eingangshalle des Sea-Tac Airport schweifen, wo Reisende aller Hautfarben sich tummelten. »Wo sind sie eigentlich?«
»Müssen arbeiten. Janice ist babysitten bei Freunden. Ich bin das Empfangskomitee.« Alec breitete seine Arme aus und umarmte mich. Meine Nase war dabei schätzungsweise zehn Zentimeter über seinem Bauchnabel. Er duftete nach frischer Baumwolle und mein Herz vollführte Purzelbäume.
Alec Turner war meine erste große Liebe gewesen. Wenn man in einem Alter von zehn Jahren schon von Liebe sprechen konnte.
Unsere Väter waren ein Jahr lang Arbeitskollegen gewesen. Warren Turner arbeitete (und tat es immer noch) bei Boeing in Seattle und mein Paps hatte damals gerade eine Stelle im Boeing-Büro in Berlin angenommen. Deswegen waren wir vor sechs Jahren von Suhl (einer kleinen Stadt hinter sieben Bergen) in Thüringen in die Hauptstadt gezogen.
Anfangs kam ich nur schwer zurecht im Großstadtdschungel. Ich vermisste meine Freunde, die Berge, den Wald. Doch dann kamen die Turners nach Berlin. Mein Vater und Warren wurden Freunde und Alec und seine Schwester Janice meine bevorzugten Spielkameraden. Ich schwärmte glühend für den drei Jahre älteren Alec mit den blauen Augen und den hellblonden Locken, deshalb wollte ich alles verstehen, was er sagte. Auf diese Weise lernte ich Englisch.
Alec war damals schon groß für sein Alter und – im Nachhinein betrachtet – sehr geduldig mit dem dünnen Winzling, der ihm auf Schritt und Tritt folgte. Liebevoll nannte er mich Zwerg.
Als die Familie Turner nach einem Jahr zurück nach Seattle zog, dachte ich, die Welt müsse stehen bleiben. Aber das tat sie natürlich nicht.
Sechs Jahre später war Berlin mein Zuhause, ich brachte es auf beinahe einen Meter sechzig, war beinahe sechzehn und hatte meine erste feste Beziehung hinter mir. Sieben Monate lang hatte mein Himmel voller Geigen gehangen, bis schlagartig alles vorbei war. Sebastian machte Schluss, als er erfuhr, dass ich für ein Schuljahr nach Seattle gehen würde. Er sei kein Freund von Fernbeziehungen, hatte er mir kurz und bündig erklärt. Seattle und Berlin, das wäre nicht kompatibel.
»Ich komme wieder«, erinnerte ich ihn, erschüttert und zutiefst verletzt. Aber er meinte, dieses Jahr in Amerika würde mich verändern und er mochte mich nun mal so, wie ich war.
Das war jetzt auch schon wieder drei Monate her. In schwachen Stunden trauerte ich Sebastian immer noch nach. Immerhin, er war meine zweite große Liebe gewesen. Trotzdem brauchte es jetzt nur etwa fünf Minuten und meine alte Leidenschaft für Alec flammte erneut auf. Aus dem niedlichen Dreizehnjährigen war ein strahlend schöner junger Mann geworden. Zum Niederknien schön. Groß und sportlich, braungebrannt, entwaffnend charmant und witzig noch dazu. Und diese wunderbaren blauen Augen, die mich schon damals fasziniert hatten. Nur, dass sie nun eine Vielzahl an Gefühlen in mir hervorriefen, die ich als Zehnjährige noch gar nicht gekannt hatte.
Alec schnappte sich den Gepäckwagen und hievte meine Koffer darauf. Gemeinsam liefen wir in Richtung Ausgang. Er plauderte ganz unbefangen, als wären nur ein paar Wochen und nicht zwei Jahre vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Vor zwei Jahren hatte ich mit meinen Eltern bei den Turners in Seattle Urlaub gemacht, doch ausgerechnet in dieser Zeit war Alec mit seinen Kumpels zelten gewesen, sodass wir uns nur ganz kurz gesehen hatten.
Janice und ich hielten durch E-Mails Kontakt, aber von ihrem Bruder hatte sie nie viel geschrieben. Ich freute mich seit Wochen auf die Warrens und das Schuljahr in Seattle. Es würde mit Sicherheit eine aufregende Zeit werden und ich hoffte, Sebastian hier schnell und endgültig zu vergessen.
Verstohlen musterte ich Alec von der Seite. Seine Dreads wippten bei jedem Schritt. Als wir draußen auf den Parkplatz zusteuerten, fragte er: »Sag mal, Midget, was ist eigentlich mit deinen Haaren passiert?«
Verdammt! Von wegen: »Du siehst toll aus!« Während des Fluges hatte ich mir eine Vielzahl Erklärungen zurechtgelegt, aber nun geriet ich doch ins Stottern. Ich spürte, wie mir erneut die Röte ins Gesicht stieg. »Ein Missgeschick«, sagte ich und strich mir eine imaginäre Haarsträhne hinters Ohr. Alte Angewohnheit.
»Ein Missgeschick?«, fragte er nach.
»Kleine Tierchen.« Ich versuchte ein lockeres Lächeln.
Alec grinste amüsiert. »Ach so, verstehe. Steht dir aber.«
Na, wenigstens war er höflich. Ich war immer stolz auf meine langen kastanienbraunen Locken gewesen, doch die waren vor ein paar Wochen einer Geburtstagsparty zum Opfer gefallen, als ich im Bett irgendeines kleinen Bruders gepennt hatte. Pech. Sämtliche teuren Mittel gegen Läuse waren wirkungslos geblieben und ich hatte meine Haare opfern müssen. Inzwischen hatte ich eine ganz passable Kurzhaarfrisur, was allerdings nichts daran änderte, dass ich aussah wie ein Junge. Wie ein kleiner Junge. Da war nichts zu machen.
Es war Mitte Juni, Ferienzeit. Die Schule würde erst im September beginnen. Ich hatte mich dafür entschieden, schon zwei Monate vor Schulbeginn nach Seattle zu fliegen, einfach, um Zeit zu haben, mich einzugewöhnen. Mein Englisch war ganz passabel, aber in ein paar Wochen würde ich auch die Feinheiten wieder draufhaben, was mir den Schulstart erleichtern sollte.
Die Turners besaßen ein großes Haus mit Terrasse am Lake Union – ziemlich nobel, wie alle Häuser in der Gegend. Ich hatte mein eigenes Zimmer und teilte mir ein Bad mit Janice. Sie war ein Jahr älter als ich und wir waren bald wieder vertraut. Auch sie war groß und sah ihrem Bruder sehr ähnlich: dieselben blauen Augen mit den dunklen Brauen und Wimpern, der Kussmund, der dunkle Teint und das naturblonde Haar, das sie allerdings meistens ganz unspektakulär zu einem Pferdeschwanz gebunden trug. Wie Alec hatte Janice ein offenes, freundliches Wesen, sie war unkompliziert und ich kam gut mit ihr aus. Überhaupt fühlte ich mich schnell heimisch bei den Turners.
In der ersten Zeit rief ich noch jeden zweiten Tag bei meinen Eltern an, aber das gab sich bald. Ich begann, meine ungewohnte Freiheit zu genießen. Meine Eltern waren zwar nicht streng, aber es gab Regeln bei uns zu Hause. Bei den Turners schien es keine zu geben, was mir ausgesprochen gut gefiel.
Warren und Monica verhielten sich sehr herzlich mir gegenüber. Und abgesehen davon waren sie kaum zu Hause, sodass ich tun und lassen konnte, was ich wollte – genauso wie Janice und Alec.
Zu meinem Leidwesen bekam ich Alec in den ersten Tagen kaum zu sehen. Er war nur selten zu Hause, daraus schloss ich, dass er eine Freundin hatte. Natürlich hatte er eine – so blendend, wie er aussah. Um weibliche Aufmerksamkeit brauchte er sich bestimmt keine Sorgen zu machen. Irgendwann fragte ich Janice beiläufig danach, aber sie meinte nur: »Ich glaube nicht. Wenn er eine Freundin hat, dann schleppt er sie meist gleich zu Hause an. Ist immer total anstrengend, wenn die Grazien mit am Frühstückstisch sitzen und ich mich mit ihnen unterhalten muss.« Sie verdrehte die blauen Augen und grinste mich an. »Also, ich glaube nicht, dass er eine Neue hat. Er trifft sich mit seinen Freunden vom College. Sie planen ihren Surftrip.«
»Ihren Surftrip?«
»Ja, nach La Push. Das ist irgend so ein Nest in einem Indianerreservat an der Pazifikküste. Keine Surfhochburg oder so«, meinte sie achselzuckend, »aber es soll ein guter Platz für Anfänger sein, weil es dort keine Monsterwellen und keine einheimischen Surfer gibt, die einem die Wellen streitig machen. Alec war im letzten Jahr mit zwei Freunden dort.«
»Wie lange bleiben sie denn?«, fragte ich. »Übers Wochenende?«
»Nee, zwei oder drei Wochen.«
Zwei oder drei Wochen. Ich schluckte. Alec hatte nichts von seinen Reiseplänen erzählt. Jedenfalls nicht, wenn ich dabei war.
»Was ist mit dir?«, fragte ich Janice. »Fährst du auch mit?«
Sie zuckte erneut mit den Schultern. »Ich weiß noch nicht. Hängt davon ab, wer alles mitkommt. La Push ist das Ende der Welt, jedenfalls wenn man Alec glauben darf. Das ist nur was für Surfer und Naturfreaks. Drei Wochen können ziemlich lang werden, wenn es oft regnet und man nicht mal ins Kino oder tanzen gehen kann.«
La Push? Der Name des Ortes kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich wusste nicht, woher. Später, als ich allein in meinem Zimmer war, fuhr ich meinen Laptop hoch und googelte. Ich fand, abgesehen von der Homepage der Quileute-Indianer, die in La Push lebten, auch etliche Werwolf-und Vampirseiten und da fiel es mir wieder ein. Vor einem Jahr ungefähr hatte meine Freundin Sanna mir ein Buch ausgeliehen, das ich unbedingt lesen sollte: »Bis(s) zum Morgengrauen« hieß es und es handelte von einem Mädchen, dass sich in einen schönen Vampir aus der Kleinstadt Forks verliebt. Ich hatte mir die englische Ausgabe, »Twilight«, gekauft und sie an drei Abenden verschlungen. Im Buch kam auch ein Indianerjunge vor, der irgendwann im Laufe der Geschichte zum Werwolf wurde. Und der kam aus La Push.
»Twilight« hatte einen wahren Vampirwahn ausgelöst, von dem ich allerdings verschont geblieben war. Ich war mehr der bodenständige Typ. Die Welt der Blutsauger war mir fremd, genauso wie die Welt des Surfens.
Letzteres hatte ich immer mit Sonne, blauem Meer, weißem Sand und Palmen in Verbindung gebracht. Die Küste am Nordpazifik wurde auch Regenküste genannt. Dass hier irgendwo ein Surferparadies sein sollte, konnte ich mir nur schwerlich vorstellen.
Immerhin, ich war neugierig geworden. Allerdings nützte mir das wenig. Ich würde keine Gelegenheit bekommen, Alec Turner als Surfgott auf einem Brett stehen zu sehen. Denn wenn er auch nur einen einzigen Gedanken daran verschwendet hätte, mich mitzunehmen, hätte er mich längst gefragt.
Von den sichtbaren Vorbereitungen auf den geplanten Surftrip bekam ich nur mit, dass Alec unermüdlich auf einem zerschrammten Skateboard übte und sein offensichtlich neues Surfbrett hin und wieder liebevoll berührte. Es war weiß mit blauem Rand und einem blauen Streifen in der Mitte und lehnte in der Doppelgarage an der Wand.
Einmal wollte ich mein Fahrrad aus der Garage holen und beobachtete, wie Alec über sein Surfbrett streichelte. Ich versteckte mich hinter einem Werkzeugregal und wünschte glühend, ich wäre dieses Surfbrett und Alec würde mich nur halb so verliebt ansehen und berühren.
Mit meiner Fantasie und meinen romantischen Sehnsüchten war ich ein hoffnungsloser Fall, da machte ich mir nichts vor. Ein Seufzer entfuhr mir und Alec entdeckte mich. »Hi«, sagte ich verlegen, senkte den Kopf, ging rasch zu meinem Fahrrad und schob es nach draußen. Beinahe konnte ich ihn spüren, den verwunderten Blick, mit dem Alec mir hinterherschaute.
Ich hatte eigentlich gar keine große Fahrradtour geplant, aber jetzt radelte ich gedankenverloren durch die Gegend, landete irgendwann am Hafen und sah zu, wie die Möwen sich von den Touristen mit Pommes füttern ließen. Es war einer der seltenen sonnigen Tage in Seattle und die meisten Leute hatten gute Laune. Nur ich nicht. Schon bald schmerzten meine Ohren vom verrückten Kreischen der Möwen und dem Stimmengewirr der vielen Menschen.
Nicht, dass ich mir, was Alec und mich betraf, wirklich Hoffnungen gemacht hätte. Aber dass er und Janice drei Wochen mit ihrer Surferclique nach La Push fahren wollten, bekam ich nicht aus dem Kopf. Ich würde währenddessen mit ihren Eltern allein im Haus sein. In der kurzen Zeit, die ich jetzt hier war, hatte ich in der Stadt noch keine Freunde gefunden. Ohne Janice und Alec würde ich mir verloren und einsam vorkommen. Auch in einer amerikanischen Großstadt konnten drei Wochen sehr lang werden.
Als ich gegen Abend verschwitzt vom Radfahren nach Hause zurückkehrte, spielte Alec mit einem Kumpel vor der Garage Basketball. Die beiden waren so in ihr Spiel vertieft, dass sie mich zuerst gar nicht bemerkten. Alecs Freund spielte mit freiem Oberkörper. Es sah so aus, als hätte er ein weißes T-Shirt an: Arme und Hals braun, Schultern, Brust und Waschbrettbauch noch käseweiß. Seine schulterlangen braunen Locken tanzten bei jedem Sprung.
Schließlich entdeckte Alec mich. Er fing den Ball und trat zur Seite, damit ich das Rad in die Garage schieben konnte. »Hi Midget«, sagte er. »Das ist Josh.«
»Hi.« Josh musterte mich von oben bis unten. Ich trug kurze Kakishorts und ein eng anliegendes Top, das jetzt zwischen meinen Brüsten und auf dem Rücken schweißnass war. »Alec hat von dir erzählt«, sagte er. »Allerdings hat er mir verschwiegen, dass du so ein heißer Feger bist.«
Heißer Feger?
Ich spürte, wie mein Gesicht zu glühen begann, und musste doch lachen. Das hatte noch nie jemand zu mir gesagt, nicht mal, als meine Haare noch lang waren. Selbst wenn ich ein Kleid trug, wirkte ich burschikos, wie meine Oma Lene zu sagen pflegte.
Ich lachte tapfer meine Verlegenheit fort. Auch Josh grinste, doch dann wurde er unvermittelt ernst und betrachtete mich mit einem verwirrten Stirnrunzeln. So ging es den meisten Leuten, wenn sie mich ansahen und sich fragten, was mit mir nicht stimmte.
Dann hatte er es oder zumindest dachte er das. »Coole Kontaktlinsen«, sagte er triumphierend, als hätte er im Rätselraten gewonnen und erwartete nun seinen Preis.
»Die sind echt.« Alec ließ den Ball fallen und fing ihn mit einer lässigen Handbewegung wieder auf.
»Was?«
»Das sind keine Kontaktlinsen, Alter. Smilla hat verschiedenfarbige Augen.«
»Ohne Scheiß?« Josh trat nahe an mich heran, beugte sich so dicht zu mir herunter, dass ich die feinen Schweißperlen auf seiner Nase und auf der Oberlippe sehen konnte, und blickte mir tief in die Augen. »Echt krass. Eins blau und eins grün. So was habe ich ja noch nie gesehen.« Er wandte den Kopf wieder zu Alec. »Und ihr verarscht mich auch nicht?«
»Man nennt es Heterochromie«, sagte Alec. »Nur vier von einer Million Leuten haben es. Unsere Smilla ist etwas ganz Besonderes.«
Unsere Smilla?
»Wahnsinn«, sagte Josh. Er schien echt begeistert zu sein, als wären meine unterschiedlichen Augenfarben ein Verdienst und kein Defekt. Inzwischen hatte ich mich an die Aufmerksamkeit gewöhnt, die meine Augen hervorriefen, aber manchmal ging mir das Theater auch auf die Nerven. In Joshs Fall tat mir das Interesse gut. Er war ein sympathischer Typ mit hübschen haselnussbraunen Augen und einem durchtrainierten Körper. Auf seiner Oberlippe spross flaumig der Ansatz eines Schnurrbartes.
»Kommst du eigentlich mit?«, fragte er unvermittelt.
Ich hielt immer noch das Rad (langsam wurde es schwer) und sah ihn fragend an: »Wohin denn? Ins Kino?« Janice hatte irgendetwas von einem Film erzählt, in den sie gehen wollten. Eine Komödie mit Brad Pitt.
»Kino? Ich meine La Push. Der Surftrip.« Er sah Alec verwundert an und der senkte verlegen den Blick.
»Du hast sie gar nicht gefragt.« Ich hörte die Enttäuschung in Joshs Stimme. Das haute mich bald um.
»Smilla kann nicht surfen«, brummte Alec.
Aha, das wusste er also. Obwohl er nie mit mir darüber gesprochen hatte. Langsam wurde mir die Situation unangenehm, Josh hatte Alec in eine miese Lage gebracht.
Doch Josh lachte. »Na und? Du etwa? Sie kann es lernen. Außerdem, willst du sie mit deinen Alten hier alleine lassen? Janice kommt doch auch mit, oder?«
Ich bekam große Augen. Ich sollte surfen lernen? Meinte er das ernst? Ich war zwar eine ziemlich gute Schwimmerin, aber das war’s auch schon. Für spektakuläre Freizeitbeschäftigungen fehlte mir der Mut. Doch ich schwieg. Ich wollte so gerne mit nach La Push und hier war plötzlich jemand, der sich für mich einsetzte.
»Hast du denn Lust, Midget?«, fragte Alec.
Er schien wenig begeistert zu sein und ich vermutete, dass es an meinem Alter lag. Er wollte kein Baby in seiner Truppe haben, kein Mädchen, das drei Jahre jünger war als die anderen. Aber das war mir in diesem Moment egal. Die Gelegenheit würde sich nur einmal bieten. »Ich weiß nicht, ob ich auf ein Surfbrett steigen würde«, sagte ich und Alec warf Josh einen Dahast-du-es Blick zu. »Aber ich würde gerne mit euch nach La Push kommen.«
»Groovy«, sagte Josh. »Die Lust kommt beim Zusehen.« Er grinste breit. »Das wird echt cool, Smilla. Du wirst schon sehen.«
Nachdem ich das Rad in die Garage geschoben hatte, ging ich in mein Zimmer. Von oben beobachtete ich die beiden durch das Fenster. Es sah so aus, als wären sie in eine wilde Diskussion verstrickt. Ich konnte nicht hören, was sie sagten, dazu hätte ich das Fenster öffnen müssen und dann hätten sie mich bemerkt. Aber keine Frage, Alec hatte Einwände. Er warf den Ball nach Josh, fuchtelte mit seinen Händen und sah sehr ärgerlich, ja beinahe wütend aus. Aber Josh ließ sich davon nicht beeindrucken. Er klopfte Alec auf die Schulter und lachte.
Eigentlich hätte ich Luftsprünge machen sollen vor Freude, doch irgendetwas hielt mich zurück. War es nur die Tatsache, dass Alec mich so offenkundig nicht dabeihaben wollte? Vielleicht. Doch was auch immer es war: Das merkwürdige Gefühl ließ sich nicht abschütteln.
Später kam Janice zu mir ins Zimmer und sie freute sich wirklich, dass ich mitkommen würde. »Meine Eltern haben mit deinen telefoniert und sie haben nichts dagegen.«
»Ehrlich?«, fragte ich.
»Ja. Alec musste versprechen, gut auf dich aufzupassen.«
Ich verdrehte die Augen. »Jetzt hasst er mich bestimmt.«
»Hey«, Janice lachte, »das ist sein Problem. Ich freue mich jedenfalls, dass du mitkommst. Wir werden dir gleich morgen einen Surfanzug kaufen. Und ein Brett haben wir auch für dich. Zwar nur ein altes Boogieboard, aber für den Anfang reicht das.«
Für den Anfang, dachte ich und machte nun doch Luftsprünge. Innerlich jedenfalls.
2. Kapitel
Den Rest von Alecs Surferclique lernte ich erst am Abreisetag kennen. Es war der Montag nach dem 4. Juli, den die Turners mit einem Picknick hatten feiern wollen, das allerdings am Ende ins Wasser gefallen war. Auch heute war der Himmel bedeckt und es sah nach Regen aus. Das typische Wetter für Seattle und langsam begann ich, mich daran zu gewöhnen.
Alec, Janice und ich hatten am Tag zuvor unsere Sachen gepackt. Wir wollten mit zwei Autos nach La Push fahren, mit Joshs altem VW-Bus und Alecs Ford-Kombi, den er von seinen Eltern zum 19. Geburtstag bekommen hatte. Zu meinem Gepäck gehörten ein nagelneuer schwarzer Neoprenanzug, Gummischuhe und ein etwa ein Meter langes Surfbrett – falls ich doch Lust bekommen sollte, wellenreiten zu lernen.
Das Brett war beige, ziemlich zerschrammt und zweimal mit Duck Tape, einem grauen Gewebeklebeband, geflickt. Beides, Brett und Surfanzug, kamen mir vor wie Fremdkörper in meinem Gepäck. Keine Ahnung, ob ich die Sachen tatsächlich benutzen würde, aber allein die Tatsache, dass ich sie dabeihatte, setzte mich jetzt schon unter Druck.
Am Morgen hatte ich ein letztes Mal mit meinen Eltern telefoniert. Zu Hause in Deutschland war es neun Stunden später als hier an der Westküste. Sie waren gerade von der Arbeit gekommen.
»Sei vorsichtig«, sagte meine Mutter. »Steig nur auf so ein Brett, wenn du dir das wirklich zutraust.«
»Keine Angst, Ma, du kennst mich doch.«
Meine Mutter war Dänin, sie war auf den Färöer Inseln aufgewachsen und konnte nachfühlen, wie sehr ich das Meer liebte. Beinahe jeden Sommer hatte ich bei meinem Großvater Tormar in Hvalba, einem kleinen Ort an der Ostküste von Färö, verbracht. Vermutlich hatte ich meiner Ma zu verdanken, dass ich diese Reise mitmachen durfte.
Von meinem Vater bekam ich noch ein paar gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg. »Mach nicht alles mit, Smilla. Du weißt schon.«
Natürlich wusste ich. Keinen Alkohol, keine Drogen und Vorsicht bei den Jungs. »Alles klar, Pa, du kennst mich doch. Ich hab euch auch lieb.« Und glücklicherweise liegt in den nächsten Monaten der große Ozean zwischen uns.
Wir waren noch nicht fertig mit dem Frühstück, als es vor dem Haus hupte. Alec und Janice liefen hinaus und ich trottete hinterher. Ein himmelblauer, mit springenden Delfinen bemalter VW-Bus stand vor der Tür, auf dem Dach vier festgeschnallte Surfbretter. Josh stieg aus dem Bus und begrüßte mich mit einer herzlichen Umarmung. Er hatte den Rest der Truppe bereits zu Hause abgeholt. Einer nach dem anderen sprangen sie aus dem Bus, und als Alec mich ihnen vorstellte, wurde mir langsam klar, warum er Bedenken gehabt hatte, mich mitzunehmen.
Zunächst war da Laura. Sie trug halblange Kakis und ein buntes Kapuzenshirt, hatte rote Korkenzieherlöckchen, rostbraune Sommersprossen und freundliche graue Augen. Ihr glucksendes, kullerndes Lachen war ansteckend, aber ihre selbstbewusste, lässige Art machte mir sofort klar, dass sie von einem ganz anderen Kaliber war als die Mädchen, die ich sonst so kannte. Brandee, das zweite Mädchen, war fast so groß wie Alec. Sie taxierte mich eingehend mit ihren eishellen, schwarz umrandeten Augen. Ihr Haar war glatt schwarz und lang, mit Ponyfran
sen bis auf die langen Wimpern. Sie hatte eine klasse Figur – viel Busen, aber nicht zu viel, flacher Bauch und lange Beine – und sie trug die angesagtesten Klamotten: enge Hüftjeans, Chuck Taylor All Star Sneakers, eine mit Nieten besetzte taillierte Lederjacke und darunter ein bauchfreies hellblaues Top. In ihrem linken Nasenflügel blitzte ein winziger blauer Glitzerstein.
Ich hatte mich nie als Mauerblümchen gesehen, doch neben solchen Mädels wurde ich schlichtweg unsichtbar.
Brandee hing ziemlich lange an Alecs Hals und es war nur zu offensichtlich, dass ich das sehen sollte. Ich fühlte, wie sich mein Magen zusammenzog. Hatte Alec gemerkt, dass ich ihn anhimmelte (wie peinlich), und es seinen Freunden erzählt? Wollte Brandee mir zeigen, dass er ihr gehörte und ich mir keine Hoffnungen zu machen brauchte?
Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, doch bei dem Gedanken, drei Wochen lang mit diesem Mädchen auskommen zu müssen, erfasste mich leise Panik.
Smilla, du passt überhaupt nicht in die Clique, dachte ich. Da liegen Welten zwischen dir und diesen Supergirls und Superboys.
Doch ehe ich mich weiter hineinsteigern konnte, begrüßte mich Mark, ein athletischer dunkler Hüne mit asiatischen Gesichtszügen und langen schwarzen Dreadlocks, die er mit einem bunten Tuch zusammengebunden hatte. Um den Hals trug er ein Lederband mit einer kleinen Muschel. Er lächelte, als er mich begrüßte, und gab mir als Einziger die Hand. Sein Händedruck war warm und fest. Seine Augen leuchteten in einem warmen Braungrün.
Ich war hin-und hergerissen. Drei Jungen und vier Mädchen, dachte ich. Eine zu viel: ich, das Küken, der Zwerg.
Noch hätte ich es mir anders überlegen können, hätte eine Ausrede erfinden können, um hierzubleiben. Alec wäre bestimmt nicht böse drum gewesen. Aber da packte er auch schon meine Sachen in den Kombi und seine Mutter, die mit Warren aus dem Haus gekommen war, um uns zu verabschieden, legte den Arm um meine Schultern.
»Lauter nette junge Leute«, sagte Monica fröhlich. »Du wirst bestimmt deinen Spaß haben.«
Ich nickte mechanisch. Sie hatte ja recht. Ich würde Spaß haben, das war es schließlich, was ich mir gewünscht hatte. Trotzdem sah ich der Reise mit gemischten Gefühlen entgegen. Keine Ahnung, warum mir beim Anblick der Truppe auf einmal mulmig zumute wurde. Etwas störte mich an ihnen. Sie kamen mir so perfekt, so sorglos, so selbstsicher vor in ihren lässigen, aber teuren Klamotten, in denen sie aussahen, als kämen sie aus der Werbung für Old Navy. Alle waren gerade gewachsen und groß. Keiner von ihnen hatte einen äußerlichen Makel, dafür hatten ihre offensichtlich reichen Eltern gesorgt. Es gab keine schiefen Zähne, keine Brille, keine verunglückte Nase, nicht mal einen winzigen Pickel im Gesicht. Alle sechs sahen aus, als wären sie direkt einem dieser Hochglanz-Surfermagazine entsprungen, die bei Alec im Zimmer lagen.
Was soll’s, dachte ich, sie sind Surfer. Eine Spezies für sich. Ich war zwar klein, aber kein hässliches Entlein und würde schon mit ihnen klarkommen. Janice war schließlich nur ein Jahr älter als ich. Sie und Alec waren meine Freunde. Und Josh – Josh war auf die Idee gekommen, mich mitzunehmen, und er flirtete sogar mit mir. Zwar war er nicht der, mit dem ich gerne geflirtet hätte, aber es tröstete mich. Nach Sebastians gefühlloser Abschiedsnummer und dem Verlust meiner Haare stand mein verbliebenes Selbstwertgefühl noch etwas auf wackligen Füßen. Ein wenig männliche Aufmerksamkeit konnte ich ganz gut gebrauchen.
Wir verabschiedeten uns von Warren und Monica und stiegen ein. Brandee schwang sich auf den Beifahrersitz von Alecs Kombi, Janice und ich saßen auf der Rückbank. Mark und Laura fuhren mit Josh im Bus. Die Turners winkten, bis wir um die Ecke bogen.
Der schnellste und kürzeste Weg auf die Olympic-Halbinsel war die Fähre. Im Hafen kauften wir Tickets nach Bainbridge und eine halbe Stunde später legte das Schiff mit den Autos im Bauch ab. Wir gingen an Deck, um die Skyline der Stadt zu sehen. Für einen Augenblick riss die Wolkendecke auf und ließ die Fassaden der Hochhäuser aufleuchten.
Von meinen Eltern hatte ich eine neue Digitalkamera bekommen, ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk, das ich jetzt einweihte. Klick, klick, klick. Bei dem Gedanken, dass Seattle für das nächste Jahr mein Zuhause sein sollte, durchzog mich ein freudiger Schauer.
Janice nahm mich am Arm. »Komm mal mit«, sagte sie und schleppte mich auf die andere Seite der Fähre. Sie streckte die Hand aus und zeigte auf etwas in der Ferne. Ich sah Verladekräne und bunte Container und auf einmal entdecke ich ihn: den Berg. Wie ein Geist schwebte die schneebedeckte Kuppe des Mount Rainier über einem Ring aus Wolken.
»Wow!«, sagte ich. Klick, klick, klick. Ich mochte das Geräusch meiner neuen Kamera.
»Echt krass, oder? Den kriegt man nicht oft zu sehen.«
Zwanzig Minuten später legte die Fähre in Bainbridge an und wir stiegen wieder in die Autos. Auf der Fahrt gen Westen blieb uns das Wetter freundlich gesinnt. Mal Sonne, mal Wolken, aber kein Regen.
Ich sah aus dem Fenster und versuchte, mir meine kindliche Freude vor den anderen nicht anmerken zu lassen. Mir gefiel, was ich sah: viel Wald, kleine Ortschaften mit bunten Holzhäusern, vor denen bunte Blumen wuchsen. Und schließlich auf der rechten Seite die Seestraße von San Juan de Fuca. Janice erklärte mir, dass der dunkle Streifen am anderen Ufer Vancouver Island in Kanada war.
Schließlich führte die Straße weg von der Küste und von nun an fuhren wir durch dichten, scheinbar undurchdringlichen Wald, der bis an die Straße reichte. Die Bäume wuchsen hoch, der Himmel war nur ein graublauer Streifen zwischen ihren Wipfeln. Fasziniert blickte ich nach draußen, ließ verschiedenfarbiges Grün an mir vorbeirauschen. Auf Janice schien der Wald allerdings ermüdend zu wirken. Sie hatte jetzt Kopfhörer im Ohr und die Augen geschlossen. Die Musik aus ihrem MP3Player drang leise zu mir herüber.
Brandee, die sich bisher noch nicht einmal zu uns umgedreht hatte, legte Alec eine Hand in den Nacken und wickelte immer wieder eine seiner Dreadlocks um den Zeigefinger.
Okay, dachte ich, das wäre also endgültig geklärt. Und es war nicht schlimm, wirklich nicht. Nur ein bisschen. Ich war schließlich kaum zwei Wochen hier und das Ganze war hoffnungslos einseitig geblieben. Außerdem war da ja auch noch Josh, der offensichtlich Gefallen an mir gefunden hatte, trotz Jungsfrisur und Jungsfigur. Klar war ich eifersüchtig auf Brandee, aber hey, immerhin saß ich in diesem Auto. Smilla Rabe aus Germany fuhr mit einer Surferclique drei Wochen lang an einen einsamen Strand am Pazifik. Das passierte wirklich. Ich beschloss, mir das nicht verderben zu lassen, komme, was da wolle.
Nach mehr als fünf Stunden Fahrt näherten wir uns La Push. Es war später Nachmittag. Wir hatten auf unserem Weg einige Kahlschläge durchquert – von Feuerkraut überwucherte, baumlose Flächen, die todtraurig aussahen in ihrer Verwüstung. Irgendwann war Alec hinter Joshs Bus vom Highway nach rechts auf eine schmale Teerstraße abgebogen und wieder säumten grüne Wälder die Straße. Zweimal überquerten wir einen kristallgrünen Fluss, den Quillayute River. Schließlich erreichten wir das Quileute-Indianerreservat und das Ortsschild von La Push tauchte vor uns auf. Darunter war ein weiteres Schild angebracht, mit der Aufschrift NO VAMPIRES PAST THIS POINT. Wer auch immer diese Quileute-Indianer waren, dachte ich, Humor hatten sie jedenfalls.
Alec bog hinter Josh auf den Parkplatz vor einem kleinen Supermarkt, der sich »Lonesome Creek Store« nannte. Hohe Bäume zur Rechten und zur Linken, der Parkplatz mit dem holzverkleideten Supermarktgebäude in der Mitte. Bemalte indianische Schnitzereien zierten die graue Fassade. Ein paar Leute betraten den Laden, andere verließen ihn mit vollen Einkaufs-tüten.
»Da wären wir«, sagte Alec und drehte sich zu uns um.
Janice merkte erst jetzt, dass wir angekommen waren, und zog die Kopfhörer aus ihren Ohren. Wir stiegen aus und ich streckte mich. Nach der langen Fahrt war ich hungrig. Aber schließlich standen wir ja direkt vor einem Supermarkt und außerdem hatten wir vier gut gefüllte Kühlboxen in den Autos.
Laura, Mark und Josh kamen aus dem VW-Bus geklettert. Mark drückte seine Fingerknöchel zusammen, dass es knackte.
»Oh Mann, hör bloß auf damit«, stöhnte Brandee mit verdrehten Augen. Mark zuckte mit den Achseln.
»Von hier aus gehen wir zu Fuß«, erklärte Alec. »Der Strand ist gleich da drüben hinter dem Wald.« Er zeigte nach links, wo sich ein schmaler Weg durch die dichten Baumreihen schlängelte. »Aber erst einmal müssen wir uns eine Campingerlaubnis holen«, fuhr er fort. »Die gibt es hier im Supermarkt.« Zielstrebig steuerte er auf den Eingang zu und wir folgten ihm.
Auf einer Bank, ein paar Meter vor dem »Lonesome Creek Store« saßen ein Junge und zwei Mädchen, die ich auf siebzehn oder achtzehn schätzte, auf jeden Fall noch keine zwanzig. Ihrem Aussehen nach waren es Einheimische. Dunkle Gesichter, rabenschwarzes Haar, schräge dunkle Augen. Eben hatten sie noch miteinander gelacht. Jetzt schwiegen sie und ihre Blicke wurden zusehends verschlossener, je näher wir kamen.
Eine der Indianerinnen, die hübschere, hatte ein rundes Mondgesicht mit einer flachen Nase, einem kleinen Mund und schmalen Augen. Bei der anderen fiel mir zuerst die verkorkste Dauerwelle auf und dann ihr hässliches Sweatshirt. Es war pinkfarben und hatte große silberne Blumen aufgedruckt.
Als ich drei Meter entfernt an ihnen vorbeiging, bemerkte ich, dass sie einen Hund bei sich hatten, der jetzt unter der Bank hervorkam. Er hatte hellgraues Fell mit einem fast schwarzen Streifen auf dem Rücken und sah aus wie ein Wolf. Mit einem Knurren zog er die Lefzen zurück und zeigte seine gelben Zähne.
Meine Nackenhaare richteten sich auf. Der Hund war nicht an der Leine. Ich hatte Schiss, aber seine Augen zogen mich in den Bann. Denn die waren zweifarbig, genau wie meine. Nur andere Farben: eines blaugrau wie Rauch, das andere bernsteinfarben. Der junge Indianer im schwarzen Kapuzenshirt – sein Haar war auf der linken Seite kurz geschoren und auf der anderen lang – sagte: »Still, Boone! Hab Geduld. Am Tag darfst du sie nicht fressen, nur bei Nacht.« Die beiden Mädchen kicherten.
Ich blickte dem Jungen mit der Punkfrisur ins Gesicht, sah seinen stechenden schwarzen Reptilienblick und die dunklen Aknenarben, die seine Wangen entstellten. Dann waren wir auch schon an den dreien vorbei.
Ich hörte noch, wie der Junge »Boone mag ihren weißen Geruch nicht« zu den Mädchen sagte und sie wieder loskicherten.
Das war meine erste Begegnung mit amerikanischen Ureinwohnern und ich wollte nicht voreingenommen sein. Sie waren es ganz offensichtlich. Nicht, dass ich keinen Spaß verstand, aber ich war noch gar nicht richtig da und fühlte mich schon auf seltsame Weise unwillkommen.
Der Supermarkt war größer, als ich von draußen vermutet hatte, aber das Angebot an Lebensmitteln erwies sich als herbe Enttäuschung: eingeschweißte Sandwichs (ich nahm ein Truthahnsandwich mit Käse, weil ich Hunger hatte), ein paar Käsesorten (sehr orange), Joghurt und Hotdogs in den Kühlregalen. Welkes Gemüse, ein paar fleckige Bananen und bunte Süßigkeiten. Jede Menge Chips natürlich, in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen. Es gab sogar Bier und Wein, was mich verwunderte, denn ich hatte gehört, dass Alkohol in Indianerreservaten verboten war.
In der hinteren Ecke des Supermarktes stand ein ATM-Bankautomat. Es gab Ständer mit Postkarten und Prospekten, ein paar Bücher über die Gegend, Regenjacken und Gummistiefel. Ich drehte am Postkartenständer und betrachtete die Karten mit Indianermasken und den alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Männern, Frauen und Kindern in Baströcken und mit seltsam geformten Regenhüten auf dem Kopf.
Das Spannende daran war: Die Nachfahren dieser Leute auf den Postkarten waren hier im Supermarkt und sie hatten dieselben faszinierenden Gesichter.
Ich fotografierte mit den Augen: die ältere Frau mit den beiden Kindern, die jedes ein buntes Wassereis in den Händen hielten und sich gegenseitig ihre blaue und scharlachrote Zunge herausstreckten. Ein Mann mit dünnem grauem Zopf und schmuddeliger Kleidung, der unentschlossen vor dem Regal mit dem Alkohol stand. Zwei Männer in Arbeitskleidung und Gummistiefeln, die sich jeder ein Sixpack Budweiser griffen. Und da war auch noch ein junger Mann in Jeans und T-Shirt, der in einem der Regale etwas zu suchen schien. Ein dicker Zopf hing ihm lang wie ein Tau den Rücken herunter.
Dreh dich mal um, dachte ich. Ich will dein Gesicht sehen.
Aber den Gefallen tat er mir natürlich nicht.
Ich hörte, wie Alec und Josh mit dem Typen hinter der Theke, der ein »Lonesome Creek Store«-Basecap trug, zu diskutieren begannen. Der Indianer schüttelte verdrießlich den Kopf. »Wenn euch das nicht passt«, sagte er zu den beiden, »könnt ihr ja wieder gehen.«
Der Junge mit dem Zopf riss den Kopf hoch und blickte vor zur Theke. Ich sah, wie sich seine Hände langsam zu Fäusten ballten.
Na wunderbar, dachte ich, das fängt ja gut an. Man schien hier geradezu auf uns gewartet zu haben. Plötzlich hatte ich ein hohles Gefühl in der Magengrube. Ich legte das Sandwich, das ich mir ausgesucht hatte, wieder ins Kühlregal zurück und ging vor zur Theke.
Alec schob seine Kreditkarte über den Tisch. Der Indianer mit dem Basecap kassierte und gab noch ein paar mürrische Anweisungen.
»Wir warten draußen«, sagte Alec zu Mark, Laura und Brandee, die jetzt mit Zahlen an der Reihe waren.
Zu dritt verließen wir den Supermarkt und ich brachte es nicht fertig, mich noch einmal nach dem Jungen umzudrehen. Auf einmal fürchtete ich mich davor, sein Gesicht zu sehen.
»Was war denn los?«, fragte ich, als wir draußen standen.
»Das Campen ist teurer geworden«, brummte Alec verstimmt. »Pro Zelt und Nacht fünf Dollar mehr als letztes Jahr. Der Typ war total unfreundlich. Er meinte, wir sollten drüben in Mora campen, wenn es uns hier nicht passt.«
»Aber in Mora gibt es keinen Swell vor der Haustür.« Josh grinste und klopfte Alec auf die Schulter. »Ach komm, Alter, lass dir doch von so einem Wichtigtuer nicht die Laune verderben.«
Alec zuckte mit den Achseln.
»Was bekommst du denn von mir?«, fragte ich ihn.
»Nichts«, sagte Alec. »Mom und Dad haben mir Geld gegeben, auch für dich.«
»Okay, aber...«
Alec machte eine Handbewegung, die keinen Widerspruch zuließ. »Kein aber, Midget. Was das Campen angeht, bist du eingeladen, okay?«
»Okay«, sagte ich leise. Josh nickte mir grinsend zu.
Während wir auf die anderen warteten, kam der Indianerjunge mit dem Zopf aus dem Supermarkt. Er hatte vier Dosen Coke in den Händen und blickte zu uns herüber. Nun sah ich auch sein Gesicht. Es war dunkel und gut aussehend, doch im schwarzen Blick des Jungen lag eine so unverhohlene Feindseligkeit, dass mir ein eisiger Schauer über den Rücken kroch und ich eine Gänsehaut bekam. Ich schluckte. Plötzlich kam ich mir vor wie ein Eindringling, ein Fremdkörper. Ich wollte wegsehen, als der Indianer in ein paar Metern Entfernung an uns vorbeiging, tat es aber nicht. Unsere Blicke trafen sich. Ich merkte, wie ein Ruck durch seinen Körper ging und er mich sekundenlang irritiert anstarrte. Meine Augen, dachte ich und sah rasch zu Boden, bis er vorüber war.
Er ging zu seinen Freunden, die jetzt vor der Bank standen. Der Wolfshund sprang bellend an ihm hoch. Der Indianer verteilte die Coladosen, öffnete sich selbst eine, legte den Kopf in den Nacken und trank.
Zufällig bekam ich mit, wie Alec und Josh vielsagende Blicke wechselten. Es war nur ein kurzes Aufblitzen, aber ich hatte es gesehen. Irgendetwas schwebte hier in der Luft, etwas, das nicht zu greifen war. Ich spürte es und konnte nichts damit anfangen. Aber es verunsicherte mich.
Sie sind wieder da.
Beinahe hat er den großen Blonden nicht erkannt, der Dreads wegen. Aber jetzt ist er sich sicher, denn er hat auch die beiden anderen gesehen: den Supersurfer und den Typen mit den braunen Locken.
Justins Mörder.
Was sie getan haben, ist ihnen offensichtlich gleichgültig. Sie kennen keine Schuldgefühle, in ihnen ist kein Funken Reue. Sie sind zurückgekommen, haben diesmal ein paar Mädchen mitgebracht und tun so, als wäre es nie passiert.
Schnell und heftig wie ein Messer dringt der Schmerz in Conrads Brust und hinterlässt eine offene Wunde, pulsierend und heiß. Dunkler Hass erfüllt ihn, das Blut pocht in seinen Schläfen, er bekommt keine Luft. Die Erinnerung bricht über ihn herein wie ein kalter Sturm. Er sieht alles ganz deutlich vor sich, als wäre es gestern gewesen. Es ist der Tag, den er nie vergessen wird, der Tag, an dem sein Bruder Justin starb.
Der bloße Anblick der Surfer ruft das zurück, was Conrad in den vergangenen Monaten zu verdrängen versucht hat. Was Justins Tod aus ihm gemacht hat: ein Halbwesen, geplagt von Albträumen und Schlaflosigkeit, von Hass, der an ihm frisst wie ein wildes Tier und sein Leben im Chaos versinken lässt.
Der Ozean hat seinen Bruder verschlungen, doch Conrad gibt dem Meer keine Schuld. Die wahren Schuldigen stehen hier vor dem Supermarkt, schwatzen fröhlich, haben Spaß, sind am Leben.
Sie werden den First Beach belagern, so wie sie es im vergangenen Jahr auch getan hatten. Sie werden so tun, als gehöre der Strand ihnen.
Ein zorniger Laut kommt aus Conrads Kehle. Milo wirft seine leere Coladose in den Abfalleimer neben der Bank und sieht den Freund fragend an. »Alles klar, Kumpel?«
»Sie sind wieder da«, würgt Conrad hervor.
Milos schwarze Augen funkeln, kurz sieht er hinüber zu den Surfern und dann wieder zu Conrad. »Bist du dir sicher?«
»Ja. Zuerst habe ich sie auch nicht erkannt, wegen der Surfer-Tussis. Aber sie sind es.« Er ballt die Rechte zur Faust, zerdrückt die Coladose mit einem lauten Knacken.
Milo packt ihn an der Schulter. »Reiß dich verdammt noch mal zusammen, okay?«
Sassy, Milos Freundin, legt eine Hand auf Conrads Arm und sieht ihn mit ihrem runden Mondgesicht mitleidig an. »Er ist tot, Con, und deine Wut macht ihn auch nicht wieder lebendig«, sagt sie sanft. »Dein Bruder hat getan, was er tun musste. So war er, du hast es nie verhindern können. Es ist vorbei.«
»Vorbei?« Er schluckt hart. »Es wird niemals vorbei sein.«
»Es bringt nichts, wenn du jetzt Stunk anfängst, okay?«, sagt Milo.
Conrad tritt einen Schritt zurück, er macht eine zornige Geste. »Was redest du da für einen Schwachsinn, Mann? Sie sind es, die Stunk machen. Schon allein ihre bloße Anwesenheit ist Stunk.«
Sassy verdreht die Augen. »Wir gehen schon mal vor«, sagt sie und verschwindet zusammen mit ihrer Freundin Valerie zwischen den Bäumen.
Boone sitzt mit heraushängender Zunge da, wedelt mit dem Schwanz und sieht Conrad erwartungsvoll an. Auch Conrad läuft los. Er muss hier weg, bevor er explodiert. Der Hass brodelt in ihm wie Magma, er kann nicht damit umgehen, er braucht ein Ventil.
»Beruhig dich, okay?« Milo rennt ihm hinterher und greift nach seinem Arm. »Wenn du jetzt Scheiße baust, kriegst du es im Handumdrehen mit deinem Alten zu tun.«
Conrad bebt. »Und was soll ich deiner Meinung nach tun?«
»Es ruhig angehen, okay? Ich lass mir was einfallen.«
Milo und Conrad laufen den Mädchen hinterher, in den Wald hinein, mitten durch das »Ocean Park Resort« mit Ferienhütten in verschiedenen Preisklassen, einer Reihe luxuriöser Strandhäuser mit Meerblick und dem neuen Motel (auch mit Meer-blick). Alles stammeseigen und trotzdem verhasst. Jedenfalls bei den meisten Quileute. Yuppie Cabins nennen sie die Strandhäuser, in denen die betuchten weißen Gäste so komfortabel untergebracht sind, wie niemand von den Einheimischen es sich leisten kann.
Die Siedlung La Push ist klein, sie hat nur rund vierhundert Bewohner, der überwiegende Teil sind Quileute. Das »Ocean Park Resort« besetzt das schönste Fleckchen Stammesland und trennt die Quileute von ihrem Strand. Aber die Ferienunterkünfte bringen dem Stamm auch viel Geld, das er dringend braucht für die Schule, das Krankenhaus, das Seniorenzentrum. Im Sommer strömen die Feriengäste nach La Push, angezogen von der wilden Schönheit der Gegend, der Abgeschiedenheit der Küste und den vielen seltenen Tierarten. Einige Besucher kommen immer wieder, andere nie.
Conrad wünscht, sie wären niemals wiedergekommen.
3. Kapitel
Nachdem auch die anderen aus dem Supermarkt gekommen waren, fanden wir uns alle wieder bei den Autos ein.
»Okay«, sagte Alec und zeigte auf eine Stelle im Schatten der Bäume, »wir können die Wagen dort drüben parken. Dann gehen wir zum Strand, suchen uns ein gutes Plätzchen zum Campen und holen später unser restliches Gepäck.«
Es schien ganz natürlich zu sein, dass Alec den Ton angab. Er strahlte Ruhe und Besonnenheit aus und besaß eine natürliche Autorität. Die anderen schienen froh zu sein, dass einer das Kommando übernahm, sogar Josh und Mark arrangierten sich damit. Das wunderte mich, denn schließlich waren die beiden im vergangenen Jahr zwei Wochen mit Alec hier surfen gewesen und kannten sich genauso gut aus wie er. Nur die Mädchen waren wie ich zum ersten Mal in La Push.
Ich warf noch einen verstohlenen Blick hinüber zu den jungen Einheimischen, aber sie verschwanden gerade auf dem Weg zwischen den Bäumen, der vermutlich in den Ort führte.
Alec und Josh fuhren die Autos auf den uns zugewiesenen Parkplatz, wo schon andere Wagen standen. Ich sah, dass ungefähr hundert Meter weiter hinter Sträuchern ein paar Wohnmobile hervorblinkten.
Jeder von uns schnappte sich ein oder zwei Gepäckstücke, bis auf Brandee, die nur ihre Handtasche trug. Unwillkürlich fragte ich mich, ob ihr klar war, dass sie einen Campingurlaub vor sich hatte. Überhaupt konnte ich sie mir mit ihrem gestylten Outfit nur schwer in einem Zelt vorstellen.
Als ich Josh fragte, wo der Zeltplatz wäre, erklärte er: »Wir zelten direkt am Strand. Du wirst schon sehen, es ist cool.«
Alec ging voran und nahm den Pfad zwischen den Bäumen hindurch. Wir folgten ihm im Gänsemarsch. Schon nach wenigen Metern konnte ich den Ozean riechen. Als ich das Brandungsgeräusch hörte, wusste ich noch nicht, was mich erwartete, aber mein Herz schlug schneller. Bald lichteten sich Wald und Buschwerk und ich sah zunächst nur ein Wirrwarr silbern ausgeblichener Baumstämme, ineinander verkeilt und aufgetürmt wie riesige Skelette. Das Brandungsrauschen war lauter geworden und ich konnte es kaum erwarten, endlich das Meer zu sehen.
Wir bahnten uns mit unserem Gepäck einen Weg durch und über die Treibholzbarriere. In diesem Moment blitzte die Sonne zwischen den Wolken hervor und blendete mich.
»Sonne«, juchzte Laura voller Freude und schüttelte ihre Korkenzieherlocken. Sie fing an zu singen: »Sunshine on my shoulders makes me happy, sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely, sunshine almost always makes me high.«
»Echt krass«, hörte ich Janice sagen, die gerade vor mir über einen Stamm kletterte, der halb im Sand vergraben lag.
Ich stieg ihr nach und dann sah auch ich ihn, den Pazifik. Die überwältigende Präsenz des Ozeans traf mich bis ins Mark. Er war von einem schweren Graugrün und milchig schäumend dort, wo die Wellen sich brachen, die mit wilder Unrast an den sandigen Strand trieben. Weiter draußen wechselte der Ozean die Farbe. Indigoblau leuchtete er und das Wasser funkelte von Sonnenlicht, als wäre seine Oberfläche mit Pailletten bestickt.
Vom ersten Moment an spürte ich, dass der Ozean voller Geheimnisse war, die sich in seinen dunklen Tiefen verbargen. Der Pazifik sprach zu mir. Wer bist du?, schien er zu fragen.
»Smilla«, flüsterte ich und hatte auf einmal den salzigen Geschmack von Tränen im Mund.
Während die anderen weitergingen, ließ ich die Henkel meiner Tasche von den Schultern gleiten und sah mich um. Der First Beach war eine lang gezogene, sichelförmige Bucht, die zu ihrer Linken von schroffen Felsen begrenzt war, auf denen dunkle Nadelbäume wuchsen. In der Nähe der Klippen ragten einzelne Felsnadeln wie schwarze, steile Zähne aus dem Meer. Auf der rechten Seite zog sich der sandige Strand lang hin. Ich sah ein Pärchen, das an der Wasserlinie spazieren ging und nach Muscheln oder anderen Meeresschätzen Ausschau hielt. Ein paar identisch aussehende Strandhäuser mit großen Glasfenstern standen dicht am Ufer, gleich hinter dem Schwemm-holz, vermutlich Touristenunterkünfte. Am anderen Ende der Bucht sah ich auf einem Hügel größere Häuser mit blauen Dächern stehen und ich nahm an, dass das der eigentliche Ort La Push war. Eine dem Festland vorgelagerte Felseninsel ragte dort aus dem Meer, auf der sturmzerzauste Bäume standen.
»James Island«, sagte Josh, der neben mir auf den Stamm gestiegen und meinem Blick gefolgt war. »Dort haben die Indianer früher ihre Toten begraben.«
Ein Schauder rann über meinen Rücken. Ich schrieb ihn dem Wind zu, der vom Meer herüberwehte und unter mein T-Shirt fuhr. »Es ist wunderschön hier«, sagte ich, schier überwältigt von diesem magischen Ort. Eine tiefe Freude durchströmte mich, dass ich hier sein durfte – für drei lange Wochen. Meine Bedenken waren wie weggeblasen.
»Na komm!«, sagte Josh. »Du wirst noch genügend Zeit haben, die Gegend zu bestaunen. Hier ist nämlich sonst nicht viel los.« Wir folgten den anderen und nach etwa hundert Metern erreichten wir ein kleines Flussdelta. Ich zog meine Turnschuhe aus, um barfuß durch das flache Wasser zu waten. Es war kalt
und klar und ich liebte das Gefühl des festen kühlen Sandes an meinen Fußsohlen.
Ein ganzes Stück weiter vorn schienen die anderen inzwischen einen Platz gefunden zu haben, an dem wir unsere Zelte aufschlagen konnten. Alec stand inmitten der Gruppe und gestikulierte nach rechts und nach links, vermutlich bestimmte er, wo die Zelte aufgebaut werden sollten.
»Das ist der beste Platz«, sagte Josh und wischte sich über die Stirn. »Letztes Jahr haben dort ein paar Surfer aus Port Angeles gecampt. Sieht so aus, als hätten wir dieses Jahr mehr Glück.«
Ich blickte mich um und konnte außer uns niemanden entdecken. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man sich hier um die besten Plätze drängeln musste – der Strand war jetzt völlig menschenleer. Aber als wir bei den anderen angelangt waren, sah ich, dass Josh recht hatte: Die Stelle, an der wir unser Camp aufschlagen würden, war perfekt. Sie lag etwas höher als der Strand, sodass die Flut uns nicht erreichen konnte, und es war genug Platz für unsere fünf Zelte, die wir allerdings auf rund geschliffenen Steinen aufbauen mussten, denn Sand gab es hier oben nicht mehr.
Jemand hatte aus Schwemmholzstämmen einen Unterschlupf gebaut, eine Art Wind-und Regenschutz. Dazu hatte er den umgestürzten Stamm einer Erle benutzt, deren größter Ast ungefähr einen Meter fünfzig über dem Boden lag. Der Erbauer des Unterschlupfes hatte diesen Ast als Querbalken genutzt und dem Ganzen eine Rückwand und ein Dach gegeben. Der Baum war noch nicht tot, der große Ast hatte an manchen Stellen ausgetrieben und die hellgrünen Blätter wirkten wie lebendiger Schmuck am grauen Holz.
»Na, was sagt ihr?«, fragte Alec strahlend. »Der Hammer, oder? Wir sind die einzigen Camper am ganzen Strand und bis zum Wochenende wird sich das auch nicht ändern.« Er griff sich in den Nacken, zog sein T-Shirt über den Kopf und rieb sich damit den Schweiß von der Stirn.
Ich hörte zustimmendes Murmeln, ein paar begeisterte Worte und Brandees Frage, wo man hier duschen und auf die Toilette gehen konnte.
»Vorne beim Supermarkt«, antwortete Alec. »Auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes sind Duschen und Toiletten. Ich habe ganz vergessen, euch das zu zeigen. Es gibt sogar Waschmaschinen.«
»Sogar?«, sagte Brandee und verzog missmutig das Gesicht. »Dass ich, um zu duschen oder auf die Toilette zu gehen, eine Meile laufen muss, hat mir vorher keiner gesagt.«
»Hey«, Alec runzelte die Stirn. »Ich habe dich gewarnt, okay? La Push ist kein glamouröser Surfspot. Aber wir können hier in Ruhe üben und niemand stört uns dabei. Es gibt keine Einheimischen, die die besten Wellen für sich beanspruchen. Und dieser Platz hier«, er breitete die Arme aus, »ist doch echt die paar Schritte wert, die man zum Duschen gehen muss. Von hier bis zum Supermarkt sind es höchstens dreihundert Meter.« Er sah Brandee herausfordernd an und hob die Hände, bevor sie etwas erwidern konnte. »Klar, das ist nicht Waimea Bay. Aber nicht jeder von uns hat das Glück, seine Sommerferien auf Hawaii verbringen zu können. Und wenn dir unser Camp zu primitiv ist, dann kannst du dir ja eins von den Strandhäusern mieten.«
Mir klappte die Kinnlade herunter, so erstaunt war ich über Alecs Tonfall. Und ich fragte mich, wie die beiden in Wahrheit zueinander standen. Nicht, dass ich mir noch irgendwelche Hoffnungen gemacht hätte, aber ich fühlte eine eigenartige Genugtuung darüber, dass Alec Brandee so hatte abblitzen lassen.
Brandee kniff die Lippen zusammen. Ganz offensichtlich wollte sie sich nicht unbeliebt machen, deshalb sagte sie schmollend: »Schon gut, kein Grund, sich so aufzuregen. Ich habe ja nur gefragt.«
»Und was ist das?«, fragte Laura. Sie wies auf ein blau-weißes Schild, das rund zwanzig Meter von unserem Lagerplatz am Waldrand stand, dort, wo ein Trampelpfad von üppigem Grün verschluckt wurde. Das Schild zeigte eine Riesenwelle und ein Männchen, das sich vor ihr auf einen Felsen rettete. Darunter stand: TSUNAMI EVACUATION ROAD.
Josh grinste. »Na, wonach sieht es denn aus?«
»Hier gibt es Tsunamis«, sagte Laura entgeistert und zog ihre Nase kraus, was bei den vielen Sommersprossen lustig aussah. »Und unser Camp liegt mitten auf dem Fluchtweg!«
»Keine Panik«, sagte Mark, der bisher geschwiegen hatte. »Den letzten Tsunami gab es hier vor mehr als fünfhundert Jahren.«
Brandee meinte: »Aber man kann nie wissen.«
»Nee, kann man nicht«, sagte Josh. »Aber schließlich sind wir doch wegen der Wellen hier, oder?« Er breitete die Arme aus und grinste fröhlich.
»Lasst uns jetzt das restliche Gepäck holen, okay?«, schlug Alec vor. »Besser, die Surfbretter sind hier.«
Alec entschied, dass Janice und ich am Strand bleiben sollten, während die anderen zu den Autos zurückgehen würden, um den nächsten Schwung Gepäck zu holen. Vor allem natürlich die Surfbretter, die (das war eine der ersten Surfregeln) nie unbeaufsichtigt bleiben durften.
Sie zogen los und Janice und ich machten uns daran, unser Zelt aufzubauen. Bevor wir es ausbreiteten, räumten wir ein paar faustgroße Steine aus dem Weg. Unsere Behausung für die nächsten drei Wochen war ein kuppelförmiges grünes Dreimannzelt, wir würden also zu zweit genügend Platz darin haben. »Und, gefällt es dir hier?«, fragte Janice, als wir Alustäbe in die dafür vorgesehenen Schlaufen schoben.
»Ja, total«, sagte ich begeistert. »Dir nicht?«
Sie hob die Schultern. »Ach, ich weiß nicht. Der Strand und das Meer sind toll, und dass wir die einzigen Surfer hier sind – das hat schon was. Aber ich campe nicht gerne so alleine. Schon gar nicht, nachdem ich weiß, dass wir hier nicht willkommen sind. Hast du die Blicke der Indianer vor dem Supermarkt gesehen? Ich habe mir bald in die Hosen gemacht.«
Ich musste lachen. »Ja. Sah so aus, als würden sie uns nicht sonderlich mögen.«
»Das Gefühl hatte ich allerdings auch«, sagte Janice sarkastisch. Sie zog die Mundwinkel nach unten. »Vermutlich können die Indianer uns Weiße einfach nicht leiden. Das wird ihnen schon in die Wiege gelegt, hat Dad immer gesagt.«
Ich dachte an den Blick, den Alec und Josh getauscht hatten, als der Junge mit dem langen Zopf an uns vorbeigegangen war. Mir war es so vorgekommen, als hätte in ihren Gesichtern Erkennen gelegen. Aber vielleicht hatte ich mir das auch bloß eingebildet.
»Ich würde gerne mehr über die Indianer hier erfahren«, sagte ich. »Andere Völker, andere Regeln. Da kann man schnell ins Fettnäpfchen treten, ohne zu wissen, wieso.«
»Ach, ich glaube, wir werden kaum mit denen zu tun haben.«
»Schade«, sagte ich.
»Sie interessieren dich wirklich, was?« Janice musterte mich mit schief gelegtem Kopf.
»Ja, na klar. Morgen werde ich mir den Ort ansehen, vielleicht gibt es in La Push ja so etwas wie ein Museum.«
Janice hatte gerade mühsam einen Zelthaken in den steinigen Boden geschlagen und hielt nun inne, den großen runden Stein noch in der rechten Hand. »Ihr Deutschen habt eine Menge übrig für unsere armen Ureinwohner, nicht wahr? Als wir mit Mom und Dad mal in Arizona bei den Navajos waren, da wimmelte es nur so von deutschen Touristen. Sie haben sich wie die Verrückten mit echt indianischem Türkisschmuck eingedeckt. Echt Made in Taiwan.«

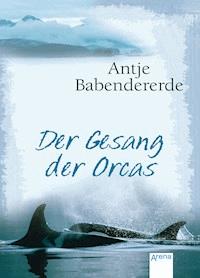
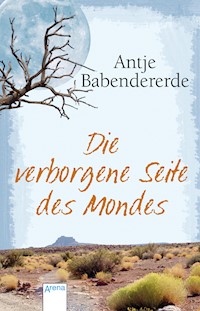


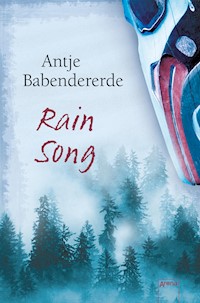

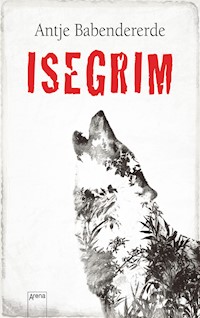
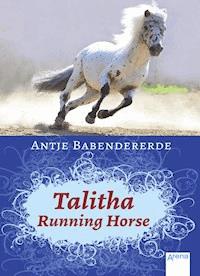

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)