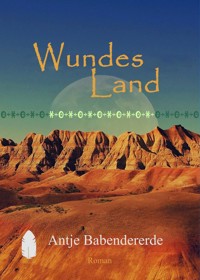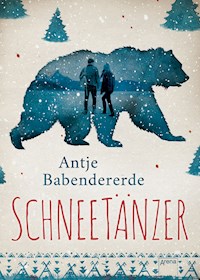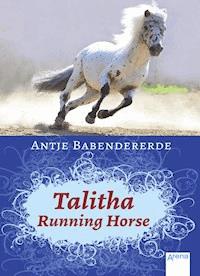
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die vierzehnjährige Talitha Running Horse ist nicht wie die anderen Lakota-Indianer, die im Reservat leben - denn Talithas Mutter ist eine Weiße. Sie hat ihre Familie und das Reservat verlassen, als Talitha noch klein war. Als dann auch noch der Vater unschuldig ins Gefängnis muss, gerät Talithas Welt vollends aus den Fugen. Kraft gibt Talitha nur noch ihre Zuneigung zu der schönen Stute Stormy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Antje Babendererde
Talitha Running Horse
Mehr von Antje Babendererde im Arena-Taschenbuch:
Libellensommer (Band 50019)Der Gesang der Orcas (Band 2393)Lakota Moon (Band 2936)Die verborgene Seite des Mondes (Band 50111)Indigosommer (Band 50222)Rain Song (Band 50369)
Antje Babendererde, geboren 1963, wuchs in Thüringen auf. Nach einer Töpferlehre arbeitete sie als Arbeitstherapeutin in der Kinderpsychiatrie.Seit 1996 ist sie freiberufliche Autorin mit einem besonderen Interesse an der Kultur, Geschichte und heutigen Situation der Indianer. Ihre einfühlsamen Romane zu diesem Thema für Erwachsene wie für Jugendliche fußen auf intensiven Recherchen und USA-Reisen und werden von der Kritik hoch gelobt.
1. Auflage als Sonderausgabe im Taschenbuchprogramm 2013 © 2005 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Frauke Schneider unter Verwendung eines Fotos von © Olga_i; shutterstock Umschlagtypografie: knaus. büro für konzeptionelle und visuelle identitäten, Würzburg ISSN 0518-4002 ISBN 978-3-401-80295-4
www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
In Sommernächten galoppierte ein geflügeltes Pferd auf dem äußersten Rand der Finsternis, und ihr Geist erfüllte es inmitten der Sterne. Es war von einem so dunklen Grau, dass es fast blau aussah, und man konnte es nur durch die Sterne in seinen Flügeln, seinem Kopf, seinen Hufen und seiner Mähne finden. C. P. Rosenthal »Sternenpferde«
Den Kindern der Lakota gewidmet
1. Kapitel
»Tally, wo steckst du?«
Ich hob den Kopf von meiner Zeichnung, legte den Bleistift beiseite und klopfte an die Fensterscheibe meines kleinen Zimmers. Draußen vor unserem Wohntrailer stand mein Vater vor der offenen Motorhaube seines alten Dodge Pick-up und machte ein besorgtes Gesicht.
Hoffentlich nichts Schlimmes,dachte ich. Dad hatte keinen festen Job, das Geld war knapp, und er brauchte den Truck, um zu den Leuten zu fahren, die ihn mit verschiedenen Arbeiten beauftragten. Mit seinen geschickten Händen konnte mein Vater alles reparieren: Autos, Zäune, Dächer. Dad machte sogar Klempnerarbeiten. Das hatte sich herumgesprochen im Reservat, und so hielten wir uns über Wasser. Mein Vater winkte mich nach draußen. Auf der Treppe erwischte mich ein kalter Windstoß und schlug mir die langen Haare über das Gesicht. Es war schon Mitte April, aber vor einer Woche hatte der Winter noch einmal Schneeschauer von Norden her über die Prärie geschickt. Die Menschen im Reservat sehnten sich nach dem Frühling. Auch wir hatten Mühe gehabt, unseren Trailer über die langen Monate hinweg warm zu halten. Die elektrisch betriebenen Heizkörper reichten nicht aus, und so hatte mein Vater immer für genügend Holz sorgen müssen, damit wir den gusseisernen Ofen in der Wohnküche anheizen konnten.
Ich sprang zurück ins Warme, flocht meine Haare zu einem Zopf und umschlang das Ende mit einem bunten Gummiband. Bevor ich wieder nach draußen ging, schlüpfte ich in meine warme Jacke. Der Wind schlug die Tür hinter mir zu, bevor ich es tun konnte.
»Was ist denn los, Dad? Ist der Pick-up schon wieder kaputt?«
Unter der Krempe seines schwarzen Hutes hervor blickte mein Vater mich an. »Ja, ich bin mit Müh und Not gerade noch bis nach Hause gekommen. Aber es war bloß ein lecker Schlauch und ich konnte ihn reparieren. Ich hoffe, jetzt hält es für eine Weile.« Er rieb seine ölverschmierten Finger an einem alten Tuch ab, aber sauber wurden sie davon nicht.
»Und warum hast du mich gerufen?«
»Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, Tante Charlene zu besuchen. Ich will versuchen ihre Heizung wieder in Gang zu bringen.« Tante Charlene war die Frau von Dads Bruder Frank. Onkel Frank war vor einem Jahr im Irakkrieg gefallen. Seit er nicht mehr lebte, kümmerte sich mein Vater so gut es ging um seine Schwägerin und ihren Sohn Marlin. Die beiden wohnten in einem hellblauen Holzhaus unweit der Straße zwischen Wounded Knee und Manderson, ungefähr zwanzig Minuten von uns entfernt.
Meine Tante hatte gestern Abend angerufen, weil ihre Heizung kaputt war. Dad hatte sich gleich noch auf den Weg zu ihr gemacht und den Schaden begutachtet. Heute Vormittag war er in die Stadt gefahren, um einige Teile zu besorgen, und auf der Rückfahrt hatte er dann Schwierigkeiten mit seinem alten Pick-up-Truck bekommen.
»Ich weiß nicht, Dad.« Ich wand mich ein wenig, weil ich nicht mitfahren wollte. »Ich muss noch Hausaufgaben machen.«
Ich ging nicht gerne zu Tante Charlene. Vor allem wegen Marlin, meinem Cousin. »Halbblut«, nannte er mich und machte sich über meine grünen Augen und meine lockigen Haare lustig. Er spottete darüber, dass meine Mutter eine Weiße war, und betonte bei jeder Gelegenheit, dass sie mich und meinen Vater verlassen hatte.
»Heute ist Samstag«, sagte Dad. »Die Hausaufgaben kannst du doch auch morgen machen.«
»Aber ich bin noch mit Adena verabredet«, fügte ich hinzu. »Picu hat gestern drei Welpen geworfen, die will sie mir zeigen.«
Adena war meine beste Freundin, die Tochter unserer Nachbarn Charlie und Nellie White Elk. Ihr Trailer stand zweihundert Meter hinter unserem, noch ein ganzes Stück den Hügel hinauf. Und Picu war Adenas Mischlingshündin. Sie hatte große Ähnlichkeit mit einem Kojoten, und ich war sehr neugierig, wie ihre neugeborenen Welpen aussahen.
Aber mein Vater lächelte, und als er seinen Hut in den Nacken schob, sah ich ein Leuchten in seinen schwarzen Augen. »Ich weiß ja, dass du deine Tante und Marlin nicht besonders magst, Talitha. Aber Charlene hat einen neuen Nachbarn. Er züchtet Appaloosapferde. Ich habe sie gestern Abend gesehen. Ich glaube, ein neugeborenes Fohlen ist auch dabei. Vielleicht macht es dir ja Freude, die Pferde zu zeichnen.«
Das war natürlich etwas vollkommen anderes! Auf jeden Fall wollte ich die Pferde sehen. Appaloosas – richtige Indianerpferde. Was hätte ich darum gegeben, selbst welche zu haben. Doch um Pferde zu halten, brauchte man Land, und man brauchte Geld. Wir besaßen zwar Land, aber nicht hier, in Porcupine, wo unser Trailer mit der braunen Holzverkleidung stand. Dad gehörten 1000 Hektar bewaldetes Land in den Hügeln hinter Tante Charlenes Haus. Sein Traum war, dort zu leben, in einem richtigen Haus mit Keller, Innentoilette und fließendem Wasser.
Mein Traum war, Pferde zu haben, sie zu reiten. Manchmal, wenn ich die Augen schloss, sah ich mich auf dem Rücken eines wunderschönen Pferdes über die Prärie fliegen. Ich konnte das Trommeln seiner Hufe hören, und schon so manches Mal war ich von seinem durchdringenden Wiehern erwacht. Diese Tagträume waren so lebendig, dass ich sogar den Schweiß riechen konnte, der vom Rücken meines Traumpferdes aufstieg.
»Deine und meine Träume gehören zusammen«, sagte Dad immer. »Wenn wir erst in einem richtigen Haus auf unserem eigenen Land wohnen, dann kannst du auch Pferde haben, das verspreche ich dir.« Doch wie sollte das jemals wahr werden? Wovon sollte mein Vater ein Haus bauen? Sein mageres Einkommen reichte ja kaum fürs Leben und für Benzingeld. Andererseits wusste ich, dass mein Vater nie leere Versprechungen machte. Und so gaben wir nicht auf, mein Dad und ich. Wir gaben unsere Träume nicht auf.
»Na gut«, sagte ich, »ich komme mit. Will nur schnell Adena anrufen und ihr sagen, dass ich erst morgen vorbeikomme.«
»Okay«, sagt Dad, »dann beeil dich! Ich wasch mir nur noch die Hände, dann geht’s los.«
Auf der Fahrt kamen wir am Hügel von Wounded Knee vorbei. Schon von weitem sah man die dunkle Holzkirche, den grauen Gedenkstein und die beiden weiß-roten Steinpfeiler mit dem kleinen schmiedeeisernen Kreuz auf dem Metallbogen, der sich von einem Pfeiler zum anderen spannte.
Das einsam stehende Tor war der Eingang zu einem Friedhof. Es war ein trauriger, ein unheilvoller Ort. Auf dem Gedenkstein waren Namen eingraviert. Im Dezember des Jahres 1890 töteten die Soldaten der 7. US-Kavallerie auf diesem Hügel fast dreihundert ausgehungerte und erschöpfte Lakota-Indianer.
Mein Vater und ich sind Nachfahren einer Überlebenden des Massakers. Meine Urgroßmutter Helen Yellow Bird war 13 – so alt wie ich –,als sie und andere Kinder, Frauen und Männer dem schwer kranken Häuptling Big Foot im eisigen Winter auf seinem Marsch über die Badlands folgten, in der Hoffnung, hier im Pine Ridge Reservat bei Red Cloud und seinen Oglala-Lakota Aufnahme und Sicherheit zu finden.
Aber die US-Armee verfolgte Big Foot und seine Leute. Als sie sie eingeholt hatten, hisste der Häuptling die weiße Flagge. Schwerbewaffnete Soldaten eskortierten die erschöpften, von Hunger und Kälte geschwächten Menschen zum Flüsschen Wounded Knee, wo sie ihr Lager aufschlagen mussten. Am nächsten Tag erging der Befehl, dass alle Indianer ihre Waffen abgeben sollten. Dabei kam es zu einem Handgemenge, und es löste sich ein Schuss aus dem Gewehr eines Lakota-Kriegers.
Daraufhin eröffneten die Soldaten das Feuer und töteten mehr als 250 von Big Foots Leuten, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Ein Teil der Verwundeten erfror im Schnee, weil sie keine Hilfe bekamen. Noch im Umkreis von zwei Meilen wurden Leichen gefunden. Einige wenige konnten fliehen und sich in Sicherheit bringen.
Deshalb wohnten auch heute noch Nachfahren der Überlebenden hier in Pine Ridge, bei den Leuten von Crazy Horse und Red Cloud, obwohl sie ursprünglich aus Reservaten im Norden von South Dakota stammten. Auch meine Urgroßmutter Helen fand Aufnahme bei einer Familie in der Nähe von Manderson. Sie heiratete und erzählte das, was sie erlebt hatte, ihren Kindern. Eines davon war mein Großvater Emmet.
Er sagte immer, dass damals in Wounded Knee nicht nur unschuldige Menschen starben, sondern auch der Traum der Indianer von einem Leben in Freiheit und Würde. Der Heilige Kreis des Lebens war zerbrochen.
Immer wenn ich am Hügel von Wounded Knee vorbeifahre, muss ich daran denken, wer ich bin. Mein Name ist Talitha Running Horse und ich bin eine Reservatsindianerin. Manche Leute nennen mich Iyeska, Mischling, denn bin ich ein Halbblut. Meine Mutter ist eine Weiße. Ich kann mich noch gut an sie erinnern, obwohl ich sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. All die Jahre hat sie mir nicht geschrieben und mich niemals angerufen.
Mein Vater Richard und meine Mutter Holly waren beide noch sehr jung, als sie sich kennen lernten. Sie ein Hippiemädchen aus San Francisco in Kalifornien, das ins Lakota-Reservat nach Pine Ridge gekommen war, weil sie Pferde liebte und neugierig auf Indianer war. Mein Dad hatte gerade das College abgeschlossen, wo er eine Ausbildung als Automechaniker gemacht hatte.
Meine Mutter begeisterte sich für die endlose Weite der Prärie und mochte sogar die Badlands, ein riesiges trockenes Gebiet, das fast nur aus mondfarbenen Kalkfelsen besteht. Sie trafen sich auf einem Powwow,einem unserer Tanzfeste. Es war Liebe auf den ersten Blick und neun Monate später wurde ich geboren. Powwow-Unfall war eines der Schimpfwörter, mit denen mein Cousin Marlin mich am liebsten betitelte.
Meine Mutter zog zu Dad in den alten Trailer, in dem er mit Großvater Emmet lebte, und sie heirateten vor dem Friedensrichter. Zuerst waren sie sehr glücklich. Doch schon bald hatte meine Mutter genug vom Reservat. Prärie und Badlands verloren ihren Reiz. Sie wollte nur noch weg, zurück nach Kalifornien, zusammen mit mir und meinem Dad. Aber er mochte davon nichts hören, denn er liebte sein Land. Außerdem wollte er seinen Vater nicht allein lassen, der sehr krank war und niemals freiwillig von dem Land fortgegangen wäre, auf dem er geboren war. »Das Land ist mit dem Blut unserer Vorfahren getränkt«, hatte Großvater Emmet gesagt. »Es atmet unsere Geschichte. Hier ist die Heimat der Spirits,unserer Geisthelfer, und hier will ich begraben werden.«
Ich war damals noch klein, aber ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter und mein Vater häufig stritten. Mom weinte oft und schimpfte über eine Menge Dinge. Dass wir kein fließendes Wasser im Trailer hatten und Dad es immer erst in Kanistern heranfahren musste. Dass die Sommer so glühend heiß und trocken waren im Reservat. Und die Winter so furchtbar kalt, dass jeder Gang aufs Klohäuschen hinter dem Trailer uns vorkam wie eine Polarexpedition. Aber dass wir nie Geld hatten, das war wohl das Schlimmste für sie.
Eines Tages, es war ein besonders heißer und trockener Sommer, packte sie ihre und meine Sachen, setzte mich in ihr Auto und fuhr mit mir davon. Ich war sieben Jahre alt und dachte, wir würden verreisen. Wir waren schon lange unterwegs in Richtung Westen, da machte meine Mutter Halt an einer Raststätte. Sie ließ mich im Auto sitzen und ging telefonieren. Das Telefon war zu weit weg, deshalb konnte ich nicht hören, mit wem sie sprach, obwohl alle Fenster offen standen. Aber ich sah sie weinen, und das machte mir Angst. Ich weiß noch, wie es in meinem Nacken zu kribbeln begann.
Schließlich kam sie zurück, ließ mich aussteigen und mit Mister Lukas, meinem Teddy, auf eine Bank setzen. Sie kaufte mir eine Limonade und einen Donut und fuhr mit den Worten »Sei schön brav und warte hier, bis dein Vater dich abholt« davon.
Ich aß den Donut und wartete. Ich wartete sehr lange und begann schon mir Sorgen zu machen. Aber dann kam mein Dad und holte mich. Von da an lebten wir zu dritt im Trailer und kamen prima miteinander aus. Niemand beklagte sich mehr.
Drei Jahre, nachdem meine Mutter uns verlassen hatte, starb Großvater Emmet. Ich habe ihn sehr geliebt und er fehlte mir. Es gab Augenblicke, in denen auch meine Mutter mir fehlte. Aber diese Augenblicke wurden immer seltener und irgendwann dachte ich überhaupt nicht mehr an sie.
Dad bog von der Teerstraße ab, die weiter nach Manderson führte, ratterte über ein Eisengitter, und hinter einer Böschung tauchte das hellblau gestrichene Holzhaus von Tante Charlene auf. Ihre beiden Hunde Scooter und Rip bellten und umkreisten den Pick-up, als Dad vor dem Haus parkte. Scooter war ein großer braun-weiß gescheckter Mischlingshund mit kurzem Fell und langen Ohren. Rip war klein und langhaarig und erinnerte mich immer an einen Mopp.
Als wir ausstiegen und sie uns erkannten, sprangen sie an uns hoch. Wahrscheinlich hatten sie Hunger oder erhofften sich ein paar Streicheleinheiten. Wir wussten, dass die Hunde von Tante Charlene nicht verwöhnt wurden. Dad kraulte beide hinter den Ohren und sagte ein paar freundliche Worte. Scooter und Rip winselten. Tante Charlene erschien in der Tür. Ihr Haar war straff nach hinten gekämmt und sie hatte es zu einem kleinen Zopf zusammengenommen. Über ihren schwarzen Leggins trug sie einen bekleckerten Pullover. Ihr mächtiger Körper füllte die Türöffnung beinahe vollständig aus. Sie hatte die fleischigen Fäuste in ihre unförmigen Hüften gestemmt und machte ein missmutiges Gesicht. »Wird Zeit, dass du kommst, Rich«, zeterte sie. »Ich bin schon halb erfroren.« »Tut mir Leid«, sagte mein Vater. »Aber heute Vormittag war ich in Rapid City, um die Teile zu besorgen, und dann musste ich meinen Pick-up-Truck reparieren. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte.«
Charlene winkte ab und verschwand im Haus. Meine Tante war schon immer anstrengend gewesen, aber seit Onkel Frank nicht mehr lebte, war sie unausstehlich geworden. Es schien fast so, als würde sie alle Lebenden für den Tod ihres Mannes verantwortlich machen. Sie achtete nicht mehr auf ihr Äußeres und kümmerte sich kaum noch um den Haushalt. Nur Marlin, ihr einziger Sohn, schien ihr noch etwas zu bedeuten. Und ihre Seifenopern.
Das mit Onkel Frank war schlimm für uns alle gewesen. Der Verlust seines einzigen Bruders hatte auch meinen Vater schwer getroffen. Mein Onkel war ein fröhlicher und gutherziger Mann gewesen, der immer alle zum Lachen gebracht hatte, sogar Charlene. Er war zur Armee gegangen, um mit dem Geld, das er dort verdiente, seinem Sohn eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Dad sagte, dass Onkel Frank den Krieg, in dem er kämpfte, nie gemocht hatte.
Nach seinem Tod bekam meine Tante nun eine Hinterbliebenenrente von der Armee und musste sich – im Gegensatz zu uns – um ihr Auskommen keine Sorgen machen. Deshalb verstaubten die Schalen mit den bunten Perlen, aus denen sie früher wunderschöne Muster gestickt hatte. Ihre Perlenarbeiten waren bei den Touristen sehr begehrt gewesen. Aber das interessierte sie alles nicht mehr.
Als ich das Haus meiner Tante betrat, blieb ich im Flur mit den Schuhsohlen am Boden kleben. Jeder Schritt machte ein Geräusch, als ob man einen Klettverschluss öffnete. Jemand hatte Limonade verschüttet und es nicht für nötig gehalten, sie aufzuwischen. In der Küche stapelte sich haufenweise schmutziges Geschirr und überall lag Kram herum: getragene Kleidungsstücke, Kartons, zerlesene Zeitschriften und Pappteller mit angetrockneten Essensresten.
Die Reinlichkeit in diesem Haus war seit Onkel Franks Tod ebenso auf der Strecke geblieben wie das Lachen und die indianischen Traditionen. Tante Charlene hatte jetzt überall Heiligenbilder aufgehängt und ging jeden Sonntag in die Kirche.
Im Wohnzimmer lief der Fernseher. Charlene saß auf der Couch unter einem Plastikjesus und stopfte Kartoffelchips in sich hinein. Obwohl sie mich bemerkt haben musste, tat sie so, als wäre ich überhaupt nicht vorhanden. Marlin schien zum Glück nicht da zu sein, wie ich mit großer Erleichterung feststellte. Ich war nicht wild darauf, meinem großspurigen Cousin zu begegnen.
Dad trug sein Werkzeug in den Keller und ich half ihm dabei. Als er die Ersatzteile aus dem Pick-up holte, folgte ich ihm nach draußen. »Die Pferde laufen frei herum«, sagte er und zeigte hinüber zum Haus von Charlenes neuen Nachbarn. Es hatte einen frischen dunkelroten Anstrich mit weiß abgesetzten Fensterrahmen und Dachrändern und sah richtig einladend aus.
»Der Besitzer heißt Tom Thunderhawk; ich hab gestern Abend kurz mit ihm gesprochen. Er hat nichts dagegen, dass du dir die Pferde ansiehst. Nur vor dem gefleckten Hengst sollst du dich ein wenig in Acht nehmen. Tom sagt, der mag Fremde nicht besonders. Laufden Weg hinter dem Haus vorbei in die Hügel, dort wirst du die Herde finden.«
Ich nickte und trat vor Aufregung von einem Bein aufs andere.
»Sei in einer Stunde wieder da, okay.«
»Ja, Dad«, sagte ich und flitzte los.
Ein breiter Fahrweg führte hinter dem roten Haus vorbei und schlängelte sich in die mit Kiefern bewachsenen Hügel. Von diesen Kiefern hatte das Reservat seinen Namen: Pine Ridge. Tante Charlene hatte immer behauptet, jenseits der Kiefern beginne das Reich der Geister. Ob sie das jetzt immer noch glaubte, wo sie doch nun den Gott der Weißen verehrte und von den Spirits nichts mehr wissen wollte?
In einigen schattigen Mulden lag noch Schnee, und es wehte ein kalter Wind. Ich blieb stehen und zog den Reißverschluss meiner Jacke bis zum Hals. Der Weg war schlammig, und ich entdeckte die Abdrücke von unbeschlagenen Pferdehufen. Ich lief schneller.
Nur wenig später, ich war überhaupt nicht weit gelaufen, sah ich die Pferdeherde auf einem Hügel stehen. Ich lief langsamer, um die Tiere nicht zu erschrecken, und ging bis auf ein paar Meter an sie heran. Vor Aufregung wagte ich kaum zu atmen, als ich Tom Thunderhawks Pferde zum ersten Mal aus der Nähe sah. Ich hatte schon hier und da mal ein Appaloosa gesehen im Reservat, aber noch nie so viele und so schöne Tiere auf einmal. Die Sonne kam plötzlich zwischen den Wolken hervor, schickte ihre Wärme herab und ließ die Fellzeichnung der Pferde aufleuchten.
Shunka wakan,Heilige Hunde, war der Name, den die Lakota den Pferden gaben, als sie zum ersten Mal welche sahen. Die Spanier brachten sie auf ihren Schiffen nach Amerika, und es dauerte noch eine Weile, bis sie zu uns in den Norden vorgedrungen waren. Die Pferde, das war das einzig Gute, was wir den Spaniern zu verdanken hatten.
Bis dahin hatten Hunde die Lasten gezogen, wenn unsere Vorfahren mit ihren Tipis der Spur der Büffel folgten. Als die Indianer die Pferde sahen, hielten sie sie für Geisterhunde. Aber schon sehr bald wussten sie die Vorteile der starken Tiere auszunutzen, denen sie eine viel größere Last aufbürden konnten als ihren Hunden.
Ich ging noch drei kleine Schritte auf die Pferde zu und blieb dann stehen. Herr über Tom Thunderhawks Herde war ein großer Hengst, einer der seltenen Leopardenschecken. Der, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte. Er wandte mir den Kopf zu, rollte mit den Augen und wieherte, was wie eine Warnung klang. Bleib lieber stehen, schien er mir sagen zu wollen.
Eine Besonderheit bei Appaloosas sind ihre Augen mit der weiß umrandeten Pupille und ihre gestreiften Hufe.
Das Fell des Hengstes war weiß und hatte überall grauschwarze Tupfen, auch auf dem Kopf und an den Beinen. Sogar seine Nüstern waren gesprenkelt. Er sah lustig aus, aber ich hatte mächtigen Respekt vor ihm. Der Hengst ließ seine Stuten und ihre Fohlen nicht aus den Augen. Mich allerdings auch nicht. Neugierigen Fremden gegenüber schien er tatsächlich sehr misstrauisch zu sein.
Von seinen fünf Stuten waren drei braun, mit weißen Kruppen und weißen Sprenkeln überall. Zwei hatten eine graue Grundfarbe und ihr Fell war von weißen Haaren durchzogen. Es sah aus, als wäre Schnee auf sie gefallen. Eine von ihnen hielt ich für die Leitstute. Sie hob immer wieder wachsam den Kopf, während die anderen sich von meiner Gegenwart nicht aus der Ruhe bringen ließen. Es gab einen grauweißen Wallach, der etwas abseits graste und sich der Herrschaft des gefleckten Hengstes fügte. Zwischen den braunen Stuten entdeckte ich zwei Jährlinge, und dann wusste ich auch, warum die eine der grauen Stuten so unruhig war. Hinter ihr versteckt stand ein dünnes Fohlen, das erst wenige Tage alt sein konnte.
Ich ging vorsichtig ein paar Schritte um die Herde herum, um es besser ansehen zu können. Kopf und Hals des kleinen Stutfohlens waren dunkelgrau. Rücken und Bauch sahen aus wie von Raureifbedeckt. Sein fast weißes Hinterteil hatte dunkle, faustgroße Flecken, fünf auf jeder Seite. Es folgte seiner Mutter auf Schritt und Tritt und drängte sich an ihren schützenden Körper.
Ich hatte das Gefühl, als wäre ich ihm schon in meinen Träumen begegnet, und verliebte mich sofort in dieses kleine Wesen. Die Sonne wärmte sein schön gezeichnetes Fell, und auf einmal machte es fröhliche, ungelenke Sprünge, die mich an einen kleinen Wirbelwind denken ließen. Beinahe unbewusst formten meine Lippen einen Namen: Stormy.
»Hey, Stormy!«, rief ich leise und flüsterte ein paar freundliche, besänftigende Worte. Das Fohlen hob den Kopf und sah mich neugierig an, als hätte es seinen neuen Namen verstanden. Es kam näher, als wollte es mehr hören von dem, was ich zu sagen hatte. Zu gerne hätte ich es gestreichelt und meine Nase an sein weiches Fell gedrückt, um seinen süßen Pferdeduft einzuatmen. Aber auch wenn der gefleckte Hengst anscheinend beschlossen hatte, mich nicht länger als Gefahr zu betrachten – die graue Stute ließ mich nicht an ihr Fohlen heran. Sobald ich mich Stormy näherte, stellte sie sich zwischen mich und ihr Fohlen.
Ich wusste, dass nährende Stuten manchmal gefährlich werden konnten, wenn sie das Gefühl hatten, ihren Nachwuchs verteidigen zu müssen. Also verhielt ich mich vorsichtig und bedrängte sie nicht. Ich war glücklich, so nah bei der Herde sein zu dürfen. Das nächste Mal wollte ich unbedingt meine Zeichenmappe mitbringen. Viel zu schnell war die Stunde vorbei, und ich musste mich schon wieder auf den Weg machen, um rechtzeitig bei meiner Tante zu sein. Mein Vater mochte es nicht, wenn er auf mich warten musste. Als ich bei Tante Charlenes Haus ankam, lud Dad gerade sein Werkzeug auf die Ladefläche des Pick-ups. »Na, hast du die Pferde gesehen?«, fragte er lächelnd.
»Ja, Dad. Sie sind wunderschön!«, schwärmte ich. »Und du hattest Recht. Da ist ein winziges Fohlen dabei, mit zehn dunklen Punkten auf der weißen Hinterhand.«
»Fünf auf jeder Seite?«, fragte er.
»Ja, fünf auf jeder Seite.« Verwundert über seine Frage, sah ich ihn an. »Dann ist es ein besonderes Pferd, Tally. Wakan Tanka,der Große Geist, hat es berührt; er hat den Abdruck seiner Hand auf ihm hinterlassen. Tom Thunderhawk ist sicher stolz darauf, so ein Tier zu besitzen.«
»Das nächste Mal, wenn ich wieder hier bin, werde ich das Fohlen zeichnen«, sagte ich und gab mir keine Mühe, meine Begeisterung zu verbergen.
2. Kapitel
Als wir wieder zu Hause waren, lief ich doch noch hinauf zu Adena. Ich wollte ihr unbedingt von den Appaloosa-Pferden erzählen. Adena White Elk war dreizehn, so alt wie ich, und wir gingen in die achte Klasse der Junior Highschool von Porcupine. Meine Freundin war Vollblutindianerin, eine Oglala-Lakota. Sie stammte aus einer sehr traditionellen Großfamilie, einer Tiospaye,wie wir Lakota sagen. Es gab Tiospayes in unserem Reservat, die mehr als achtzig Mitglieder zählten.
Die White Elks besaßen aus Prinzip keinen Fernseher, um die Einflüsse der weißen Kultur von ihren Kindern fern zu halten. Hinter ihrem Trailer stand eine Schwitzhütte, ein halbrunder Bau aus gebogenen Weidenästen, der mit grauer Plane abgedeckt war. Darin wurden regelmäßig Inipis, Schwitzbäder abgehalten, um Körper und Geist zu reinigen. Adenas Großvater Bernhard White Elk, der mit dem Rest der Tiospaye in Kyle lebte, war ein geachteter Medizinmann im Reservat, der jedes Jahr den Sonnentanz in den Black Hills leitete. Meine Freundin Adena hatte drei Brüder, von denen aber nur noch der zehnjährige Jason zu Hause lebte. Leider war er eine ziemliche Großklappe.
Der Trailer, den Familie White Elk bewohnte, war genauso groß wie unserer, aber viel moderner und besser eingerichtet. Sie hatten sogar ein Badezimmer mit fließendem Wasser und Spülklosett. Dad und ich durften ab und zu bei den White Elks duschen, was ich ziemlich nett von ihnen fand. Denn eine Wasserleitung zu legen kostete eine Menge Geld, und immer wenn wir das Geld dafür zusammenhatten, ging irgendetwas an unserem Truck oder am Trailer kaputt oder jemand kam und brauchte das Geld dringender. Um einem Verwandten eine dringend notwendige Operation zu ermöglichen, zum Beispiel. Manchmal bekamen wir unser Geld zurück, manchmal auch nicht. Wer etwas hatte, der gab. Großzügigkeit ist eine der wichtigsten Tugenden der Lakota. Die anderen sind Aufrichtigkeit, Weisheit, Mut und Demut.
Adena freute sich, als ich vor der Tür stand. Sie zog mich herein und führte mich gleich zu Picu, die in der Küche auf ihrer Decke in einer Kiste lag und drei Welpen säugte. Als Adena den Kopf der Hündin streichelte, blinzelte sie uns müde an.
»Picu ist ganz schön erschöpft«, sagte Adena, »die drei haben ständig Hunger.«
»Sie sind süß.« Ich streichelte einem der Hundebabys mit dem Zeigefinger über das Bäuchlein.
»Willst du einen?«
»Sofort«, sagte ich und seufzte hingerissen. »Aber Dad wird es nicht erlauben. Wir haben ja schon Miss Lilly.« Miss Lilly war meine grauschwarz getigerte Katze. Ihr fehlte ein halbes Ohr, das sie vermutlich beim Kampf mit einem Kojoten eingebüßt hatte. Miss Lilly war eine sehr eigenwillige Dame, die über Konkurrenz aus der Hundewelt sicher nicht erfreut gewesen wäre.
»Na ja, du kannst es dir ja noch überlegen.«
Ich nickte und erzählte Adena von Tom Thunderhawks Pferden und dem kleinen Stutfohlen, das ich Stormy genannt hatte.
Adena schüttelte ungläubig den Kopf. »Du gibst einem Fohlen, das dir überhaupt nicht gehört, einen Namen?«
Betrübt zuckte ich die Achseln. Meine überschwängliche Freude machte der nüchternen Erkenntnis Platz, dass ich mich Hals über Kopf in ein Fohlen verliebt hatte, das wildfremden Menschen gehörte. Mit ziemlicher Sicherheit hatte es bereits einen Namen, da hatte Adena vollkommen Recht.
»Es sieht wunderschön aus«, sagte ich. »Ich hab es in meinen Träumen gesehen.« Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. In meinen Träumen hatte ich ein Pferd gesehen, das schön und stark war. Aber es war kein bestimmtes Pferd und schon gar kein Fohlen. Doch jetzt war Stormy das Pferd meiner Träume.
»Träume hin, Träume her, du darfst dein Herz nicht so dranhängen«, sagte Adena und klang furchtbar erwachsen. »Wenn das Fohlen groß genug ist, verkauft der Besitzer es vielleicht, und du siehst es niemals wieder.«
Manchmal konnte sie ganz schön grausam sein in ihrer nüchternen Art.
»Dad sagt, es ist ein besonderes Pferd. Es ist wakan*weil Wakan Tanka es gezeichnet hat. Vielleicht behält Tom Thunderhawk das Fohlen ja auch«, erwiderte ich trotzig. »Dann kann ich es besuchen, wenn wir bei Tante Charlene sind.«
Nachdem ich von Adena zurückgekommen war, aßen Dad und ich Reis mit roten Bohnen und tranken Tee aus cheyaka, wilder Pfefferminze, die ich im vergangenen Sommer gesammelt und getrocknet hatte. Im Öfchen prasselte ein gemütliches Feuer und aus dem Radio erklang Musik von Walela, einer indianischen Frauenband, die Dad mit Vorliebe hörte. Rita Coolidges rauchige Stimme füllte den Raum. Miss Lilly lag auf unserer zerschlissenen alten Couch und räkelte sich genüsslich in der Wärme.
Ich war noch immer ganz erfüllt von der Begegnung mit den Pferden und hatte jetzt schon Sehnsucht nach dem gepunkteten Fohlen. Ich beklagte mich bei meinem Vater, dass Tom Thunderhawks Appaloosas mich zwar in ihrer Nähe geduldet hatten, sich aber von mir nicht anfassen ließen.
»Das braucht seine Zeit«, sagte er. »Du musst geduldig sein.«
»Aber wenn ich sie nur so selten sehe, werden sie sich nie an mich gewöhnen«, murrte ich. Geduld ist nicht unbedingt meine Stärke.
»Wenn du etwas hättest, das sie gerne fressen, irgendeine Leckerei, dann wäre es vielleicht einfacher«, bemerkte Dad.
Etwas ratlos sah ich ihn an. Die Pferde der Lakota waren keine Leckerbissen gewöhnt. Karotten kamen in die Suppe, wenn man welche hatte, denn frisches Gemüse war teuer in den wenigen Läden, die es im Reservat gab. Die meisten Pferde mussten sehen, dass sie das Jahr über selbst genug zu fressen fanden, jedenfalls solange kein Schnee lag. Im Winter wurden die Tiere dann gefüttert, solange das Geld für Futter reichte. Wenn nichts mehr da war, mussten sie mit ihren Hufen den Schnee beiseite scharren und zusehen, wie sie allein zurechtkamen.
Auch der letzte Winter war hart gewesen. Dad hatte mir erzählt, dass einige Pferdebesitzer im Reservat Tiere verloren hatten. Im Januar lag der Schnee so hoch, dass sie nichts mehr zu fressen fanden. Ihre Besitzer hatten kein Geld gehabt, um ihre Häuser oder Trailer zu heizen, geschweige denn, um Futter zu kaufen.
Auch unser Geld reichte natürlich nicht, um Leckereien für Pferde zu kaufen, die uns nicht mal gehörten. Aber ein paar Tage später kam mein Vater mit einem Karton krümeliger dunkelgrüner Würste von einem Arbeitseinsatz zurück. Er überreichte mir die Pappkiste mit einem strahlenden Lächeln.
Ich machte große Augen: »Was ist das, Dad?«
»Ich war heute bei einem Mann in Wanblee, der sich gut auskennt mit sämtlichen Pflanzen, die bei uns wachsen«, erklärte mein Vater.
»Er hat in seinem Keller eine elektrische Ölpresse und presst damit Öl aus Sonnenblumenkernen und Sesamsaat, manchmal mit Salbei, Hagebutten oder Kräutern vermischt. Ich habe seine Dachrinne repariert und er fragte mich, ob ich Pferdebesitzer sei, denn er hätte da etwas, das Pferde gerne fressen würden.«
Helle Freude wuchs in mir, obwohl ich immer noch keine Ahnung hatte, was das für merkwürdiges Zeug in diesem Karton war. Ich nahm eine fingerdicke Wurst heraus und schnupperte daran. Es fühlte sich fest an und roch nussig.
»Was du in den Händen hältst, ist das, was beim Pressen der Ölsaat übrig bleibt«, sagte mein Vater. »Man nennt es Presskuchen. Vielleicht hast du mit diesen Pellets Glück bei den Pferden.«
Er zwinkerte mir zu und ich setzte die Kiste ab, um ihn zu umarmen. Mein Vater dachte immer an mich. Oft brachte er mir eine Kleinigkeit mit, irgendetwas, von dem er wusste, dass ich mich darüber freuen würde. Eine besonders schöne Feder oder einen kirschgroßen weißen Stein, in dessen hohlem Inneren winzige Körner rasselten, ein zerlesenes Exemplar des National Geographic Magazine, neue Stifte oder Papier zum Zeichnen.
Und diesmal einen Karton mit Leckerbissen für Pferde.
Ich drückte ihm einen dankbaren Kuss auf die Wange. Mein Vater hob mich hoch, wie er es oft getan hatte, als ich noch kleiner war, und schleuderte mich einmal herum, dass meine langen Zöpfe flogen.
»Du bist der beste Dad, den ich habe«, sagte ich.
Er lachte. »Ich liebe dich auch, Braveheart.«
Braveheart. Das war Dads Kosename für mich. Er hatte ihn mir gegeben, als ich vor fünf Jahren beim Spielen in Gift-Efeu gefallen war und keine Träne vergossen hatte, obwohl sich grässliche große Blasen an meinen Beinen bildeten, die nässten und fürchterlich brannten.
Es war gar nicht so schwer gewesen, den Schmerz nicht über die Lippen kommen zu lassen. Ich hatte ihn zu einer kleinen Kugel zusammengepresst, um die sich mein Wille schloss wie eine Faust. Das hatte Dad mir beigebracht.
Auf einmal hörten wir Flügelschlag über unseren Köpfen und blickten beide in den Himmel. Es war ein Vogel mit langen Beinen, langem Hals und einem spitzen Schnabel. Ein Kranich, der in Richtung Norden flog. Mit einem frohen Lächeln setzte mein Vater mich ab. Ich wusste, dass auch er in diesem Augenblick an Großvater Emmet dachte. Beide hörten wir die Worte des alten Mannes: Wenn du einen Kranich nordwärts fliegen siehst, dann weißt du, dass der Winter vorbei ist.
Im Schulbus erzählte ich Adena von den Pellets. Sie machte ihr typisches skeptisches Gesicht. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pferde Abfälle von irgendetwas mögen«, sagte sie.
»Du wirst schon sehen«, erwiderte ich.
Während des Unterrichts schweiften meine Gedanken andauernd zu Tom Thunderhawks Pferden. Durch die großen Fenster im Klassenzimmer sah ich die Wolken am Himmel fliegen, wie sie zerrissen und sich wieder vereinten. In meiner Phantasie wurden sie zu weißen Pferden mit fliegenden Mähnen. Die Stimme meiner Klassenlehrerin plätscherte dahin wie ein Bach. Ich träumte mit offenen Augen, bis Mrs Turnbull mich weckte.
»Hältst du noch Winterschlaf, Tally?«, fragte sie spöttisch. Die Klasse lachte.
Dass ich im Unterricht träumte, war nicht neu. Trotzdem hatte ich in den meisten Fächern gute Noten. Adena war natürlich besser. Sie war in fast allem besser als ich, auch wenn sie das nie herauskehrte.
Adena wollte Lehrerin werden. Sie konnte ein Gedicht in kürzester Zeit auswendig lernen und ausdrucksvoll vortragen. Im Kopfrechnen war sie die Schnellste der ganzen Klasse. Auch im Sportunterricht war sie immer ein bisschen schneller als ich, sprang ein paar Zentimeter weiter oder höher. Sie hatte eine wunderschöne klare Stimme und auf dem Powwow war sie die bessere Tänzerin. Ihre Handarbeiten sahen immer korrekter aus als meine, und was sie anhatte, saß stets perfekt, während ich meistens so aussah, als ob ich verschlafen hätte und wie der Blitz in die Klamotten gesprungen wäre, die gerade herumlagen.
Nur in einem konnte Adena mir nicht das Wasser reichen: Ich war eindeutig die bessere Zeichnerin. Wenn Adena versuchte ein Pferd zu zeichnen, konnte man es leicht mit einer Kuh verwechseln. Wenn ich Tiere zeichnete, wirkten sie so lebendig, als könnten sie jederzeit aus dem Papier springen, sagte Dad immer.
Nach der Schule kam Adena gleich mit zu mir, um sich meine kostbaren Pferdeleckerbissen anzusehen. Mit spitzen Fingern nahm sie ein grünes Würmchen aus dem Karton. Sie roch daran und rümpfte die Nase. »Und das soll den Pferden schmecken? Na ich weiß nicht…«
Sie unkte mal wieder. Adena unkte gern. Manchmal trieb sie mich damit fast zur Verzweiflung.
Aber diesmal ließ ich mich durch ihren skeptischen Blick nicht beirren. »Wenn dieser Kräutermann sagt, dass Pferde dieses Zeug gern fressen, dann wird es auch so sein«, erwiderte ich zuversichtlich.
Die Frühjahrsstürme begannen und es regnete viel, was gut war für den trockenen Boden im Reservat. Der Wind trieb den Regen gegen die Scheiben unseres Trailers und unter das Dach, das im Winter undicht geworden war. Dad flickte und reparierte es, während ich die Pfützen auf dem Boden aufwischte.
Die Kakteen auf dem Hügel hinter unserem Trailer füllten sich mit Wasser, und das grüne Gras kam hervor. Nun würden Tom Thunderhawks Pferde wieder genügend zu fressen finden. Doch ich würde es noch schwerer haben, an sie heranzukommen. Die Kiste mit den Pellets stand immer noch unberührt in meinem Zimmer, und ich konnte es kaum erwarten, wieder zu Tante Charlene zu fahren, um mein Glück bei den Pferden zu versuchen.
Drei Tage später bot sich die Gelegenheit. Diesmal war es ein Reifen von Tante Charlenes Ford-Combi, der gewechselt werden musste. Dad hatte gewartet, bis ich aus der Schule kam, weil er wusste, dass ich sonst traurig gewesen wäre, wenn er sich ohne mich auf den Weg gemacht hätte. Ich füllte einen Teil der Pellets in einen Stoffbeutel, und wir fuhren los.
Den ganzen Vormittag hatte es geregnet, aber nun lugte die Sonne zwischen den Wolken hervor. »Zum Glück«, sagte Dad, »ich dachte schon, ich müsste den Reifen bei strömendem Regen wechseln.«
Marlin stand auf den Holzstufen vor dem Haus und spielte mit den Hunden. Sie bellten und sprangen um ihn herum, weil er einen Knochen in der Hand hielt, den sie gerne haben wollten. Als ich aus dem Pick-up stieg, hörte er auf, freundlich zu ihnen zu sein, und jagte sie weg. Er bedachte Dad und mich mit einem gleichgültigen Blick.
Marlin war schon immer groß und kräftig gewesen. Nach dem Tod seines Vaters aber war er fett geworden, genau wie seine Mutter. Wenn er so weiterfuttert, wird er bald nicht mehr aus den Augen schauen können, dachte ich jedes Mal, wenn ich ihn sah.
Er ging ins Haus. In Gegenwart meines Vaters traute er sich nicht, mich zu hänseln. Ich fragte mich, warum nicht Marlin das Rad am Wagen seiner Mutter wechselte. Alt genug war er schließlich dazu. Doch hätte ich diese Frage laut ausgesprochen, hätte er mir das später heimgezahlt. Irgendwann, wenn mein Vater nicht dabei war.
Mit meinem Stoffbeutel voller grüner Würste machte ich mich gleich auf den Weg zu den Pferden. Tagsüber suchten sie die saftigsten Wiesen in den Hügeln. Neben der Bretterscheune, hinter der sich eine große Koppel befand, hatte Tom Thunderhawk ihnen einen Unterstand gebaut, wo sie vor Sturm und Regen Schutz suchen konnten.
Ich musste nicht weit laufen – nur bis zu einer Baumgruppe, wo die Pferde grasten und sich an der schorfigen Rinde scheuerten, um ihr Winterfell loszuwerden. Neugierig kamen einige der Tiere auf mich zu und schnoberten an meiner Tasche. Ich musste lächeln und holte eine Hand voll Pellets heraus. Stormys Mutter beschnupperte die duftenden Würstchen, die ich ihr auf der Hand darbot und begann zu fressen. Ich hielt ganz still, aber innerlich jauchzte ich vor Freude.
Stormy beobachtete uns aus sicherer Entfernung. Ganz langsam ließ die Scheu der Pferde nach, doch sie wandten auch weiterhin die Köpfe ab, wenn ich versuchte sie zu berühren.
Als ich mich nach der einen Stunde, die mein Vater mir zugebilligt hatte, auf den Weg zurückmachte, liefen die Pferde mir nach. Das war ein unglaubliches Gefühl, als ob sie zu mir gehören würden – oder ich zu ihnen. Aber vermutlich verbrachten sie die Nacht immer auf der Koppel hinter der Scheune, und Tom hatte ihnen durch abendliche Futtergaben beigebracht, sich in der Dämmerung auf den Weg zu machen, damit er sie nicht holen musste.
Tatsächlich liefen die Pferde zum Unterstand, und als ich mich noch einmal zu ihnen umwandte, sah ich jemanden aus der Scheune kommen. Die Gestalt war groß, aber nicht so kräftig wie ein Mann. Es war ein Junge mit langen Zöpfen. Er musste gespürt haben, dass er beobachtet wurde, denn er drehte sich um und sah zu mir herüber.
Ich tat so, als hätte ich ihn nicht bemerkt, und lief einfach weiter zum Haus meiner Tante. Mein Herz flatterte wild wie ein Vogel in meiner Brust, weil ich den Blick des Jungen in meinem Rücken spürte. Wer er wohl war? Hatte Tom Thunderhawk einen Sohn? Dad hatte mir gar nichts davon erzählt, dass Tante Charlenes neuer Nachbar eine Familie hatte.
Von nun an begleitete ich meinen Vater jedes Mal bereitwillig, wenn er zu Tante Charlene fuhr. Um die Pferde zu sehen, nahm ich sogar Marlins Schikanen in Kauf. Er kniff mich, wenn niemand hinsah, und zog mich an den Zöpfen. Er war vierzehn und ich konnte nicht begreifen, dass ihm derart kindisches Benehmen Vergnügen bereitete. Aber auch wenn seine Kniffe blaue Flecken auf meinen Armen hinterließen, die noch lange zu sehen waren: Vielmehr schmerzte es mich, wenn er über mich lästerte.
Daran, dass er mich Halbblut und Powwow-Unfall schimpfte, hatte ich mich inzwischen gewöhnt, aber er zog auch gerne über mein Äußeres her. Spitznase, Brett mit Warzen, Knochenbein, Heuschrecke.
Um Marlins Demütigungen zu entgehen, ließ ich mich oft gar nicht erst im Haus blicken, sondern machte mich gleich auf den Weg zu den Pferden. An manchen Tagen war es schon sommerlich warm, und wenn ich am roten Haus der Thunderhawks vorbeiging, sah ich manchmal zwei kleine Mädchen auf der Wiese spielen oder eine junge Frau, die Wäsche auf eine Leine hängte und mir freundlich zuwinkte. Auch den Jungen, von dem ich inzwischen wusste, dass er Toms Sohn war, sah ich hin und wieder, machte aber jedes Mal einen großen Bogen um ihn.
Bisher hatten Jungs mich kaum interessiert, wobei Adena meinte, das läge nur daran, weil die Jungs sich nicht für mich interessierten. Vielleicht hatte sie damit sogar Recht. Was nützte es mir, ihnen mit schmachtenden Blicken hinterherzusehen, wenn sie mich überhaupt nicht wahrnahmen.
Einen plausiblen Grund, warum ich Toms Sohn aus dem Weg ging, hätte ich nicht zu nennen gewusst. Zugegeben, in Wahrheit brannte ich darauf, ihn kennen zu lernen. Ich hatte nämlich gesehen, wie er mit den Pferden sprach, wie liebevoll er mit ihnen umging. Sie dankten es ihm mit Vertrauen und Zuneigung. Und jemand, dem Tiere auf diese Weise vertrauten, musste ein besonderer Mensch sein.
Vielleicht hätte er mir das Geheimnis verraten, wenn ich den Mut aufgebracht hätte, ihn anzusprechen. Stattdessen übte ich mich in Geduld, lockte und fütterte die Pferde mit Pellets und gewann auf diese Weise die Zuneigung von Stormys Mutter und den anderen Tieren. Einzig der gefleckte Hengst und das Fohlen weigerten sich immer noch, mir aus der Hand zu fressen. Der Hengst war zu stolz und Stormy zu vorsichtig.
Aber ich gab nicht auf, und nach einiger Zeit gewöhnte sich das Fohlen an meine Stimme und meinen Geruch. Es begann sich für meine Spezialitäten zu interessieren und verlor seine Scheu. Stormy schnupperte an den duftenden Pellets, fraß ein wenig und ließ zu, dass ich sie am Kopf berührte. Es war ein unglaublich schönes Gefühl, als ich zum ersten Mal ihre gesprenkelten Nüstern streichelte, die sich so samtig anfühlten wie weich gegerbtes Wildleder.
Seit ich Stormy das erste Mal gesehen hatte, war sie bereits ein Stück gewachsen und längst nicht mehr so zittrig und ungelenk wie am Anfang. Wenn das Stutfohlen hinter seiner Mutter herjagte und ausgelassene Sprünge vollführte, dann sah es aus wie ein Schneewirbel auf der grünen Frühlingswiese.
Einmal begleitete mich Adena zu den Pferden, und ich bewies ihr, wie wild die Tiere auf meine ungewöhnlichen Leckerbissen waren. Die Stuten und die beiden Jährlinge ließen sich von ihr füttern, nur der Hengst und Stormy nicht. Da wusste ich, dass zwischen mir und dem Fohlen etwas Besonderes entstanden war, etwas, das nicht nur mit den schmackhaften Pellets zu tun hatte, die ich ihm brachte.
Stormy erkannte mich und vertraute mir.
»Es mag mich nicht«, sagte Adena gekränkt. »Wieso kannst du es streicheln und ich nicht?«
»Du bist ihm fremd, das ist alles«, tröstete ich sie. Und während ich das sagte, durchströmte mich ein warmes, wunderbares Gefühl von Einzigartigkeit. Ich streichelte Stormy, mein Fohlen, das mir nicht gehörte. Es stupste mich an und schien mir sagen zu wollen, dass es mich ebenfalls mochte.
*wakan: heilig
3. Kapitel
Eines Tages Ende Mai, als ich wieder bei den Pferden war, passierte, was ich immer befürchtet hatte. Tom Thunderhawk kam dazu, wie ich Stormy mit Pellets aus der Ölpresse fütterte. Ich erschrak, als er plötzlich hinter mir stand, denn ich hatte ihn nicht kommen gehört. Er war groß, noch größer als mein Vater, hatte dunkle Haut, zwei dicke glänzende Zöpfe, schwarze Augen und narbige Wangen. Auf dem Kopf trug er eine rote Baseballkappe mit dem Aufdruck KILI Radio.
»Du verwöhnst meine Pferde«, sagte er mit strenger Stimme, deren Resonanz ich in meinem Magen spürte.
Ich versteckte den Beutel hinter meinem Rücken und blickte verlegen zu Boden, als könne ich irgendwie im Gras verschwinden.
»Was gibst du den Pferden denn da?«, fragte Tom. »Sie scheinen ja richtig wild darauf zu sein. Zucker ist nicht gut für sie, schon gar nicht für ein Fohlen, das noch säugt. Sie kriegen schlechte Zähne, und dann habe ich ein großes Problem.«
»Es ist nichts Süßes«, stotterte ich. »Das würde ich ihnen nie geben.« »Was ist es dann?« Er streckte fordernd die Hand aus und ich reichte ihm widerstrebend meinen Beutel. Er fasste hinein, nahm ein paar Pellets und roch daran.
»Das sind Reste aus einer Ölpresse«, sagte ich, einen Anflug von Trotz in der Stimme. »Sonnenblumensaat mit Kräutern. Sie fressen es furchtbar gern.«
»Soso«, bemerkte Tom brummig, aber dann erschien plötzlich ein breites Lächeln auf seinem narbigen Gesicht. »Wasté«, sagte er, was auf Lakota so viel wie »gut« oder »schön« bedeutete. »Ist genehmigt, junge Frau.«
»Wirklich?« Ich konnte mein Glück kaum fassen und wurde rot. Ich war dreizehn Jahre alt, klein und dünn. Junge Frau hatte noch nie jemand zu mir gesagt.
»Ja, du kannst sie damit füttern, das ist in Ordnung.« Er gab mir den
Beutel zurück und lachte, als Stormy neugierig an meiner Hand zu knabbern begann. »Das Fohlen mag dich«, sagte er freundlich.
»Ja«, sagte ich, »ich mag Stormy auch.«
Tom betrachtete mich mit einem seltsam fragenden Blick und ich schlug mir die Hand vor den Mund, als mir bewusst wurde, was ich verraten hatte.
»So so, du gibst meinen Pferden also Namen«, sagte er, mit offensichtlicher Verwunderung.
Ich senkte den Kopf. Mit Sicherheit hatte Tom dem gepunkteten Fohlen längst einen Namen gegeben und es konnte natürlich nicht zwei Namen haben.
»Nur dem Fohlen«, erwiderte ich kleinlaut.
»Stormy ist ein schöner Name«, meinte er schließlich. »Schöner als Corry, aber er klingt ähnlich. Meinetwegen kann das Fohlen deinen Namen behalten.«
»Wirklich?« Ich blickte auf und strahlte Tom an.
»Ja, warum nicht.« Er nannte mir die Namen der anderen Tiere und so erfuhr ich, dass Stormys Mutter Hanpa hieß und der gefleckte Hengst Taté. Das war Lakota und bedeutete Wind.
»Hast du ihn schon mal laufen sehen?«, fragte Tom.
Ich schüttelte den Kopf. Meine Zeit bei den Pferden war immer nur kurz, nie länger als eine Stunde.
»Er ist schnell wie der Wind, daher hat er auch seinen Namen. Nur ich und mein Sohn Neil dürfen ihn reiten.«
So erfuhr ich die Namen der Pferde und dass der Junge, den ich manchmal dabei erwischte, wie er mich beobachtete, Neil hieß.
Tom musterte mich nachdenklich. »Du magst Pferde, nicht wahr?«
»Ja«, sagte ich und sah zu ihm auf. »Sehr.«
»Kannst du denn reiten?«
Verlegen schüttelte ich den Kopf. »Nicht richtig. Wir haben keine Pferde.«
Ich war zwar hier und da mal geritten, aber richtig gelernt hatte ich es nie. Und das bei meinem Namen: Running Horse.Etwas Beschämenderes konnte ich mir als Lakota-Indianerin nicht vorstellen. Die meisten Kinder im Reservat wuchsen mit Pferden auf und waren gute Reiter. Mit den Pferden verband sich unser ganzes Lebensgefühl. In meinem Fall verband sich mit ihnen nur mein Name und eine große Sehnsucht.
»Möchtest du es lernen?«
Ich blickte ihn hoffnungsvoll an, aber dann sank mein Kopf wieder nach unten. »Wir haben kein Geld für so was«, sagte ich bekümmert. Tom Thunderhawk begann zu lachen, ein tiefes, donnerndes Lakota-Lachen, das in meinem Magen kollerte und auf merkwürdige Weise liebevoll klang.
»Hab ich vielleicht was von Geld gesagt? Du magst die Tiere und sie mögen dich. Außerdem hast du ein gutes Gefühl für Pferde, und das gefällt mir. Ich beobachte dich schon lange.«
»Aber wir wohnen ziemlich weit weg«, sagte ich.
»In Porcupine, wenn ich mich nicht irre?«
»Ja, das stimmt.«
Er lachte wieder. »Das ist doch nur ein Katzensprung. Komm, wann immer du kannst, und wenn ich Zeit habe, werde ich dir das Reiten beibringen.« Er strich mir mit seiner großen dunklen Hand übers Haar. »Wie heißt du eigentlich, Mädchen?«
»Tally«, sagte ich mit wild klopfendem Herzen. »Talitha Running Horse.«
Für einen kurzen Augenblick huschte ein Schatten über Toms Gesicht und er fragte: »Ist Charlene deine Tante?«
Ich nickte. »Mein Dad hilft ihr manchmal, wenn es was zu reparieren gibt. Deshalb bin ich ab und zu hier.«
»Charlene ist nicht besonders gut auf meine Familie zu sprechen«, sagte er, und ich hatte plötzlich furchtbare Angst, dass er sein Angebot zurücknehmen könnte, nur weil ich mit Tante Charlene verwandt war.
»Sie ist auf niemanden gut zu sprechen«, erwiderte ich schnell.
»Mein Onkel ist vor einem Jahr im Irak gefallen und seitdem geht es ihr nicht so gut.«
Thunderhawk nickte. »Ja, ich weiß. Wenn sie etwas freundlicher zu anderen wäre, würde es ihr vielleicht besser gehen.«
Mein Vater kam und holte mich. Er wechselte ein paar Worte mit Tom Thunderhawk und dabei stellte sich heraus, dass Tom ein Stück Land pachten wollte, das meinem Vater gehörte und das an sein eigenes Land grenzte.
»Dann hätten die Pferde einen größeren Auslauf«, sagte er.
Aber Dad wollte nicht verpachten, was mich wunderte, wo wir doch jeden Dollar gut gebrauchen konnten.
»Das Land gehört mir, aber es ist nicht mein Besitz«, sagte mein Vater, »und ich achte es zu sehr, als dass ich daraus Gewinn schlagen könnte.«
Thunderhawk nickte. »Das verstehe ich und ich hätte da einen Vorschlag.«
Schließlich einigten sie sich darauf, dass Toms Pferde auf unserem Land grasen durften und ich dafür bei ihm Reiten lernen würde. Ich konnte kommen, sooft ich wollte. Mit diesem Angebot war ich mehr als zufrieden, und Tom war es auch. Freudestrahlend umarmte ich meinen Vater.
Wieder zu Hause, lief ich gleich zu Adena und erzählte ihr, dass ich reiten lernen würde. Ich tat mein Bestes, um die Euphorie zu verbergen, die sich meiner bemächtigt hatte. Aber Adena merkte natürlich, wie es um mich bestellt war.
»Du hast bloß Pferde im Kopf«, sagte sie und verdrehte die Augen.
»Und du Jungs«, gab ich zurück.
»Weil ich kein Kind mehr bin«, bemerkte sie schnippisch.
Ich wollte auch kein Kind mehr sein, aber ich sah immer noch aus wie eins. Da war nichts zu machen.
Der Sommer zog ins Land. Er roch nach Salbei, der an manchen Stellen so dicht wuchs, dass die Prärie wie ein silbern schimmerndes Meer aussah. Die Ferien begannen Anfang Juni und ich fieberte meiner ersten Reitstunde entgegen. Alles war abgesprochen. Dad würde mich zu Tom bringen, hatte verschiedene Dinge in Manderson zu erledigen und wollte mich dann wieder abholen.
Er setzte mich gleich an der Straße ab, an der Einfahrt zu den Häusern von Tante Charlene und Tom Thunderhawk. Als ich zur Scheune kam, wartete Tom schon auf mich. Er hatte Psitó, eine brave alte Stute für mich ausgesucht, eine von den braun gefleckten, die kein Fohlen hatte. Psitó bedeutet Perle und die Stute machte ihrem Namen alle Ehre. Dass sie mich kannte, mit meiner Stimme und meinem Geruch vertraut war, erwies sich als großer Vorteil.
»Sitz gerade und bleib locker«, sagte Tom, als ich auf Psitós Rücken im Sattel saß. Er stellte die Steigbügel nach der Länge meiner Beine ein, und als ich ihm zunickte, schnalzte er mit der Zunge und sagte: »Hoka hey,auf geht’s!«
Nun saß ich zwar nicht zum ersten Mal auf einem Pferderücken, aber das letzte Mal war lange her. Ich musste mich erst wieder an das Gefühl gewöhnen, von einem Tier getragen zu werden, das so viel größer war als ich.
Ich lehnte mich leicht nach vorn. Der riesige Pferdekörper schaukelte unter mir, als Psitó sich in Bewegung setzte. Ich war ein Fliegengewicht und die Stute ganz andere Lasten gewohnt. Das verunsicherte sie für einen Augenblick, aber dann merkte sie, dass sie sich nach meinem Willen zu richten hatte.
»Versuche mit ihren Bewegungen mitzugehen, aber zeige ihr deutlich, wer das Sagen hat.« Tom führte die Stute im Kreis, beobachtete mich und gab mir Hinweise. Die meisten Dinge musste er mir nur einmal sagen, denn meine Bewegungen glichen sich ganz von selbst denen der braunen Stute an. Es war ein herrliches Gefühl.
Ich lernte, die Stute loslaufen zu lassen, sie zum Stehen zu bringen und die Richtung ändern zu lassen. Zuletzt zeigte mir Tom, wie ich sie durch leichten Schenkeldruck im Trab laufen lassen konnte. Psitó war gut ausgebildet, und weil ich ihr nichts durchgehen ließ, gehorchte sie meinen Befehlen.
Irgendwann kam mein Dad mit dem Pick-up vor Charlenes Haus gefahren. Ich sah, wie er am Ford-Combi meiner Tante bastelte, und winkte ihm zu. Später kam er herüber, lehnte sich mit den Ellenbogen auf die Koppelstange und sah mir noch eine Weile zu. »Wie macht sie sich denn?«, fragte er Tom.
»Sieht so aus, als wäre deine Tochter ein Naturtalent«, sagte Thunderhawk. »Aus ihr wird ganz sicher mal einmal eine gute Reiterin.« Mir schwoll die Brust vor Stolz und ich schämte mich dafür, denn Stolz ist keine Tugend bei uns Lakota. »Übe dich in Demut«, hatte Großvater Emmet immer gesagt, »denn Demut besiegt den Stolz.«


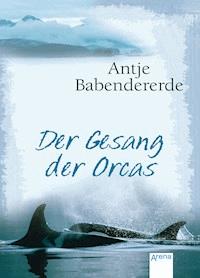
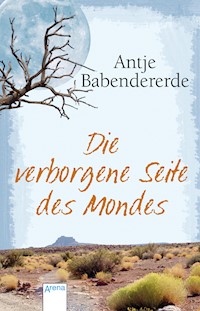


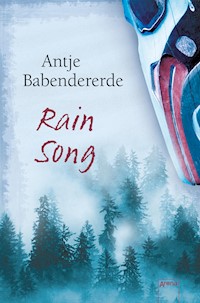

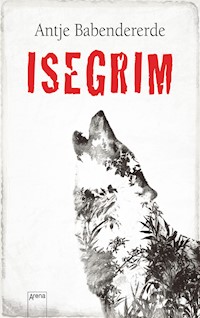

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)