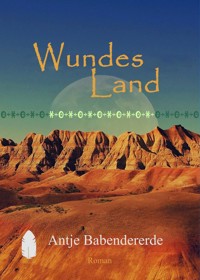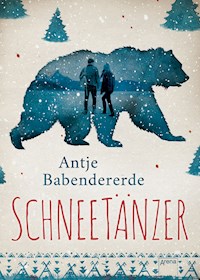Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goya libre
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
An einer Tankstelle am Highway begegnet Jodie dem jungen Indianer Jay zum ersten Mal. Ein paar Tage später ist sie mit ihm auf einer Reise, die ihr Leben verändern wird. Die beiden erleben einen Sommer voller Liebe und Magie inmitten der kanadischen Wildnis - und bald steht Jodie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antje Babendererde
Libellensommer
Veröffentlicht als E-Book 2010 © 2006 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Frauke Schneider unter Verwendung eines Fotos von Irene Teesalu Umschlagtypografie: KCS GmbH · Verlagsservice & Medienproduktion, Stelle/Hamburg E-Book-Umsetzung: CMS – Cross Media Solutions GmbH, Würzburg ISBN 978-3-401-80026-4
www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Den Wäldern dieser Erde gewidmet
Liebe ist ein Anfang, eine verborgene Wärme, die stärker, die lebendig wird; die Seele wendet sich in der Haut und öffnet die Augen.
Aus »Sonnenstaub« von Linda Hogan
1.
Eigentlich hatte ich nichts gegen Indianer. Bis zu dem Tag, an dem mein Vater entlassen wurde. Die Indianer waren schuld daran, dass die Pappfabrik schließen musste. Und das alles nur wegen ein paar blöden Bäumen. Als ob es nicht genug davon geben würde.
Mit den Indianern fing alles an. Doch damals ahnte ich noch nicht, was mir bevorstand. Ein großes Abenteuer. Vielleicht ein bisschen zu groß für mich. Heute frage ich mich, wie viel wir von unserem Leben beeinflussen können und was vorherbestimmt ist. Eines weiß ich jedoch sicher: Es geschehen immer wieder Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als einen Weg zu finden, um damit fertig zu werden.
Klar, es war eine schwierige Zeit für unsere Familie. Aber mit ziemlicher Sicherheit waren wir nicht die Einzigen auf diesem Planeten, die es schwer hatten. Andere Familien hielten in schlimmen Zeiten fest zusammen, unsere schien immer mehr auseinanderzufallen. Es tat weh, das mit ansehen zu müssen, ohne etwas dagegen tun zu können.
Auch an diesem Abend drang das Geschrei aus dem Wohnzimmer durch den Flur bis in mein Zimmer. Meine Eltern stritten mal wieder. Ich wickelte mir das Kissen um den Kopf und presste die Arme auf meine Ohren. Aber es nützte nichts. Ich hörte es trotzdem.
Die Knie an die Brust gezogen, rollte ich mich in meinem Bett ganz klein zusammen. Wie ein Baby im Bauch seiner Mutter.
Manchmal wünschte ich mich dahin zurück. Natürlich erinnere ich mich nicht daran, wie es dort war; ich glaube, das kann niemand. Aber warm und sicher war es bestimmt, und ich weiß, dass meine Eltern damals noch nicht so viel stritten.
Das begann erst vor ein paar Monaten. Jahrelang hatte mein Vater in einer großen Pappfabrik gearbeitet und dort gut verdient. Aber dann wehrte sich auf einmal irgendein kleines Indianervolk gegen die Abholzung der Wälder, auf die es angeblich Anspruch hatte. Die Indianer nahmen sich einen Anwalt, und plötzlich waren die Zeitungen voll von Boykottaufrufen gegen den kanadischen PapierkonzernPapermill, der das Holz aus ihren Wäldern holte und an Dads Pappfabrik lieferte.
Es passierte, womit zunächst keiner gerechnet hatte: Der Boykott funktionierte. Viele Leute waren empört über die Ungerechtigkeit gegenüber den Ureinwohnern. Sie kauften nicht mehr bei den Fastfood-Ketten, die Produkte aus Dads Fabrik verwendeten. Die Firma musste schließen.
Nach der Schließung der Pappfabrik waren in Thunder Bay mit einem Schlag hundert Männer und Frauen auf Arbeitssuche, und nur einige wenige von ihnen hatten Glück und bekamen einen Job.
Mein Dad hatte kein Glück. In der Fabrik hatte er komplizierte Maschinen bedient, er war ein hoch qualifizierter Facharbeiter, für den es nun keine Verwendung mehr gab. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf dem Sozialamt zu melden.
Jemand zerrte an meinem Kissen. Ich spürte eine warme Hand auf meinem Arm und nahm unwillig das Kissen vom Kopf.
»Jodie, ich kann nicht schlafen bei diesem Krach.« Es war Nicci. Meine fünf Jahre jüngere Schwester hockte neben mir und sah mich mit müden Augen an. »Kann ich mit in dein Bett kommen? Ich hab Angst, wenn sie so laut sind.«
Ich seufzte leise. Schließlich hob ich die Bettdecke hoch, rutschteein Stück zur Seite und ließ Nicci darunterschlüpfen. Sie kuschelte sich an mich, ich nahm sie in die Arme.
»Wovon soll ich die Familie ernähren, wenn du alles versäufst?«, hörte ich meine Mutter schreien. Inzwischen waren unsere Eltern nicht mehr im Wohnzimmer, sondern auf dem Flur. Es kam mir so vor, als würden sie direkt neben meinem Bett stehen.
»Hör endlich auf mit deinen verdammten Vorwürfen, Maggie«, sagte mein Vater, »ich halte das bald nicht mehr aus. Es ist nicht meine Schuld, dass ich den Job verloren habe, und ich kann auch nichts dafür, dass ich keinen neuen finde.«
Dad schrie nicht, trotzdem konnte ich jedes seiner Worte ganz deutlich hören. Er war angetrunken, aber ich begriff, wie unglücklich es ihn machte, dass alles so gekommen war.
»Nein«, rief meine Mutter aufgebracht, »das ist nicht deine Schuld. Aber du musst nicht das bisschen Geld, das wir zum Leben haben, auch noch in die Kneipe tragen. Du bist schließlich verantwortlich für uns.«
Ich lauschte angstvoll auf ihre Stimmen und fragte mich, wann es bei uns zu Hause so laut geworden war.
Am Anfang war es noch nicht so schlimm gewesen. Dad kümmerte sich um den Haushalt, kaufte ein und machte mit Nicci Hausaufgaben. Meine Mom hatte einen Job imBig Thunder, einem Fastfood-Restaurant bekommen, aber sie hasste es, den ganzen Tag in der nach ranzigem Fett stinkenden Küche zu stehen oder ungeduldige Menschen zu bedienen. Wenn sie am Abend geschafft nach Hause kam, war ihre Laune dementsprechend mies.
Nach einiger Zeit hatte mein Vater Moms Nörgeleien satt. Er verschwand abends immer öfter in der Kneipe, wo er sich mit ein paar ehemaligen Arbeitskollegen traf, die arbeitslos waren wie er. Wenn er dann spät nach Hause kam, hatte er eine Alkoholfahne, und meine Mutter fing jedes Mal Streit an, wenn sie noch wach war.
Manchmal gingen dabei Dinge zu Bruch. Das war Mom. Sie konntefurchtbar sein, wenn sie wütend war. Und in letzter Zeit war sie fast nur noch wütend.
»Ich erkenne dich nicht wieder, George.« Die Stimme schrillte durch unsere winzige Sozialwohnung, in die wir vor zwei Monaten gezogen waren.
»Ich dich auch nicht, Maggie«, erwiderte Dad. »Bestimmt sind die Mädchen wach geworden von deinem Geschrei. Was müssen sie denken, wenn sie uns ständig streiten hören?«
»Was kümmern dich die Mädchen, du machst dir doch sonst auch keine Gedanken darum, wie es ihnen geht.«
Das war ein harter Vorwurf, und vor allem stimmte er nicht. Normalerweise war es meine Mutter, die wenig davon mitbekam, was mir oder Nicci wichtig war. Dad machte sich sehr wohl Gedanken, wie es uns ging. Er nörgelte nicht oder kritisierte an mir herum, weil ich zu dick war. Ich konnte gut mit ihm reden. Viel besser als mit meiner Mutter, die immer gleich schrecklich aufbrausend war, wenn ihr etwas gegen den Strich ging.
Dad hatte meistens Verständnis, auch wenn ihm eine Sache mal nicht passte. Er war geduldiger als Mom, und ich liebte seinen Humor. Der war allerdings in den letzten Wochen kaum noch zum Vorschein gekommen. Die meiste Zeit lief er mit traurigen Augen herum, etwas, das einem auf Dauer Angst machen konnte.
Plötzlich schlug die Wohnungstür zu, und für einen Augenblick war es furchtbar still. Kurze Zeit später hörte ich meine Mutter weinen und merkte, dass auch Niccis Körper von kleinen Schluchzern geschüttelt wurde.
»Schschsch«, flüsterte ich, »nicht weinen. Es wird alles gut werden, glaub mir. Dad findet bald einen neuen Job, dann können wir wieder ein Haus mieten und Cookie zurückholen.«
Cookie war unser kleiner Mischlingshund, den wir zu Bekanntenhatten geben müssen, als wir aus unserem Haus in den Block mit den Sozialwohnungen gezogen waren. Ich vermisste Cookie, aber Nicci vermisste ihn noch mehr. Die beiden waren unzertrennlich gewesen. Seit sie den Hund nicht mehr hatte, war sie noch quengliger geworden.
Langsam beruhigte Nicci sich und hörte auf zu schluchzen. Ich weiß nicht, ob meine kleine Schwester mir glaubte. Wo ich doch selbst nicht so recht an das glauben konnte, was ich gesagt hatte. Schon bald hörte ich sie gleichmäßig atmen. Sie war eingeschlafen.
Vorsichtig, um meine Schwester nicht zu wecken, stand ich auf und legte mich in ihr Bett. Wir beide teilten uns ein winziges Zimmer von vier mal vier Metern, was eine ziemliche Katastrophe war. Überall lagen Niccis Sachen herum, und für meine war kein Platz mehr.
Ich zog die Bettdecke über den Kopf und versuchte, die Gedanken daran, wie es weitergehen sollte, für ein paar Stunden von mir zu schieben. Ich schaltete um auf träumen. Darin war ich Meisterin, und das nicht nur in der Nacht. Tagträume waren meine Spezialität. Aber nachts, wenn alles dunkel und still war (wennes denn still war), ließ es sich am besten träumen.
Es passierte automatisch, ohne dass ich es wollte. Wenn es mir schlecht ging, waren es meine Träume, die mir halfen. Die Welt in meinem Kopf war um so vieles aufregender als das, was in meinem wirklichen Leben passierte. Und so viel tröstlicher. Ich war die Heldin schillernder Abenteuer in verschiedenen Zeitepochen und auf anderen Erdteilen. Natürlich hatte ich auch einen Helden. Er hieß Tim, hatte braune Locken und blaue Augen. Und Muskeln, klar. Er rettete mich aus jeder noch so verzwickten Situation, und ich liebte ihn dafür von ganzem Herzen.
Tim gab es wirklich. Ich hatte ein Foto von ihm. Und unzählige wunderschöne E-Mails.
2.
Ich hatte Tim im Internet kennengelernt. Vor einem Jahr war ich einer Gruppe von Tierschützern beigetreten, die sichHeart for Animalsnannte, und für zwei Wochen war ich sogar Vegetarierin gewesen. Ich verschickte Petitionen gegen den Walfang, den Abschuss von Wölfen und das Abschlachten von Robbenbabys.
Eines Tages war ich beim Chatten und Unterschriftensammeln auf einen Jungen gestoßen, der über all diese Dinge gut Bescheid wusste und mit dem ich mich ausgiebig darüber unterhalten konnte. Zum Beispiel, wie die Japaner unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Forschung das Walfangverbot umgingen. Oder dass Wölfe und Berglöwen auch weiterhin von Jägern abgeschossen wurden, obwohl sie zu den bedrohten Tierarten gehörten. Dass jährlich am St.-Lorenz-Strom 300 000 Robbenbabys brutal abgeschlachtet wurden, nur um an ihr weiches weißes Fell zu kommen, während ihre blutigen, kleinen Körper einfach liegen gelassen wurden.
Es stellte sich heraus, dass Tim in Sudbury lebte, einer Stadt, die fast 1000 Kilometer östlich von Thunder Bay lag. Tim war schon 18. Er machte eine Ausbildung zum Automechaniker, hatte eine eigene Wohnung, und ich verstand mich wunderbar mit ihm.
Keine Ahnung, was er an mir fand, aber schon nach ein paar Wochen verließen wir den Chatroom und schickten uns regelmäßig E-Mails, die nicht nur gefährdete Tierarten zum Thema hatten.
Im Unterschied zu den Jungs aus meiner Klasse war Tim viel reifer und verständnisvoller. Er ging auf das ein, was ich ihm schrieb. Er war witzig und charmant und machte mir Komplimente, und nachdem das Eis einmal gebrochen war, flirteten wir hemmungslos.
Als er mir schließlich per E-Mail ein Foto von sich schickte, war esendgültig um mich geschehen. Er hatte braune Locken (die sich bestimmt wunderbar weich anfühlten), große blaue Augen und ein strahlendes Lächeln. Ich konnte nicht fassen, dass er seine Zeit für mich opferte, wo er doch jede haben konnte, so toll, wie er aussah.
Leider wünschte sich Tim nun auch ein Foto von mir und stürzte mich mit seiner Bitte in eine große Krise. Denn Tim Webster wusste zwar eine Menge über mich, aber ein paar Dinge hatte ich ihm auch verschwiegen. Zum Beispiel mein Körpergewicht.
Manchmal, wenn ich meine Mutter und mich auf Fotos betrachtete, konnte ich nicht glauben, dass wir verwandt waren. Mom war zierlich und schlank, hatte lange Beine, strahlend blaue Augen und naturblondes Haar. Die Männer sahen ihr auf der Straße hinterher, und mein Dad war stolz darauf, so eine schöne Frau zu haben.
Ich hatte von meiner Mutter nur die Haarfarbe geerbt, sonst nichts. Ihre Haare waren glatt und glänzten, meine kringelten sich wie wild, sodass ich sie kaum bändigen konnte. Meine Augen waren grau wie der Himmel an einem trüben Tag im November, und von Moms Figur konnte ich nur träumen. In Niccis Alter war ich noch spillerig gewesen, genau wie meine kleine Schwester jetzt. Aber dann legte ich plötzlich zu. Seit drei Jahren musste ich einen BH tragen, und in der Körbchengröße hatte ich meine Mutter bereits übertroffen. Alles an mir war rund und weich, und jeder Versuch, eine Diät zu machen, scheiterte meist schon am ersten Abend. Ich aß einfach zu gerne Süßes. Eiscreme und Schokoriegel waren mein Verhängnis.
Früher war Mom immer darauf bedacht gewesen, dass unsere Familie sich gesund ernährte. Aber nun musste sie jeden Dollar dreimal umdrehen, und beim Einkaufen kam es vor allem darauf an, dass wir satt wurden. Manchmal brachte sie Reste aus dem Restaurant mit, übrig gebliebene Hamburger und Würstchen, die unseren eintönigen Speiseplan ergänzten.
So war ich noch ein bisschen dicker geworden und hatte, weil dasnicht reichte, eine schlechte Haut bekommen. Pickel auf der Stirn und am Kinn, die zu den unpassendsten Zeitpunkten hässlich aufblühten.
All das hatte ich Tim natürlich verschwiegen, aber als er beharrlich nach einem Foto fragte, machte ich mich auf die Suche und fand eins, auf dem ich ganz passabel getroffen war. Der Fotograf hatte mich leicht von der Seite aufgenommen, sodass mein Profil zur Geltung kam, das Gesicht schmaler wirkte. (Das Foto war vom letzten Sommer, da war es mit den Pickeln noch nicht so schlimm gewesen.)
Ich konnte es kaum fassen, als Tim mir zurückschrieb, dass er mich süß fände. Und meine Träume von uns beiden, ob am Tag oder in der Nacht, waren von nun an in die rosigsten Farben getaucht.
Auch in jener Nacht, nachdem mein Vater die Wohnungstür mit einem unversöhnlichen Knall zugeschlagen hatte und Nicci sich im Bett nebenan unruhig hin und her wälzte, war es Tim, der mich rettete.
Diesmal träumte ich nicht von längst vergangenen Zeiten und reiste auch nicht in ferne Länder. Mein Traum spielte im Hier und Jetzt, denn ich machte mich auf den Weg, Tim zu besuchen. (Schließlich waren bald Sommerferien.) Am schönsten war der Moment, als ich klingelte und er die Tür öffnete. Gleich darauf lagen wir einander in den Armen, und er küsste mich. Was für ein Kuss! Konnte man so etwas träumen?
Am nächsten Morgen erwachte ich unausgeschlafen, und der Tag in der Schule wurde zur Qual. Nicht mal meine beste Freundin Marla schaffte es, mich etwas aufzumuntern, und ich war froh, als ich endlich nach Hause gehen konnte.
Dad war nicht da. Er hatte kein Essen für Nicci und mich vorbereitet, aber ich dachte mir nichts dabei. Das war in letzter Zeit häufig vorgekommen. Er suchte ja Arbeit, vielleicht hatte er irgendwo ein Vorstellungsgespräch.
Ich machte Pfannkuchen mit Ahornsirup für meine Schwester und mich. Nachdem wir gegessen hatten, ging ich in unser winziges Zimmer, setzte mich an den Laptop und checkte meine E-Mails. Tim hatte geschrieben. Mit klopfendem Herzen öffnete ich die Mail. Gestern hatte ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, mich in den Ferien zu besuchen. Mein Verstand sagte mir zwar, dass mein Traum von letzter Nacht nicht Wirklichkeit werden konnte,(schließlich war ich erst 15, und meine Eltern würden mir nicht erlauben, Tim in Sudbury zu besuchen), aber ich hoffte, er würde stattdessen zu mir nach Thunder Bay kommen.
Natürlich konnte er nicht bei uns wohnen, aus Platzgründen und auch weil Mom und Dad es nicht zugelassen hätten. Aber es gab ein preiswertes Hostel in der Stadt, und ich würde ihm dort eine Übernachtung reservieren. Wir könnten uns tagsüber sehen, über neue Aktionen beraten und alles Mögliche gemeinsam unternehmen. Einer, der ein Herz für Tiere hatte, konnte bestimmt wunderbar küssen.
Doch ich wurde enttäuscht. Tim schrieb, dass er gerne kommen würde, er aber demnächst seine alte Großmutter betreuen müsse, weil seine Eltern für ein paar Wochen nach Europa reisen wollten. Ich wusste, dass er eine Großmutter hatte. Sie hieß Louise und wohnte im Haus seiner Eltern. Tims Eltern schwärmten für geschichtsträchtige Orte wie Florenz, Rom, Venedig. Auch das wusste ich. Aber die Reise kam doch etwas plötzlich, davon hatte er mir bisher gar nichts erzählt.
Mutlos schloss ich das Programm. Wenn Tim auch nur für drei Tage gekommen wäre, hätte ich die endlosen Ferienwochen vorprogrammierte Langeweile klaglos in Kauf genommen. An Familienurlaub war nämlich nicht zu denken, so groß, wie das Loch in unserer Haushaltskasse war. Ich konnte etwas mit Marla unternehmen, aber spätestens im August, wenn sie mit ihren Eltern verreiste, würde ich dasitzen und Trübsal blasen.
Meine Laune verschlechterte sich schlagartig. Nicci spielte mit ihren Puppen, sprach mit verstellter Stimme und ging mir furchtbar auf die Nerven. Ich warf ihr einen so bösen Blick zu, dass sie es vorzog, aus dem Zimmer zu verschwinden und sich vor den Fernseher zu setzen.
Ich war froh darüber, denn so sah sie nicht, dass ich vor Wut und Enttäuschung zu heulen anfing.
Am Abend kam Mom geschafft nach Hause. Sie hatte kalte Hamburger aus dem Restaurant mitgebracht, die wir in der Mikrowelle aufwärmten. Nicci und ich kümmerten uns um das Essen, aber Dads Platz am Tisch blieb leer. Mom war schweigsam und hatte dunkle Ringe unter den Augen. Ich wagte nicht, sie zu fragen, aber Nicci tat es.
»Wo ist Dad, Mommy? Warum isst er nicht mit uns?«
»Ich weiß es nicht, Nicci«, antwortete sie müde. »Ich weiß nicht, wo Dad ist.«
Erschrocken sah ich meine Mutter an. »Was heißt, du weißt nicht, wo er ist?«
»Euer Vater ist in der Nacht nicht nach Hause gekommen. Und wie es aussieht, war er heute Vormittag in der Wohnung und hat ein paar Sachen geholt.«
»Dad ist weg?«, rief ich. »Er hat uns einfach so verlassen?« Ich wollte das nicht glauben. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen, und ich kriegte den Bissen kaum hinunter, den ich im Mund hatte.
Nicci fing an zu heulen.
»Wir werden schon zurechtkommen«, sagte meine Mutter. »Wir drei müssen jetzt zusammenhalten.«
Das Messer fiel mir aus der Hand und kam klirrend auf dem Teller auf. Ich sprang auf, rannte in mein Zimmer und schlug die Tür hinter mir zu. Das Gesicht ins Kopfkissen gepresst, wartete ich auf Tränen, aber sie kamen nicht. Mom hatte Dad mit ihrem Geschrei, ihrerschlechten Laune und ihren ewigen Vorwürfen fortgetrieben. Und nun ging sie über die Tatsache, dass er nicht mehr da war, mit einer Leichtigkeit hinweg, die mich wütend machte.
Dad hatte immer für uns gesorgt. Und jetzt, wo er nicht dazu in der Lage war, schien es meiner Mutter recht zu sein, dass er fort war. Wie konnte sie bloß so schnell den Glauben an ihn verlieren?
War das Liebe? Ich begriff die Welt nicht mehr.
Irgendwann kam Nicci ins Zimmer und setzte sich auf mein Bett. »Mommy sagt, er kommt wieder.«
Ich hörte die Zweifel in ihrer Stimme, hatte aber keine Lust, sie zu beruhigen. Mich tröstete auch niemand. »Das werden wir ja sehen«, erwiderte ich, stand auf und ging ins Badezimmer. Als ich wiederkam, lag Nicci brav in ihrem Bett und hatte Cookie im Arm (den aus Plüsch). Es ging ihr nicht gut. Sie vermisste ihren Dad genau so wie ich. Trotzdem legte ich mich in mein Bett und löschte das Licht, ohne meiner kleinen Schwester eine gute Nacht zu wünschen.
Irgendwie rettete ich mich über die nächsten Tage. Dad kam nicht zurück, und wir wussten auch nicht, wo er war. Mom wurde immer unausstehlicher, Nicci quengelte, und meine Laune verschlechterte sich stündlich.
Die meiste Zeit flüchtete ich mich zu Marla. Sie war nicht nur meine beste Freundin, sondern auch die erfolgreichste Seelentrösterin, die ich kannte. Marla war eine Bohnenstange mit glatten schwarzen Haaren und auch sonst das ganze Gegenteil von mir. Ich hatte viele Fragen, sie auf alles eine Antwort. Ich war neugierig, sie vorsichtig. Ich war chaotisch, sie ordentlich. Marla stand stets mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen, während ich die größere Hälfte des Tages träumte.
Manchmal sprachen wir darüber, eins zu werden, das Ganze dann lange und heftig zu schütteln, um es danach wieder in zwei Hälften zu teilen. Herauskommen würden zwei perfekte Mädchen, denensämtliche Jungs von Thunder Bay hinterherschauen würden. Aber das waren natürlich nur Hirngespinste. Marla war Marla und Jodie war Jodie. Da ließ sich nichts machen.
Marla versuchte alles Mögliche, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Wir schlenderten durch die Geschäfte und probierten die neueste Mode. Lauter Dinge, die wir uns nicht leisten konnten. Beinahe jeden Tag gingen wir nach der Schule ins Freibad, lagen auf der Wiese, und Marla hörte mir zu, wenn ich immer wieder die gleichen Fragen stellte.
Aber irgendwann wurde ihr meine schlechte Laune zu viel, und sie stauchte mich nach allen Regeln der Kunst zusammen. Das war am letzten Schultag vor den großen Ferien, und erstaunlicherweise zeigte ihre Standpauke Wirkung. Ich beschloss, die Ferien zu genießen, auch wenn sie nicht so werden würden, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und ich wollte auf der Stelle damit anfangen.
3.
Um meinen Entschluss in die Tat umzusetzen, feierten Marla und ich den ersten Ferientag im Sleeping Giant Café, wo es die gigantischsten Eisbecher aller Zeiten gab. Die Sonne brannte vom Himmel, kein Wölkchen war zu sehen.
Die Terrasse des Cafés war voll besetzt. Aber wir hatten alle Zeit der Welt und warteten, bis zwei Plätze frei wurden. Von hier aus hatten wir einen schönen Blick auf den Lake Superior und den Sleeping Giant, eine lang gezogene Halbinsel, das Wahrzeichen von Thunder Bay.
Seinen Namen hatte die felsige Halbinsel von den Ojibwa-Indianern bekommen, weil sie in ihrer Form an einen schlafenden Riesen erinnerte. In unserer Klasse gab es zwei Ojibwa-Mädchen, Lisa und Theresa, die uns einmal im Geschichtsunterricht die Legende vom Schlafenden Riesen erzählt hatten.
Nanna Bijou, der Geist des Tiefen Wassers, hatte einem Ojibwa-Stamm den Weg zu einer reichen Silbermine gezeigt, als Belohnung für ihren Fleiß, ihr friedvolles Leben und ihre Güte. Er gebot ihnen, das Geheimnis niemals an die Weißen zu verraten, sonst würde er zu Stein.
Die Ojibwa wurden schnell reich und berühmt für ihre kunstvollen Silberornamente. Bald benahmen sie sich überheblich und gingen leichtfertig mit ihrem Geheimnis um. Ein betrunkener Indianer verriet den Weg zur Silbermine an die Weißen, und die Prophezeiung bewahrheitete sich:Nanna Bijouwurde zu Stein.
Schon merkwürdig: Wir Weißen redeten schlecht über die Indianer, und die Indianer dachten nichts Gutes über uns Weiße. Es gab eine ganze Menge Indianer in Thunder Bay, auch in unserem Block lebten welche. Aber ich hatte nie etwas mit ihnen zu tun. Es schien, als würden Weiße und Ureinwohner in einer Art Parallelwelt leben. Selbst mit den beiden Ojibwa-Mädchen aus meiner Klasse hatte ich bisher kaum mehr als ein paar belanglose Sätze gewechselt.
»Was denkst du?«, fragte Marla.
»Ach nichts«, erwiderte ich.
»Träumerin.« Kopfschüttelnd verdrehte sie ihre eidechsengrünen Augen.
Endlich wurden unsere Eisbecher gebracht. Vor mir stand ein eleganter Turm aus Schokoladeneiskugeln, Schlagsahne und glänzender Schokosoße.
»Na, dann mal los.« Marla hatte einen Früchtebecher mit frischen Erdbeeren bestellt, auf dem ein glimmerndes Schirmchen steckte. Sie griff nach dem Löffel. »Auf die Ferien!«
»Auf die Ferien«, sagte ich.
Einfach himmlisch, so ein Schokoladeneis mit Sahne. Es gab Menschen, die konnten Dingen widerstehen, von denen sie wussten, dass sie nicht gut für sie waren. Ich nicht. Zwar plagte mich für einen Augenblick das schlechte Gewissen, aber dann gab ich mich ganz ungeniert der köstlich schokoladigen Kälte auf meiner Zunge hin.
»Hmmm«, seufzte ich und schloss genüsslich die Augen, »so ähnlich muss küssen sein. Küssen mit Tim.«
Marla lachte. »Dann solltest du lieber küssen, statt Eisbecher zu essen. Ein Zungenkuss verbraucht nämlich eine Menge Kalorien. Küssen ist besser als jede Diät.«
Was Marla alles wusste! Dabei war es pure Theorie, denn im Gegensatz zu mir war Marla noch ungeküsst. Mein erstes Mund-zuMund-Erlebnis mit einem Jungen war allerdings auch nicht sonderlich berauschend gewesen. Küssen mit Philip Ashley war wie eine tote Schnecke im Salat. Ashley ging schon in die Zehnte und hatte vor einiger Zeit Interesse an mir bekundet. Eines Tages hatte ich seinem Drängen nachgegeben, einfach, weil ich es endlich wissen wollte. Das war ein Fehler gewesen. Er hatte mir seine Zunge in den Mund geschoben und dann nicht mehr weitergewusst. Sie lag wie etwas Totes zwischen meinen Zähnen. Ich hatte kaum noch Luft bekommen und zugebissen, weil ich seine Zunge wieder loswerden wollte. Philip hatte einige Tage Schwierigkeiten mit dem Sprechen gehabt und überall herumerzählt, dass es lebensgefährlich sei, mir zu nahe zu kommen.
Marla und ich redeten viel über Sex, wobei unser Mangel an Erfahrung durch übergroße Fantasie ersetzt wurde. Während ich dem ersten Mal mit fieberhafter Neugier entgegensah (natürlich mit Tim), hatte Marla allerhand Bedenken. »Wenn du es zudergroßen Sache machst, die dein Leben verändern soll«, sagte sie, »wirst du enttäuscht sein.«
Woher sie diese geniale Weisheit wohl hatte?
Natürlich fantasierten wir stets nur ins Blaue hinein, denn Sex war bei Weitem kein akutes Problem bei uns. Marla hatte keinen Freundund war nur theoretisch bestens informiert. Ich hatte Tim, aber der lebte fast 1000 km von mir entfernt (sozusagen auf einem anderen Stern). Für mich war klar, dass er es sein sollte, mit dem ich mein erstes Mal erlebte. Er meinte es ernst mit mir, da war ich mir sicher. Ich würde mich eben noch eine Weile gedulden müssen.
Wenigstens hatte ich jemanden, von dem ich träumen konnte.
Es wurde ein perfekter Tag für uns beide. Marla und ich löffelten unser Eis, wir lachten viel, und ein bisschen war es wie früher, als alles noch in Ordnung war. Aber das änderte sich schlagartig, als ich nach Hause kam. Ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Mom hatte einen schuldbewussten Ausdruck in den Augen, und Nicci schlich in der Wohnung herum wie ein Geist, dem die Tarnkappe abhanden gekommen war.
»Was ist denn los?«, fragte ich. »Ist was mit Dad?«
Meine Mutter schüttelte den Kopf. »Mein Auto ging heute auf dem Weg zur Arbeit kaputt, ich bin ziemlich fertig.«
Moms alter Nissan war eine Schrottkiste und gab ständig seinen Geist auf. Das war keineswegs eine umwerfende Neuigkeit. Achselzuckend verzog ich mich in mein Zimmer, doch kaum hatte ich es betreten, erstarrte ich vor Schreck. Das war doch...Das konnte sie mir nicht antun...Mir blieb fast das Herz stehen: Mein Laptop war weg.
Ich lief in die Küche. »Mom?«
Sie stand rücklings gegen die Spüle gelehnt, ein Glas mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit in der Hand. »Ich wusste nicht, wie ich die Reparatur bezahlen sollte, Jodie. Es tut mir leid. Aber wir müssen alle verzichten.«
»Verzichten?«, rief ich. »Du hättest mich wenigstens fragen können.«
»Es ist Dads Laptop, Jodie, nicht deiner.«
»Dann hättest du eben Dad fragen müssen.« Ich kriegte kaum Luft vor Wut, und Tränen standen in meinen Augen.
»Dad ist nicht da.« Nun schrie Mom.
»Ja, weilduihn weggetrieben hast. Mit deinen ständigen Nörgeleien bist du ihm so auf die Nerven gegangen, dass er es nicht mehr bei uns ausgehalten hat. Du bist an allem schuld«, schrie ich zurück, »und bist doch nicht viel besser als er, wenn du jetzt auch noch anfängst zu trinken.«
Im selben Augenblick erntete ich eine schallende Ohrfeige.
Voller Entsetzen starrte ich meine Mutter an, durch einen trüben Tränenschleier hindurch. Meine Wange brannte wie Feuer, mir wurde so übel, dass ich schwankte. Das hatte meine Mutter noch nie getan: mich geschlagen.
Ich konnte sehen, wie erschrocken sie war, aber das tröstete mich wenig. Wortlos drehte ich mich um und ging in mein Zimmer, wo ich eilig ein paar Sachen zusammensuchte und in meinen Rucksack stopfte.
»Wo willst du denn hin?«, fragte Nicci mit kläglicher Stimme.
»Zu Marla. Ich schlafe heute bei ihr.«
Als ich wieder aus dem Zimmer kam, stand Mom direkt vor der Tür. »Es tut mir leid, Jodie, ich wollte das nicht. Die Nerven sind mit mir durchgegangen.«
Ich schob sie zur Seite und verließ die Wohnung. Mit einem Krachen fiel die Tür hinter mir ins Schloss.
Marla guckte verdattert, als ich mit verheulten Augen und meinem
Rucksack vor ihrer Tür stand. Sie zog mich ins Haus.
»Ich haue ab«, sagte ich.
»Was?«
»Ich gehe weg, gleich morgen.«
»Aber warum? Und wo willst du denn hin, Jodie?«
Ich erzählte ihr alles, und sie hörte stumm zu. Als ich fertig war, sagte sie: »Tu es nicht, Jodie.«
»War ja zu erwarten, dass du das sagen würdest. Aber mein Entschluss steht fest. Kann ich mal eine Mail schicken von deinem Computer?«
Sie zuckte die Achseln. »Ja, klar.«
Während Marla uns ein paar Sandwichs schmierte, schrieb ich eine Mail an Tim und fragte ihn, ob ich zu ihm kommen könnte. Ich hätte Zoff mit meiner Familie und bräuchte dringend etwas Abstand.
Zugegeben, abzuhauen war nicht sonderlich originell, Kids in meinem Alter machten das andauernd. Leider fiel mir im Augenblick nichts Besseres ein. Ich wollte meiner Mutter einen Denkzettel verpassen. Für ein paar Tage zu verschwinden, war zumindest eine wirksame Idee, wenn auch keine neue.
Drei Minuten, nachdem ich die Nachricht abgeschickt hatte, kam die Antwort. Klar könnte ich kommen, er freue sich und erwarte mich. Darunter stand die Anschrift seiner Eltern und die Telefonnummer.
Gleich ging es mir etwas besser. Marla kam mit den Sandwichs und zwei Gläsern Limonade. Sie war so kalt, dass mein Hals brannte. Hustend weihte ich Marla in meinen Plan ein.
»Und du bist dir sicher, dass du auch wirklich bei Tim wohnen kannst?« Wie skeptisch ihre Stimme klang. Und diese Falten auf ihrer Stirn . . .
»Ja. Er hat es mir angeboten. Er wartet auf mich. Ich kann dir seine E-Mail zeigen.«
»Ich dachte ja nur, dass du ihn überhaupt nicht richtig kennst . . .« Marla war jemand, der sich nichts vormachte. Ich dagegen schon.
»Wieso sollte ich ihn nicht kennen? Wir schreiben uns seit fast einem Jahr.«
»Ja, aber du bist ihm noch nie persönlich begegnet, hast ihn noch nicht mal am Telefon gesprochen.«
»Na und? Das kann ich ja jetzt machen.«
»Vielleicht solltest du das.«
Das klang beinahe beleidigt, aber irgendwie schien Marla begriffenzu haben, dass es mir ernst war. Ich ging nach draußen und wählte Tims Nummer, doch es meldete sich keiner. Als der Anrufbeantworter ansprang, legte ich auf. »Niemand da. Ich kann es ja später noch mal versuchen. Vielleicht ist er mit seiner Großmutter spazieren.«
Marla nickte, einen merkwürdigen Ausdruck in den Augen.
Mein Plan war, dass ich gleich am nächsten Morgen Thunder Bay mit dem Bus verlassen würde, nur ein Stück, bis Nipigon vielleicht, sodass ich aus der Stadt war, bevor ich mich an die Straße stellte und per Anhalter weiterfuhr. Für mehr reichte mein Geld nicht.
Mom würde mich frühestens am Nachmittag des nächsten Tages vermissen, so hatte ich genügend Vorsprung. Ich wollte ihr einen Brief schreiben, sie darin bitten, nicht die Polizei nach mir suchen zu lassen. Marla sollte den Brief bei uns in den Kasten stecken.
Die Nacht über schlief ich schlecht vor Aufregung, und am Morgen sah ich müde und blass aus. Für die Reise wählte ich mein blaues Lieblings-T-Shirt und die helle Khakihose mit den vielen Taschen. Danach packte ich meinen Rucksack noch einmal mit etwas mehr Sorgfalt, um zu sehen, was ich in der Eile hineingestopft hatte. Zwei Paar Socken, dreimal Unterwäsche, einen warmen Pullover, meine Jeans, den zu kleinen Bikini, einen Abdeckstift für die Pickel und meine Zahnbürste.
Als wir an der Bushaltestelle standen, versuchte Marla es ein letztes Mal.
»Bist du dir ganz sicher, Jodie?« Mit ihren großen grünen Augen sah sie mich an, den Blick voller Zweifel.
»Ja, ich bin ganz sicher«, antwortete ich mit fester Stimme. »Ich kann meiner Mutter nicht verzeihen, dass sie Dad mit ihren Nörgeleien aus dem Haus getrieben hat. Sie hat den Laptop verkauft und mich geschlagen.«Geschlagen–oh Mann, wie das klang. Aber die Ohrfeige war bitter gewesen. »Vielleicht denkt sie mal über ihre blöde Streiterei nach, wenn ich nicht mehr da bin.«
Marla umarmte mich spontan. »Ich mach mir Sorgen um dich, Jodie«, sagte sie, »aber ein bisschen beneide ich dich auch. Du wirst eine Menge erleben, das wette ich.«
»Ich rufe dich an, okay?«
»Ja, das musst du.«
»Und wenn sie dich fragen, sag ihnen, ich bin bei einem Freund. Sag einfach, ich hätte dir seinen Namen nicht verraten und auch nicht, wo er wohnt.«
»Versprochen.«
Ich schulterte meinen Rucksack und umarmte Marla noch einmal. »Mach’s gut«, sagte ich, einen dicken Kloß im Hals. »Und vergiss den Brief nicht.«
Sie nickte. »Viel Glück, Jodie. Und versprich mir, dass du wieder da bist, bevor ich in den Urlaub fahre.«
»Ist versprochen«, sagte ich und stieg in den Bus.
Ich sah aus dem Fenster, und als der Bus mit einem Ruck anfuhr, winkte ich Marla. Sie winkte zurück. Mir war auf einmal mulmig zumute, aber ich dachte, dass ich ja nur für ein paar Tage weg sein würde.
Schon bald beschlich mich das unangenehme Gefühl, man müsse mir ansehen, was ich vorhatte. Als ob in Leuchtbuchstaben auf meiner Stirn stand: »Hey Leute, ich bin dabei abzuhauen!« Aber niemand beachtete mich und meinen Rucksack. Schließlich waren Ferien.
Der Bus fuhr durch die Vororte von Thunder Bay, vorbei an riesigen Supermärkten, Tankstellen und Fastfood-Restaurants. Als wir amBig Thundervorbeikamen, in dem Mom arbeitete, befielen mich die Zweifel wie ein Bienenschwarm. Das schlechte Gewissen stach und zwickte überall, und ich dachte: Noch kannst du aussteigen, Jodie, und so tun, als wäre nichts gewesen.
Aber das wollte ich nicht. Ich wollte nicht feige sein. So schloss ichdie Augen und machte sie erst wieder auf, als wir raus waren aus der Stadt. Der Highway führte direkt am Lake Superior entlang, und seine glitzernde Wasseroberfläche funkelte wie eine wunderbare Verheißung.
Ich fuhr bis Nipigon, das war fürs Erste weit genug weg von Thun-der Bay. Hier teilte sich die Straße. Der Highway 17 führte weiter am Superior entlang über Sault Ste. Marie nach Sudbury. Der Highway 11 verlief nördlich über Longlac, Hearst und Smooth Rock Falls, aber die Entfernung war letztendlich die gleiche, und so war es egal, für welche Richtung ich mich entscheiden würde.
Auf einem Rastplatz mit Tankstelle fragte ich nach einer Mitfahrgelegenheit, natürlich nicht, ohne mir die Leute genau anzusehen, die ich ansprach. Marla hatte mich inständig gebeten, vorsichtig zu sein. So hielt ich nach Leuten Ausschau, die harmlos aussahen, mich aber auch nicht gleich an der nächsten Polizeistation abliefern würden.
Und ich hatte Glück. Ein junges Hippiepärchen war bereit, mich in seinem bunt bemalten VW-Bus mitzunehmen. Lilian und Ricky waren auf dem Weg von der Westküste zur Ostküste, eine Reise, für die sie den ganzen Sommer Zeit hatten. Ihr nächstes Ziel war Kormac, dort hatten sie Bekannte, bei denen sie eine Weile bleiben wollten.
Auf ihrem Bus stand mit dickem rotem Pinselstrich geschrieben:»Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann!«,und in Blau:»Wer einen Baum fällt, stört einen Stern.«
Die beiden waren Ökofreaks und hatten mit Sicherheit an der Boykottaktion gegen Dads Pappfabrik teilgenommen. Aber in meiner Situation konnte ich nicht wählerisch sein. Ricky (mit Spitzbärtchen und John-Lennon-Brille) zeigte mir Kormac auf der Karte, die ich bei mir hatte. Es war die nördliche Variante, und bevor sie vom Highway abbiegen mussten, würde ich schon fast in Hearst sein.
Ich stieg in ihren Bus.
Lilian fragte mich ein bisschen aus. Ich gab vor, schon siebzehn zu sein und auf dem Weg zu meiner Großmutter, bei der ich einen Teil der Ferien verbringen wollte. Ich log etwas zusammen von tollen, verständnisvollen Eltern, die früher selbst durch die Gegend getrampt seien und deshalb auch kein Problem damit hatten, wenn ich es tat.
Ich weiß nicht, ob die beiden mir glaubten. Auf jeden Fall gaben sie sich mit meiner Geschichte zufrieden und ließen mich in Ruhe. Ricky schob eine CD nach der anderen ein. Wir hörten Neil Young, die Stones, Bob Dylan und Jimi Hendrix. Ich kannte die meisten Songs, denn es war die Musik, die auch meine Eltern hörten. Jedenfalls früher, als sie noch gut drauf gewesen waren.
Ich erinnere mich an einen Abend, als sie ihre alten Platten aufgelegt und zu Neil Young getanzt hatten. Eng umschlungen zuHeart of Gold. Wie zwei frisch Verliebte. Das war noch vor der Schließung der Fabrik gewesen. »Stoppt Neil Young« hatten Nicci und ich im Chor gerufen und uns halb totgelacht.
Der Blick aus dem Fenster zeigte zu 90 Prozent Grün, nämlich endlose Wälder zu beiden Seiten der Straße. Die hypnotisierende Wirkung war verblüffend. Irgendwann wurde ich müde und nickte ein. Ich wachte erst wieder auf, als Lilian mich am Arm rüttelte.
»Hast du Lust, mit uns was essen zu gehen?«, fragte sie.
Wir machten Rast an einem Coffee Shop, und danach ging es gleich weiter. Ricky und Lilian wechselten sich mit dem Fahren ab. Wir erzählten und waren lustig, und bald hatte ich nicht mehr das Gefühl, zu Fremden ins Auto gestiegen zu sein. Ich lauschte gespannt, auch wenn hin und wieder etwas dabei war, das sich für meine Begriffe zu abgefahren anhörte.
Zum Beispiel, als Lilian behauptete, Bäume würden über elektrische Felder miteinander kommunizieren. »Man kann das mit einem speziellen Gerät messen«, erklärte sie. »Und wenn irgendwo in derNähe ein Baum gefällt wird, dann sind beim Testbaum heftige Reaktionen zu verzeichnen. Daran kann man sehen, was Bäume für empfindungsfähige Wesen sind.«
Irgendwann unterhielten sich die beiden über alte Freunde, und dabei muss ich wieder eingeschlafen sein. So tief und fest wie schon lange nicht mehr.
4.
Es war die Stille, die mich weckte. Das Motorengeräusch fehlte. Der Van stand, Lilian und Ricky schliefen zusammengekauert auf ihren Sitzen. Die Scheiben des Busses waren beschlagen, und als ich die Feuchtigkeit wegwischte, sah ich, dass wir uns auf einem kleinen Parkplatz befanden, ganz allein.
Ich stieg aus, davon wurden die beiden wach. Ein kurzer Blick auf meine Armbanduhr: Es war acht Uhr morgens, und die Sonne begann schon zu wärmen. Ich streckte mich und sah mich um. Bizarre weiße Wolkenfetzen hingen unbeweglich am Horizont, und die endlose Reihe sonnenbeschienener Tannenspitzen wurde nur durch das graue Asphaltband der Straße unterbrochen.
Die Morgenluft war würzig frisch, und auf dem großen Holztisch am Parkplatz jagten sich zwei kleine Streifenhörnchen, die vermutlich darauf warteten, dass wir endlich unser Frühstück auspackten.
Lilian stieg aus. Sie gähnte, und als sie die beiden Chipmunks sah, beugte sie sich noch einmal in den Van und holte eine offene Tüte Cornflakes hervor. Sie fütterte die drolligen Tiere, und wir sahen ihnen eine Weile zu, wie sie die Cornflakes zwischen ihren Pfötchen hielten und fraßen.
»Nicht weit von hier ist eine Raststätte«, sagte Lilian. »Da können wir frühstücken, und dann musst du dich nach einer anderen Mitfahrgelegenheit umsehen. Bald zweigt die Straße nach Kormac vom Highway ab.«
Es ging also weiter, bis zur Raststätte, wo die beiden mir ein Frühstück spendierten. Danach verabschiedeten wir uns.
Ricky umarmte mich, seine Bartstoppeln kratzten an meinem Kinn.
»Danke fürs Mitnehmen«, sagte ich.
Lilian umarmte mich auch. »Pass auf dich auf, Jodie, und steig nur zu freundlichen Menschen ins Auto, okay?«
»Mach ich«, erwiderte ich. »Und vielen Dank für alles.«
Die beiden stiegen in den Van, winkten und fuhren davon.
Ich sah mich an der Tankstelle um, wer für die Weiterfahrt infrage käme. Aber es war wohl noch zu früh am Morgen, denn ich fand niemanden, der gen Osten fuhr. So setzte ich mich auf meinen Rucksack und dachte an Mom und Nicci und an meinen Dad, von dem ich nicht wusste, ob er inzwischen wieder zu Hause war. Wenn nicht, wo schlief er dann? Wie ging es ihm? Ob wir ihm fehlten?
Heimweh hatte ich nicht, aber der Gedanke an meine Familie ließ Tränen in mir aufsteigen. Es kam mir so vor, als wäre ich schon tagelang unterwegs und nicht erst seit 24 Stunden. Die Gespräche mit Ricky und Lilian geisterten in meinem Kopf herum. So viele neue Gedanken, die wie Kugeln ins Rollen gekommen waren, sich an Hindernissen stießen und in immer neue Richtungen kullerten.
»Hey«, sagte plötzlich eine Männerstimme über mir, »suchst du eine Mitfahrgelegenheit?«
Ich sah abgewetzte braune Arbeitsstiefel vor mir und blickte an ausgewaschenen Jeans, einem schlabberigen grünen T-Shirt nach oben in ein wettergegerbtes, bärtiges Gesicht.
Der Mann grinste breit. »Wo willst du denn hin, Kleine?«
»Sudbury«, antwortete ich.
»Ich fahre bis Kapuskasing, muss dort eine Ladung Holz holen. Wenn du willst, kannst du mitkommen.«
Der Trucker hatte mein Zögern bemerkt, denn auf einmal wurde er ernst und meinte: »Schon richtig, dass du misstrauisch bist. So ein hübsches Mädchen wie du sollte nicht zu jedem ins Auto steigen. Aber vor mir brauchst du keine Angst haben. Ich hab selber eine Tochter in deinem Alter, und ich bin auch keiner, der sich an Kindern vergreift. Außerdem bin ich nicht allein, ich hab schon einen Mitfahrer.« Er zeigte auf einen metallic blauen Truck, vor dem ein Junge stand und rauchte. »Ich gehe jetzt noch einen Kaffee trinken, und du kannst dir überlegen, ob du mitwillst oder nicht. Ich heiße übrigens John.«
»Okay«, sagte ich. »Danke für das Angebot, John.«
Ich schulterte meinen Rucksack und lief hinüber zu dem Jungen. Er war älter als ich, mindestens 18 oder 19, und es sah so aus, als wäre er schon eine Weile unterwegs. Seine roten Haare standen verfilzt vom Kopf, und er hatte eine Menge Schlaf in den Augen. Wahrscheinlich hatte er sich am Morgen weder gewaschen noch die Zähne geputzt. Wenigstens lächelte er, als ich ihn ansprach.
»Hi, ich heiße Jodie. John hat mir angeboten, bis Kapuskasing mitzufahren.«
»Na, dann rein mit dir.«
»Und wie heißt du?«
»Kip.«
»Ist John okay, Kip?«, fragte ich.
»Na klar. Ich bin schon seit Thunder Bay mit ihm unterwegs.«
Als der Junge den Namen meiner Heimatstadt erwähnte, durchzuckte mich das schlechte Gewissen wie ein Blitz. Vielleicht hatte Mom meinen Brief schon gefunden? Ich rätselte, ob sie tun würde, worum ich sie gebeten hatte: nämlich nicht die Polizei zu informieren.
Kip nahm mir den Rucksack ab, und ich kletterte in die Fahrerkabine. Dann kam er nach. Als er so dicht neben mir saß, merkte ich, dass er ein bisschen roch, aber sein Lächeln machte das wiederwett. Wahrscheinlich hatte er nur eine Weile keine Gelegenheit gehabt, sich zu waschen.
»Bist du schon lange unterwegs?«, fragte ich ihn.
»Seit zwei Monaten.«
»Wow. Wo kommst du her?«
»Aus Colorado.«
Ein Amerikaner also. Ich hatte mir schon so etwas gedacht. »Und was machst du hier oben in Longlac?«
»Ich suche ein Mädchen, Tanya. Sie ist Kellnerin. Hab sie in Boulder kennengelernt. Sie war ganz allein unterwegs, und wir taten uns eine Weile zusammen. Eines Tages war sie auf einmal weg. Sie fehlte mir, und da wurde mir klar, dass ich mich verliebt hatte.« Er lächelte schief. »Ich weiß nur, dass sie aus Hearst kommt. Vielleicht finde ich sie dort. Oder wenigstens eine Spur von ihr.«
»Du hast den ganzen weiten Weg von Boulder hier rauf nach Kanada gemacht, obwohl du gar nicht weißt, ob diese Tanya auch was für dich übrig hat?« Ich sah Kip zweifelnd an.
Was würde das Mädchen wohl sagen, wenn er plötzlich vor ihrer Tür stand? So ungewaschen und zerzaust.
»Ja«, sagte er, »das habe ich. Wie sie sich auch entscheiden wird, wenn ich sie finde: Ich muss es wissen. Sie ist toll.« Er zog ein zerknittertes Foto aus seiner Hemdtasche und reichte es mir. Auf dem Foto war er Arm in Arm mit einem Mädchen zu sehen, das auf den ersten Blick völlig unscheinbar wirkte. Jedenfalls hatte ich etwas ganz anderes erwartet. Diese Tanya sah nicht aus wie eine, für die man Tausende Kilometer weit reiste. Aber dann nahm mich ihr Lachen doch gefangen, das Leuchten in ihren Augen. Und auf einmal verstand ich Kip.
»Hübsch«, sagte ich und gab es ihm zurück.
»Sie ist eine Wahnsinnsfrau.« Sein Blick verklärte sich.
In diesem Moment wurde mir plötzlich klar, was ich eigentlich vorhatte: Ich war unterwegs zu einem jungen Mann, den ich überhaupt nicht kannte, den ich nur auf einem Foto gesehen hatte. Kip war mit seiner Tanya richtig zusammen gewesen. Er hatte zwar keine Adresse, so wie ich, aber wenigstens einen Menschen aus Fleisch und Blut vor Augen.
War es verrückt, was ich da machte? Hätte ich auf Marla hören sollen? Nein, diesmal nicht. Es würde funktionieren, es musste einfach funktionieren. Ich liebte Tim, und ich war mir sicher, dass er meine Gefühle erwiderte. Hätte er mich sonst so spontan eingeladen? Ich konnte es kaum erwarten, ihn endlich zu sehen. Auch wenn ich ihn mit seiner Oma Louise teilen musste.
John, der Trucker, kam über den Rastplatz zurück, der sich langsam mit Fahrzeugen füllte. Er schwang sich auf den Fahrersitz.
»Du hast dich also entschieden«, sagte er zu mir und lachte gutmütig. »Wie heißt du denn?«
»Jodie.« Ich reichte ihm die Hand, und er drückte sie kräftig.
»Na, dann mal los ihr beiden. Auf geht’s!«
Es wurde eine lustige Fahrt mit John, der pausenlos von seinen Kindern erzählte. Außer der Tochter, die in meinem Alter war, hatte er noch zwei kleine Jungen, die ständig irgendwelche Streiche ausheckten.
Als er nach meinem Ziel fragte, gab ich wieder meine Geschichte von der Großmutter zum Besten, bei der ich die Ferien verbringen wollte. Ich fürchte, weder John noch Kip glaubten mir auch nur ein Wort, aber sie akzeptierten meine Story und die Tatsache, dass ich ihnen die Wahrheit nicht erzählen wollte.

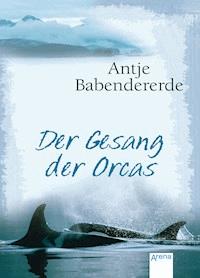
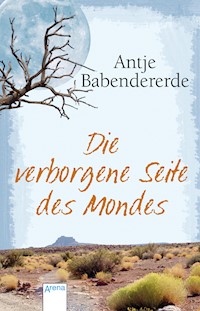


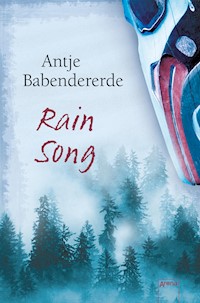

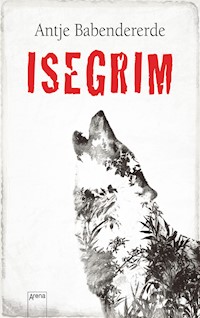
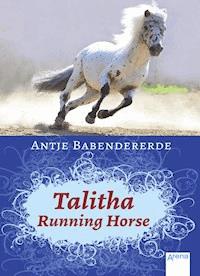

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)