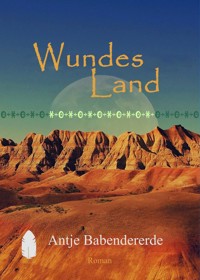Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GOYAlibre
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, du willst deinen Vater suchen und begegnest dabei deiner großen Liebe … Hals über Kopf, voller Wut und Enttäuschung bricht Jacob in den Norden Kanadas auf, in die unendliche Wildnis von Eis und Schnee. Dort will er seinen Vater finden und das Geheimnis seiner Herkunft lüften. Dass aus Schmerz jedoch Liebe werden kann, zeigt ihm die unnahbare Kimi, die ihrerseits an einem schweren Schicksalsschlag zu zerbrechen droht. Alles, was Jacob über seinen Vater weiß, hat ihm seine Mutter erzählt. Dass sie ihn sein Leben lang belogen hat, erfährt er ausgerechnet von seinem Stiefvater, den er hasst. Was bleibt Jacob also übrig, als in die kanadische Wildnis zu reisen, ans andere Ende der Welt, um die wahre Geschichte seines Vaters und damit auch seine eigene zu erfahren? Denn wie willst du entscheiden, wer du bist, wenn du nicht weißt, wo du herkommst? Als er lebensgefährlich von einem Bären verletzt wird, ahnt der Junge mit dem Wolfsherzen noch nicht, dass er dort, in der eiskalten Einsamkeit der wilden, ungezähmten Natur, der Liebe seines Lebens begegnen wird … Bildgewaltig, fesselnd und magisch - Survival-Abenteuer und epische Liebesgeschichte gleichermaßen: das neue Meisterwerk der preisgekrönten Autorin! Gedruckt auf Recycling-Umweltschutzpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antje Babendererde
Schneetänzer
Weitere Bücher von Antje Babendererde im Arena Verlag:
Wie die Sonne in der Nacht
Der Kuss des Raben
Isegrim
Julischatten
Rain Song
Indigosommer
Die verborgene Seite des Mondes
Libellensommer
Der Gesang der Orcas
Lakota Moon
Talitha Running Horse
Findet mich die Liebe?
Schneetänzer ist auch als Hörbuch erhältlich.
Antje Babendererde,
geboren 1963, wuchs in Thüringen auf und arbeitete nach demAbi als Hortnerin, Arbeitstherapeutin und Töpferin, bevor sie sichganz dem Schreiben widmete. Seit vielen Jahren gilt ihr besonderesInteresse der Kultur, Geschichte und heutigen Situation der Indianer.Ihre einfühlsamen Romane zu diesem Thema für Erwachsene wie fürJugendliche fußen auf intensiven Recherchen während ihrerUSA-Reisen und werden von der Kritik hochgelobt.
Antje Babendererde
Den Menschen von Moosonee undMoose Factory gewidmet.
1. Auflage 2019
© 2019 Arena Verlag GmbH, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, unter Verwendung von
Bildern von Shutterstock © Alix Kreil, Olena Gai, meow_meow,
Carlos G. Lopez, Bogdan Sonjachnyj und AnnaNenasheva
Vignetten im Innenteil unter Verwendung von Bildern von Shutterstock
© Olena Gai, meow_meow und AnnaNenasheva
E-Book-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net
E-Book ISBN 978-3-401-80839-0
Besuche uns unter:
www.arena-verlag.de
www.twitter.com/arenaverlag
www.facebook.com/arenaverlagfans
They tried to bury us.
They didn’t know
we were seeds.
Mexikanisches Sprichwort
Whe-tiko
Weißer Flockenwirbel. Kalt, so kalt. Ich laufe, setze einen Fuß vor den anderen. Meine Schritte werden vom kalten Weiß verschluckt. Mein Kopf schmerzt und ich will um Hilfe rufen, doch aus meinem Mund kommen nur weiße Wolken, in denen die Schneeflocken tauen.
Plötzlich höre ich knirschende Schritte im Schnee und ein wildes Schnaufen. Ohne mich umzudrehen, fange ich an zu rennen. Kälte sticht in meine Lungen, die Schritte kommen näher. Mit jagendem Herzen laufe ich zwischen verschneiten Bäumen hindurch, aber meine kurzen Beine versinken immer tiefer im frischen Schnee. Ich höre meinen Verfolger krachend durchs Holz brechen, brauche mich nicht umzudrehen, um zu wissen, was mir da dicht auf den Fersen ist. Das Ungeheuer des Waldes. Ein Monstrum mit einem Eisherzen, das Appetit auf ungehorsame Jungen hat.
Plötzlich bleibe ich mit dem Fuß an einem im Schnee verborgenen Ast hängen, stolpere und fliege der Länge nach hin. Das kalte Weiß ist überall um mich herum, sogar in meinem Mund. Mit letzter Kraft sauge ich Luft in meine Lungen. Doch der Schrei gefriert in meiner Kehle.
1
EISBÄRENEXPRESS
Mit einem wilden Atemzug fuhr ich aus meinem Albtraum vom zotteligen Ungeheuer im Schnee. Mein Blick jagte im Zickzack durch den Raum. Vier weiße Wände statt Winterwald. Kein Ungeheuer. Aber warum war mir dann so furchtbar kalt?
Mein Handywecker klingelte. Fluchend kämpfte ich mit dem Bettzeug, die Arme und Beine verstrickt in das schweißnasse Laken. Die dicke Wolldecke war zu Boden gerutscht, deshalb fror ich auch so in meinem T-Shirt und den Boxershorts.
An der Wand gegenüber dem Bett hing eine fotografierte Winterlandschaft: schwarze Baumspitzen, die aus einer endlosen, unberührten Schneefläche ragten. Nun wusste ich auch wieder, wo ich war: in einem Hotelzimmer in Cochrane, Ontario, auf dem Weg in meine Vergangenheit.
Es war kurz vor acht und in einer Stunde ging mein Zug in den hohen Norden. Mein Ziel war Moosonee, ein abgelegenes Nest, zu dem es keine Straßenverbindung gab. Ich schwang die Beine aus dem Bett und tappte ans Fenster. Der Himmel war von dicken Wolken verhangen und überall türmten sich schmutzige Schneeberge an den Straßenrändern. Direkt gegenüber vom Hotel lag der kleine, eingleisige Bahnhof von Cochrane. Ein Bus aus Timmins lud gerade neue Fahrgäste mit Unmengen Gepäck auf dem Bahnhofsvorplatz ab und auf einmal konnte ich nicht schnell genug dort unten bei den anderen Reisenden sein. Ich duschte, packte zusammen und checkte aus.
Das digitale Thermometer am Bahnhofsgebäude zeigte 15 °C, was so weit nördlich vermutlich okay war für Mitte April. Im Bahnhofsrestaurant bestellte ich mir einen Milchkaffee und zwei Croissants mit Butter und Marmelade.
Auf dem lang gezogenen Bahnsteig ging es kurz vor Abfahrt des Polar Bear Express ins rund dreihundert Kilometer entfernte Moosonee geschäftig zu. Menschen, die aussahen wie ich, schleppten riesige Koffer und mit Klebestreifen umwickelte Kartons zum Gepäckwaggon, wo alles verladen wurde: von rosafarbenen Kinderfahrrädern über Küchengeräte, riesige Packungen Pampers, Computer und Stereoanlagen bis hin zu sperrigen Staubsaugern und Tetrapacks voller Milch. Irritiert starrte ich auf den Flyer von Moosonee in meiner Hand. Gab es dort etwa keinen Supermarkt?
Ich war tief verletzt und wütend gewesen und hatte meiner Mutter keine Gelegenheit gegeben, mir mehr über den abgeschiedenen Ort an der James Bay zu erzählen, bevor ich Hals über Kopf von zu Hause abgehauen war, nur vier Wochen vor den Abiprüfungen. Als ich Mum dann vom Frankfurter Flughafen aus anrief, fragte sie mich, ob ich lange Unterhosen eingepackt hätte. Und sie warnte mich, dass es schwer werden könnte, mich unter einem Volk von Jägern fleischlos zu ernähren.
Dann sagte sie noch: »Er wird dich enttäuschen, Jacob.«
Ich bestieg einen der beiden dunkelblauen Passagierwaggons mit dem gelb-roten Logo, das eine fliegende Kanadagans darstellte, und suchte wie alle anderen meinen Platz. Eine indianische Großfamilie beschlagnahmte gleich mehrere Sitzbänke, die Kinder warfen sich in die blauen Sitze.
Das Ticket nach Moosonee und wieder zurück nach Cochrane hatte mich hundertzwanzig kanadische Dollar gekostet. Inzwischen war ich mit meinen Reisekosten bei knapp tausend Euro angelangt und mein Budget schrumpfte rapide. Tante Sonja hatte noch einen Hunderter auf mein Konto überwiesen, somit blieben mir knapp zweihundert Euro für die nächsten beiden Wochen. Ich ging fest davon aus, dass mein Erzeuger mich beherbergen und ernähren würde, nachdem er vierzehn Jahre lang keinen Cent für mich ausgegeben hatte.
Erneut stieg Wut in mir hoch. Auf meine Mutter, die mich jahrelang belogen hatte, aber auch auf meinen verantwortungslosen Vater, der vor vierzehn Jahren unsere Familie zerstört hatte. Beide waren schuld daran, dass ich mein bisheriges Leben unter falschen Vorzeichen gelebt hatte. Dass nun ein gewaltiges Drunter und Drüber in meinem Inneren herrschte.
Es gab reservierte Plätze. Zu meinem Ticket gehörte der Fensterplatz einer Viererbank. Nachdem ich meine Sporttasche und meine Jacke in der Gepäckablage verstaut hatte, machte ich es mir bequem. Blaues Kunstleder, weiche Polster und eine breite Fußablage wie bei diesen Omasesseln. Gar nicht übel für die fünf Stunden Fahrt ans Ende der Welt, die mich erwarteten. Mein Blick fiel wieder auf den Flyer von Moosonee, der am Bahnhof ausgelegen hatte. »Come visit us and touch the edge of the Arctic.«
Obwohl es gemütlich warm war im Zug, rann mir ein Schauer über den Rücken. Eine Vorahnung?
Der Waggon füllte sich schnell, doch die anderen Fahrgäste beachteten mich gar nicht. Familien mit kleinen Kindern, die auf wackligen Beinen durch den Gang liefen. Männer in karierten Wolljacken, Frauen und Mädchen, die lachend schwatzten. Neugier schluckte meinen Groll, denn es war ein seltsames Gefühl, unter Menschen zu sein, die aussahen wie ich: kohlschwarze Haare, dunkle Haut, leicht schräge dunkle Augen. Kanadische Ureinwohner, deren Vorfahren dieses Land noch allein gehört hatte.
Einige dieser Leute waren von meinem Stamm. Die Wahrheit über meine Herkunft wusste ich erst seit ein paar Tagen und ich hatte mich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, einen Cree-Indianer zum Vater zu haben.
Mum hatte mir jahrelang weisgemacht, ich wäre die Folge eines One-Night-Stands. Meinen Erzeuger, irgendein Student aus Südostasien namens Greg (wenigstens was seinen Vornamen anging, hatte sie mich nicht belogen), hätte sie mit achtzehn auf ihrer großen Reise durch Kanada in einem Hostel kennengelernt. Und am nächsten Morgen, als sie aus ihrem Marihuana-Rausch erwacht war, hätte er bereits das Weite gesucht. Damit hatten sich alle weiteren Fragen erübrigt.
Wie oft hatte ich in den vergangenen Jahren vor dem Spiegel gestanden und nicht gewusst, wer mich daraus anblickte. Ein Teenager mit dunkler Haut, halb deutsch, halb …Ja, was?
Ich hatte meine ausgeprägten Wangenknochen, die braungrünen, wie liegende Halbmonde geformten Augen und mein rabenschwarzes Haar betrachtet und mich gefragt, wer ich war – wo auf der Erdkugel diese andere Hälfte beheimatet war.
Ein paar Tage nach meinem achtzehnten Geburtstag hatte mein Freund Ben mir geraten, meine DNA bei einem genetischen Testdienst einzuschicken, um vielleicht per DNA-Matches eine Übereinstimmung zu erzielen. Beinahe hatte er mich so weit gehabt, das Geld zu investieren, als sich die Frage schlagartig von selbst erledigte und ich endlich eine Erklärung dafür geliefert bekam, wieso ich manchmal in Englisch träumte.
Weil es meine Vatersprache war.
Meine Welt stand kopf, ich war wütend und durcheinander, aber auch von einer prickelnden Aufregung erfasst. Mein Vater war kein Phantom mehr. Er hatte einen Namen: Greg Cheechoo. Und es gab einen Ort, an dem ich schon gelebt hatte: Moosonee.
Eine Indianerin unbestimmbaren Alters setzte sich mir gegenüber auf den Platz am Gang. Sie grüßte mich mit einem freundlichen Lächeln und widmete sich ihrem Smartphone. Punkt neun Uhr stieß die Diesellok einen langen, durchdringenden Pfiff aus. Der Eisbärenexpress setzte sich in Bewegung.
In meinem Inneren brodelte es. Ich konnte es kaum erwarten, endlich meinem Erzeuger gegenüberzutreten. Immer wieder stellte ich mir Greg Cheechoos verblüfftes Gesicht vor, wenn ich plötzlich vor ihm stand – nach all den Jahren. Dabei wusste ich nicht mal, wie er aussah. Hatte er dieselben Augen, Haare, Wangenknochen? Als ich Mum nach einem Foto gefragt hatte, war sie wieder in Tränen ausgebrochen und hatte gemeint, sie hätte damals alle Fotos vernichtet. Was ich ihr nicht glaubte.
Wie dem auch sei, mein Cree-Vater hatte keine Ahnung, dass ich auf dem Weg zu ihm war. Aber ich hatte in Erfahrung gebracht, dass er immer noch in Moosonee lebte. Und die Chancen, ihn dort zu finden, standen in Anbetracht der Überschaubarkeit des Ortes ziemlich gut.
Ich nahm mein Smartphone, rief Wikipedia auf und las zum wiederholten Mal, was das Online-Lexikon über das Nest ausspuckte: Moosonee ist eine Siedlung mit etwas mehr als 1700 Einwohnern im Norden Ontarios, Kanada. Der Ort wurde im Jahre 1903 als Stützpunkt der französischen Pelzhandelsfirma Revillon Frères in Konkurrenz zur Hudson’s Bay Company gegründet. Der Ort beherbergt zwei Schulen und einen Ableger des Northern College, den Northern Store, ein Postamt und einige kleine Läden. Die einheimischen Cree machen 80 Prozent der Bevölkerung aus. Die Siedlung Moosonee liegt am Moose River, einem etwa 80 Kilometer langen Fluss, der unweit des Ortes in die James Bay mündet. Auf einer der vielen Inseln im Mündungsdelta liegt Moose Factory, das Reservat der Moose-Cree-Indianer, ursprünglich ein alter Stützpunkt der Hudson’s Bay Company.
Jedenfalls kam man nur mit dem Eisbärenexpress oder einem kleinen Flieger in das Nest, in dem ich die ersten vier Jahre meines Lebens verbracht hatte. Letzteres wollte mir immer noch nicht in den Kopf, denn ich hatte nicht den kleinsten Funken einer Erinnerung daran.
Nachdem ich vor fünf Tagen mit blutverkrusteter Lippe und völlig durch den Wind bei Tante Sonja in Hanau aufgekreuzt war, war sie nach einigem Zögern schließlich mit der Adresse und Telefonnummer meines Cree-Vaters herausgerückt. Außerdem hatte sie mir eine kleine Schachtel mit einem Amulett gegeben, das jetzt unter Stoffschichten auf meiner Brust lag. Es war ein flacher, aus Horn geschnitzter Wolf an einem Lederband, den ich offenbar am Hals getragen hatte, als Mum mit mir für immer nach Deutschland zurückgekehrt war.
Sonja Peters war eine Art Patentante für mich. Sie und meine Mutter waren zusammen in Eisenach aufgewachsen und kannten sich seit der ersten Klasse. Einst waren die beiden beste Freundinnen gewesen, unzertrennlich, doch inzwischen telefonierten sie höchstens noch ein, zwei Mal im Jahr miteinander. Was Sonja anging, hatte ihr Rückzug aus dieser Freundschaft etwas mit meinem Vater und Mums Lügen zu tun.
»Christine wollte, dass ich den Anhänger wegwerfe«, hatte Sonja mir offenbart. »Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, denn es war alles, was du hattest von deinem Vater.«
Ich warf ihr vor, mich ebenso belogen zu haben wie Mum, aber Sonja sagte, sie hätte sich schon einmal in das Leben meiner Mutter eingemischt und hatte ihr schwören müssen, es niemals wieder zu tun.
Weder meine Mutter noch Sonja hatten gewusst, ob Greg (ich hatte beschlossen, meinen Vater Greg zu nennen) noch in Moosonee lebte, ob mein Vater überhaupt noch lebte. Nachdem ich seine Nummer zigmal vergeblich gewählt hatte, kam ich auf die Idee, kurzerhand auf der Gemeindeverwaltung von Moosonee anzurufen. Dort hatte ich erfahren, dass Greg Cheechoo sich zurzeit noch in seinem Buschcamp aufhielt, aber in den nächsten Tagen zurückerwartet wurde.
Sonja arbeitete als Dispatcherin am Frankfurter Flughafen und mit ihren Connections konnte ich ein bezahlbares Ticket für einen Direktflug nach Toronto und weiter nach Timmins ergattern. Ich hatte die Einreisegebühren abgedrückt und war gestern, am Samstag vor den Osterferien, nach Kanada geflogen, um meinen Cree-Vater zu treffen.
Obwohl der Zug nur gemächlich voranzuckelte, hatte der Übergang zur Wildnis überraschend schnell stattgefunden. Hin und wieder führten die Gleise noch über eine Schotterpiste, doch schon bald gab es zu beiden Seiten nur noch zerzauste Birken, Erlengestrüpp und krüppelige Fichten. Den Busch, wie die Kanadier ihre Wildnis nannten. Es war, als hätte ich eine unsichtbare Grenze überschritten.
Ich presste meine Stirn an das kalte Fensterglas. Fragen schoben sich in meinen Kopf. Andere Fragen, als ich sie mir in den vergangenen vierzehn Jahren gestellt hatte.
Würde ich meinen Vater tatsächlich finden? Hatte er mich vermisst in den vergangenen Jahren oder überhaupt einen Gedanken an mich verschwendet? Und warum hatte er nie versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen?
Wenn ich gewusst hätte, dass es ihn gibt, hätte ich mich niemals von Stefan adoptieren lassen. Unwillkürlich betasteten meine Finger die verschorfte Stelle an meiner Lippe, wo Stefans Siegelring sie aufgerissen hatte.
»Vielleicht hat er sich ja längst totgesoffen, dein Indianervater«, hatte das Arschloch zu mir gesagt.
Als Mum Stefan anschleppte, waren wir gerade zum sechsten Mal in zehn Jahren umgezogen (inzwischen ahnte ich, warum), jedes Mal in eine andere Stadt, und lebten in einem Plattenbau in Jena-Winzerla. Ich war vierzehn und dachte, der aalglatte Typ würde eines Tages einfach nicht mehr auftauchen, so wie die anderen Ersatzväter vor ihm. Doch Stefan Berger war hartnäckig. Er war Witwer und hatte einen kleinen Sohn, Jonas. Der brauchte eine Mutter und meine Mum brauchte jemanden, der seine kleinen Arme um ihren Hals legte, was ich zu dem Zeitpunkt schon seit einer Weile nicht mehr getan hatte.
Im Gegensatz zu den anderen Typen war Stefan solide und verdiente mit seiner Schweinemastanlage einen Haufen Kohle. Also wurde geheiratet und wir zogen in Stefans Villa im italienischen Stil am Rande der Stadt. Weiße Säulen und Steinlöwen vor dem Eingang und so.
Stefan war bereit gewesen, mich zu adoptieren, und Mum wollte es unbedingt. Damals muss ich wohl an einer Art geistiger Umnachtung gelitten haben, denn zu diesem Zeitpunkt fand ich die Idee von einem Vater aus Fleisch und Blut noch ganz verlockend.
Ich konnte ja nicht wissen, wie sehr das mit »Fleisch und Blut« passte, denn für Stefans Schweinemastanlage in Rodendorf interessierte ich mich erst ein Jahr später im Rahmen eines Schulprojektes. Aber da war längst alles gelaufen zwischen uns. Ich konnte meinen Stiefvater nicht leiden und er hatte längst das Interesse an mir verloren. Stefan hatte mich abgeschrieben. Er machte sich lustig über unsere Band und meine Versuche an den Drums. Für ihn war ich ein Nichtsnutz, ein langhaariger Querulant, der den Rockstar mimte und es nie zu etwas Ordentlichem bringen würde.
Alles, was meinen Stiefvater noch an mir interessierte, waren die Abiprüfungen. Weil ich danach schon bald das Haus verlassen würde, mitsamt meinen Drums und der Verstärkeranlage im Keller. Weil er mich dann endlich los war, diesen Jungen, der ihm von Anfang an fremd gewesen war. Ich war derjenige, der störte. Stefan hatte nie wirklich etwas mit mir anfangen können und es war ernüchternd gewesen, das zu erkennen.
Dabei hätte mir etwas mehr Familie durchaus gefallen. Ich kannte das nämlich kaum. Mum war Einzelkind und meine Großeltern schon lange unter der Erde. Sie waren bei einem Busunglück in der Türkei ums Leben gekommen, da war ich ein Jahr alt gewesen. Also gab es lange Zeit nur Mum und mich und dieses rätselhafte Loch in meinem Inneren, in das ich alles versenkte, was mit meinem nicht existenten Vater zu tun hatte.
Klar hatte ich einen Vater vermisst in meinem Leben. Einen, der mit mir Männerkram machte und mit dem ich über das Mysterium Mädchen hätte reden können. Aber ich war nie wütend auf den Südostasiaten gewesen, weil er ja nicht ahnen konnte, dass ich überhaupt existierte.
Doch nun lagen die Dinge völlig anders. Greg Cheechoo und meine Mum waren ordnungsgemäß verheiratet gewesen. Ich war also nicht das Resultat eines banalen One-Night-Stands, ich hatte einen richtigen Vater, einen, der mich im Arm gehalten, mich gefüttert und meine Windeln gewechselt hatte. Der mich mal geliebt hatte. Das musste einfach so sein, sonst würde ich nicht in diesem Zug sitzen.
Doch was, wenn mein Vater eine neue Familie hatte und nichts mehr von mir wissen wollte? Die Vorstellung, ihn zu treffen und nach zwei Wochen mit zufriedenstellenden Antworten und einer guten Vater-Sohn-Zeit im Gepäck nach Deutschland zurückzukehren, wurde immer unwahrscheinlicher. Ein mulmiges Gefühl beschlich mich bei der Frage, was mich am Ende meiner Reise erwartete. Was für ein Mensch war dieser Greg Cheechoo überhaupt?
Vor vierzehn Jahren war er betrunken mit mir in sein Auto gestiegen und hatte mich beinahe umgebracht. Das war das Einzige, was ich mit Sicherheit über ihn wusste. Doch ganz egal, was er damals getan hatte, er war immer noch mein Vater und das bedeutete doch etwas. Mum hätte ihn mir nicht vorenthalten dürfen.
»Es war zu deinem eigenen Schutz, Jacob«, hatte sie mir unter Tränen versichert.
Okay, als ich vier war, mochte das vielleicht gestimmt haben. Aber jetzt war ich kein Kind mehr. Ich war achtzehn, verdammt, und keine acht. Sie hätte es mir sagen müssen. Sie hätte es mir schon vor Jahren sagen müssen.
Ich erinnerte mich daran, als Kind leidenschaftlich gerne Cowboy und Indianer gespielt zu haben. Doch auch wenn ich wie einer aussah, ich wollte nie der Indianer sein. Jetzt war ich es. Ich konnte es mir nicht mehr aussuchen.
Auf dem Weg zur Toilette stieg ich über Taschen und Beine. Männer und Frauen schliefen in Schieflage oder quer über zwei Sitze gestreckt, Kinder zusammengerollt inmitten ihres bunten Spielzeugs. Teenager spielten auf Tablets oder hörten Musik über ihre Smartphones. Die wenigen Weißen im Zug konnte ich an einer Hand abzählen.
Ich holte mir ein Käsesandwich und zwei Müsliriegel im Speisewagen, dann begab ich mich zurück auf meinen Platz und aß das pappige Sandwich. Die Landschaft draußen hatte sich verändert. Je weiter nördlich wir kamen, umso mehr schrumpften die Bäume. Bald waren nur noch verfilzte Büsche und kleine, spitz aufsteigende Nadelhölzer übrig, die eine gezackte Horizontlinie bildeten.
Beim Anblick dieser pinselförmigen Baumspitzen und der wie Quecksilber schimmernden kleinen Moorseen wusste ich, dass ich nicht zum ersten Mal mit dem Polar Bear Express fuhr.
»Siehst du den Biberbau?«, hörte ich hinter mir einen Mann sagen.
»Aber wo ist der Biber, Daddy?«, fragte eine neugierige Jungenstimme.
»Vermutlich in seinem Haus«, antwortete der Vater.
Die dunkle Stimme des Mannes kam mir seltsam vertraut vor. Ich wandte mich um und spähte zwischen den Sitzlehnen hindurch nach hinten. Doch auf den beiden Plätzen saß ein älteres Ehepaar, das schlief. Der Mann schnarchte mit offenem Mund.
Hatte ich akustische Halluzinationen? Oder war das die Erinnerung an eine Zugfahrt mit meinem Vater? Warum konnte ich mich nicht an ihn und unser gemeinsames Leben in Moosonee erinnern? Immerhin war ich schon vier Jahre alt gewesen, als Mum mit mir nach Deutschland flüchtete, um nie wieder zurückzukehren.
Laut meiner Mutter hatte der Unfall, den mein Vater mit mir in einer kalten Winternacht gehabt hatte, mein Gedächtnis ausgelöscht. Jener Unfall, von dem mein immer wiederkehrender Albtraum von einem zotteligen braunen Ungeheuer rührte, das mich verschlingen wollte.
Ich fasste mir an den Haaransatz, wo sich eine blasse Narbe über meine linke Stirn zog. Mum hatte mir mit wenigen Worten von jener Schneesturmnacht erzählt. Wie mein Vater nach einem furchtbaren Streit betrunken mit mir in sein Auto gestiegen und viel zu schnell gefahren war.
»Er kam von der Straße ab und überschlug sich. Du wurdest dabei durch die kaputte Windschutzscheibe geschleudert. Dein Vater war bewusstlos und du bist verletzt und völlig verwirrt in den Wald gelaufen. Damals waren zehn Grad unter null und du warst halb erfroren, als die Rettungskräfte dich fanden.«
Drei Tage hatte ich im Koma gelegen. Als ich aufwachte und nur wenige Tage später wieder quicklebendig und reisefähig war, flüchtete meine Mutter mit mir nach Deutschland, während mein Vater wegen Trunkenheit am Steuer im Gefängnis von Moosonee saß.
»Es war zu deinem Besten, Jacob, das musst du mir glauben.«
Hätte Mum mir das alles auch dann erzählt, wenn ich nicht die Existenz unserer Patchworkfamilie aufs Spiel gesetzt hätte? Wenn Stefan nicht vor lauter Wut auf mich mit der Wahrheit über meinen Vater herausgeplatzt wäre? Hätte meine Mutter mich für den Rest meines Lebens belogen?
Ich schloss die Augen, gab mich dem rhythmischen Rattern der Gleise hin und dachte an den Abend vor einer Woche, an dem alles ans Licht gekommen war. Fühlte mich wie ein Scheusal, als ich Jonas, meinen kleinen Stiefbruder, vor mir sah. Er war neun und fürchtete, dass sein Vater meinetwegen ins Gefängnis musste. Jonas liebte seinen Vater und meine Mum. Und er liebte mich. Er wollte keinen von uns verlieren.
Dass ich Jonas diesen Ängsten ausgesetzt hatte, darauf war ich nicht stolz. Doch ich hatte das Elend in Stefans Schweinemastanlage einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Es hatte viel zu lange gedauert, bis ich kapierte, dass Stefan Berger nicht zu helfen war, seinen Schweinen aber schon. Nein, verdammt, es war richtig, die Fotos und Videos, die ich heimlich in seinem Stall gemacht hatte, an PETA zu senden.
Meine Aktion brachte Stefan eine Strafanzeige vom Veterinäramt ein – und mir einen Cree-Indianer als Vater.
»Wachay. Ist hier noch frei?«
Erschrocken setzte ich mich aufrecht hin. Ich war wohl eingenickt und hatte nicht bemerkt, dass der Zug gehalten hatte. Die beiden Sitze mir gegenüber waren leer, die Frau war wahrscheinlich im Speisewagen oder auf der Toilette.
Vor mir stand eine vermummte Gestalt: tief ins Gesicht gezogene Fellmütze, voluminöser Parka mit Fellkragen an der Kapuze, Jeans und hohe Lederschnürstiefel. Der Zugestiegene war angezogen, als käme er aus der Arktis. Ein frostiger Hauch umgab ihn.
»Ja«, sagte ich und deutete auf den Fensterplatz mir gegenüber. »Der ist noch frei.«
Ein wenig irritiert von den winterlichen Klamotten, warf ich einen Blick aus dem Fenster und stellte fest, dass hier tatsächlich viel mehr Schnee lag als in Cochrane. Deshalb war ich froh, dem Rat meiner Mutter gefolgt zu sein und mir in Hanau vor meiner Abreise noch ein paar lange Unterhosen gekauft zu haben.
Draußen war noch immer kein Zeichen von Zivilisation zu erkennen und ich fragte mich, wo der Typ auf freier Strecke hergekommen war. Offenbar mitten aus der Wildnis. Ein Blick auf mein Handy: schon halb eins durch. Nur noch anderthalb Stunden bis Moosonee.
Als sich mein Gegenüber die Mütze vom Kopf zog und aus seinen Sachen schälte, stellte ich mit einiger Überraschung fest, dass es ein Mädchen in meinem Alter war – vielleicht auch ein bisschen jünger. Ihr Haar, glatt und schimmernd schwarz wie Holzkohle, fiel ihr bis über die Schultern. Unter dem Parka trug sie ein XL-Flanellhemd, beige-braun kariert und nicht unbedingt vorteilhaft. Die anderen Indianermädchen, die während der Fahrt durch den Zug gelaufen waren, hatten typische Mädchenklamotten getragen: Skinny Jeans, eng anliegende Pullover und darunter Push-up-BHs.
Sie ist viel zu klein für ihre Kleidung, schoss es mir durch den Kopf. Das Mädchen setzte sich und zog ein Buch aus dem Rucksack. Mit meinen hochgelegten Beinen auf der Fußstütze kam ich mir vor wie ein Greis, aber als ich versuchte, die Stütze unauffällig verschwinden zu lassen, klappte sie mit einem lauten Schlag nach unten. Das Mädchen grinste in sich hinein.
Mein rechtes Bein war eingeschlafen und ich versuchte, die Durchblutung wieder in Gang zu kriegen, ohne die Beine des Mädchens dabei zu berühren. Ich tat so, als würde ich gedankenverloren aus dem Fenster schauen, doch in Wahrheit musterte ich sie aus den Augenwinkeln.
Die Kleine trug kein Make-up, aber das hatte sie auch nicht nötig, denn ihr Teint war dunkel und makellos. Auf ihren Wangen lag eine leichte Röte von der Kälte, und als sie den Kopf ein wenig drehte, entdeckte ich eine schneeweiße Strähne in ihrem Haar. Wow. Doch ihre Augen, groß, tiefbraun und leicht schräg, waren das Eindrucksvollste an ihrem Gesicht.
Neugier packte mich und ich ertappte mich dabei, wie ich immer wieder zu ihr hinübersah. Die Mädchen, mit denen ich es bisher zu tun gehabt hatte, wollten aller Welt zeigen, wie hübsch sie waren, wie begehrenswert. Aber die Kleine mir gegenüber, so schien es, versuchte das unter ihren weiten Jungsklamotten zu verstecken.
Krampfhaft überlegte ich, wie ich sie ansprechen konnte, doch der kühle Hauch, den sie von draußen mit hereingebracht hatte, schien sie immer noch wie eine Aura zu umgeben. Ich bekam kein Wort heraus, obwohl das gar nicht meine Art war. Bisher hatte ich nie Probleme damit gehabt, Mädchen anzusprechen.
Auf einmal hob sie den Kopf und unsere Blicke begegneten sich. »Hi«, sagte ich lächelnd und merkte, wie mir das Blut in die Wangen stieg. »Fährst du auch bis Moosonee?«
Mein Gegenüber bedachte mich mit einem spöttisch kühlen Blick. »Du bist nicht von hier, oder?«
»Doch, bin ich«, entgegnete ich. »Aber ich war lange weg.«
Das Mädchen zog eine Augenbraue nach oben. »So lange, dass du nicht mehr weißt, dass alle in diesem Zug nach Moosonee fahren? Dort ist Endstation und vorher gibt’s keinen Halt.«
Sie hatte eine angenehme Stimme und es wäre cool gewesen, mich mit ihr zu unterhalten. »Ich bin Jacob und komme aus Deutschland«, erklärte ich, obwohl ich ahnte, dass mein Versuch nichts fruchten würde. »Meine Mum ist Deutsche«, schob ich hinterher.
Kurz blitzte in ihren dunklen Augen etwas auf. Neugier? Interesse? Ermutigt fragte ich: »Und du bist…?«
Doch in diesem Moment schien hinter diesen schönen Augen ein Vorhang zu fallen und das Mädchen schüttelte den Kopf. »Das braucht dich nicht zu interessieren, okay?«
Wow. Auf so eine Abfuhr war ich nicht gefasst. Zugegeben, es war die erste dieser Art, die ich in meinem Leben einstecken musste. Deshalb wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte.
»Lass mich das gleich klarstellen«, bemerkte sie entschieden, »ich bin nicht interessiert an Small Talk.«
»Okay, verstehe. Aber ich suche nach meinem Vater und dachte, du könntest mir vielleicht helfen, wenn du aus Moosonee stammst«, unternahm ich noch einen Versuch.
»Mir egal, was du dachtest.« Sie vertiefte sich wieder in ihr Buch.
»Ist angekommen.« Beschwichtigend hob ich die Hände. »Sorry.«
Das fing ja gut an. Was, wenn alle hier oben im Norden so drauf waren? Ich war zu dieser Reise aufgebrochen, ohne zu wissen, was mich am Ziel erwartete. Ich kannte niemanden in Moosonee und niemand kannte mich. Zum ersten Mal kam mir in den Sinn, dass meine spontane Erkundungsreise auch scheitern könnte.
Frustriert stöpselte ich meine Kopfhörer in die Ohren und blickte wieder aus dem Fenster. Chester Bennington von Linkin Park sang: Tell me what I’ve gotta do. There’s no getting through to you. Was passte. But you’re not giving me a chance. Unsere Band hatte ein paar Titel von Linkin Park gecovert, die kamen bei den Mädchen gut an. Vor zwei Jahren, nachdem der Sänger sich das Licht ausgeblasen hatte, hatte ich begonnen, eigene Songs zu schreiben. Die kamen auch gut bei den Mädchen an.
Der Zug fuhr jetzt noch langsamer, zuckelte auf einer Brücke über einen breiten, zugefrorenen Fluss. Das musste der Moose River, der Elchfluss, sein. Die Schneedecke war geschlossen, eine weiße, fast makellose Fläche. Winterland. Ein neuer Songtitel? Ich schrieb ein paar Stichpunkte in mein Notizbuch, was mein Gegenüber mit einem kurzen Blick registrierte.
Eine halbe Stunde später hielten wir in Moosonee. Das unfreundliche Mädchen hatte sich längst angezogen und war mit ihrem Rucksack zur Tür gelaufen. Ich reihte mich in die Schlange der Aussteigenden, und als ich auf dem Bahnsteig stand, wehte mir tatsächlich der kalte Hauch der Arktis um die Nase. Hier war es bestimmt zehn Grad kälter als in Cochrane und ein Blick auf die Wetter-App bestätigte meine Vermutung.
Ich zog meine Strickmütze tiefer in die Stirn und schloss den Reißverschluss meiner Jacke. Ich war zwar am Ziel, aber noch längst nicht da. Als ich loslief, wurde ich zufällig Zeuge, wie ein drahtiger Typ das Mädchen in die Arme schloss. Klar: Wer so aussah wie sie, war natürlich nicht solo. Der junge Mann, ich schätzte ihn auf Mitte zwanzig, hatte strähniges, langes Haar und einen dünnen Oberlippenbart. Die beiden liefen zu den geparkten Wagen. Okay, sie hatte einen Freund. Trotzdem hätte sie sich mit mir unterhalten können.
Ich verließ den Bahnsteig und stand nach wenigen Schritten mitten auf einer breiten Schlammpiste. Zur Linken die verschneiten Warenstapel eines Baustofflagers, rechts ein alter grüner Waggon mit seltsamen Zeichen, die mich an ägyptische Hieroglyphen erinnerten. Ein schiefes verwittertes Schild verkündete: Welcome to Moosonee.
2
MOOSONEE
Es gibt Orte auf der Welt, die einen verändern können, doch dass ich mich an solch einem Ort befand, war mir in diesem Moment nicht bewusst. Endstation, hatte das Mädchen gesagt. Für sie vielleicht, aber mir kam es plötzlich so vor, als stünde ich erst am Anfang meiner Reise.
Ich lief bis zur ersten Querstraße, dann zog ich mein Handy aus der Tasche, ging auf Google Maps und gab die Adresse ein, die ich von Tante Sonja bekommen hatte. Moosonee, drei Kilometer lang und einen halben breit, lag eingezwängt zwischen den Gleisen der Eisenbahn und dem Fluss. In Richtung Nordosten endete die Straße am kleinen Flugplatz, in Richtung Südwesten nur wenige Kilometer hinter einem Steinbruch. Mein Vater wohnte in der Quarry Road, also musste ich mich die erste Querstraße rechts halten, Richtung Steinbruch.
Nachdem ich ein paar Schritte entlang hoher, schmutziger Schneeberge gelaufen war, hielt ein über und über mit Schlamm bedecktes Taxi neben mir. Die Entfernung bis zu Greg Cheechoos Haus betrug laut Google nur zwei Kilometer und ich musste mein Geld zusammenhalten, also schüttelte ich den Kopf und marschierte weiter.
Mein Weg führte mich an ein paar braun gestrichenen Holzhäusern vorbei, die hinter struppigen Sträuchern standen. Ich querte eine Betonbrücke, ließ eine kleine, moderne Krankenstation hinter mir und war auch schon raus aus dem Ort und drin in der Wildnis. Na ja, ich auf der unbefestigten Straße und links und rechts die Wildnis, der Busch. Schließlich stieß ich im Wald auf die Quarry Road und marschierte etwas schneller, denn mir wurde kalt.
Vor den einzeln stehenden Häusern auf der linken Seite parkten Autos und Motorschlitten, vor einem sogar ein knallrotes Buschflugzeug. Zwischen schwarzen Baumstämmen hindurch schimmerte das Weiß des zugefrorenen Flusses. Zielgerichtet schritt ich voran, denn hier war ich schon mal gewesen, mein innerer Kompass kannte den Weg. Ich erinnerte mich sogar an diesen roten Flieger, der hatte vor vierzehn Jahren auch schon hier gestanden. Krass, dachte ich, eine echte Erinnerung an mein früheres Leben.
Schließlich sah ich das Haus, das ein Stück von der Schotterstraße entfernt in einem Waldstreifen stand. Es war ein beige angestrichenes Holzhaus mit einem Satteldach und einem kleinen Vorbau. Ein Holzschild neben dem Eingang mit dem Namen meines Erzeugers: Greg Cheechoo.
Mir war schon seit einer Weile mulmig in der Magengegend, doch nun drohte mir das Herz bald aus der Brust zu springen. Trotz Kälte begann ich zu schwitzen. Ich war da. Die große Frage lautete: War Greg Cheechoo zu Hause und gab es noch irgendetwas, das uns miteinander verband? Was sollte ich sagen, wenn er vor mir stand? Hallo, Dad, wo hast du mein ganzes Leben lang gesteckt?
Ich klopfte, aber im Haus blieb es still. Ich rüttelte am Messingknauf, doch die Eingangstür war verschlossen. Ich klopfte, rief – vergeblich. Niemand zu Hause. Fuck!
Enttäuscht lief ich ums Haus herum und stellte meine Sporttasche auf einem der klobigen geschnitzten Holzstühle auf der überdachten Veranda ab. Ein Stück vom Haus entfernt stand ein seltsamer Bau, dessen untere Hälfte wie eine Jurte und die obere wie ein Tipi aussah. Ich lief hin, öffnete die schmale, unverschlossene Holztür und trat ein.
Der Boden und die Wände waren aus Sperrholz gezimmert, das Dach, von Stangen gehalten, aus hellem Leinen. Neben dem Eingang stapelte sich Feuerholz. Ein würziger Geruch nach Nadelholz, verbrannten Zedernzweigen und Salbei hing in der Luft.
Das Zentrum des Tipis bildete eine von Steinen eingefasste Feuerstelle mit einem Grillrost, auf dem eine geschwärzte Teekanne stand. Auf einem Stein lag ein Feuerzeug und ich probierte es aus. Es funktionierte. Zur Not konnte ich mir also ein Feuer machen.
Von einer der Dachstangen baumelte ein großer Traumfänger und hielt Wache. Die nach oben zusammenlaufenden Dachstangen und der Zederngeruch riefen etwas in mir wach, etwas Altvertrautes. Ich schloss die Augen, hörte den gleichmäßigen, dumpfen Schlag einer Handtrommel und den volltönenden Gesang eines Mannes.
»Wey-ah-hey-hey-hey-yoh, weho-he-weho-he, wey-ah-hey-hey-hey-yoh.«
Als mir bewusst wurde, dass ich die Melodie mitsummte, musste ich hart schlucken. Was war nur los mit mir? Kamen auf einmal lang verschüttete Erinnerungen zurück? Hatte ich ein Déjà-vu? Aber woran erinnerte ich mich da eigentlich?
Ich verließ das Tipi wieder und ging hinunter zum Flussufer. Skidoo-Spuren im Schnee zeigten in alle möglichen Richtungen. War Greg Cheechoo mit seinem Motorschlitten unterwegs? War er überhaupt schon zurück aus seinem Buschcamp?
Verdammt, was hatte ich mir bloß dabei gedacht, einfach hier aufzukreuzen, ohne dass mein Vater von meinem Kommen wusste? Inzwischen war es vier vorbei und die Kälte kroch mir erbarmungslos in die Knochen. Ich hätte mir ein Feuer im Tipi machen können und warten, in der Hoffnung, dass mein Vater nach Hause kam. Doch ich verwarf diesen Gedanken und beschloss, zurück in den Ort zu laufen, um herauszufinden, ob noch ein paar Erinnerungen aufploppten. Und vielleicht wusste ja irgendjemand in Moosonee, wo ich Greg Cheechoo finden konnte.
Während ich in Toronto auf meinen Flieger nach Timmins gewartet hatte, hatte ich den Namen meines Vaters gegoogelt und jede Menge Cheechoos gefunden in Moosonee und auf Moose Factory, der Insel im Fluss. Unter anderem einen bekannten Eishockeyspieler, eine Filmemacherin und eine Mitarbeiterin des Stammesbüros im Reservat auf der Insel. Würde ich hier auf Blutsverwandte treffen? Hatte ich Halbgeschwister?
Kaum war ich ein paar Schritte auf der Quarry Road in Richtung Ort gelaufen, hielt ein schwarzer SUV neben mir, in dem eine Indianerin um die fünfzig saß. Sie ließ die Scheibe herunter und sah mich neugierig aus schwarzen Augen an.
»Wachay, Kleiner, wo soll’s denn hingehen?«
Wachay hieß »Hallo« auf Cree, das stand auf dem Moosonee-Flyer. Als »Kleiner« hatte mich allerdings niemand mehr bezeichnet, seit ich mit vierzehn so richtig in die Höhe geschossen war und erst bei eins achtzig haltgemacht hatte.
»Zurück in die Stadt.«
»Stadt?« Die Frau stieß ein kollerndes Lachen aus. »Na, steig schon ein, du Spaßvogel.«
Ich umrundete den Wagen und stieg auf den Beifahrersitz, froh, im Warmen zu sein und jemanden gefunden zu haben, der mit mir redete.
»Ich bin Louise Koostachin«, stellte die Indianerin sich vor. Sie trug ihr schwarzes Haar in der Mitte gescheitelt und zu einem langen Pferdeschwanz gebunden. »Und du«, bemerkte sie, »du bist nicht von hier, stimmt’s?«
»Jacob«, sagte ich und rieb meine kalten Hände aneinander.
»Suchst du jemanden?«
»Ja. Ich will zu Greg Cheechoo, aber er ist nicht zu Hause.«
»Greg«, meinte sie nachdenklich, »der ist wahrscheinlich bei seiner Freundin Pauline im Camp Ajuawak, ein paar Kilometer den Fluss runter. Inzwischen trifft man ihn nur noch selten in seinem Haus in Moosonee.«
»Verdammter Mist«, murmelte ich auf Deutsch.
Louise ging vom Gas. »Du sprichst Deutsch?«
»Ja«, erwiderte ich missmutig. »Deutschland, da komme ich her.«
»Holy smokes«, stieß sie hervor, »du hast eine weite Reise hinter dir. Was hast du denn da gemacht?«
»Ich lebe in Deutschland.«
»Siehst aus wie ein Cree.« Louise musterte mich von der Seite. Mit fünfzehn hatte ich angefangen, mir die Haare wachsen zu lassen, um mehr dem Image eines Drummers zu entsprechen. Als ich merkte, dass Stefan langhaarige Jungs nicht ausstehen konnte, ließ ich sie mir schulterlang wachsen.
»Wie alt bist du?«, fragte Louise.
»Achtzehn.«
Louise schwieg eine Weile und wir fuhren über die Brücke wieder nach Moosonee hinein. Sie lenkte ihren Wagen nach rechts an einem vergitterten Schnapsladen vorbei und fuhr die breite, schlammige Hauptstraße entlang. Ein großer Backsteinkomplex auf der linken Straßenseite beherbergte die Schule und das Northern College, gegenüber bohrte sich der spitze Blechturm einer Backsteinkirche in den grauen Himmel. Auf die Kirche folgten ein Waffenladen und das Postamt.
Louise bog nach links auf einen großen Parkplatz und hielt vor dem Eingang des Northern Store, einem großen Einkaufsmarkt, in dem auch ein Kentucky Fried Chicken untergebracht war. Nur vier Autos parkten neben einem mannshohen Schneeberg.
»Jacob Cheechoo also«, sagte Louise und auf Englisch hörte sich der Name fremd an. Dscheykop Tschietschu.
»Ich heiße Berger«, stellte ich richtig, »meine Mum hat wieder geheiratet.« Ich mochte Stefans Namen nicht, aber mein Cree-Name wirkte einfach noch zu exotisch auf mich.
»Jacob Cheechoo«, wiederholte sie, ungeachtet meiner Worte. »Ich kannte dich, da warst du noch ein kleiner Knirps. Mein Lucas und du, ihr hattet eure Walking-out-Zeremonie zusammen.«
Walking-out-Zeremonie? Was sollte das denn sein?
»Ihr wart wie Brüder, ihr zwei, habt viel zusammen gespielt«, sagte Luise mit wehmütiger Stimme. »Lucas wäre jetzt so alt wie du. Erinnerst du dich denn gar nicht an ihn?«
»Tut mir leid.« Ich schüttelte den Kopf. Doch mein Inneres war in hellem Aufruhr. Der erste Mensch, mit dem ich in Moosonee sprach, erzählte Dinge über mich, die fremd und sehr exotisch klangen.
»Was … was ist denn mit Lucas passiert?«
»Er ist vor zwei Jahren bei einem schrecklichen Feuer ums Leben gekommen.« Louise schluckte, ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Das tut mir leid.«
Sie nickte schniefend. Besser, ich fragte nicht weiter nach.
»Ich habe nur ein paar Tage«, bemerkte ich, um vom heiklen Thema abzulenken, »dann geht mein Flieger zurück nach Deutschland. Ich muss unbedingt meinen Vater finden. Auf der Gemeindeverwaltung haben sie mir gesagt, er käme bald.«
»Ja, irgendwann in den nächsten Tagen ist eine Gemeinderatssitzung wegen der neuen Niob-Mine, da sollte er dabei sein. Allerdings kommt es schon mal vor, dass Greg nicht auftaucht, wenn er im Jagdfieber ist.«
Im Jagdfieber? Mum hatte so etwas angedeutet. »Aber ich muss ihn unbedingt treffen.«
Louise schien nachzudenken. »Weißt du was?«, meinte sie schließlich. »Wir kaufen jetzt zusammen ein und dann kommst du mit zu mir und ich koche uns was. Danach telefoniere ich ein bisschen herum und wir versuchen, deinen Dad zu erreichen.«
Vor Erleichterung und Dankbarkeit war meine Kehle wie zugeschnürt und ich brachte kein Wort heraus.
»Nun?« Erwartungsvoll sah Louise mich an.
»Klingt toll, danke.«
»Meegwetch«, sagte sie lächelnd. »›Danke‹ heißt bei uns meegwetch.«
Im Supermarkt schob ich für Louise den Einkaufswagen durch die weiten Regalreihen und merkte, wie einige Leute uns verstohlen musterten.
»Weißt du«, sagte sie mit leuchtenden Augen, »zur Feier deiner Heimkehr werde ich uns Elchsteaks braten, ich habe noch welche in der Tiefkühltruhe. Dazu Kartoffelbrei und Bohnen. Was sagst du dazu?«
Heimkehr? Elchsteaks? Was ich dazu sage? Ich druckste herum. »Ich …«
»Du magst kein Elchfleisch?« Sie runzelte die Stirn. »Dann mache ich Gans.«
»Ich … ich bin Vegetarier«, stieß ich hervor.
Louise starrte mich eine Weile entgeistert an, dann kicherte sie los. Nun drehten sich alle nach uns um und ich wäre am liebsten auf der Stelle im Boden des Supermarktes versunken.
»Du willst mich auf den Arm nehmen.«
Ich schüttelte den Kopf. Meine Ohren prickelten, aber die steckten ja zum Glück unter meiner Strickmütze.
»Okay«, meinte Louise, »dann komm mal mit.«
Sie führte mich zu einer Kühltruhe mit vegetarischen Gerichten und Zutaten. Tofu, Hummus, Salate, Süßspeisen. Die Preise waren astronomisch und ich schreckte kopfschüttelnd zurück.
»Na, was ist? Nichts dabei?«, fragte sie enttäuscht.
»Das Zeug ist ja megateuer.«
»Oh ja.« Louise nickte. »Im Northern ist so gut wie alles megateuer, aber die Preise für die vegetarischen Lebensmittel sind besonders hoch. Ich schwöre dir, es gibt keinen einheimischen Vegetarier in Moosonee. Wir Cree sind Fleischesser, Kleiner. Jeder Versuch der Weißen, uns zu Farmern zu machen, ist gescheitert. Was du hier in der Kühltruhe siehst, ist für die weißen Ärzte, Anwälte und Berater, die ab und zu für ein paar Tage zum Arbeiten herkommen.«
»Ich esse gerne Kartoffelbrei und Bohnen«, sagte ich.
Louise lachte. »Das lässt sich machen.«
Ein Mann in Gummistiefeln und gefüttertem Tarnanzug grüßte Louise und fragte, wer ich sei. Sie antwortete ihm auf Cree. Ich verstand sie nicht, trotzdem wusste ich, was sie antwortete. Dass ich Greg Cheechoos Sohn war und kein Fleisch aß. Der Mann grinste, ihm fehlten ein paar Zähne.
»Na komm«, sagte Louise zu mir. »Fahren wir nach Hause.«
Louise Koostachin und ihr Mann Edward lebten in einem hübschen, weiß gestrichenen Holzhaus in der Veterans Road direkt am Fluss. Edward, ein stämmiger Mann mit kurzem Haar und Schnurrbart, saß im gemütlichen Wohnzimmer vor dem großen Fernseher und verfolgte ein Hockeyspiel.
Ich begrüßte ihn und Louise klärte ihn darüber auf, wer ich war. Edward gab mir die Hand und wandte sich dann wieder seinem Spiel zu.
»Unser Lucas war ein guter Hockeyspieler«, meinte Louise, als sie mich in ein Zimmer mit einem breiten Bett, einer Kommode und einem Schreibtisch führte. »Ed spricht nicht mehr viel seit seinem Tod. Nimm es nicht persönlich, okay?«
Es war Lucas’ ehemaliges Zimmer, das sah ich an seinen Hockeypokalen, die aufgereiht im Regal an der Wand standen, und an den Fotos, die ihn in Hockeymontur zeigten. Auf dem Bett lag eine Patchworkdecke in warmen Erdtönen. Louise drehte die Heizung auf.
»Mach es dir bequem«, sagte sie. »Das Bad ist gleich um die Ecke, die zweite Tür. Handtücher liegen im Regal. Wenn du Lust hat, kannst du mir ja ein bisschen beim Kochen helfen.«
Es wurde schnell warm in dem kleinen Raum und ich schälte mich aus meiner Jacke. Erst jetzt merkte ich, wie müde und erschöpft ich war – und wie hungrig. Ich wollte mein Handy aufladen, doch der Stecker passte nicht in die verdammte Steckdose. Ich brauchte einen Adapter, an so etwas hatte ich überhaupt nicht gedacht.
Mum hatte mir eine WhatsApp geschickt.
Bist du gut in Moosonee gelandet? Wie geht es Greg? Hab dich sehr lieb, Mum
Ich stieß kopfschüttelnd Luft durch die Zähne. Sie tat so, als wäre ich auf einem ganz normalen Besuch bei meinem Paps und nicht auf einer Reise in die Tiefen meiner Existenz.
Hab ihn noch nicht getroffen, schrieb ich zurück. Bin bei Louise Koostachin. Es geht mir gut
Ich drückte auf Senden, ließ mich auf das Bett sinken und schloss die Augen. War dankbar für Louises Gastfreundschaft, dieses weiche Bett und freute mich auf Kartoffelbrei und Bohnen.
Ein Sonnenstrahl kitzelte mich im Gesicht und weckte mich. Angezogen und mit einer warmen Wolldecke zugedeckt, lag ich auf dem Bett und mein Magen knurrte. Offenbar war ich gestern Abend eingepennt und Louise hatte mich schlafen lassen. Der Duft nach frisch Gebackenem stieg mir in die Nase und löste ein Gefühl des Willkommenseins in mir aus, wie ich es sonst nur in Bens Familie hatte.
Ich ging duschen, und als ich zurückkam, piepte mein Handy. Der Akku war alle. Ich nahm es mit in die Küche, wo Louise den Tisch für zwei gedeckt hatte.
»Guten Morgen, Kleiner«, begrüßte sie mich mit einem Lächeln. »Du hast gestern so tief und fest geschlafen, ich wollte dich nicht wecken.«
»Kein Problem.« Ich schnupperte. »Was riecht denn hier so gut?« Mein Magen grollte vor Hunger.
»Ich habe Rosinenbrötchen im Ofen.« Ihre dunklen Augen musterten mich erwartungsvoll.
»Ich müsste mein Handy aufladen, aber ich habe nicht an einen Adapter gedacht. Ob die im Supermarkt so etwas haben?«
»Vermutlich nicht. Aus Europa verirrt sich kaum noch jemand nach Moosonee, diese Zeiten sind lange vorbei. Du kannst dein Handy an meinem Laptop aufladen.« Sie zeigte auf einen Uralt-Laptop, der auf einem Tisch am Fenster stand. Er hatte einen USB-Anschluss und ich steckte mein Handy ans Ladekabel.
Ich fand Nachrichten von Tante Sonja, von Ben und eine neue von meiner Mum.
Ben schrieb: Hey Alter, wie ist es denn so am Arsch der Welt?
Und wie läuft es mit deinem Erzeuger?
Ich antwortete: Es ist gar nicht der Arsch der Welt, sondern der Arsch der Arktis, schrieb ich. Kalt ist es hier. Meinen E habe ich noch nicht getroffen, aber jemanden, der mich noch von früher kennt. Melde mich.
Mum schrieb: Grüß Louise und Edward von mir und melde dich, wenn du bei Greg bist.
Mach ich, schrieb ich grausam knapp zurück.
Ich war immer noch stinksauer auf meine Mum. Loyal gegenüber Stefan zu sein, das war eine Sache. Aber mich vierzehn Jahre lang hinters Licht zu führen, eine ganz andere.
»Wo ist denn Ed?« Ich wies auf die beiden Teller.
»Er steht immer sehr früh auf. Heute hilft er unserer Tochter Della bei Arbeiten in ihrem Haus. Kaffee?«
»Ja, gern.« Unter Louises mütterlichem Blick verschlang ich drei noch warme Rosinenbrötchen mit dick Butter und Honig.
»Die haben Lucas und du als Kinder schon so gerne gemocht.« Bedauern hatte sich in ihre Stimme geschlichen. In ihren Augen sah ich, wie sehr sie sich wünschte, dass ich mich an ihren Sohn erinnerte. Oder schlimmer noch: dass ich er wäre.
Der letzte Bissen in meinem Mund ließ sich nur mit Mühe hinunterschlucken. »Tut mir leid, dass ich mich nicht an Lucas erinnere«, sagte ich. »Mein Vater und ich hatten diesen Unfall, an den ich allerdings auch keine Erinnerung habe. Alles, was vorher war, ist wie ausgelöscht. Ich habe erst vor ein paar Tagen durch Zufall erfahren, dass Greg mein Vater ist und ich mal hier in Moosonee gelebt habe.«
»Holy Smokes«, meinte Louise und schlug die Hände zusammen, tiefe Bestürzung in ihrem dunklen Gesicht. »Was hat Christine dir denn all die Jahre erzählt?«
»Dass ich das Ergebnis eines One-Night-Stands mit einem Typen aus Südostasien bin.«
Sie legte eine Hand auf ihren Mund und schüttelte ungläubig den Kopf. Schließlich fragte sie: »Wie geht es deiner Mum? Du hast gesagt, sie hat wieder geheiratet.«
Ich nickte. »Vor vier Jahren. Er heißt Stefan und kann mich nicht leiden. Das beruht auf Gegenseitigkeit.« Ich zuckte die Achseln und nahm mir doch noch eins der köstlichen Rosinenbrötchen.
Und dann erzählte ich Louise von meinem Stiefvater und was er für ein Idiot war. Dass er pausenlos an mir herumnörgelte und ich ihn nie zufriedenstellen konnte. Ich berichtete ihr von seiner Schweinemastanlage und dass ich die Zustände dort heimlich gefilmt und an eine Tierschutzorganisation geschickt hatte. Dass Stefan mir eine gelangt hatte und in seiner Wut auf mich mit der Wahrheit über meinen Vater herausgeplatzt war.
»Und hier bin ich.«
»Ja«, sie nickte, »da bist du. Ich habe deinem Dad immer gesagt, du würdest eines Tages zu ihm zurückkommen. Doch in den letzten Jahren hat er mir nicht mehr geglaubt.«
»Hat er … hat Greg Kinder?«, fragte ich. »Ich meine, außer mir?«
Louise wischte einen imaginären Krümel vom Tisch und schüttelte den Kopf. Sie legte eine Hand auf meinen Arm. »Dass dein Stiefvater so ein Idiot ist, tut mir leid«, sagte sie. »Christine hätte dir deine Herkunft nicht verschweigen dürfen.« Sie seufzte tief. »Was geschehen ist, lässt sich nun nicht mehr ändern. Doch etwas solltest du wissen, bevor du deinen Vater triffst, Jacob. Er hat dich all die Jahre sehr vermisst.«
Ich schnaubte trotzig. »Wenn er mich so vermisst hat, warum hat er sich dann nie bei mir gemeldet?«
»Deine Mum ist mit dir weggezogen, als er im Gefängnis festsaß. Das war hart für ihn. Dein Vater hat lange nach euch gesucht, nachdem er wieder draußen war. Aber irgendwann hat er aufgegeben. Er …« Sie verstummte, schüttelte den Kopf und sah weg.
»Bei diesem Unfall wäre ich beinahe gestorben«, sagte ich und merkte selbst, wie vorwurfsvoll ich klang. Es fiel mir nicht leicht, das Gehörte zu verdauen. Wenn es um Gefühle ging, blockte ich ab.
»Wir alle machen Fehler, Jacob. Aber darüber solltest du mit deinem Dad sprechen. Ich habe gestern Abend noch mit Pauline, seiner Freundin, telefoniert«, erzählte sie. »Greg ist zurzeit nicht in Camp Ajuawak, er ist auf seiner trapline im Busch unterwegs. Aber du hast Glück. Sein Freund Tony Loon aus Moose Factory hat vor, ihn zu besuchen, und zwar noch heute. Ich habe schon mit Tony gesprochen. Er will heute Mittag los und ist bereit, dich mitzunehmen.« Louise gab mir einen Zettel mit Tonys Handynummer. »Am besten erreichst du ihn über Facebook. Drüben auf Moose Factory Island ist das Internet umsonst und so kommunizieren alle über den Messenger miteinander.«
»Und wie kommen wir in Gregs Buschcamp?«
»Auf dem Motorschlitten natürlich.«
»Okay, klar«, sagte ich.
»Gut. Dann rufe ich Tony an und lasse ihn wissen, dass du gegen eins da bist.«
Erneut machte sich Aufregung in mir breit. Noch heute würde ich meinem Vater gegenüberstehen. Die Stunde der Wahrheit näherte sich in Riesenschritten oder besser: auf Skidoo-Kufen. Ich versuchte, ihn mir vorzustellen, da draußen, in der Wildnis, auf seiner trapline, seiner Fallenstrecke. Doch Greg Cheechoo nahm keine konkrete Gestalt an, sosehr ich mich auch darum bemühte.
Ich speicherte Tonys Nummer in mein Handy ein. Es war nach zehn und gegen zwölf wollte Louise mich zu den Skidoo-Taxis am Fluss bringen.
Auf die Frage nach meinem Vater holte Louise einen alten Schuhkarton mit Fotos. Sie zeigte mir ein verblichenes Farbfoto, auf dem meine junge Mum, mein Dad und ich als Knirps zu sehen waren, zusammen mit Louise, Ed, einem Mädchen im Teenageralter und einem kleinen Jungen, der fröhlich grinste. Das war Lucas, mein Kumpel, an den ich mich nicht erinnern konnte. Leider auch jetzt nicht, als ich sein Bild vor Augen hatte.
Louise und Edward lächelten, meine Eltern auch, aber Mums Lächeln sah gezwungen aus. Ein Ausdruck, den ich nur zu gut kannte.
»Christine war in Moosonee nicht glücklich«, sagte Louise, die meinen Blick bemerkt hatte. Und ich dachte, dass Mum in Deutschland auch nicht glücklich war. »Sie konnte die langen Winter nicht ertragen. Greg ist ein guter Mann, er hat alles versucht, ihr das Leben hier erträglich zu machen. Aber es hat nicht funktioniert und deine Mum ist immer trauriger geworden.« Sie schluckte. »Als dein Dad damals aus dem Gefängnis kam und nach Moosonee zurückkehrte, war er ein gebrochener Mann und alle dachten, er käme nie mehr auf die Beine. Zwei Jahre später hat er dann wieder geheiratet, aber die Ehe mit Nora ging auch nicht gut.«
Für einen Augenblick kam es mir so vor, als würde Louise noch etwas auf der Zunge liegen, etwas über meinen Vater und seine zweite Frau Nora, doch dann schien sie es sich anders zu überlegen. »Seit einem halben Jahr ist er mit Pauline Wabano zusammen«, sagte sie mit einem Lächeln, »und die beiden sind glücklich miteinander. Pauline tut ihm gut. Sie betreibt ein Camp für Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind oder mit ihrem Leben nicht klarkommen. In Camp Ajuawak lernen sie die alten Jagdtechniken und wie man in der Wildnis überlebt. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein.«
Louise drückte mir ein weiteres Foto in die Hand, das gestochen scharf war, und ich blickte in das strahlende Gesicht meines Vaters. Er musste damals Mitte zwanzig gewesen sein und ich war erschüttert über die große Ähnlichkeit zwischen uns. Ich erkannte meine Augen und mein Lachen in ihm wieder. Greg hatte das gleiche, leicht wellige Haar wie ich.
Wie musste das für meine Mutter gewesen sein, mich jeden Tag vor Augen zu haben, ein Abbild von ihm?
Auf dem nächsten Bild waren wir beide zu sehen und ich war ausstaffiert wie ein kleiner Jäger. Trug ein Sweatshirt in Tarnfarben, ein ledernes, mit Perlen besticktes Stirnband und kniehohe, verzierte Mokassins. Mein Vater kniete neben mir auf einem Teppich aus grünen Tannenzweigen, hatte einen Arm um mich gelegt und in seiner freien Hand hielt er ein Spielzeuggewehr, das so täuschend echt aussah, dass ich es im ersten Moment für echt hielt. Vor uns lag eine tote Kanadagans. Nicht zu fassen.
»Deine und Lucas’ Walking-out-Zeremonie«, erklärte Louise, die langsam begriff, dass ich mich tatsächlich an nichts erinnern konnte. »Ihr wart damals zwei Jahre alt. Bei dieser Zeremonie werden Kinder in die Gemeinschaft des Stammes eingeführt. Es war euer erstes Verlassen des Hauses zu Fuß.«
»Und die tote Gans?«, fragte ich stirnrunzelnd.
»Kleine Jungen jagen bei dieser Zeremonie«, sagte Louise. »Natürlich nur symbolisch«, fügte sie hinzu, als sie mein Gesicht sah. »Das stellt sicher, dass aus euch kleinen Burschen später einmal echte Kerle und geschickte Jäger werden.«
Ich wusste nicht, wo ich hinsehen sollte, und Louise lachte ihr herzliches, kollerndes Lachen. »Das mit dem Jäger hat sich wohl bei dir nicht erfüllt.«
»Nein«, ich schüttelte vehement den Kopf. »Ich könnte niemals ein Tier töten.«
Louise blickte mich nachdenklich an. »Dein Dad ist ein erfolgreicher Jäger und Fallensteller«, sagte sie. »Er ist hierüberall bekannt für sein Wissen über den Busch und die Jagd. Greg hat eine ganz besondere Beziehung zur Wildnis und zu den Tieren.«
Ich kapierte zwar nicht ganz, wie man eine besondere Beziehung zu Tieren haben konnte, die man strangulierte oder abknallte, aber ich schwieg. Dass mein Vater ein berühmter Jäger war, würde die Dinge nicht unbedingt leichter machen zwischen uns, aber ich wollte nicht voreingenommen sein.
Louise packte die Fotos wieder in den Schuhkarton, als mir eins ins Auge fiel, auf dem ich das Mädchen aus dem Zug zu erkennen glaubte.
»Darf ich das mal sehen?«
Sie gab es mir. »Lucas und seine Freundin Kimi«, sagte sie. »Das war kurz vor seinem Tod.«
Kimi, dachte ich. Sie blickte ernst in die Kamera und Lucas sah sie verliebt an.
»Eigentlich heißt sie Kimiwan, das bedeutet ›Regen‹ auf Cree.« Louisa nahm mir das Foto aus der Hand und es verschwand im Karton. »Tut mir leid, Jacob«, entschuldigte sie sich, »aber ich kann mir diese Fotos noch nicht anschauen, ohne dass der Schmerz um meinen Jungen mir das Herz abschnürt.«
»Verstehe«, murmelte ich. »Das wollte ich nicht.«
»Schon gut, du kannst doch nichts dafür. Ich bin so froh, dich da draußen auf der Quarry Road getroffen zu haben, das musst du mir glauben.« Sie seufzte. »Aber nun müssen wir los, sonst kommst du nicht rechtzeitig rüber auf die Insel.«
Bevor wir das Haus verließen, begutachtete Louise die Skidoo-Tauglichkeit meiner Kleidung. Meine Jacke und die winddichte Hose waren okay, wenn ich mein Fleece und die langen Unterhosen darunterzog. Meine knöchelhohen Lederboots waren zwar gefüttert, doch sicherheitshalber vermachte Louise mir ein paar mukluks, fast kniehohe, fellgefütterte Lederstiefel, die vorne geschnürt wurden. Dazu schenkte sie mir noch ein paar dunkle Lederhandschuhe. Beides war nicht neu, sah aber ungeheuer bequem aus.
»Die Elchlederhandschuhe gehörten Lucas«, sagte sie, »die mukluks auch. Probier mal, ob sie dir passen. Ich weiß, es würde ihm gefallen, dass du beides bekommst.«
Ich schlüpfte in die mukluks und sie passten wie angegossen. »Die sind ja irre warm.«
»Ja, die Handschuhe auch.« Louise nickte. »Versprich mir, dass du beides auf dem Skidoo trägst.«
»Versprochen«, sagte ich. »Danke. Ähm …meegwetch.«
Louise lächelte. »Meegwetch heißt mehr als nur ›danke‹, Jacob. Es bedeutet: ›Ich werde in Ehren halten, was du mir gegeben hast.‹«
Es war sonnig und warm draußen, als wir in Louises SUV stiegen, und ich fing schnell an zu schwitzen in meinen Klamotten. Wir fuhren an einem Spielplatz vorbei, auf dem Kinder in bunten Schneeanzügen auf einem Gerüst herumturnten. Hinter einer Brücke bog Louise nach rechts und fuhr die Straße am Fluss entlang, die von Holzhäusern und einem ausgebrannten Hotel mit zerbrochenen Scheiben und dunklen Fensterlöchern gesäumt war. Nachdem wir ein kleines Gewerbegebiet passiert hatten, tauchte linker Hand ein großes, aufgebocktes Boot auf. Mühsam entzifferte ich seinen rostigen Namen: Polar Princess.
»Vor ein paar Jahren«, erklärte Louise, »als die Touristen im Sommer noch so zahlreich waren wie die Moskitos, haben wir sie mit der Polarprinzessin zur Mündung der James Bay geschippert.«
»Und jetzt nicht mehr?«
»Mona, nein. Es kommen nicht mehr viele Besucher von außerhalb nach Moosonee. Nur noch Sportjäger und Fischer oder Leute, die beruflich hier zu tun haben. Anwälte aus Timmins in ihren feinen Anzügen, wenn sie einmal im Monat vor Gericht einen armen Schlucker verteidigen müssen.« Sie seufzte. »Man hat uns hier oben schon vor langer Zeit abgeschrieben.«
Louise brachte ihren Wagen am Straßenrand hinter einem anderen Auto zum Stehen.
»Woran liegt das?«, wollte ich wissen.
Sie zuckte die Achseln. »Vielleicht daran, dass wir ihnen zu uninteressant sind. Kaum jemand hat schon mal was von Sumpf-Cree gehört. Wir haben keine großen Krieger wie Sitting Bull oder Crazy Horse vorzuweisen. Die meisten Leute, die geschäftlich hier raufkommen, bemitleiden uns. Sie sind froh, nicht hier leben zu müssen.«
Wir stiegen aus und Louise umarmte mich kurz, aber heftig. »Ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst, ja? Grüß Greg von mir und lass dich noch mal bei mir sehen, bevor du wieder nach Deutschland fliegst.«
Ich schulterte meine Sporttasche. »Mach ich, versprochen. Meegwetch für alles.«
»Wa-che-yeh, Jacob.« Louise stieg wieder in ihren Wagen und wendete. Ich winkte ihr noch zu, dann blickte ich zum Ufer des zugefrorenen Flusses hinunter, wo Skidoos mit Schlittenanhängern und hin und wieder auch ein Auto das schneebedeckte Eis querten.
3
SCHWARZES EIS
Stirnrunzelnd beobachtete ich das Treiben. Die selbst gebauten, kastenförmigen Sperrholzschlitten, die an einigen der Skidoos hingen, sahen nicht sehr vertrauenerweckend aus. Aber ich hatte keine Wahl. Ich lief zum Fluss hinunter und begutachtete die freigeräumte Piste über den Fluss. Wo der Wind den Schnee fortgeweht hatte, schimmerte blankes Eis durch. Schwarzes Eis, von Rissen durchzogen. Das mulmige Gefühl in meiner Magengegend nahm zu.


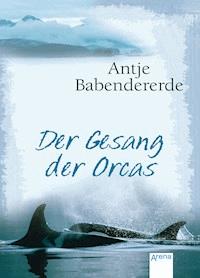
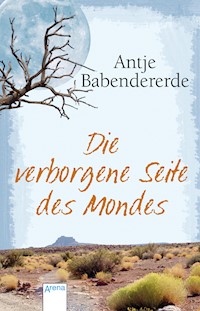


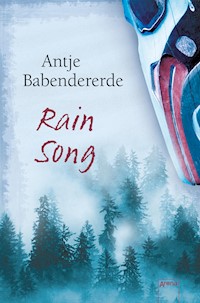

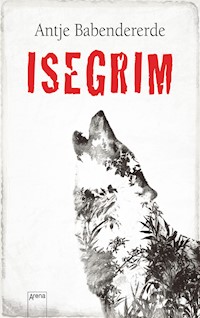
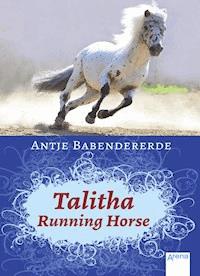

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)