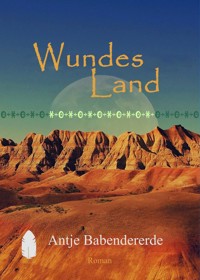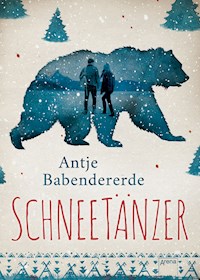Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Sturz von den Klippen am Cap Flattery hätte leicht tödlich ausgehen können. Doch Hanna überlebt - dank dem Makah Indianer Greg. Hat der Vorfall etwas mit Hannas verzweifelter Suche nach ihrer großen Liebe Jim zu tun, der hier vor fünf Jahre spurlos verschwand? Gemeinsam mit Greg macht Hanna sich daran, den Dingen auf den Grund zu gehen. Doch während sie Greg immer näherkommt, entdeckt sie Stück für Stück Jims wahre Identität.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antje Babendererde
Rain Song
Roman
Die Autorin
Antje Babendererde,geboren 1963, wuchs in Thüringen auf. Nach einer Töpferlehrewar sie als Arbeitstherapeutin in der Kinderpsychiatrie tätig.Seit 1996 ist sie freiberufliche Autorin mit einem besonderen Interessean der Kultur, Geschichte und heutigen Situation der Indianer.Ihre einfühlsamen Romane zu diesem Thema für Erwachsenewie für Jugendliche fußen auf intensiven Recherchen und USA-Reisenund werden von der Kritik hochgelobt.
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012© 2010 Arena Verlag GmbH, WürzburgDie Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel»Der Pfahlschnitzer« beim Hannah-Verlag.Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Frauke Schneiderunter Verwendung eines Fotos von Brenda Tharp © gettyimagesISBN 978-3-401-80028-8www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Prolog
Die Flut wird steigenDie Flut wird zurückgehenDie Nacht wird kommenDie Nacht wird gehen.Aus: »Töchter der Kupferfrau« von Anne CameronTradition ist Bewahrung des Feuersund nicht Anbetung der Asche.Gustav Mahler
1. Kapitel
Weiße Nebelfetzen hingen in den zerklüfteten Felsen vor der Steilküste von Cape Flattery und ein leichter Wind trieb die Wellen des Pazifiks sanft gegen das steinige Ufer am Kap. Die Sonne, ein milchiger Fleck am grauen Himmel, kämpfte gegen die Feuchtigkeit und Kühle der Nacht.
Hanna stand auf einer Aussichtsplattform aus Zedernplanken, die von dicken Rundhölzern begrenzt wurde. Der harzige Duft des frischen Holzes mischte sich mit der Salzluft des Meeres. Offensichtlich war die Plattform gebaut worden, damit sich neugierige Touristen nicht zu nah an die steil abfallende Felskante wagten, aber ein Trampelpfad hinter dem Geländer zeugte davon, dass sich die Neugierigen und Wagemutigen nach wie vor nicht abhalten ließen.
Hanna stützte sich auf die Brüstung und ihr Blick wanderte hinüber nach Tatoosh Island, einer kleinen, grasbewachsenen Felseninsel mit einem Leuchthaus aus Stein, als sie plötzlich in ihrem Rücken eine schattenhafte Bewegung wahrnahm. Sie drehte sich um, aber da war – niemand. Nur Büsche und ein paar verkrüppelte Kiefern, hinter dem Morgennebel der Wald. Sie war allein am Kap. Es war sechs Uhr morgens, für Touristen noch viel zu früh. Dennoch empfand Hanna so etwas wie Anwesenheit, ein unerklärbares Gefühl, das ihr Herz schneller schlagen ließ.
Schließlich schrieb sie die seltsame Wahrnehmung ihrer Müdigkeit zu. Die ungeheure Erwartung, die Hanna mit ihrer Rückkehr nach Neah Bay verband, hatte sie bis jetzt wach gehalten. Doch nun forderten der siebzehnstündige Flug und die anschließende Autofahrt durch die Nacht ihren Tribut.
Hanna wandte sich wieder dem Meer zu und betrachtete die Klippen von Tatoosh Island. Auf der kleinen Insel hatte sich nichts verändert, seit Jim Kachook sie hierhergeführt und ihr die Schönheit des Kaps gezeigt hatte. Es war ein strahlend blauer Maitag gewesen, der Duft des feuchten Waldes schwer und der Blick von der Steilküste eine Offenbarung.
Von drei Seiten das Meer.
Hanna erinnerte sich daran, als wäre es gestern gewesen. Dabei waren inzwischen fünf Jahre vergangen. Ihr ganzes Leben hatte sich verändert, doch hier, im kleinen Reservat der Makah-Indianer, schien die Zeit stehen geblieben zu sein.
Ein Auftrag des Völkerkundemuseums, für das Hanna als Restauratorin arbeitete, hatte sie vor fünf Jahren auf die Olympic-Halbinsel im Bundesstaat Washington geführt. Die Nordwestküstenstämme waren berühmt für ihre kunstvoll geschnitzten Masken und Wappenpfähle und das Museum plante damals eine Ausstellung über diese Region. Hanna sprach gut englisch und aufgrund zweier vorangegangener Kurierreisen ins Burke Museum in Seattle kannte sie die richtigen Ansprechpartner. Sie sollte einen indianischen Schnitzkünstler ausfindig machen, der bereit war, für drei Monate nach Deutschland zu kommen und auf dem Museumsgelände einen Pfahl zu beschnitzen. Das Entstehen des Wappenpfahls sollte die Attraktion der Ausstellung sein und Besucher aus allen Teilen des Landes anlocken.
Mit einer Liste von Namen, die man ihr im Burke Museum zusammengestellt hatte, machte Hanna sich auf den Weg, musste jedoch schon bald feststellen, dass sie mit ihrem Anliegen auf wenig Gegenliebe stieß. Keiner der Künstler, die sie auf der Olympic-Halbinsel aufsuchte, wollte sein Land und seine Familie für so lange Zeit verlassen. Schon fast am Ende ihrer Reise, verschlug es Hanna nach Neah Bay. Im kleinen Reservat der Makah-Indianer stieß sie auf Jim Kachook, einen jungen Holzschnitzer, der sich spontan bereit erklärte, den Auftrag des Völkerkundemuseums anzunehmen.
Kachook hätte seine Abreise in Ruhe vorbereiten und Hanna eine Woche später nach Deutschland folgen können, aber der Holzschnitzer wollte sofort mit ihr kommen. Einen Nachmittag lang hatte Jim sie in Neah Bay herumgeführt und unter anderem auch hierhergebracht, an diesen magischen Ort. Beinahe knöcheltief waren sie in schwarzem Schlamm versunken, um den nordwestlichsten Punkt des amerikanischen Hauptlandes zu erreichen.
Hanna hatte eine Nacht im heruntergewirtschafteten Clamshell Motel verbracht und am nächsten Morgen waren sie zusammen nach Seattle zum Flughafen gefahren
Ihr Herz zog sich zusammen. Ich bin wieder hier.
Dieses Mal hatte sie sich mit wasserabweisenden Schuhen und alten Jeans für die sumpfigen Abschnitte des rund einen Kilometer langen Wanderpfades gerüstet, war jedoch von einem stabilen Steg aus Zedernholzplanken überrascht worden.
Hatten die Makah beschlossen, Touristen zu tolerieren? War das Indianerreservat mit seinen landschaftlichen und kulturellen Attraktionen neuerdings für Fremde zugänglich, ohne dass sie bei ihren Erkundungen Gefahr liefen, sich den Hals zu brechen?
Es raschelte neben Hanna im Gesträuch und sie zuckte zusammen. Cape Flattery ist ein Ort der Geister, hatte Jim damals gesagt und sich über ihr skeptisches Gesicht amüsiert. Hanna fröstelte. Obwohl sie nicht viel von Übersinnlichem hielt, hatte sie immer noch das merkwürdige Gefühl, nicht allein zu sein. Als ob sie jemand beobachtete.
Unwillkürlich zog sie die Schultern nach oben. Die feuchtkalte Luft kroch in ihre Kleider und Hanna bereute, nicht ihre Windjacke über das Fleece gezogen zu haben. Die bleierne Stimmung am Kap schlug sich auf ihre Seele und erinnerte sie daran, warum sie hier war: Sie hatte den Ozean überquert, um nach Jim Kachook zu suchen. Denn Liebe hört nicht einfach auf, auch wenn man sich das manchmal sehnlichst wünscht. Sie hinterlässt Spuren, die einen wie unsichtbare Wegweiser durchs künftige Leben führen.
Hanna wandte ihren Blick von der Insel und verließ die Plattform. Sie lief ein paar Schritte den felsigen Pfad zurück, bis zu der Stelle, wo einige Holzstufen zu einer kleinen, von salzverkrusteten Bäumen und Sträuchern gesäumten Ausbuchtung führten, die ebenfalls mit einem neuem Geländer gesichert war. Sie stieg die Stufen hinab. Von hier aus konnte man die Felsenhöhlen von Cape Flattery sehen. Es waren tiefe Grotten im Basaltgestein, deren muschelbewachsener Boden selbst bei Ebbe noch von Wasser bedeckt war.
Vogelschreie drangen aus den großen Höhlen. Hanna lehnte sich über die Brüstung, um besser in die vordere Höhle hineinsehen zu können. Von Jim wusste sie, dass hier große Seevögel nisteten. Die Jungen schrien, wenn ihre Eltern mit Nahrung in den Schnäbeln vom Meer zurückkehrten.
Hanna seufzte. An diesem Ort drängte die Sehnsucht der letzten Jahre mit aller Macht an die Oberfläche. Tränen brannten in ihren Augen und die Kehle wurde eng. Sie nahm das leise Knarren gar nicht wahr, die kaum hörbare Warnung des Materials, bevor es unter ihrem Gewicht nachgab und wegrutschte. Das nagelneue Geländer löste sich in seine Einzelteile auf. Instinktiv drehte Hanna sich um ihre eigene Achse und versuchte, nach einem rettenden Ast zu greifen – vergeblich.
Ihr Schrei glitt über das Wasser wie ein flacher Stein, der erst einige Male wieder aus der Oberfläche springt, bevor er in endgültigen Tiefen versinkt. Hannas Hände klammerten sich in wildes Gestrüpp, das aus einer Felsspalte wuchs, ihre Füße suchten verzweifelt nach einem Halt. Zentimeter für Zentimeter rutschte sie weiter nach unten. Die kleine Ausbuchtung war schon mehr als einen Meter über ihr, der Meeresspiegel zehn Meter unter ihr.
Ich werde sterben.
Hanna schrie nicht mehr. Keiner würde sie hören an diesem einsamen Ort – nicht zu so früher Stunde. Zwischen dem drohenden Aussetzen der Sinne und ihrer wilden Angst lag eine Welt von Bildern, die in einem wahllosen Durcheinander auftauchten. Sequenzen aus ihrer Kindheit, Lachen und Weinen. Eindrücke von Zärtlichkeit und von Einsamkeit. Das Fieber seelischer Verwundung. Dann sah sie sich selbst wie in einem Spiegel, nackt und hilflos. Verzweifelt bäumte sie sich dagegen auf.
Durch die jähe Bewegung rutschte Hanna wieder ein Stück und das holte sie in die Realität zurück. Das Gesträuch, in das sie sich klammerte, hatte biegsame Zweige und kräftige Wurzeln, aber sie würden ihr Körpergewicht nicht ewig halten. Ihr war nur eine kurze Pause vergönnt. Zeit, um sinnlos darüber nachzudenken, was aus ihrer Tochter Ola werden würde, wenn sie von dieser Reise nicht lebend nach Hause zurückkehrte.
Hanna wagte einen kurzen Blick über ihre Schulter nach unten. Sie hing direkt über muschelbewachsenen Uferfelsen, freigelegt durch die Ebbe. Der sichere Tod.
Ein unmenschlicher Laut kam aus ihrer Kehle.
Das war nicht fair. Jedenfalls nicht auf diese Weise. Gerade jetzt, wo sie dabei war, Ordnung in ihr Leben und das ihrer Tochter zu bringen.
Ich darf nicht sterben.
Wer sollte Ola von ihrem Vater erzählen – oder von diesem Ort am Ende der Welt, aus dem er stammte? Wer würde Jims Tochter von ihren indianischen Vorfahren, den Walfängern, Lachsfischern, Holzschnitzern und Korbflechtern berichten? Wer, wenn nicht sie?
Tränen liefen über ihre Wangen. Zentimeter für Zentimeter gab die Felsspalte die Wurzeln des Strauches frei und Hanna rutschte nach unten.
Plötzlich hörte sie einen Ruf. Hanna glaubte, einer Halluzination erlegen zu sein, doch die Hoffnung war wieder da und sie schrie, so laut sie konnte, um Hilfe.
»Bleiben Sie ganz ruhig«, drang eine Männerstimme von unten zu ihr herauf. »Nicht bewegen! Ich helfe Ihnen.«
Während Hanna sich panisch festkrallte, versuchte sie herauszufinden, wo der Mann stand. Doch ein paar Haarsträhnen hatten sich aus dem Gummi gelöst, sie klebten an ihrer feuchten Stirn und nahmen ihr jede Sicht.
»Beeilen Sie sich!«, brüllte sie.
Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, bis der Mann sich wieder meldete.
»Hören Sie mir gut zu und machen Sie genau, was ich sage.«
»Okay.« Sie versuchte, die Haarsträhnen aus ihrem Gesicht zu pusten, aber es funktionierte nicht.
»Stoßen Sie sich mit den Beinen von der Felswand ab und springen Sie, so weit Sie können, nach links. Dort ist eine tiefe Stelle.«
Ein Gurgeln drang aus Hannas Kehle. Springen? Der einzige Mensch, der ihr helfen konnte, schien hoffnungslos verrückt zu sein.
»Niemals!«, schrie sie. Angst schnürte ihre Kehle zu und erstickte ihr verzweifeltes Schluchzen. Ihre Kräfte ließen nach.
»Es ist Ihre einzige Chance«, rief der Mann ungeduldig. »Machen Sie schon! Die Wurzel hält Sie nicht mehr lange.«
Hanna schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht.« Ich kann keinem verrückten Fremden mein Leben anvertrauen.
»Nicht nachdenken, okay? Das Meer wird Sie auffangen.«
Die Wurzeln des Strauches gaben erneut ein Stück nach und Hanna stöhnte leise auf.
»Springen Sie, verdammt noch mal!«
Mit einem grausam endgültigen Geräusch lösten sich die Wurzeln aus der Felsspalte. In letzter Sekunde stieß Hanna sich mit dem rechten Bein kräftig nach links vom Felsen ab und – sprang.
Sie fiel nur kurz. Das Wasser schlug über ihr zusammen und die Kälte drückte ihr die Luft aus den Lungen. Es hat funktioniert, schoss es ihr durch den Kopf, dann dachte sie nichts mehr. Es war unerwartet still um sie herum – wie unter einer Glocke aus Glas. Dahinter eine andere Welt, ein Rausch aus Farben. Die Zeit schien langsam zu werden und die Kälte spürte sie nicht mehr. Grün schillernde Hände griffen nach ihr und zogen sie auf den Grund.
Das Meer nahm Hanna in die Arme. Es war so einfach, sich gehen zu lassen. Schwerelos trieb sie dahin, spürte, wie ihr Körper sich aufzulösen begann und wie sie eins wurde mit der Welt unter Wasser. In ihrem Inneren war es ein beruhigendes Gefühl: am Ende dorthin zurückzukehren, wo alles Leben einst begonnen hatte. Die Schwerkraft der Farben war beglückend. Sie würde zum Ufer der Stille gelangen. Ihr Körper als Gegengabe für immerwährenden Frieden. Wenn sich der Tod so anfühlt, dann hatte sie keine Angst vor ihm.
Kräftige Finger, warm und sehr lebendig, packten Hanna derb unter den Achseln und holten sie zurück ans Licht. Über der Wasseroberfläche machte sie einen schmerzhaften Atemzug, hustete und schlug prustend um sich. Jemand klemmte ihre Arme fest und ging dabei nicht zimperlich mit ihr um. Gegen diese Kraft hatte sie keine Chance.
»Es ist vorbei«, sagte die Männerstimme dicht an ihrem Ohr. »Atmen Sie.«
Hanna hörte auf, sich zu wehren, und versuchte zu tun, was von ihr verlangt wurde. Sie blinzelte gegen das Brennen in ihren Augen an. Der Mann, der sie fest umklammert hielt, hatte dunkle Haut und schwarzes Haar. Mit einem Arm hielt er sie über Wasser, schwamm mit ihr zum muschelbewachsenen Felsen und zog sie hinauf. Er lehnte ihren Oberkörper so vorsichtig gegen eine Felswand, als wäre sie zerbrechlich.
»Sind Sie in Ordnung?«, fragte er besorgt.
Hanna wollte etwas sagen, aber sie musste husten und spuckte salzigen Schleim.
Nichts ist in Ordnung. Ich wäre beinahe gestorben.
Brennende Flüssigkeit rann ihr aus der Nase. Sie hatte Meerwasser in die Nebenhöhlen bekommen, vermutlich eine ganze Menge.
Der Indianer kniete neben ihr. »Tut Ihnen etwas weh?«
Sie schüttelte den Kopf, begann aber auf einmal, am ganzen Körper unkontrolliert zu zucken.
Der Mann nahm sie an den Schultern und drückte sie sanft aber bestimmt gegen die Felswand – bis das Zittern aufhörte. »Schon gut!«, versuchte er, sie zu beruhigen. »Es ist nichts passiert. Ziehen Sie Ihre nasse Jacke aus und bewegen Sie sich ein bisschen.« Er ließ Hanna los. Sie sah, dass er barfuß war. Vorsichtig stieg er über die Muschelbänke wieder in die Bucht. »Ich hole nur schnell das Boot«, sagte er, schon halb im Wasser, »dann bringe ich Sie ins Trockne.«
Sie blickte ihm nach und ihre Zähne begannen zu klappern. Zum Glück war das Meer ruhig. Die Morgennebel hatten sich verzogen und langsam fing die Sonne an zu wärmen. Der Indianer schwamm zum Boot, das in einigen Metern Entfernung auf den Wellen dümpelte, und schwang sich hinein.
Mit einem Mal waren Hannas Gedanken wieder vollkommen klar und der Schock ließ nach. Ich lebe noch.
Sie versuchte, ihre Glieder zu bewegen. Ganz langsam. Erst die Finger, die Handgelenke, dann beide Arme. Die Zehen und Fußgelenke. Sie streckte erst ein Bein, dann das andere. Die Bewegungen bereiteten ihr keine Schmerzen. Nichts war gebrochen. Das Meer hatte sie tatsächlich aufgefangen.
Hanna beugte sich nach vorn und ihr Blick wanderte über die Trauben blauschaliger Muscheln, deren Ränder scharf wie Messer waren. Ohne diesen Mann und seine verrückte Anweisung wäre sie jetzt tot. Hanna schob den Gedanken weit von sich. Sie schlang die Arme um ihre Beine, legte den Kopf auf die Knie und schloss die Augen.
»Alles klar bei Ihnen?«
Hanna hob den Kopf. Sie hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Wie lange hatte der Indianer gebraucht, um das Boot zu ihrem Felsen zu manövrieren? Fünf Minuten? Fünfzehn?
Er half ihr einzusteigen. Hanna klammerte sich an seiner Hand fest, bis sie auf der Bank im Bug saß. Das Boot, ein alter Blechkahn, roch nach Tang und Fisch. Neben einem Netz und einer Angel lagen zwei Teile der kaputten Brüstung, die er aus dem Wasser gefischt hatte. Zu ihren Füßen entdeckte Hanna ein Messer. In einem zerkratzten Plastikeimer die Ausbeute: schwarz schimmernde Miesmuscheln.
»Das war knapp«, sagte der Indianer und rubbelte sich mit einem alten Handtuch über seine nassen Haare.
Unwillkürlich wanderte Hannas Blick die Felswand hinauf und sie schauderte. Noch immer konnte sie nicht glauben, was soeben passiert war. Dieses Geländer hatte nagelneu ausgesehen und doch hatte es unter ihrem Gewicht nachgegeben. Sie sah die Stelle, wo die Wurzeln des Strauches sich aus der Felsspalte gelöst hatten.
»Ich bringe Sie ins Krankenhaus, okay?«
»Ins Krankenhaus?«, stieß Hanna hervor. Ihr Blick glitt über das Gesicht ihres Retters: länglicher Schädel mit hoher Stirn, schräge Augen, volle Lippen, die Nase gerade und schmal. Seine dichten schwarzen Augenbrauen erinnerten sie an die Schwingen eines Adlers, der zum Flug ansetzt.
»Vielleicht haben Sie sich verletzt.«
Sie schüttelte vehement den Kopf. »Nein, ich bin in Ordnung.«
»Sicher?« Der Indianer runzelte die Stirn und sah sie mit wachsender Skepsis an.
Sie konnte es ihm nicht verdenken. Vermutlich hatte er sich seinen Vormittag auch anders vorgestellt.
»Ja, ganz sicher. Mein Wagen steht oben am Kap. Können Sie mich irgendwie dorthin zurückbringen?«
Offensichtlich erleichtert, nickte er. »Wohnen Sie im Motel?«
»Ja … das heißt, ich habe es vor. Als ich heute früh in Neah Bay ankam, schlief alles noch.«
Die Falten auf seiner Stirn wurden noch tiefer.
»Besser, Sie ziehen die nasse Jacke aus.« Er drehte sich um und ließ den Außenbordmotor an. Eine leichte Benzinwolke stieg Hanna in die Nase. Als er sich ihr wieder zuwandte, sagte er: »Ich heiße übrigens Greg.«
»Hanna.« Sie versuchte ein Lächeln. »Danke, dass Sie mir geholfen haben.«
Greg erwiderte ihr Lächeln nicht. Es war nahezu unmöglich, seinem Gesicht zu entlocken, was er dachte.
Das Boot tuckerte aus der kleinen Bucht. Hanna quälte sich aus der nassen Fleecejacke, was mit ihren klammen Fingern gar nicht so leicht war. Ihr Anblick musste jämmerlich sein: T-Shirt und Jeans trieften, ihre Schuhe hatten sich voll Wasser gesogen und das nasse Haar klebte ihr am Kopf.
Das Allerschlimmste war jedoch die Kälte.
Hanna schlang ihre Arme um die Brust, aber dadurch wurde ihr auch nicht wärmer. Wenn sie nicht schnell aus den nassen Kleidern herauskam, würde sie sich eine dicke Erkältung holen. Die Wassertemperatur war gefährlich kalt gewesen.
Neah Bay ist ein Ort, wo der Ozean auch im Sommer kalt ist, hatte Jim gesagt. Jetzt wusste sie, was er gemeint hatte. Sie musste niesen und hielt sich beide Hände vors Gesicht.
Greg langte hinter den Sitz und reichte ihr eine dunkelgrüne Windjacke. Die Jacke roch nach Fisch, aber als Hanna sie um ihre Schultern legte, stellte sie fest, dass sie auf der Innenseite gefüttert war. Dankbar sah sie ihren Retter an. Das weiße T-Shirt klebte wie eine zweite Haut an seiner Brust und Hanna starrte auf seine muskulösen braunen Arme. Noch jetzt spürte sie den harten Griff seiner Hände unter ihren Achseln.
Sie zog die Jacke vor ihrer Brust zusammen. Greg schaute sie nicht an. Er steuerte das Boot nach links um die Landspitze herum. Sein Ziel war ganz offensichtlich nicht Neah Bay, sie fuhren in Richtung Süden.
Wo brachte er sie hin?
Ein neuer Kälteschauer kroch ihren Nacken hoch und sie musste wieder niesen. Ihr Blick fiel auf das Messer zu ihren Füßen und auf einmal fühlte Hanna sich wie die Muscheln im Eimer: als Beute. Vielleicht hatte der Indianer sie nur aus dem Wasser gefischt, um …
Mach dich nicht lächerlich, okay!
Hanna schätzte Greg auf Anfang dreißig. Bestimmt war er verheiratet und hatte eine Schar Kinder. Doch als sie den Eimer mit den Muscheln ansah, schwand ihre Zuversicht. Damit konnte man keine Familie ernähren. Das war die Ausbeute eines einsamen Feinschmeckers.
»Wohin bringen Sie mich?«, fragte Hanna, entschlossen, sich nicht von ihren Ängsten verrückt machen zu lassen.
»Sie müssen so schnell wie möglich Ihre nassen Kleider loswerden, sonst holen Sie sich den Tod«, sagte Greg. »Mein Haus steht am Sooes Beach. Dort können Sie sich aufwärmen. Danach bringe ich Sie zurück zu Ihrem Wagen.« Seine Mundwinkel zuckten spöttisch, als er ihre krampfhaft ineinander verschlungenen Finger sah. »Keine Angst, ich habe nicht vor, Sie als Nachtisch zu verspeisen.« Kleine Funken sprühten aus seinen dunkelbraunen Augen.
Ein mattes Lächeln huschte über Hannas Gesicht. Sie hatte gehofft, er würde ihre Gedanken nicht lesen können.
Die felsige, von Klippen beherrschte Küste schien endlos. Sie war von rauer, nackter Schönheit. Überall Vogelnester. Auf einer Klippe entdeckte Hanna eine Robbe mit ihrem Jungen. Der Steilküste folgte eine Bucht mit einer Flussmündung. Das musste der Waatch River sein. Weiter hinten, versteckt hinter Bäumen, graue Holzhäuser. Hanna kramte in ihrem Gedächtnis: die Siedlung Waatch.
Nach der Flussmündung begann ein langer Strand. Eine Frau war mit ihrem Hund unterwegs. Das war Hobuck Beach mit seinem Campingplatz. Wenig später tuckerte das Boot an einer sandigen Landzunge vorbei, die die Form eines Halbmondes hatte.
Das alles war wunderschön, aber Hanna fror immer mehr. Sie wollte gerade fragen, wo denn nun das rettende Haus stand, als sie im Küstenwald etwas blinken sah und Greg das Boot an Land steuerte. Er half Hanna heraus, klappte den Außenbordmotor nach oben und zog das Boot so weit auf den Strand, dass die Flut es nicht mehr erreichen konnte. Dann holte er das Messer und den Muscheleimer aus dem Boot.
»Kommen Sie«, sagte er, »es ist nicht mehr weit.«
Greg lief voran. Sein Gang war schwankend, als wäre er betrunken, bis Hanna merkte, dass er leicht humpelte. Hoffentlich hatte er sich bei seinem Rettungsmanöver nicht am Bein verletzt.
Sie folgte dem Indianer über den Strand, vorbei an wirren Haufen von Treibholz und zwischen großen entwurzelten Stämmen hindurch. Sonne und Salzwasser hatten das Holz silbrig grau ausbleichen lassen. Gespenstisch ragten die mächtigen Wurzeln in den Himmel. Wie gewaltig mussten die Kräfte gewesen sein, die diese Bäume aus ihrer Verankerung gerissen hatten?
Hanna blieb kurz stehen. Obwohl sie nass war und fror, umfing sie die Magie dieses Landes, einer Welt, die sie nur aus Jims Erzählungen kannte. Doch das Gefühl verflüchtigte sich auf der Stelle, als sie an ihren Zustand dachte und daran, dass sie hergekommen war, um einen Strich unter ihre Wünsche und Erinnerungen zu ziehen, die mit diesem Land verwoben waren.
Mit schnellen Schritten lief sie weiter und entdeckte schließlich ein an den Hang gebautes, durch Fichten geschütztes Haus, auf das Greg geradewegs zusteuerte. Es war ein einfacher Holzkasten mit flachem Satteldach und einer großen Veranda, die zum Meer zeigte. Die verwitterten Zedernplanken hatten keinen Anstrich. Befestigt an der Veranda ragte ein imposanter Hauspfahl aus der Erde, der verschiedene stilisierte Wappentiere zeigte. Hanna erkannte einen Wal, einen Bären, Rabe und Otter und ganz oben saß ein Wolf, der einen kleinen Menschen hielt.
Ein heftiger Stich fuhr durch ihre Brust und nahm ihr für einen Moment den Atem. Dieser Pfahl sah aus, als wäre er unter Jims Händen entstanden. Die Tierfiguren waren in ihre Bestandteile zerlegt und nach festen Gesetzmäßigkeiten wieder zusammengefügt worden. Der Künstler hatte zwischen den einzelnen Figuren keinen Abstand gelassen – aber das war nicht nur typisch für Jims Arbeitsweise, es gehörte zur künstlerischen Tradition dieses Volkes. Den indianischen Malern und Schnitzern der Nordwestküste wurde ein ausgeprägter Horror vacui – eine Scheu vor leeren Flächen – nachgesagt.
Doch bei diesem Pfahl wies jede der Figuren eine Verbindung zur anderen auf. Die Klauen des Wolfs verschmolzen mit den Flügeln des Raben, die Beine des Otters wurden zu den Armen des Bären und die Rückenflosse des Wals verschwand im Bauch des Bären. Das war typisch für Jims Arbeitsweise. Auf diese Art verdeutlichte er die Fähigkeit der Figuren zur Transformation.
Wie gebannt starrte Hanna auf den Pfahl. Sie hatte das Gefühl, als würde Jim Kachook jeden Moment dahinter auftauchen. Sie musste nur stehen bleiben und auf ihn warten.
Schließlich gab sie sich einen Ruck und folgte Greg die Stufen hinauf zur Veranda. Es war ganz normal, dass dieser Hauspfahl sie an Jims Arbeiten erinnerte. Jim stammte schließlich aus Neah Bay und hier hatte er auch das Schnitzen gelernt. Sein Meister, Matthew Ahousat, war ein angesehener Mann, ein bekannter Holzschnitzer. Vermutlich hatte der Meister neben seiner Kunst und seinen Fertigkeiten auch ein paar stilistische Eigenheiten an Jim weitergegeben.
Greg schloss die Eingangstür auf und ließ Hanna hinein. Von außen hatte das Haus den Eindruck einer primitiven Fischerhütte gemacht, aber das Innere war unerwartet geräumig und bot allen Komfort, den man zum Leben brauchte. Sie standen in einer offenen Diele, von der aus vier Holzstufen in den tiefer liegenden Wohnraum führten. Ein großes Panoramafenster, das bis auf den Boden reichte, öffnete den Blick zu einer sandigen Bucht.
Nachdem Greg sich ächzend seiner Turnschuhe entledigt hatte, öffnete er eine Tür rechts neben ihr, die in ein voll ausgestattetes Badezimmer führte.
»Nehmen Sie ein heißes Bad«, sagte er, »damit Sie warm werden. Saubere Handtücher sind im Regal.«
Unschlüssig stand Hanna in der Tür und blickte sehnsüchtig auf die Badewanne.
Greg wurde allmählich ungeduldig. »Nun machen Sie schon. Die Tür hat einen Riegel.«
Riegel war das Zauberwort. Hanna zerrte ihre Schuhe von den Füßen und verschwand im Bad. Sie schloss die Tür ab und quälte sich aus ihren nassen Kleidern. Fünf Minuten später saß sie in der Wanne, erholte sich von dem Schrecken und wärmte ihre Glieder. Schaumkronen türmten sich auf der Oberfläche. Als sie das Wasser abdrehte, hörte sie Greg in der Diele mit jemandem sprechen.
»Ich weiß, dass das Geländer neu war, Oren. Aber sie ist nun mal da runtergefallen … Nein, sie ist okay … nichts passiert.«
Eine Pause entstand und Hanna wurde klar, dass Greg telefonierte. Vermutlich sprach dieser Oren (wer auch immer das war) am anderen Ende der Leitung.
»Ja, verdammtes Glück«, erwiderte ihr Retter. »Sie ist nur ein Fliegengewicht, sonst hätten die Wurzeln viel eher nachgegeben und sie wäre auf die Uferfelsen geschlagen. Du musst den Pfad zum Kap schnellstens absperren lassen, Chief.«
Hanna hörte Greg laut niesen, danach war es still. Er hatte aufgelegt.
Fliegengewicht, dachte sie empört.
Aber das Telefonat hatte ihre letzten Ängste, in die falschen Hände geraten zu sein, zerstreut. Offenbar hatte Greg mit dem örtlichen Hüter des Gesetzes gesprochen. Mit ihrem Misstrauen hatte sie sich lächerlich gemacht. Hanna hoffte, Greg würde es nicht persönlich nehmen.
Hanna spürte, wie sich ihr Körper im heißen Wasser langsam entkrampfte. Die Spannung in Rücken und Nacken löste sich und zuletzt auch in ihrem Kopf. Sie hätte ewig so liegen bleiben können, in diesem duftenden, warmen Mikrokosmos, losgelöst von der realen Welt. In diesem Moment war Deutschland so weit weg, als hätte sie es schon vor einer Ewigkeit verlassen und nicht erst am Tag zuvor.
Während sie sich abtrocknete, sah sie sich im Badezimmer um. Sie hatte recht gehabt mit ihrer Vermutung – augenscheinlich lebte Greg allein. Keine Spur von einer Frau oder Kindern im Badezimmer. Auf der Ablage vor dem Spiegel lagen eine Zahnbürste und Rasierzeug. Sie suchte nach einem Föhn, fand aber keinen und in den Schränken wollte sie nicht nachsehen.
Barfuß und nur bekleidet mit einem dunkelblauen Bademantel, der so groß war, dass sie beinahe darin verschwand, machte Hanna sich auf die Suche nach ihrem Lebensretter. Auf der anderen Seite der Diele entdeckte sie die Küche mit einer modernen Küchenzeile, einer Abzugshaube über dem Herd und einem Geschirrspüler. An Haken über der Arbeitsplatte hingen sauber geschrubbte Töpfe, denen man den häufigen Gebrauch ansah. Auf dem Herd grummelte ein Teekessel vor sich hin.
Sie fand Greg, wie er vor dem Kamin im offenen Wohnraum kniete und Treibholzstücke auf die Flammen schichtete. Das Feuer prasselte und der herbe Duft von Zedernholz und Meer breitete sich aus. Die Flammen auf den ausgeblichenen Holzstücken züngelten bläulich.
Dieser Mann konnte wirklich Gedanken lesen. Ein Kaminfeuer war genau das, was sie jetzt brauchte. Greg stützte seine Hände auf die Oberschenkel und erhob sich. Als sein Blick auf Hanna fiel, umspielte ein Lächeln seine Lippen. »Der Bademantel steht Ihnen.«
Hanna wurde rot, was ihn noch mehr zu amüsieren schien. Greg hatte sich umgezogen, er trug saubere Jeans und ein langärmeliges schwarzes Baumwollhemd mit dem Aufdruck eines alten Fotos, das eine Gruppe Indianer mit Gewehren zeigte. Darunter stand »Homeland Security«.
»Setzen Sie sich ans Feuer, ich bringe Ihnen einen heißen Tee«, sagte er.
Hanna kauerte sich in einem der beiden Ledersessel zusammen, die direkt vor dem Kamin standen, sodass die Wärme des Feuers ihren Körper bestrahlte und ihre Haare trocknen würde.
Greg verschwand in der Küche und kam mit zwei großen Keramikbechern zurück, die mit Motiven der Nordwestküste bedruckt waren. »Hier«, sagte er und reichte Hanna einen Becher. »Der Tee wird Sie von innen wärmen.«
»Danke.« Hanna legte ihre Hände um den Becher und ließ den Tee ein wenig abkühlen, bevor sie ihn kostete. Er schmeckte nach Brombeerblättern und Greg hatte ihn mit Honig gesüßt, was sie rührend fand.
»Besser?« Er setzte sich auf die Lehne des anderen Sessels und trank einen Schluck aus seiner Tasse. Seine Haare waren fast trocken und fielen ihm in Strähnen auf die Schultern. Er sah gut aus, aber das sollte sie nicht denken – nicht in dieser absurden Situation.
»Ja, mir geht es bestens.« Hanna nippte von ihrem Tee und genoss die heiße Süße. »Sie haben mir das Leben gerettet, Greg. Ich bin Ihnen unendlich dankbar.«
Auch dafür, dass Sie mich nicht zum Nachtisch verspeist haben.
Greg winkte ab. »Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Wenn Sie nicht so mutig gesprungen wären, hätte ich eine Menge Scherereien gehabt.«
»Scherereien haben Sie trotzdem mit mir«, meinte Hanna zerknirscht. »Tut mir leid, dass ich nicht gleich auf Sie gehört habe. Ich hatte furchtbare Angst und konnte nicht glauben, dass es funktionieren würde.« In Wahrheit konnte Hanna es immer noch nicht fassen, dass sie den Sprung völlig unbeschadet überlebt hatte.
»Sie haben keinen Laut von sich gegeben, als Sie gefallen sind«, sagte Greg und musterte sie eindringlich.
Sie hielt seinem Blick stand. »Ich habe versucht, die Luft anzuhalten. Aber unter Wasser hatte ich auf einmal keine mehr.«
»Das war der Schock«, sagte er.
Hanna hatte ihren Tee ausgetrunken und Greg fragte, ob sie noch einen zweiten Becher wollte.
»Gerne.« Sie lächelte ihn an. »Er wärmt tatsächlich von innen.«
Greg nahm ihren Becher und ging in die Küche. Hanna ließ ihren Blick durch den spärlich eingerichteten Raum gleiten. Die Wände waren in Holz belassen worden und auch der Boden bestand aus einfachen Dielen. Zwei breite Holzpfeiler stützten den Dachaufbau. Sie waren mit Schnitzereien verziert, aber nicht bemalt, genauso wie der Pfahl draußen vor dem Haus.
Der Kamin nahm viel Platz ein und prall gefüllte Bücherregale bedeckten die gegenüberliegende Seite. Die dritte Wand wurde fast vollständig von dem Panoramafenster eingenommen, das man nicht sah, wenn man direkt vor dem Haus stand. Die dicke Scheibe war mindestens vier Meter breit und drei Meter hoch. Auf den Dielen davor lag ein auffallend schöner Webteppich, ungeheuer dick und in Pastellfarben gemustert. Es war eine Navajoarbeit aus Arizona, ein besonders wertvolles Stück, wie Hanna zu erkennen glaubte.
Ihr Blick schweifte über die Einrichtung, den niedrigen Tisch, einen großen LCD-Fernseher, die Stereoanlage. Ein paar CDs lagen daneben auf dem Boden. Bob Dylan, die Rolling Stones, John Trudell, Led Zeppelin.
Greg kam zurück und reichte Hanna den dampfenden Teebecher. Sie nahm ihn entgegen und bedankte sich.
»Wohnen Sie ganz allein hier?« Hanna sah aus dem Fenster aufs Meer hinaus. Der Wind hatte aufgefrischt und auf der Brandung trieben Schaumkronen. Die Wolken brachen auf und schoben sich wieder zusammen. Sie wechselten ständig ihre Farben und Formationen.
»Ich wohne mit meinem Vater zusammen. Er hat dieses Haus selbst gebaut.«
Gefesselt von den wechselnden Bildern hinter der Scheibe, reagierte Hanna nicht gleich auf Gregs Antwort. Erst nach einer Weile wurde sie sich ihres eigenen Schweigens bewusst. »Was?« Irritiert blickte sie ihn an.
»Sie haben mir gerade eine Frage gestellt«, erinnerte er sie verwundert.
»Tut mir leid, aber für einen Moment war ich so gebannt von diesem Ausblick, dass ich … Sie und Ihr Vater, sagten Sie?«
»Ja. Mein Vater und ich.«
War da ein bitterer Unterton in seiner Stimme gewesen? Sie sah ihn an, aber seine Miene war ausdruckslos. »Wäre dies mein Haus«, sagte sie, »würde ich vermutlich den ganzen Tag auf diesem wunderschönen Teppich liegen und nichts anderes tun, als auf den Ozean hinauszustarren.«
Greg folgte ihrem Blick. »Ich bin lieber unten am Strand und lasse mir den salzigen Wind um die Nase wehen.« Er erhob sich und hockte sich vor den Kamin, um mit einem eisernen Haken die Glut zusammenzuschieben und neues Holz nachzulegen. »Ach, übrigens habe ich unserem Polizeichef gemeldet, was passiert ist«, wechselte er das Thema. »Das Geländer muss schnellstens repariert werden. Der Chief war sehr besorgt, dass es Gerede geben könnte.«
Gerede?
»Was für Gerede meinen Sie?«
»Na ja«, Greg hob die Schultern, »einige von uns versuchen gerade, Neah Bay ein wenig attraktiver für Touristen zu gestalten. Wissen Sie, die meisten Leute hier leben vom Fischfang. Aber die Ausbeute wird immer spärlicher, weil ausländische Fangflotten und Sportfischer uns unsere Fischgründe streitig machen. Kunsthandwerk und Tourismus sind eine Chance, das auszugleichen. Wir leben hier ziemlich isoliert vom Rest der Welt, das macht es nicht leichter. Wenn die Sache mit dem Geländer erst publik wird, dann …« Greg atmete hörbar ein und setzte sich in den anderen Sessel.
»Keine Sorge, ich werde schweigen wie ein Grab. Es ist ja nichts passiert.«
Er sah ins Feuer, doch sein skeptischer Blick war ihr nicht entgangen.
»Was ist denn?«, fragte sie. »Glauben Sie mir nicht?«
»Sie wollen kein Schmerzensgeld verlangen?«
»Nein, mir tut ja nichts weh. Am liebsten würde ich die ganze nasse Angelegenheit so schnell wie möglich vergessen. Schließlich bin ich nicht den weiten Weg aus Deutschland hierhergekommen, um mich mit Anwälten herumzuschlagen.«
Sie schüttelte den Kopf und lehnte sich in ihrem Sessel zurück. Dass Greg sich über solche Dinge Gedanken machte, amüsierte sie. Andererseits musste er sie für eine gewöhnliche Touristin halten und konnte nicht wissen, warum sie den weiten Weg aus Deutschland wirklich gemacht hatte.
2. Kapitel
Deutschland.
Greg Ahousat hatte plötzlich das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Hanna war Deutsche, und das änderte alles.
Dass sie keine Amerikanerin war, hatte er sich bereits denken können. Ihr Englisch war gut, aber er hatte gemerkt, dass es nicht ihre Muttersprache war. Dass sie jedoch ausgerechnet aus Deutschland kam, traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Greg fühlte, wie Zorn an einer wunden Stelle aufstieg, und er wusste, dass er nichts, aber auch gar nichts dagegen tun konnte.
»Gut.« Abrupt sprang er auf. »Wenn Sie mir den Autoschlüssel geben, dann hole ich Ihren Wagen, damit Sie an Ihre Sachen kommen und sich umziehen können.«
Und aus meinem Haus verschwinden, fügte er stumm hinzu. Plötzlich wollte er Hanna so schnell wie möglich loswerden.
Sie schien seinen Stimmungswechsel nicht bemerkt zu haben. »Es ist ein roter Chevy Casanova«, sagte sie, »einen Moment, ich hole den Schlüssel.«
Sie verschwand im Bad, kehrte aber wenig später mit zerknirschtem Gesicht in die Diele zurück. »Tut mir leid, aber der Schlüssel muss mir während des Sturzes aus der Tasche gefallen sein. Er ist nicht mehr da. So ein verdammter Mist.« Sie kaute auf ihrer Unterlippe und ihre grünen Augen funkelten ärgerlich.
Es ist nicht ihre Schuld, dachte Greg. Und trotzdem – er verspürte keine Lust mehr, etwas Mitfühlendes zu sagen. »Auch das noch«, erwiderte er und musterte die Deutsche kühl. Auf einmal sah er sie mit ganz anderen Augen. Ihr von der Hitze des Feuers gerötetes Gesicht war von unzähligen winzig braunen Punkten übersät, die sich auf der Nase konzentrierten.
Greg dachte an die Maske eines indianischen Künstlers, die er vor ein paar Jahren im Burke Museum gesehen hatte. Sie war aus Holz geschnitzt und stellte einen Weißen mit braunen Sonnenflecken im Gesicht dar. Die dunklen Punkte bestanden aus Perlmuttsplittern, die in das Holz eingelegt waren. Die Maske war bemalt gewesen. Helle Haut und rotes Haar.
Alles wiederholt sich, dachte er.
Nur mit Mühe vermochte Greg, seinen Unmut zu verbergen. »Ich fahre zum Kap, mal sehen, was sich machen lässt«, rang er sich ab. »Wenn das Telefon klingelt, lassen Sie es klingeln. Alles, was Sie zu tun haben, ist, das Feuer in Gang zu halten.« Er hörte die Feindseligkeit in seiner Stimme und wollte nur noch weg.
»Danke«, sagte Hanna, die immer noch nichts von seinem Stimmungsumschwung bemerkt zu haben schien. »Der Schlüssel hat einen ziemlich auffälligen roten Plastikanhänger. Ein Werbegeschenk von einer Computerfirma. Ich habe ihn gleich angebracht, nachdem ich den Wagen abgeholt hatte, weil ich meine Schlüssel immer verlege.«
Greg nickte und verließ das Haus. Während der Fahrt zum Kap versuchte er, seinen Zorn und seine Abneigung zu bekämpfen, um seine Objektivität wiederzuerlangen.
Doch es wollte ihm nicht gelingen.
Hanna kam aus Deutschland, das war Grund genug, ihr nicht zu trauen.
Oben am Kap inspizierte Polizeichef Oren Hunter die Absturzstelle. Der große stämmige Mann mit kurzem Haar und stolzem Schnauzbart verstand die Welt nicht mehr. Kopfschüttelnd, die mächtigen Fäuste in die Hüften gestemmt, stand er da und blickte auf das dunkelblaue Meer hinunter, auf dem noch Teile des kaputten Geländers trieben. Hunter untersuchte die Teile des Geländers, die nicht ins Meer gefallen waren. Irgendetwas stimmt da nicht, dachte er. Irgendetwas, das ihm überhaupt nicht gefiel.
Chief Oren Hunter wurde in zwei Monaten sechzig und sah seiner Pensionierung entgegen. Für den Rest seines Berufslebens hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, jeglichen Aufruhr zu vermeiden, der nichts als Ärger nach Neah Bay brachte. Denn Ärger hatte er schon mehr als genug. Der Bau des Steges und der Aussichtsplattform am Kap war im Rat genauso heiß umstritten gewesen wie der Bau des Jachthafens. Einige Makah wollten, dass in ihrem Reservat alles so blieb, wie es war.
Jahrelang war der Tourismus für die Makah nicht mehr als ein notwendiges Übel gewesen. Das einzige Motel von Neah Bay war so heruntergekommen gewesen, dass es in keinem Reiseführer auftauchte. Die Ausschilderung im Ort schaffte mehr Verwirrung als Klarheit und die abweisende Haltung der Einheimischen, die jeden Fremden als Störung empfanden, trug das Übrige dazu bei.
Nur Hartgesottene ließen sich nicht von derartigen Unannehmlichkeiten schrecken. Die Einzigen, die ein wenig Geld nach Neah Bay brachten, waren Archäologen, Ethnologen, Ornithologen, Sportfischer und eben einfache Reisende, die von den Schönheiten des Kaps erfahren hatten.
Die wirtschaftliche Situation des Reservats war prekär. Die Hälfte der Makah war arbeitslos und bekam Sozialhilfe. Viele Familien lebten unter der Armutsgrenze, denn die Jobs in Neah Bay und Umgebung waren rar.
Ein Dutzend Männer und Frauen arbeitete im Clallam-County-Gefängnis. Der Stamm hatte ein paar Forstarbeiter eingestellt – aber die meisten Familien lebten vom Fischfang. Die Fischfabrik im Hafen lief jedoch längst nicht mehr so gut wie früher. Die Maschinen in der kleinen Konservenfabrik waren alt und gingen ständig kaputt, wodurch es laufend zu Produktionsausfällen kam. Außerdem blieben die großen Fänge immer öfter aus. Der Kuroshio, die warme, salzreiche Meeresströmung von der japanischen Ostküste, trieb nicht mehr so viele Fische wie früher in die Küstengewässer vor dem Kap.
Aus schierer Existenznot hatten die Makah entschieden, in Zukunft Touristen an der Schönheit ihres Landes und ihrer Kultur teilhaben zu lassen. Ein buntes Faltblatt, das kostenlos in jedem Touristenbüro auf der Olympic-Halbinsel auslag, pries Cape Flattery mit seinen Felsenhöhlen und der einmaligen Vogelwelt als Geheimtipp an. Erleben Sie die Schönheit dieser abgeschiedenen Ecke der Welt!
Mit Unterstützung des Washington State Departements of Natural Resources waren der Steg, die Plattform und die Brüstungen gebaut worden. Das Makah Museum am Ortseingang lockte mit Sonderausstellungen und Workshops. Der Strand, der lange Zeit ausschließlich von Reservatsangehörigen genutzt werden durfte, war der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden – allerdings nur unter strengen Auflagen. Im vergangenen Jahr war der Ausbau des Jachthafens abgeschlossen worden. Es gab Duschen, Toiletten und einen Waschsalon für die Jachtbesitzer.
Helma Ward hatte das Clamshell Motel übernommen und es mithilfe ihres Sohnes renovieren lassen. Die Investition hatte sich gelohnt, Touristen, Wissenschaftler und Bootsbesitzer nutzten gerne die sauberen und hübsch gestalteten Unterkünfte.
Die Öffnung von Neah Bay für den Tourismus war vor drei Jahren auf einer öffentlichen Versammlung mit geringer Mehrheit entschieden worden. Die Makah wollten ihre Traditionen wahren, aber nicht in der Vergangenheit stecken bleiben. Der Beschluss änderte allerdings nur wenig an der Auffassung einiger Traditionalisten, dass Fremde im Ort und an den Stränden nichts zu suchen hatten.
Oren Hunter war sich noch nicht sicher, auf welcher Seite er wirklich stand. Als Polizeichef von Neah Bay war er verantwortlich für Gesetz und Ordnung. Aber er stammte auch aus einer angesehenen Familie, deren Mitglieder die alten Bräuche wahrten und lebendig hielten. Tradition und Fortschritt schienen hier, am Ende der Welt, unvereinbar.
War es richtig, am Alten festzuhalten, um es zu bewahren, oder war es besser, es loszulassen, um etwas Neues daraus zu machen?
Mit dem Daumen fuhr Hunter über eine Schnittstelle am Holz und bückte sich tiefer, um diesen Teil des Geländers näher zu untersuchen. Kopfschüttelnd richtete er sich wieder auf.
Ja, hier stimmte etwas nicht. Das Ganze war kein Unfall gewesen. Jemand hatte das neue Geländer präpariert, sodass es unter dem Gewicht eines Körpers nachgeben musste. Jemand hatte den Tod eines Menschen in Kauf genommen, vielleicht sogar geplant.
Hunter straffte die Schultern. Ärger hin oder her – es war sein Job, denjenigen zu finden und dafür einzusperren.
»Was macht dein Onkel denn da?«, fragte Grace Allabush, die – verborgen hinter einem Strauch – neben Joey Hunter hockte und den Polizeichef vom Rand der gegenüberliegenden Steilküste aus beobachtete.
»Keine Ahnung«, Joey zuckte mit den Achseln. »Sieht so aus, als ob das Geländer kaputtgegangen wäre.«
»Aber das ist doch erst ein paar Wochen alt.«
»Na ja, ich nehme an, aus diesem Grund ist mein Onkel da.«
Grace Allabush warf ihrem Freund einen Blick zu. Er war ein gut aussehender Junge mit feinen Gesichtszügen und klugen Augen. Sie waren so schwarz wie sein Haar, das er schulterlang trug, um zu zeigen, dass die alten Bräuche ihm etwas bedeuteten.
Doch der siebzehnjährige Neffe des Polizeichefs war keiner von diesen Eiferern, die am liebsten die alten Zeiten zurückholen würden. Joey ging auf die Highschool. Er war zwei Klassenstufen über ihr und Grace wusste, dass er das Lernen sehr ernst nahm. Er wollte studieren und später Anwalt werden.
Letzteres imponierte Grace. Aber viel wichtiger war ihr, dass Joey nach dem Studium hierher zurückkommen wollte, nach Neah Bay, wo er sein ganzes bisheriges Leben verbracht hatte.
Sie hatte sich in ihn verliebt, weil er anders war als die meisten Jungs im Ort. Er war kein Schwätzer, kein Angeber. Von Alkohol und Drogen hielt er sich fern, sonst hätte sie sich gar nicht erst mit ihm eingelassen. Joey Hunter war klug, fair und ernst. Ein bisschen zu ernst, wie sie manchmal fand.
Grace kannte all seine Geheimnisse und er ihre. Beide trugen eine Bürde aus der Vergangenheit mit sich herum, aus einer Zeit, in der sie noch gar nicht geboren waren. Seit drei Monaten waren sie nun schon zusammen, aber weder Joeys Mutter noch Grace’ Urgroßmutter Gertrude wussten etwas davon. Grace fürchtete, ihre Granny könne etwas gegen Joey Hunter haben. Das hatte etwas mit den alten Regeln ihres Volkes zu tun. Mit einem Teil der Vergangenheit, dessen Existenz sie am liebsten leugnen würde.
Ihre Granny hatte ihr oft von den alten Zeiten erzählt, in denen das Volk der Makah sich noch in drei Klassen teilte: die Ranghohen, die Gemeinen und die Sklaven. Die Familien der Walhäuptlinge und Schnitzkünstler waren von hohem Rang. Erstere, weil sie mit dem Walfleisch für das Überleben der Familien sorgten, und die Holzschnitzer, weil sie wussten, wie die Tiere und Geistwesen auf den Wappenpfählen dargestellt werden mussten, damit sie vom Ruhm der Ahnen berichten konnten.
Die einfachen Leute waren Jäger und Fischer. Ihre Namen waren nicht über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und sie waren nicht wohlhabend genug, um eigene Potlatches auszurichten.
Die auf den Kriegszügen erbeuteten Sklaven zählten zu den Geringsten. Die Oberen besaßen Leibeigene, um sie für sich arbeiten zu lassen und zu zeigen, dass sie wohlhabend genug waren, um sie zu ernähren.
Die weißen Missionare hatten die Sklaverei schließlich verboten. Grace hatte ihre Granny gefragt, was aus den Nachfahren der ehemaligen Sklaven geworden war und ob sie sich mit den anderen Makah vermischt hatten. Daraufhin hatte die alte Gertrude brummig abgewunken. »Einmal Sklave immer Sklave«, hatte sie gesagt. »Du bist, wer du bist am Tag deiner Geburt.«
Grace war ein Allabush-Mädchen, deren Wurzeln bis zu den Anfängen der Zeit zurückreichten. Sie trug die Verantwortung, das alte Wissen, ihr Makah-Erbe, für die kommenden Generationen zu bewahren. Alles Wichtige hatte sie von ihrer Granny erfahren und auswendig gelernt. Die Wahrheit des alten Wissens war nicht verloren, wie viele in Neah Bay glaubten. Aber es waren Zeiten großer Veränderungen und Prüfungen für das Volk der Makah. Alles war in Bewegung, was vergessen war, musste wiedererlernt werden. Grace sah in ihrer Aufgabe eine Bürde, aber auch eine Möglichkeit. Die Möglichkeit zu verhindern, dass die alten Fehler der Vergangenheit sich wiederholten.
Von ihrer Granny wusste sie, dass Generationen von Allabush-Frauen auf die Liebe eines Mannes verzichtet und ihre Träume den Wellen übergeben hatten. Doch Grace hatte keineswegs vor, auf Joeys Liebe zu verzichten, auch wenn das Probleme mit sich bringen würde.
Einst selber hochgeboren, waren die Vorfahren von Joeys Mutter Sklaven eines Makah-Walfängers gewesen, das wusste Grace schon lange. Einmal hatte sie mitbekommen, wie in der Schule jemand über Joeys Herkunft gelästert hatte. Aber auch wenn er Sklavenblut in den Adern hatte, für sie war er ebenso viel wert wie die anderen. Nein, viel mehr. Grace Allabush liebte Joey von ganzem Herzen und sie war fest entschlossen, um ihr Glück zu kämpfen.
Ich werde meine Träume nicht den Wellen übergeben.
Grace schmiegte sich an Joeys Arm, sie beugte sich zu seinem Gesicht und er küsste sie. Doch es war ein halbherziger, gedankenverlorener Kuss. Joeys Blick war schon wieder drüben, am Kap bei seinem Onkel. Grace schnaubte entrüstet. »Offensichtlich ist dein Onkel interessanter für dich, als ich es bin«, sagte sie schmollend.
Joey wandte sich ihr zu und es zeigte sich ein verstecktes Lächeln auf seinem Gesicht. Statt etwas zu sagen, zog er sie zu sich heran und küsste sie noch einmal. Diesmal spürte Grace, dass seine Gedanken ganz bei ihr waren. Dass er dasselbe wollte wie sie.
»Komm, lass uns gehen«, sagte er. »Wahrscheinlich wimmelt es hier bald von Leuten.«
»Du hast recht«, sagte sie zu ihm. »Spätestens heute Abend werden wir wissen, was da drüben los war.«
Auf dem Parkplatz von Cape Flattery standen neben Hannas rotem Leihwagen ein VW-Bus mit dem Kennzeichen des Bundesstaates Oregon und die beiden weißen Jeeps der Stammespolizei.
Greg parkte zwischen dem Mietwagen der Deutschen und dem VW-Bus. Als er ausstieg, kamen ein Mann und eine Frau im Outdoor-Look aus dem Wald, die ärgerlich schimpften. Greg nahm an, dass den beiden der VW-Bus gehörte.
Als das Ehepaar einstieg, sagte die Frau zu Greg: »Wir haben einen weiten Weg auf uns genommen, das Kap zu sehen, nur um dann kurz vor dem Ziel von einem Polizisten zurückgeschickt zu werden, der anscheinend zu viele Wildwestfilme geguckt hat. Was ist eigentlich los mit euch Indianern? So bekommt ihr eure Wirtschaft nie in Gang!«
»Tut mir leid«, sagte Greg, »es ist nur zu Ihrer Sicherheit.« Er wollte zu einer längeren Erklärung ansetzen, aber da schlug die Frau die Tür zu und ihr Mann ließ den Motor an. Greg sah dem VW-Bus nach, wie er den Parkplatz verließ, und er dachte, dass es nicht schade war um solche Gäste, die nichts als Unfrieden stiften wollten und sich in allem überlegen fühlten.
Greg umging die Absperrung und schlug den Weg zum Kap ein. Er traf als Erstes auf Bill Lighthouse, der als Sheriff für den Stamm der Makah zuständig war. Der junge Mann stand gleich am Anfang des Pfades hinter einer mächtigen Rotzeder und Greg wäre erschrocken gewesen, hätte er nicht vorher den Geruch von Zigarettenrauch wahrgenommen.
»Hallo Bill«, sagte er, »bist du zum Touristenschreck avanciert?« In seiner dunkelblauen Uniform wirkte der Sheriff auf Greg jedes Mal fremd, obwohl er ihn gut kannte. Bill war fünf oder sechs Jahre jünger als er. Aufgrund des Altersunterschiedes hatten sie als Kinder und Jugendliche nicht viel miteinander zu tun gehabt. Doch Greg mochte den jungen Polizisten, weil er es verstand, mit den Alten und den Jungen gleichermaßen gut auszukommen.
Bill warf brummend seine halb aufgerauchte Zigarette zu Boden und trat sie sorgfältig aus. »Als Sheriff ist man eben immer schlecht dran. Ich kam bis jetzt nicht mal dazu, mir anzusehen, was passiert ist. Und diese Leute waren furchtbar hartnäckig. Sie hätten ein Recht darauf, das Kap zu sehen, haben sie vehement behauptet. Schließlich wären sie extra deswegen von Oregon hier raufgefahren.« Er sah Greg empört an. »Recht! Was für Rechte haben wir denn? Schließlich ist es unser Land.«
»Wie hast du es geschafft, sie davon abzuhalten, ihr Recht einzufordern?«, fragte Greg lächelnd und verlagerte sein Körpergewicht auf sein gesundes Bein. Sein linker Knöchel schmerzte, wahrscheinlich würde es bald Regen geben.
Der Sheriff richtete sich auf, reckte die Brust unter seinem Uniformhemd und stellte sich gewichtig in Positur. Doch selbst jetzt war er immer noch einen halben Kopf kleiner als Greg Ahousat.


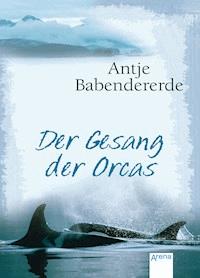
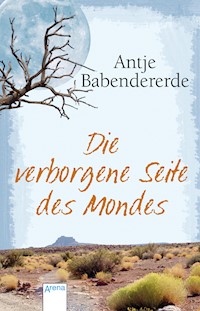



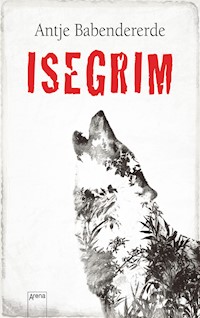
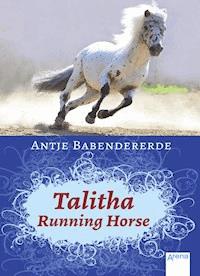

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)