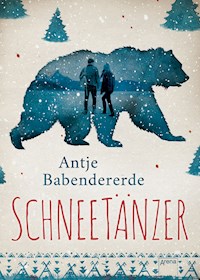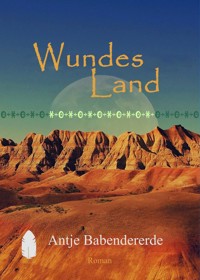
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Auftrag eines Entwicklungshilfeprojektes reist die junge Deutsche Ellen Kirsch nach South Dakota in das Pine Ridge Indianerreservat, der Heimat der Oglala Lakota. Ihr Aufenthalt im Reservat, der mit großen Herausforderungen verbunden ist und in den sie große Hoffnungen setzt, entpuppt sich bald als Albtraum. Nichts ist so, wie sie es sich vorgestellt hat. Ellen, die nicht nur mit den Unbilden des rauen Landes zu kämpfen hat, sondern auch mit der Ablehnung seiner Bewohner, wird zufällig Zeugin eines Verbrechens und muss erkennen, dass schon ganz harmlose Fragen sie selbst in große Gefahr bringen. Sie rettet dem Lakota-Indianer Keenan Kills Straight das Leben und riskiert ihr eigenes, um ihn in Sicherheit zu bringen. Immer mehr erkennt Ellen, dass die Dinge hier nicht so sind wie sie scheinen. Aber sie gibt nicht auf und lernt, sich in der fremden Welt zurechtzufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Antje Babendererde
Wundes Land
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Meiner Familie gewidmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nachwort
Über die Autorin
Impressum neobooks
Meiner Familie gewidmet
Man nennt uns die neuen Indianer.
Zum Teufel, wir sind die alten Indianer,
die Herren dieses Kontinents,
und kommen, die Pacht einzutreiben.
Dennis Banks
1.
Einer nach dem anderen verließen die Passagiere die Eingangshalle des kleinen Flughafens von Rapid City. Die Propellermaschine aus Denver war der letzte Flieger, der an diesem Abend hier gelandet war. Das Gepäckband war bereits leer und in wenigen Minuten würde ich der letzte verbliebene Fluggast sein. Ein Vertreter des Wápika-Dorfprojektes sollte mich abholen. Doch ich wusste weder, wie derjenige hieß, noch, wie er aussah. Ebenso wenig wusste ich, was mich in diesem Land erwartete: South Dakota, Prärieland, Indianerland.
Schon jetzt kam ich mir verlassen vor. Unschlüssig stand ich da, war müde und neugierig zugleich, und fürchtete, man könnte mich vergessen haben. Meine erste Nacht im Wilden Westen auf einem Flughafen zu verbringen, war keine sehr verlockende Aussicht.
Hinter getöntem Glas senkte sich Dunkelheit über grasbewachsene Hügel bis zum Horizont und auf einmal hatte ich ein flaues Gefühl in der Magengegend. War meine Entscheidung, diesen Job anzunehmen, richtig gewesen? Oder hätte das jemand übernehmen sollen, der mehr Erfahrung hatte als ich?
Als Vertreterin des Potsdamer Vereins „Wundes Land“ war ich beauftragt, die Arbeiten am Wápika-Dorfprojekt im Pine Ridge Indianerreservat für die nächsten drei Monate zu betreuen und einen Rechenschaftsbericht über das bisher Erreichte abzufassen. Mit dem Bau von Häusern aus einheimischen Rohstoffen, wollte der Verein die desolate Wohnungssituation der Lakota im Reservat verbessern.
Inga Morgenroth, die Vorsitzende des Vereins, hatte das Projekt vor einem Jahr ins Leben gerufen und die ersten Arbeiten im zukünftigen Dorf persönlich geleitet. Nach einer Winterpause hatten ihre Mitstreiter die Arbeiten wieder aufgenommen. Sie selbst wollte im September für ein paar Tage nach South Dakota fliegen, um die Entwicklung des Dorf-Projektes persönlich in Augenschein zu nehmen. Jetzt war Anfang Juni, und ich würde einige Wochen Zeit haben, um mich mit allem vertraut zu machen. Nach den umfangreichen Vorbereitungen der letzten Wochen hatte ich voller Neugierde und Freude meine Koffer gepackt, war bereit, mich mit Enthusiasmus in meine Aufgabe zu stürzen.
Wie von Geisterhand geschoben, rollte mein Gepäckwagen vor eine der gläsernen Vitrinen, in denen kunsthandwerkliche Arbeiten der Lakota Sioux ausgestellt waren: mit winzigen Glasperlen bestickte Mokassins, Ohrgehänge aus eingefärbten Stachelschweinborsten und auf Lederschnüre gereihte Hornperlen. Ein besonders schöner Traumfänger, der in der Mitte des Glaskastens arrangiert war, zog mich in den Bann. Das Netz aus künstlicher Sehne war verziert mit Perlen, Federn und herabhängenden Lederschnüren. So ganz anders als die Traumfänger ,Made in Taiwan‘, die ich aus dem Esoterik-Laden in Potsdam um die Ecke kannte.
Ich bewunderte die Knüpfarbeit, als ich durch das grobmaschige Netz des Traumfängers hindurch zwei Männer entdeckte, die zuvor noch nicht dagewesen waren. Ein kurzer Blick in die andere Richtung: Kein Zweifel, sie mussten es sein, die mich abholen sollten.
Die beiden Indianer in Jeans und geprägten Lederstiefeln standen reglos unter den Blättern einer riesigen Yuccapalme. Der Ältere von beiden, er mochte so um die fünfzig sein, trug das Haar in zwei geflochtenen Zöpfen, die über seine breite Brust hingen. Der Jüngere war ungefähr in meinem Alter, Anfang oder Mitte dreißig vielleicht. Beide Männer waren auffällig groß, ich schätzte weit über eins neunzig, aber der Jüngere war bedeutend sportlicher. Sein langes Haar fiel ihm offen über die Schultern.
Himmel, dachte ich. Die beiden sind echt.
Im selben Augenblick entdeckte mich der ältere Mann hinter der Vitrine und stieß dem anderen seinen Ellenbogen in die Rippen. Der nickte und sah mich an, taxierte mich mit einem durchdringenden Blick.
Hatte meine Frisur was abgekriegt? Mein Blick irrte durch die Halle auf der Suche nach einer Toilette. Zu spät. Zielstrebig kamen die beiden Männer auf mich zu und ich versuchte mit einem Lächeln mein zerknittertes Aussehen wettzumachen. Doch ihre dunklen Gesichter zeigten keine erkennbare Regung, auch nicht, als sie bei mir angekommen waren, um mich zu begrüßen.
„Miss Kirsch?“, fragte der ältere Lakota. Er hatte ein narbiges Gesicht und seine straffen Zöpfe waren von grauen Strähnen durchzogen. Er sagte „Köösch“ statt „Kirsch.“
Ich nickte und streckte ihm meine Hand entgegen.
Er ignorierte sie und sagte: „Willkommen in South Dakota, Miss. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug?“
„Alles bestens, danke“, sagte ich und ließ meine Hand wieder sinken.
„Ich bin Vine Blue Bird, zweites Mitglied des Stammesrates und Beauftragter für Umweltfragen“, stellte er sich vor. Mit einem Kopfnicken wies Vine auf seinen Begleiter. „Mein Sohn Tom. Er ist der Leiter des Wápika-Projektes und wird sich um Sie kümmern, bis Sie sich im Reservat allein zurechtfinden.“
Tom Blauer Vogel nickte mir nur kurz zu und holte meinen Koffer und die Reisetasche vom Gepäckwagen. Als Vine nach dem schwarzen Lederkoffer mit den Schnappschlössern griff, nahm ich ihn schnell an mich. „Danke, aber das ist nicht nötig. Er ist nicht schwer.“
In diesem speziellen Koffer befanden sich gläserne Röhrchen in bruchsicherer Halterung. Von Inga hatte ich den Auftrag bekommen, sie mit Boden- und Wasserproben aus dem Reservat zu füllen und später an ein Berliner Umweltinstitut zu übergeben. Niemand hier wusste etwas davon. Es war ein Geheimauftrag von Inga und ich fühlte mich gebauchpinselt, weil sie mir die Sache zutraute. Warum alle anderen Vereinsmitglieder und Projektmitarbeiter von diesem Nebenjob Abstand genommen hatten, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.
Inga hatte mir dazu Folgendes anvertraut: Bei Untersuchungen, die im vergangenen Sommer im Rahmen des Dorfprojektes durchgeführt worden waren, hatten zwei deutsche Ärztinnen herausgefunden, dass im Pine Ridge Reservat vermehrt Strahlenschäden auftraten. Die Messwerte einer amerikanischen Umweltorganisation, die von den beiden Ärztinnen ausgewertet worden waren, befanden sich jedoch im normalen Bereich. Deshalb sollte ich unabhängige Messungen einholen, und zwar undercover, denn es bestand der Verdacht, dass die Werte der Umweltorganisation ausgetauscht oder gefälscht worden waren.
„Kommen Sie, Miss Kirsch“, brummte Vine. „Sie sind sicher müde und erschöpft vom Flug und wir haben noch über eine Stunde Fahrt vor uns. Heute Nacht werden Sie Gast in unserem Haus sein. Morgen bringt Tom Sie dann in Ihr Motel nach Martin.“
Ich folgte den beiden nach draußen auf den Parkplatz. Alles schien gut zu laufen und meine Mutter hatte sich umsonst Sorgen gemacht. Sie war davon überzeugt, dass die amerikanischen Ureinwohner sich immer noch wild und schießwütig gebärdeten, während ich felsenfest daran glaubte, dass sie stets die Guten waren.
Als ich meiner Mutter das erste Mal von meinem bevorstehenden Aufenthalt bei den Lakota erzählte, hatte ich ihr nur mit Mühe klarmachen können, dass mein Auftrag keine besonderen Gefahren barg, und ich das Ganze eher als bezahlten Urlaub betrachtete. Es war schließlich Sommer.
Während der Fahrt ins Pine Ridge Indianerreservat saß ich allein auf dem Rücksitz von Vine Blue Birds Ford, der kaum ein paar Tage alt zu sein schien. Alles roch noch ganz neu und war blitzsauber, nur am Sitz vor mir entdeckte ich Spuren von Kinderschuhen.
Ich hatte mir den straffen Gurt über die Brust gezogen, denn ein großes Schild am Straßenrand wies darauf hin, dass Anschnallen im Bundesstaat South Dakota Vorschrift war. Zudem verlieh mir der Gurt ein Stück Sicherheit in diesem kargen Land, von dem ich nicht wusste, ob es Fremden gegenüber freundlich oder feindlich gesinnt war.
Die beiden Männer redeten nicht. Nach den ersten Willkommensfloskeln, die Vine für mich übriggehabt hatte, schwieg er jetzt ebenso beharrlich wie sein Sohn. Ehrlich gesagt, ich hatte ziemlichen Respekt vor den beiden. Vine Blue Bird, mit seinem narbenzerfurchten Gesicht und seinen traditionellen Zöpfen beeindruckte mich enorm. Tom hatte offene, feinere Gesichtszüge und dunkel glitzernde Augen, aber auch er schien auffallend darum bemüht, finster zu wirken.
Ich sah aus dem Fenster. Die Straße vom Flughafen ins Reservat führte zunächst nach Osten. Die letzten Farmhäuser hatten wir bald hinter uns gelassen und wie es schien, auch die letzten Bäume. Der zunehmende Mond ließ die hügelige Landschaft in einem geheimnisvollen Licht erscheinen.
Später machte die Straße einen Bogen in Richtung Süden, und eine Weile, nachdem wir einen geisterhaften Ort namens Scenic passiert hatten, tauchten links und rechts spitze Felsformationen auf. Scharfgratig und vielzackig, bleiche Architekturen aus Lehm. Im Schatten der Täler lag Dunkelheit. Obwohl es auch jetzt noch sehr warm war, zog ich fröstelnd die Schultern nach oben. Da draußen lauern Gespenster auf der Suche nach Leichtsinnigen und Gutgläubigen, dachte ich, und war froh, im sicheren Wagen zu sitzen.
Nach einer Weile drehte Vine Blue Bird den Kopf leicht nach hinten, aber nicht weit genug, um mich tatsächlich sehen zu können. „Morgen werde ich Sie in Pine Ridge mit ein paar wichtigen Leuten vom Stammesrat bekannt machen. Später zeigt Tom Ihnen das Wápika-Dorf, damit Sie sehen, wie weit wir bisher gekommen sind. Natürlich bekommen Sie auch ein Auto. Ohne Auto ist man im Res aufgeschmissen.“
„Das ist sehr freundlich“, bedankte ich mich höflich.
Nach dem, was ich von Inga über die Lakota gehört hatte, war ich darauf vorbereitet, vom ersten Tag an mir selbst überlassen zu sein. Doch wie es aussah, würde man sich um mich kümmern. Inga hatte mich eindrücklich vorgewarnt, was die kulturellen Eigenheiten der Lakota betraf. Zur Sicherheit hatte sie mir ein paar Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben: „Sei zurückhaltend und aufmerksam. Stelle nicht so viele Fragen und erst recht keine Forderungen“, hatte sie mich belehrt. „Kleide dich unauffällig und sieh den Männern nicht offen in die Augen, sie könnten das als Aufforderung verstehen. Beschwere dich nicht und versuche niemals deine Meinung durchzusetzen. Lass sie nicht merken, was du über sie weißt. Du bist zwar gekommen, ihnen zu helfen, aber sie haben das Sagen im Reservat und wir sind auf ihr Wohlwollen angewiesen.“
Diese Regeln hatte ich mir gut eingeprägt, aber jetzt kamen sie mir übertrieben vor. Inga war eine schillernde, selbstbewusste Frau, die erwartete, dass ihre Mitarbeiter genau das taten, was sie sagte. Ihr Verein hatte bereits mehr als hunderttausend Dollar in die Zukunft der Lakota investiert und nun brauchte sie Erfolge, damit ihre Sponsoren auch weiterhin den Geldbeutel zückten.
Ich war dem Unterstützerverein „Wundes Land“ erst vor ein paar Monaten beigetreten, deshalb hatte es mich überrascht, als Inga Morgenroth mit dieser Aufgabe an mich herantrat. Bisher hatte ich nur Büroarbeiten für den Verein erledigt, während einige der anderen Mitglieder schon einmal im Reservat gewesen waren und über die Gegebenheiten dort besser Bescheid wussten als ich. Doch ich hatte etwas anderes zu bieten: Zeit.
In den vergangenen fünf Jahren hatte ich für die Stadt Potsdam als Landschaftsgärtnerin gearbeitet und mir für die kommenden drei Monate beruflich eine Auszeit genommen, um mich neu zu orientieren. Da kam mir Ingas Angebot gerade recht.
In meiner Kindheit war ich großer Fan von sämtliche DEFA- Indianerfilmen gewesen, aber später hatte ich die Indigenen aus den Augen verloren. Meine Reisevorbereitung hatte darin bestanden, dass ich mir sämtliche Indianerfilme reinzog, die seit Winnetou produziert worden waren, und alles las, was Inga mir an Statistiken über die Zustände im Pine Ridge Reservat in die Hand drückte. Was ich erfahren hatte, hatte mich zutiefst erschüttert und ich brannte darauf, den Menschen hier zu helfen.
Dass dieser Job mit Schwierigkeiten verbunden sein könnte, kam mir damals überhaupt nicht in den Sinn.
Irgendwo im Nichts bog Vine von der Hauptstraße ab. Der Ford holperte einen ausgefahrenen Feldweg entlang, dann waren wir da. Endlich. In meinem Zustand hätte wohl jede Hütte mit erleuchteten Fenstern einladend gewirkt, denn ich war todmüde, auch wenn mein Inneres vibrierte wie ein Motor.
Die beiden Männer holten mein Gepäck aus dem Van. Ein paar Holzstufen führten zur Tür des Hauses, in der eine zierliche junge Frau stand und auf uns wartete, die Vine mir als seine Schwiegertochter Billie vorstellte. Sie musterte mich kurz und lächelte zurückhaltend.
„Wie war Ihr Flug?“, erkundigte sie sich höflich.
Zur Begrüßung streckte ich Billie meine Hand entgegen und musste akzeptieren, dass auch sie nicht vorhatte, sie zu ergreifen. Schon bei Vine hatte ich es als eine Art Skepsis mir gegenüber empfunden, dass er meine Hand ignoriert hatte. Erst später sollte ich herausfinden, dass Händeschütteln unter den Lakota etwas Besonderes war. Mit einem herzlichen Händedruck wurde etwas Positives bekräftigt, er war sozusagen eine Ehre. Aber das hatte Inga vergessen zu erwähnen.
„Es ging alles reibungslos“, beantwortete ich schließlich Billies Frage. „Aber nach zwölf Stunden, eingeklemmt zwischen zwei übergewichtigen Amerikanern, findet man alles andere schöner als Fliegen.“
Billi lächelte. „Ich bin noch nie so weit geflogen. Nur einmal von Rapid City nach New York. Und das ist auch schon wieder fast zehn Jahre her.“ Sie deutete mir an ihr zu folgen und führte mich in die Küche.
Der Raum war groß und das helle Neonlicht blendete mich im ersten Moment. Was ich dann sah, war eine nüchterne Einbauküche mit heller Holzmaserung. An den beigen Wänden hingen Fotos mit lachenden Kindern und ein paar vergilbte Poster, unter anderem eins von Sitting Bull, dessen anklagender Blick mich seltsam berührte. Auf sämtlichen freien Flächen lag etwas. Spielzeuge, Bücher und Zeitschriften, aber zumeist waren es angefangene Handarbeiten und die dazu notwendigen Materialien: bunte Stoffe, Lederstücken, Schachteln mit Glasperlen und Spulen, auf die künstliche Sehne gewickelt war.
Inga hatte mir erzählt, dass die Lakota Probleme mit westlicher Wohnkultur hätten. Aufräumen und Sauberkeit würde ihnen Mühe bereiten, die sie nicht immer gewillt waren auf sich zu nehmen. Mein Eindruck von Billie Blue Birds Küche war ein anderer: ihr Arbeitsplatz war blitzblank.
Den Küchentisch hatte Toms Frau mit vier Suppenschüsseln aus Keramik eingedeckt und es roch nach gekochtem Mais.
„Ich habe Wastunkala gekocht, Maissuppe mit Fleisch“, verkündete sie. „Es ist ein traditionelles Lakota-Gericht und ich hoffe, Sie werden es mögen. Deutsche essen nicht alles, hat Tom erzählt.“
Verflixt, dachte ich, jetzt sitzt du in der Tinte. Musste es gleich am ersten Abend passieren? Seit Rinderwahnsinn, Maul- und Klauenseuche und Geflügelpest, war ich überzeugte Vegetarierin. Es hatte mich damals keine große Willenskraft gekostet, auf Steaks und Schinken zu verzichten. Inzwischen löste allein der Gedanke an Fleisch Übelkeit in mir aus.
So wie jetzt.
Was sollte ich tun? Die Familie Blue Bird war überaus gastfreundlich. Wenn ich das Essen ablehnte, würden sie das sicher als Überheblichkeit auffassen und beleidigt sein. Aber Fleisch essen? Unmöglich!
Die Männer kamen in die Küche und setzten sich. Ich stand noch immer unentschlossen da und mein Blick streifte die Gesichter der beiden. Vines wirkte nach seiner anfänglichen Freundlichkeit verschlossen wie eine Auster, und ich hoffte, bei ihm nicht aus irgendeinem Grund in Ungnade gefallen zu sein. Tom sah mich an, als käme ich nicht von einem anderen Kontinent, sondern von einem anderen Stern.
Mir war klar: Wenn ich die Suppe verschmähte, war ich ohne Gnade durchgefallen.
„Ich esse alles“, log ich tapfer, obwohl ich nicht einmal Hunger hatte. Brav setzte ich mich zu den Männern an den Tisch mit der blankgescheuerten Holzplatte.
Während Billie am Herd hantierte, versuchte ich mich von dem abzulenken, was mir bevorstand. Ich beobachtete Toms Frau, bewunderte ihr schimmerndes schwarzes Haar, das sie mit einer perlenbesetzten Spange aus der Stirn zurückgenommen hatte. Trotzdem reichte es ihr bis zur Taille. Ihre Statur wirkte weich und mädchenhaft.
Mein Blick streifte die Fotos an der Wand. „Ihre Kinder?“, fragte ich.
„Ja“, sagte Tom, und ich sah Stolz in seinen Augen aufblitzen.
Billie wandte sich um. „Es sind drei. Zwei Mädchen und ein Junge. Sie schlafen schon, aber morgen werden Sie unsere Kinder kennenlernen.“ Sie stellte einen angeschlagenen Emaille-Topf auf den Tisch und füllte die Suppenschüsseln mit einer großen Kelle.
Ich starrte auf das, was ich essen sollte. Hoffte, dabei nicht zu fassungslos auszusehen, denn Tom beobachtete mich jetzt scharf aus den Augenwinkeln. An der Oberfläche der milchigen Suppe schwammen einzelne gelbe Maiskörner. Dazwischen große gräuliche Fleischstücke. Ich hatte keine Ahnung, von welchem Tier das Fleisch stammte, ich wusste nur eins: Ich musste es essen.
„Es ist Büffelfleisch“, klärte Billie mich auf und nickte mir aufmunternd zu. „Sehr mager und gesund.“
Gesund! Ich hielt den Atem an und griff todesmutig zum Löffel. Beim ersten Bissen hatte ich glücklicherweise nur Maiskörner und kein Fleisch erwischt.
„Vorsicht!“, warnte mich Billie, aber es war schon zu spät.
Die Suppe war so heiß, dass mir Tränen in die Augen schossen. Auf diese Weise wurden gleich beim ersten Löffel sämtliche Geschmacksnerven betäubt und ich brauchte nur noch gegen die Übelkeit in meinem Kopf anzukämpfen. Ich stopfte etwas von dem bräunlich-gelben Fladenbrot in den Mund, das auf einem Teller in der Mitte des Tisches lag. Das Brot linderte das Brennen auf Zunge und Gaumen. Als ich wieder einigermaßen Luft holen konnte, wurde mir klar: Die Suppe schmeckte nach gar nichts, sie war einfach fad. Von Salz und Pfeffer schien Billie Blue Bird nicht viel zu halten.
Um mich und die anderen von meinem ganz persönlichen Problem abzulenken, fragte ich Billie, was sie arbeitete.
„Arbeit habe ich mehr als genug“, antwortete sie. „Einen Job, um Geld zu verdienen, allerdings nicht. Die meisten Leute im Reservat haben keinen Job und leben von Sozialhilfe.“ Sie blickte vom Teller auf und seufzte. „Ich bin gelernte Krankenschwester und habe auch eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet. Aber seit die Kinder da sind, gibt es zu Hause genug zu tun.“
„Ja“, sagte ich. „Das verstehe ich.“
Billie musterte mich kurz und ich merkte an ihrem Blick, dass sie an meinen Worten zweifelte. Sie traute mir nicht zu, überhaupt etwas von ihrem Leben zu verstehen. Damals kränkte mich das ein wenig. Heute weiß ich, dass sie recht hatte.
„Im vergangenen Jahr haben sich einige Frauen von Pine Ridge zusammengeschlossen, um etwas gegen Alkoholismus und Drogen im Reservat zu unternehmen“, fuhr Billie fort. „Ich bin Mitglied dieser Gruppe.“ Sie warf einen kurzen Seitenblick auf Vine, der mürrisch seine Suppe löffelte. „Wir nennen uns Cante Ohitika Win, was so viel bedeutet wie: Frauen mit tapferen Herzen. Unsere Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch, sie kostet Nerven und einen Lohn gibt es nicht. Aber nun sind Sommerferien. Da muss ich mich den ganzen Tag um die Kinder kümmern. Seit die Arbeiten im Wápika-Dorf wieder angelaufen sind, ist Tom dauernd unterwegs und kommt erst spät nach Hause. Die Kinder und ich, wir sehen ihn kaum noch.“
Ich hörte den versteckten Vorwurf wohl heraus, hielt es aber für klug, ihn zu ignorieren. Auch Tom schien ihn überhört zu haben, jedenfalls sagte er kein Wort. Vine hingegen sah seine Schwiegertochter ärgerlich an und zuckte verächtlich die Achseln.
Er mag sie nicht, dachte ich. Vielleicht war er aber auch nur deshalb so voller Unmut, weil Billie versucht hatte, ein persönliches Problem vor einer Fremden zu diskutieren.
Mit einem Mal flogen fremde Laute durch den Raum. Schnelle Sätze auf Lakota. Es war Tom, der mit seinem Vater diskutierte. Vielleicht verteidigt er seine Frau, vielleicht ging es aber auch um etwas ganz anderes. Vine funkelte seinen Sohn zornig an. Dann antwortete er kurz - ebenfalls auf Lakota. Mit einem „Epelo!“, beendete er das Wortgefecht. Später lernte ich die Bedeutung des Wortes kennen. Sie lautete: Ich habe nichts mehr zu sagen.
Mir wurde unbehaglich zumute. Um jetzt noch in einem Familienstreit zwischen die Fronten zu geraten, war ich schlichtweg zu müde und kaputt. Auf die Idee, dass es bei diesem Wortgefecht um mich gehen könnte, kam ich gar nicht.
„Seit wann leiten Sie das Wápika Projekt?“, fragte ich Tom, um wieder auf die Sprache zurückzukommen, die ich verstand.
„Seit einem halben Jahr“, antwortete er, sichtlich dankbar für mein Ablenkungsmanöver.
Inga hatte mir einmal erzählt, dass es häufig zu Auseinandersetzungen zwischen Tom Blue Bird und dem damaligen Leiter des Projektes gekommen war. Deshalb hätte sich der ältere, sehr traditionell eingestellte Mann von dieser Aufgabe zurückgezogen. Ich wusste, dass Inga von Blue Birds Art wenig begeistert gewesen war, doch sie hatte nicht verhindern können, dass die Lakota ihn als neuen Leiter des Dorfprojektes einsetzten.
Tom warf einen kurzen Blick auf die Küchenuhr. „Ich muss noch telefonieren“, murmelte er. Als er hinausging, hörte ich sein leises: „Gute Nacht!“
Billie berührte meinen Arm. „Sie werden viel mit Tom zusammen sein, Ellen.“
Mit einem Mal war da eine Unsicherheit in ihrer Stimme, die ich zuvor nicht bemerkt hatte. Ich sah ihr forschend in die Augen. Für Sekunden waren sie wie ein offenes Tor zu ihrer Seele, das sich aber sofort wieder schloss. Ich ahnte, wovor sie Angst hatte. Mir war nicht entgangen, was für ein attraktiver Mann Tom war. Seine hochgewachsene Statur, die langen schwarzen Haare, sein scharfgeschnittenes Gesicht und die glitzernden dunklen Augen, ließen mit Sicherheit so manches Frauenherz höher schlagen.
Zugegeben, auch auf mich hatte er Eindruck gemacht. Allerdings war Tom äußerst wortkarg, was Schüchternheit bedeuten konnte, aber auch Arroganz. Ich hatte mich noch nicht entschieden, ob ich ihn sympathisch finden sollte oder nicht. Doch ich eins wusste ich mit Sicherheit: Ich war ganz bestimmt keine Gefahr für seine Ehe.
„Er leitet das Dorfprojekt“, sagte ich, und merkte selbst, dass es nach Entschuldigung klang. „Ich kenne die Probleme ja bisher nur vom Papier und bin auf Toms Hilfe angewiesen.“
„Natürlich“, erwiderte Billie und lächelte verlegen.
„Seit Tom die Sache in die Hand genommen hat“, mischte Vine sich ins Gespräch, „geht es draußen im Dorf wenigstens voran. Bei so einem großen Projekt kann man schließlich nicht die Wünsche aller berücksichtigen.“
Obwohl er vermieden hatte, Billie dabei anzusehen, wusste ich, gegen wen dieser Satz gerichtet war. Vielleicht hatte Vine recht, ich konnte das nicht beurteilen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Trotzdem fühlte ich eine eigenartige Solidarität Billie gegenüber, auch wenn sie mich nach wie vor mit Vorsicht behandelte. Es beeindruckte mich, wie sie versuchte, sich gegenüber ihrem Mann und ihrem Schwiegervater zu behaupten.
Schwerfällig erhob sich Vine. „Schlafen Sie gut, Miss Kirsch“, sagte er. „Wir sehen uns morgen.“
Zwar war ich jetzt mit Billie allein in der Küche, doch der Zeitpunkt für eine Annäherung war bereits verstrichen.
„Ich zeige Ihnen das Bad und wo Sie schlafen werden“, schlug sie vor. Ich nickte dankbar und folgte ihr.
2.
Am nächsten Morgen holte mich ein Klopfen aus dem Schlaf. Mein erster Gedanke war: Wo zum Teufel bin ich? Dann, als die Gesichter auf den Postern an den Wänden Konturen annahmen, kam die Erinnerung langsam zurück.
Eric Schweig, der schöne Uncas aus „Der letzte Mohikaner“, blickte mich traurig an. Und da waren auch noch andere alte Bekannte aus Filmen, die ich mir auf Video angesehen hatte: Kevin Costner und Graham Greene, wobei Costner inzwischen mit Filzstift eine Brille und einen Kinnbart bekommen hatte, was ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit General Custer verschaffte.
Direkt über meinem Bett hing ein wunderschöner roter Traumfänger und da wusste ich auch wieder, wo ich war: im Pine Ridge Indianerreservat, im Haus der Familie Blue Bird.
Erschrocken schaute ich auf meine Armbanduhr. Halb zehn. Ich hatte geschlafen wie ein Murmeltier. Du meine Güte, dachte ich, das fängt ja gut an: Gleich am ersten Tag verschlafen.
„Ja“, rief ich, aber es war schon zu spät. Ein etwa fünfjähriger Junge, barfuß und in kurzen Hosen, stand in der Tür und grinste mich an.
„Frühstück!“, krähte er und sauste davon. Ich eilte ins Bad, das an diesem Morgen auch nicht anders aussah als am gestrigen Abend. Verstreut auf dem Boden und auf sämtlichen Ablageflächen lagen schmutzige Kleidungsstücke. Ich schob sie beiseite. Im Waschbecken fanden sich Spuren von Zahnpasta und schwarze lange Haare. Ich freute mich auf mein Motelzimmer.
Für meinen ersten offiziellen Auftritt im Reservat wählte ich eines der beiden Kleider, die ich mitgenommen hatte. Das ärmellose dunkelgrüne mit dem kleinen Ausschnitt, das mir bis über die Knie reichte. Mein widerspenstiges Haar bändigte ich im Nacken mit einem Flechtgummi. Ein Hauch Lippenstift und meine Lieblingsohrringe, so fühlte ich mich äußerlich gewappnet. Doch in meinem Inneren sah es anders aus: Ich war entsetzlich aufgeregt.
Als mir auf dem Flur der Geruch von gebratenem Fleisch in die Nase stieg, erstarrte ich und ahnte Schlimmes. Nicht schon am Morgen, hoffte ich. Aber als ich in die Küche trat, wurden meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Vine hatte ein halb durchgebratenes Steak auf seinem Teller und verspeiste es mit Ketchup.
Der Geruch machte mich benommen, aber ich registrierte, dass Billie ein ganz normales Frühstück für sich und ihre Familie hergerichtet hatte: Toastscheiben lagen auf einem Teller, Honig und Marmelade standen auf dem Tisch. Toms Frau stand am Herd und wendete Pfannkuchen.
Ich murmelte ein halblautes „Guten Morgen“ und setzte mich.
Billie stellte mir ihre Kinder vor: Gordon war der Fünfjährige, der mich geweckt hatte. Cub, seine jüngere Schwester, war drei Jahre alt, und Shannon, die Älteste, war acht. In ihrem Zimmer hatte ich geschlafen. Gordon und Shannon beobachteten mich mit zurückhaltendem Interesse, während ich vorsichtig an dem heißen Getränk in meiner Tasse nippte, dass ich seiner Farbe nach für Tee gehalten hatte, und das sich nun als Kaffee entpuppte.
Die Gesichter der Kinder waren dunkel und die funkelnden schwarzen Augen schienen in der Familie zu liegen. Gordon blinzelte mich an und spreizte Zeige- und Mittelfinger zu einem V-Zeichen, ohne, dass die anderen es merkten. Offensichtlich war er der Einzige im Raum, der mit meiner Anwesenheit keine Probleme hatte. Ich zwinkerte ihm zu. Wir verstanden uns auch ohne Worte ganz gut.
Billie war damit beschäftigt, die köstlich dicken Pfannkuchen so schnell zu produzieren, wie sie verspeist wurden. Tom alberte mit seiner jüngsten Tochter, die ihm auf den Knien herumkletterte und Vine sortierte irgendwelche Unterlagen auf seinem Schoß. Ganz normaler Familienalltag. Was hatte ich auch erwartet? Dass sie schon am Morgen politische Reden führen oder irgendwelche Zeremonien abhalten würden? Ellen, wach auf!
Ich aß einen der daumendicken Pfannkuchen mit Honig, und obwohl er köstlich schmeckte, war mir klar, dass diese Art Kost auf Dauer ungesund war. Laut Inga waren viele Lakota im Reservat übergewichtig und litten unter Diabetes, weil die Umstände es ihnen schwer machten, sich gesund zu ernähren.
„Aber ihnen fehlt auch das Interesse daran“, hatte Inga mir erzählt. Deshalb gab es im Dorf eine Ernährungsberaterin, die die Leute aufklären sollte.
Für mich würde das Essen kein Problem mehr darstellen, wenn ich erst in meinem Motelzimmer wohnen und mich selbst versorgen konnte. Ich hoffte, es hatte einen Kühlschrank.
Als Vine zum Aufbruch drängte, war ich erleichtert. Draußen musste ich zusehen, wie mein kostbares Gepäck im Kofferraum eines Wagens verschwand, der dem äußeren Anschein nach mindestens fünfzig Jahre alt war. Jemand hatte dem Thunderbird mit Pinsel und Farbe einen dunkelgrünen Anstrich gegeben, der an manchen Stellen wieder abzublättern begann. Darunter kam die ursprüngliche Farbe, ein schmutziges Gelb zum Vorschein, was den Wagen von Weiten wie ein Tarnfahrzeug aussehen ließ.
Da wurde mir klar: Es war dieses riesige Gefährt, das man mir für die nächsten Wochen als fahrbaren Untersatz zugedacht hatte.
Ich sah mich um. Im nüchternen Licht des Vormittages wirkte die Gegend einsam und trostlos. Fast überall nichts als trockenes Gras. Nur das Haus der Blue Birds stand vor einem Pappelwäldchen unweit der Straße.
Auf der anderen Seite, ungefähr ein oder zwei Meilen entfernt, begannen die Ausläufer der Badlands, dieser mondähnlichen Karstlandschaft, die sich laut Karte über den nördlichen Teil des Reservats erstreckte, und die ich am gestrigen Abend nur vage wahrgenommen hatte.
Tom trat neben mich und wies auf die Badlands. „Wir nennen sie Maco Sica, Schlechtes Land. Aber so schlecht ist es gar nicht“, behauptete er lächelnd. „Unsere Vorfahren lebten in den weißen Bergen und hielten ihre Zeremonien dort ab. Ihre Geister sind immer noch dort.“
Geister? Auch das noch.
Tom setzte sich in den Thunderbird und öffnete mir die Beifahrertür. Ich winkte den Kindern, die auf den Holzstufen vor dem Haus herumturnten und stieg ein. Vine fuhr in seinem nagelneuen kirschroten Ford voraus und Tom chauffierte mich in dem riesigen alten Gefährt hinterher. Er hatte sein Haar im Nacken mit einem Lederband zusammengenommen und trug eine dieser verspiegelten Sonnenbrillen, in denen man sich selbst sah, wenn man dem anderen in die Augen blicken wollte.
„Baujahr 1970“, klärte Tom mich auf und klopfte liebevoll auf das verstaubte Armaturenbrett des alten Autos. „Aber der T-Bird fährt noch sehr gut. Er ist sozusagen unser Leihwagen. Wenn besondere Gäste kommen, dann geben wir ihnen unseren Froggy. Das ist sein Name. Für die nächsten drei Monate gehört er dir.“
Für besondere Gäste! Du meine Güte. Aber ich mochte Froggy sofort, zumal der äußere Schein trog. Der Wagen fuhr gut und klapperte kein bisschen. Man schaukelte darin wie in einem Boot. Das Auto hatte beige Kunstledersitze, eine Klimaanlage und ein Radio. Und jemand hatte versucht, es wenigstens vom gröbsten Dreck zu befreien.
Froggys Motorhaube streckte sich dem Horizont entgegen und irgendwo weit hinten verschmolz die Heckklappe mit dem Asphalt der Straße. Am Rückspiegel hing ein kleiner, besonders schön gearbeiteter Traumfänger und ich berührte das Netz mit den Fingern.
„Die Perle“, erklärte Tom, „symbolisiert eine Spinne, die das Netz des Lebens webt. Es fängt die Träume auf. Die schlechten fallen durch das Loch in der Mitte, die guten gleiten über die Federn und Bänder in den Kopf des Träumers.“ Er zeigte auf den Traumfänger und sagte: „Er gehört dir. Du kannst ihn im Wagen lassen oder ihn im Motel über dein Bett hängen.“
„Danke“, sagte ich überrascht. Dass dieser Mann Geschenke macht, hätte ich nie gedacht und es machte mich verlegen.
Doch meine Aufmerksamkeit war inzwischen von etwas anderem gefesselt: An Tom Blue Birds Handgelenken hatte ich winzige Tätowierungen entdeckt. Blassblaue Punkte und zwei parallele Zickzacklinien. Ich betrachtete sie verstohlen, wagte aber nicht, ihn danach zu fragen. Durch zu viel Neugier konnten leicht Missverständnisse entstehen und ich wollte nicht gleich am ersten Tag ins Fettnäpfchen treten.
Die Straße nach Pine Ridge, dem Hauptort des Reservats, führte durch eine hügelige Landschaft, die, von vereinzelten Pappelhainen abgesehen, baumlos war. Überall dieses kurze, bräunlich gelbe Gras, wie mit Filz überzogen. Weil ich nirgendwo Rinder sah, nahm ich an, dass es nicht mal als Weidefläche zu gebrauchen war.
Schlechter Asphalt. Aber Blue Bird schien sämtliche Schlaglöcher zu kennen und in gewagten Manövern wich er ihnen aus. Nur manchmal bremste er scharf und musste hindurchfahren, wenn die Schäden im Asphalt so breit wie die ganze Straße waren.
Wohin ich auch sah: endlose Weite bis zum Horizont. Nur hin und wieder ein Haus inmitten der Prärie, hinter dem Autowracks in den verschiedenen Stadien des Verfalls vor sich hin rosteten. Der erste richtige Ort, durch den wir kamen, war Manderson und Tom fuhr langsamer.
„Die Einheimischen nennen den Ort Murdertown“, sagte er, „es ist die gewalttätigste Siedlung des Reservats.“
Eine eiskalte Hand legte sich um mein Herz, während wir langsam durch den Ort rollten. Rechts ein Hügel mit Holzhäusern im graublauen Einheitsanstrich, in deren Vorgärten ausgedienter Hausrat herumlag. Einige dieser Häuser hatte man immer wieder notdürftig repariert, andere waren von ihren Besitzern einfach sich selbst überlassen worden.
Ich sah heruntergetretene Drahtzäune und filzige Rasenflächen, auf denen zwischen alten Reifen, zertrümmerten Möbeln und modrigen Lumpen Kinder spielten. Es gab ein paar Bäume, aber nirgendwo Blumen. Die T-Shirts der Kinder und ihre bunten Plastikspielzeuge waren die einzigen Farbtupfer in dieser Trostlosigkeit.
Mühsam versuchte ich den Kloß in meiner Kehle herunterzuschlucken. Obwohl ich sämtliche Statistiken über die Armut in Pine Ridge verinnerlicht hatte: Dinge zu lesen, oder sie mit eigenen Augen zu sehen, war nicht dasselbe. Die Trostlosigkeit drohte mich zu überwältigen. Mein Bild von den Lakota war das eines armen, von der weißen Regierung unterdrückten und verachteten Volkes, aber das ging weit über Armut hinaus.
Tom warf mir einen Seitenblick zu. „So geht es allen, die das erste Mal im Res sind.“
„Wie geht es mir denn?“, fragte ich mit belegter Stimme.
„Du bist schockiert, würde ich sagen.“
Tatsächlich brauchte ich einen Moment, um das, was ich gesehen hatte, zu verarbeiten. „Ich dachte, ich wäre darauf vorbereitet“, räumte ich schließlich ein. „Aber ich bin es nicht.“.
„Ja“, meinte Tom mit spöttischer Bitterkeit, „die Wirklichkeit ist immer anders als das, was wir uns in unseren Köpfen zurechtgelegt haben.“ Er trat wieder aufs Gas, denn inzwischen hatten wir Mörderstadt passiert. „Die Regierung ließ diese Einheitshäuser in den siebziger Jahren bauen, in der Hoffnung, die alten Teerpappenhütten und die ausgebeulten Wohnwagen würden daraufhin verschwinden. Viele Lakota haben ein Haus gekauft oder zahlen eine kleine Miete, die sich nach ihrem Einkommen richtet.“ Er zog die Mundwinkel nach unten. „Eigentlich keine schlechte Sache. Aber viele hingen an ihrem Wohnwagen oder an der alten, baufälligen Hütte, die oft vom Großvater mit eigenen Händen gebaut worden war.“
Tom bremste scharf ab, aber es war schon zu spät. Die Vorderräder des Thunderbird krachten in ein tiefes Schlagloch.
„Mist!“, fluchte Blue Bird. „Unsere Leute mögen die neuen Häuser nicht“ fuhr er fort, „denn die Freude, in einem zu wohnen, währt meistens nur kurz. Die Wände sind aus Sperrholz und haben eine billige Plastikisolierung. Die Entlüftung besteht aus Attrappen. Schon mal was von Black Mold, dem Schwarzen Schimmelpilz gehört?“, fragte er.
„Ja.“ Ich nickte, und er redete weiter.
„Die meisten Häuser sind davon befallen und die Leute, die darin wohnen müssen, werden krank. Zuerst trifft es die Kinder und die Alten. Tja, von außen sieht alles sehr hübsch aus, aber drinnen funktioniert es nicht. Im Winter weht der eisige Präriewind durch alle Ritzen. Wir sind hier in South Dakota und nicht in Miami Beach.“
„Deshalb das Wápika Dorfprojekt“, bemerkte ich.
Was er mir gerade erzählt hatte, war mir ausnahmsweise nicht neu. Diese Menschen hatten einen schwierigen Weg vor sich und ohne fremde Hilfe würden sie es nicht schaffen. Da die eigene Regierung kein Interesse an einer Veränderung hatte, und die Lakota die Nase voll hatten von den unzähligen Kirchen, die sich im Reservat ausbreiteten, akzeptierten sie die Hilfe unseres Vereins.
Tom nickte. „Ja, deshalb. Vielleicht können unsere Leute auf diese Art zur traditionellen Lebensweise zurückfinden.“
„Okay“, sagte ich. „Aber was bedeutet für die Leute hier traditionell? Wird es im Dorf kein Auto, keinen Fernseher und keine Kühlschränke geben?“
„Ach was, das sind vielleicht europäische Vorstellungen von indianischer Zukunft. Aber Tradition hat nichts mit Folklore zu tun. Natürlich werden wir nicht in Tipis zurückkehren, die Autos gegen Pferde eintauschen und wieder ausschließlich von der Jagd leben.“ Tom seufzte. „Aber man kann sich keine Zukunft aufbauen, indem man das Alte zerstört. Früher war unser ganzes Leben auf dem Zusammenhalt der Familie aufgebaut. Tiospaye nennen wir das. Es ist uns verlorengegangen. Jetzt müssen wir versuchen, zu retten was zu retten ist.“
„Na ja, ein guter Anfang wäre doch, erst einmal etwas gegen den Unrat und den Müll zu unternehmen“, murmelte ich.
Tom schnaubte missbilligend. „Blödsinn. Das sind bloß Bierdosen und rostende Autos. Wir Lakota nennen es „Indianische Gartenkunst“. Es ist nur Schrott, nichts von Bedeutung. Ich sehe das gar nicht.“
Vermutlich sah es niemand, deswegen war es ja da.
„Wir haben wichtigere Probleme, glaub mir“, sagte Tom. „Die Selbstmordrate im Reservat beträgt fast das Zehnfache des Landesdurchschnitts. Herauszufinden, warum Menschen den Tod erträglicher finden als das Leben, ist eine wichtigere Aufgabe, als ein bisschen Schrott loszuwerden.“
Ein eisiger Klumpen hockte in meiner Brust und von diesem Moment an wusste ich, warum sich niemand aus dem Verein um diesen Job gerissen hatte.
Pine Ridge war der Hauptort des Oglala-Lakota-Reservats und erstreckte sich lang und weitläufig durch ein mit Pappeln und Eichen bewachsenes Tal. Vor dem Ortseingang zeigte mir Tom das neue Krankenhaus, ein modernes flaches Gebäude, das auf einem Hügel stand.
„Seit es das Krankenhaus gibt“, klärte er mich auf, „hat sich hier durchaus einiges verbessert.“
„Ich würde es mir gerne ansehen“, bat ich, als wir schon daran vorbei gefahren waren. Ich hatte mich wieder einigermaßen gesammelt und versuchte, mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren. Inga hatte mir Berichte über die medizinische Versorgung im Reservat zu lesen gegeben, aber sie waren nicht auf dem neuesten Stand. Aktuelle Zahlen zu besorgen, war ein Teil meines Jobs.
„Heute nicht“, meinte Tom. „Aber ich werde mich darum kümmern.“
Im Zentrum des Ortes gab es den Sioux Nation Supermarkt, ein Postamt, verschiedene Fastfoodketten und Big Bats, die Tankstelle mit Restaurant und Laden, die Tag und Nacht geöffnet hatte. Gegenüber von Big Bats standen mehrere einstöckige Gebäude in einem einfachen, schmucklosen Baustil. Drumherum Bäume, große, schattenspendende Pappeln, die dem Ganzen ein parkähnliches Aussehen verliehen. Es war der Sitz der Stammesregierung. Das Hauptgebäude war ein großer Backsteinbau mit einem sauberen Vorplatz.
Tom parkte neben dem Ford seines Vaters. Vine Blue Bird stand mit verschränkten Armen rücklings gegen seinen Wagen gelehnt, in dessen getönten Scheiben sich die Bäume und der Himmel spiegelten, wie in einer überdimensionalen Sonnenbrille. Vine schien in seinen Gedanken weit weg zu sein, denn erst als wir direkt vor ihm standen, bewegte er sich.
„Wir können gehen“, sagte Tom.
Vine nickte abwesend und ging voran. Tom hielt die Schwingtür für mich auf und wir betraten die klimatisierte Eingangshalle. Eine Schulklasse mit Teenagern drängelte sich vor einer Vitrine mit Artefakten der Lakota-Geschichte. Männer und Frauen diskutierten miteinander oder standen wartend herum. Einige eilten geschäftig über die beiden großen Gänge im hinteren Teil des Gebäudes. Alles erschien mir überraschend normal, bis mir bewusst wurde, dass ich hier die einzige Weiße war.
Inzwischen hatten das auch die anderen bemerkt. Man drehte sich nach mir um und musterte mich verstohlen. Noch nie war ich mir so andersartig und auffällig vorgekommen wie in diesem Moment. Verunsichert und nervös konzentrierte ich mich auf Tom Blue Birds breiten Rücken und hoffte darauf, so schnell wie möglich erlöst zu werden.
Vermutlich lag es nicht nur an meiner Hautfarbe und den blonden Haaren, offenbar hatte ich auch meine Kleidung völlig falsch gewählt. In dieser Umgebung wirkte selbst das einfache grüne Kleid viel zu elegant und es fühlte sich an wie ein Brennnesselhemd.
Was hatte ich mir bloß dabei gedacht, so overdressed loszuziehen, wo doch jeder hier Jeans und T-Shirt trug? Sogar der Vorsitzende des Stammesrates, Marcus Red Bull, dem wir zufällig über den Weg liefen. Der ältere Mann mit einem dicken Zopf im Nacken, trug dunkle Jeans und ein ausgewaschenes T-Shirt mit dem buntem Aufdruck: SUPPORT NATIVE RIGHTS und Vine machte uns miteinander bekannt. Doch Marcus Red Bull hatte es eilig und so schleppte Vine mich weiter, immer nach jemandem Ausschau haltend.
Als wir einem Mann in die Arme liefen, den er mir als Red Bulls Stellvertreter Murdo Garret vorstellte, spürte ich Ungeduld in Vines Verhalten. Garret war ungefähr in Vines Alter, aber noch korpulenter und vor allem von fröhlicherer Natur. In der Brusttasche seines Holzfällerhemdes trug er eine Sammlung verschiedener Kugelschreiber. Es waren bestimmt sechs oder sieben und der Saum der Tasche endete in tintenblauen, wolkenförmigen Flecken.
Aus Garrets dunklen Gesicht leuchteten hervorstehende Zähne. Er lachte mich offen an und wechselte ein paar Worte mit mir, es waren die üblichen Fragen. Wie mein Flug gewesen sei, ob ich mich gut fühlte, und wie mein erster Eindruck vom Reservat war.
Ich antwortete, was man von mir erwartete, das war die erste Lektion, die ich gelernt hatte: „Prima. Gut. Interessant.“
Der stellvertretende Stammesratsvorsitzende war mir sympathisch und hätte mich gerne ausführlicher mit ihm unterhalten, aber an diesem ersten Tag hielt ich Zurückhaltung für angebrachter. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich keine Gelegenheit mehr bekommen würde, mit Murdo Garret zu sprechen.
„Waren Sie schon draußen im Dorf?“, fragte er mich.
„Nein, noch nicht.“
„Tom wird Ellen das Dorf heute noch zeigen“, brummte Blue Bird, dessen Blick schon wieder unruhig suchend durch den Gang schweifte.
Ich wurde den Verdacht nicht los, dass meine Anwesenheit ihn frustrierte und dass das, was er tat, für ihn nicht mehr als eine lästige Pflicht war. Diese Erkenntnis dämpfte meinen Enthusiasmus gewaltig. Zum Teufel mit Vine Blue Bird, ich würde auch ohne ihn zurechtkommen. Tom war schließlich auch noch da. Ich drehte mich suchend nach Vines Sohn um, aber er war verschwunden.
„Eine gute Sache, die Ihre Gruppe da unterstützt“, meinte Garret freundlich. „Wir sind Ihnen sehr dankbar, Ellen.“
Nun, ich gab mir zwar alle Mühe, aber Dank hatte ich mir bisher noch keinen verdient. „Wir ... äh, ich ...“, verdammt, ich war so durcheinander, dass mir die Worte fehlten.
Wo war Tom abgeblieben?
Garret blickte auf die große Uhr am Ende des Ganges und klopfte Vine auf die Schulter. „Tut mir leid, aber ich muss los. Heute wird der neue Waldorfkindergarten in Kyle eingeweiht und ich soll ein paar Worte dazu sagen.“ Er wandte sich noch einmal an mich. „Schön, Sie kennengelernt zu haben, Ellen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie jederzeit zu mir kommen.“ Er steckte mir seine Visitenkarte zu. „Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung.“
„Freut mich auch … und Danke.“ Ich sah ihm nach.
Vine gab einen grunzenden Laut von sich. Mir wurde wieder bewusst, dass ich mich über ihn ärgerte, also vermied ich es, ihn anzusehen. Was sollte ich tun? Im Moment war ich auf ihn angewiesen, zumal sich Tom in Luft aufgelöst zu haben schien.
Nachdem ich von Vine noch Dempster Little Crow, dem Polizeichef des Reservats vorgestellt worden war, entdeckte er vermutlich jenen Mann, nach dem er die ganze Zeit Ausschau gehalten hatte. Dieser Mann, den ich nur flüchtig sehen konnte, verschwand hinter einer der vielen Türen.
Vine sagte: „Tut mir leid, aber ich habe gleich einen wichtigen Termin, Ellen. Tom bringt Sie noch zum Richter, danach zeigt er Ihnen das Dorf und wo Sie wohnen werden. Wir sehen uns später.“
„Mist!“, fluchte ich leise, als ich allein auf dem Flur stand.
Wo zum Teufel war Tom Blue Bird? Während der Autofahrt hatte er sich als durchaus gesprächig und auf spröde Weise charmant erwiesen und ich hatte nicht das Gefühl gehabt, ihm lästig zu sein. Aber wo war er jetzt? Ich fühlte mich abgestellt. Sollte ich losgehen und hinter einer von diesen vielen Türen nach ihm suchen? Oder war es schlauer, hier auf ihn zu warten?
Ich entschied mich, da stehen zu bleiben, wo ich gerade war.
Als Tom wenig später hinter mir auftauchte wie ein Geist, erschrak ich fürchterlich. Er grinste schelmisch. Es schien ihm zu gefallen, dass ich für einen Augenblick aus der Fassung geraten war.
„Gehen wir!“, sagte er. „Der Richter hat einen Augenblick Zeit für dich.“
Das Stammesgericht war in einem grauen Schlackensteinbau untergebracht, nur wenige Schritte vom Haupthaus entfernt. In einem freundlich hellen Bürozimmer schüttelte ich Robert Fast Elk, dem obersten Stammesrichter der Oglala Lakota die Hand. Er war noch sehr jung, wahrscheinlich kaum älter als Tom. Die beiden Männer schienen näher befreundet zu sein, was ich mir aus ihrem vertrauten Umgangston zusammenreimte.
Fast Elk fragte mich, wie ich den Flug überstanden hatte und wie mein erster Eindruck vom Reservat war. Ich wählte meine Worte sehr sorgfältig, denn die Fettnäpfchen standen überall parat.
„Woher kommen Sie, Miss Kirsch?“, wollte Fast Elk wissen, als ich geendet hatte. Das hatte mich noch keiner gefragt. Der Richter lächelte über mein skeptisches Gesicht und sagte: „Vor ein paar Jahren war ich auf Vortragsreise in Deutschland und kenne mich ein wenig aus.“
„Ich komme aus dem Osten“, sagte ich und war mir sicher, dass er sich dort nicht auskannte. Doch ich sollte mich irren.
„Eisenach, Weimar, Jena“, zählte Fast Elk auf, „Rostock ...“
„Ich lebe seit ein paar Jahren in Potsdam“, platzte ich heraus, „aber in Weimar bin ich geboren.“
Ich versuchte mir den obersten Stammesrichter als Tourist auf dem Theaterplatz vorzustellen, wie er ein Erinnerungsfoto von Goethe und Schiller macht, aber es wollte mir nicht gelingen.
„Goethe“, meinte Fast Elk prompt, als hätte er meine Gedanken erraten. Ich musste mich arg zusammenreißen, um nicht albern zu kichern.
Es klopfte an der Tür und eine junge Indianerin in einem kurzen hellblauen Kostüm kam herein. Sie trug ihr Haar kurz und sorgfältig frisiert. Seine Sekretärin, dachte ich, und hatte recht.
Sie blieb in der offenen Tür stehen, begrüßte Tom und mich mit einem Kopfnicken und wandte sich an Fast Elk: „Sie haben um zwei einen Termin mit Joe Gunmans Anwalt, Richter“, erinnerte sie ihn mit strenger Stimme.
„Ich habe ihn nicht vergessen, Lucie.“ Fast Elk nickte lächelnd. „Geben Sie mir noch drei Minuten, dann komme ich.“ Die Sekretärin ließ die Bürotür offen, als sie ging. Sie hatte ihren Chef gut im Griff.
Wir erhoben uns von unseren Stühlen. „Lucie“, wiederholte Tom den Namen der jungen Dame und schnalzte mit der Zunge.
„Sie ist ein kluges Mädchen“, verteidigte der Richter seine Sekretärin. „Und noch dazu sehr ehrgeizig.“
Auf einmal drangen streitende Männerstimmen vom Gang ins Büro und Fast Elk spähte mit gerunzelter Stirn durch die Tür. Wir verabschiedeten uns von ihm und beim Hinausgehen prallte Tom in der Türöffnung mit einem jungen Indianer zusammen, der in Fast Elks Büro stürmte, während er noch den stellvertretenden Stammesratsvorsitzen Murdo Garret beschimpfte, der draußen auf dem Gang stand.
„He, pass auf wo du hintrittst“, wetterte Tom.
Der junge Indianer in Jeans und rotem T-Shirt hielt inne und wandte den Kopf. Er hatte ein offenes, attraktives Gesicht und sein Blick traf mich mitten ins Herz. Schließlich wanderte sein Blick weiter zu Tom und es schien, als brauche er eine Weile, um zu begreifen, wen er vor sich hatte.
„He, Blue Bird“, schnaubte er schließlich. „Nicht so eilig, alter Freund. Warst du bei Robert, um selbst einen kleinen Landanspruch anzumelden? Oder brauchst du seine Stimme für das Kasino?“
„Halt bloß die Luft an, Freundchen“, kam die Stimme des Richters aus dem Hintergrund.
„Idiot!“, knurrte Tom ärgerlich und zerrte mich am Arm aus dem Büro. Murdo Garret folgte dem jungen Mann ins Büro und die Tür des Richters schloss sich hinter den beiden Streitenden.
„Wer war das denn?“, fragte ich, verwundert über die seltsame Auseinandersetzung. Ich rieb meinen Arm, denn Toms Griff war nicht gerade sanft gewesen.
„Das war einer von denen, die immer nur Ärger machen“, bemerkte er abfällig. „Ein kleiner Möchte-gern-Russel-Means.“
Russel Means? Wardas nicht der Tomahawk schwingende Rächer in „Der letzte Mohikaner“, meinem heimlichen Lieblingsfilm?
„Noch nie etwas von Russel Means gehört?“ Tom musterte mich ungläubig.
„Ist der nicht Schauspieler?“, fragte ich, auch auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen.
„Russel Means hat Mitte der Siebziger das American Indian Movement mitbegründet“, klärte Tom mich auf. „Er war 1973 bei der Belagerung von Wounded Knee dabei und hat in der Vergangenheit eine Menge kluger Reden gehalten. Aber du hast recht: Means hat vor ein paar Jahren der der Indianerpolitik den Rücken gekehrt und sich als Hollywoodstar versucht. Seit einiger Zeit taucht er jedoch wieder auf, wenn es irgendwo im Reservat brenzlig wird. Man munkelt, dass er bei der nächsten Wahl für den Stammesrat kandidieren will.“
„Verstehe“, sagte ich. „Aber worum ging es denn bei diesem Streit eben? Gibt es irgendwelchen Ärger mit dem Wápika-Projekt?“
„Nein. Das war wohl eher eine persönliche Sache“, wiegelte Tom ab. Er blieb stehen, wandte sich um und machte ein überraschend freundliches Gesicht. „Ich bin hungrig“, sagte er. „Was ist mit dir? Du bist schon ganz blass. Ein richtiges Bleichgesicht.“ Tom lachte.
Ich hatte zwar mächtigen Hunger, aber ich fürchtete, dass wieder nur fleischliche Kost oder Fastfood auf dem Speiseplan stehen würde. „Ich weiß nicht“, stotterte ich. „Ich ...“
„Na komm schon“, Tom klopfte mir auf die Schulter. „Keine falsche Bescheidenheit. Ich lade dich ein.“
3.
Die Zeiten der Büffeljagd und der Lagerfeuer waren vorbei, deshalb lud Tom mich zu einem verspäteten Mittagessen in die „Sunny Red Fox Hall“ ein.
Das Gebäude, ein langer, schindelverkleideter Flachbau, befand sich am Ortsausgang von Pine Ridge und war eine Art Freizeitzentrum für Jugendliche. Seinen Namen hatte es von einer indianischen Sprinterin, die aus der Stadt stammte und eine Zeit lang olympiaverdächtige Rekorde gelaufen war.
Überall an den Wänden hingen Fotos von ihr und Zeitungsartikel über ihre Erfolge. Tom erzählte mir, dass sie im Alter von zweiundzwanzig ermordet worden war und man den Täter nie gefasst hatte. Vermutlich war ich blass geworden, denn er meinte: „Das Ganze ist schon zehn Jahre her, Ellen.“
Die Einrichtung des Restaurants war billig und fantasielos. Plastikstühle und wackelige Tische aus Presspappe. Nicht gerade gemütlich, aber wahrscheinlich war es das einzige Lokal in der näheren Umgebung. Die junge Bedienung hatte ein hübsches Gesicht mit schrägen dunklen Augen und nahm gerade an einem der anderen Tische eine Bestellung auf.
Die anderen Gäste, ausnahmslos Indigene, bedachten uns mit neugierigen Blicken und ich hatte das Gefühl, an einem elektrischen Weidezaun festzuhängen.
„Vermutlich fragen sie sich gerade, ob Tom Blue Bird es wieder mal geschafft hat, sich für den Sommer eine Weiße zu angeln, die ihm die Stromrechnung, einen neuen Kühlschrank oder gar einen neuen Pickup bezahlen wird.“
Während Tom das sagte, glitt sein Blick langsam über meinen Kopf, meine Schultern und weiter nach unten. Ungewollt wurde ich mir meines Aussehens bewusst: meiner strohfarbenen Haare, die so widerspenstig waren, dass sie sich nach und nach aus dem Haargummi lösten und mir in die Stirn hingen. Meiner bleichen Haut, die dringend ein paar Sonnenstrahlen bedurfte. Und dann war da immer noch mein Kleid, das hier erst recht fehl am Platz war. Unter meinen Achseln hatten sich dunkle Flecken gebildet und Toms Blick klebte dort fest.
„Das ist doch lächerlich“, stotterte ich.
„Für dich vielleicht“, sagte er, „Aber so läuft es hier nun mal. Was glaubst du, wie gerne weiße Frauen ihre Brieftaschen öffnen, um sich eine spirituelle Erfahrung im Bett zu holen.“
Ich stieß Luft durch die Zähne, schüttelte den Kopf, lachte ungläubig – und merkte, wie ich rot anlief. Hitze breitete sich über Stirn und Wangen aus.


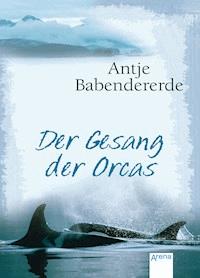
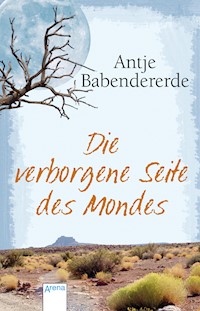


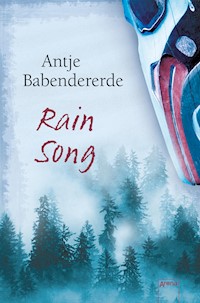

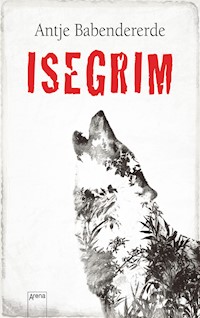
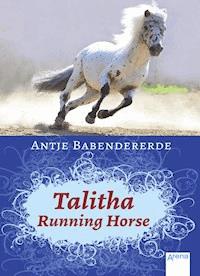

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)