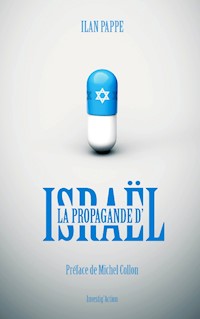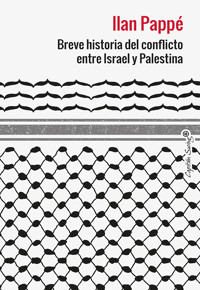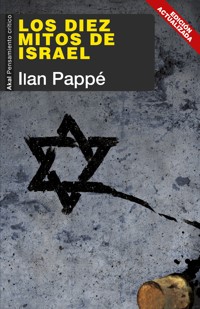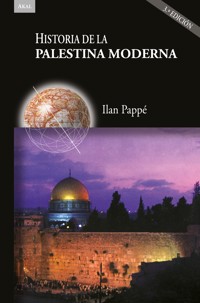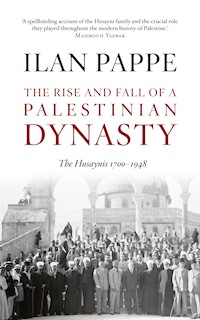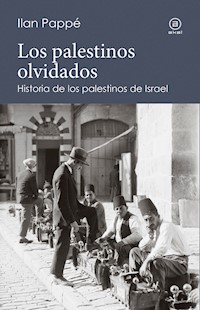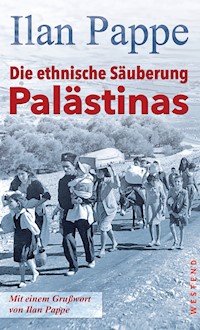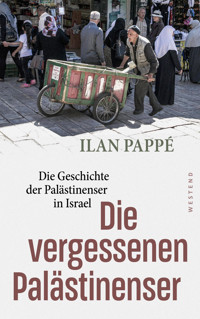
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit mehr als 60 Jahren leben Hunderttausende von Palästinensern als israelische Staatsbürger innerhalb der Grenzen des Staates, der am Ende des Konflikts von 1948 gegründet wurde. Die israelischen Palästinenser, die einen prekären Mittelweg zwischen den jüdischen Bürgern Israels und den enteigneten Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen einnehmen, haben eine äußerst komplexe Beziehung zu dem Land entwickelt, das sie ihre Heimat nennen; in den unzähligen Diskussionen über das israelisch-palästinensische Problem werden ihre Erfahrungen jedoch oft übersehen und vergessen. In diesem Buch untersucht der Historiker Ilan Pappé, wie es den israelischen Palästinensern unter der jüdischen Herrschaft ergangen ist und was uns ihr Leben sowohl über Israels Haltung gegenüber Minderheiten als auch über die Haltung der Palästinenser gegenüber dem jüdischen Staat verrät. Auf der Grundlage von umfangreichem Archiv- und Interviewmaterial analysiert Pappé die Politik des israelischen Staates gegenüber seinen palästinensischen Bürgern und stellt Diskriminierungen in den Bereichen Wohnen, Bildung und Bürgerrechte fest. Das sehr lesenswerte Buch Die vergessenen Palästinenser bringt eine neue und dringend benötigte Perspektive in die israelisch-palästinensische Debatte ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
WESTEND
Im Gedenken an die 13 palästinensischen Bürger, die im Oktober 2000 von der israelischen Polizei erschossen wurden
ILAN PAPPE
Die vergessenen Palästinenser
Eine Geschichte der Palästinenser in Israel
WESTEND
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://(dnb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich ge-schützt. Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Rechteinhabers unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzun-gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Übersetzung: Neues Vorwort für die deutsche Ausgabe: Abraham Melzer / Prolog, Einleitung, Kapitel 1 + 2, Gieselher Hickel /
Kapitel 3, Uli Schieszl / Kapitel 4 + 5 Abraham Melzer /
Kapitel 6 + 7 + Nachwort, Viktoria Waltz / Anhang: Abraham Melzer
Copyright © 2011 Ilan Pappe
Die englische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel:
THE FORGOTTEN PALESTINIANS – A History of the Palestinians in Israel bei der Yale University Press, London
Alle Rechte für die deutsche Ausgabe und Übersetzung liegen bei Abraham Melzer, Neu-Isenburg, 1. Auflage 2025
Lektorat der deutschen Ausgabe: Ute Hehr
Umschlaggestaltung: Buchgut, GmbH
Satz und Layout: Bernd Heun, Rüssingen
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Ulm
Printed in Germany
ISBN: 978-3-86489-493-0
Inhalt
Grußwort zur deutschen Ausgabe 9
Vorwort: Feind und Fremd im eigenen Land 12
Einleitung 20
1 Aus der Asche der Nakba 26
2 Die offene Wunde: Militärherrschaft und ihre bleibende Wirkung 59
3 Militärherrschaft mit anderen Mitteln, 1967 – 1977 111
4 Zwischen dem ›Tag des Bodens‹ und der ›Ersten Intifada‹, 1967 – 1987 156
5 Nach der ›Ersten Intifada‹: Zwischen palästinensischer Selbstbehauptung und jüdischer Verunsicherung, 1987 – 1995 194
6 Die hoffnungsvollen Jahre und ihr Niedergang, 1995 – 2000 228
7 Das Erdbeben 2000 und seine Auswirkungen 261
8 Nachwort: Der Unterdrückungsstaat 300
9 Anhang – Hinweise für Studierende 314
10 Anmerkungen 331
11 Bibliografie 360
12 Personenregister 375
Deshalb
Wenn du willst, sage ich, dass ich es bin
Ein vor-islamischer Dichter, der seine Flügel ausbreitete und in die Wüste flog
Und ich war ein Jude, ehe Juden über den See Genezareth fuhren
Und ich war ein sonnenverwöhnter Araber im Morgendämmern ...
Und ich war ein Fels, ein Olivenbaum, der blieb.
Das ganze Land war ein Zuhause, aber ich war darin ein Fremder.
Ich war Moslem in Jesu Land und Katholik in der Wüste.
Nicht, dass irgendetwas meinen Lebensweg verändert hätte; nur habe ich nicht vergessen,
dass ich im Wüstensand geboren wurde und im Lichte wanderte
bis ich in den Schatten eines herzlosen Baumes des Wissens kam.
Ich kostete von seiner Frucht.
Ich wurde für immer ausgestoßen, ohne Chance auf Rückkehr
wie das Wasser, das fließt und niemals zum Fluss zurückkehrt ...
Salman Masalha, ›Letzte Antwort auf die Frage »Wer bist du?«‹
GRUSSWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
The Follow Up Committeeist heute das Vertretungsorgan aller palästinensischen Bürger Israels. Es handelt sich um eine Art Mi-niparlament der Gemeinschaft. Zu ihr gehören alle palästinensischen Mitglieder der Knesset, Gemeindevorsteher, NGOs und andere be-kannte Persönlichkeiten der Gemeinde. Ihr Vorsitzender im Jahr 2024 war der ehemalige Knesset-Abgeordnete Muhammad Barakeh. Auf ei-ner Konferenz in Europa erzählte er seinen Zuhörern, dass seiner Ge-meinde erneut ein Leben unter Militärherrschaft bevorstehe.
Barakeh bezog sich auf die frühe Periode der Militärherrschaft von 1948 bis 1966, die in diesem Buch ausführlich beschrieben und ana-lysiert wird. Die den palästinensischen Bürgern auferlegte Militärherr-schaft war damals offiziell und formell. Das, mit dem sie seit Oktober 2023 konfrontiert sind, ist nicht offiziell. Theoretisch sind sie vollwer-tige Staatsbürger Israels mit den gleichen Rechten wie die jüdischen Staatsbürger.
Doch in Wirklichkeit werden sie seit Oktober 2023 verhaftet, wenn sie auch nur Mitleid mit ihren Brüdern und Schwestern im Gazastrei-fen zeigen oder es wagen, die israelische Politik zu kritisieren. Jede von ihnen geäußerte Meinung kann zum Verlust des Arbeitsplatzes, zum Ausschluss von der Universität oder sogar zum Ausschluss von einer weiterführenden Schule führen. Es versteht sich von selbst, dass sie nicht gegen den Krieg in der einzigen Demokratie im Nahen Osten demonstrieren können.
Im November 2024 begann die Knesset mit der Vorbereitung ei-ner Reihe von Gesetzen, die es den palästinensischen Bürgern Isra-els sehr schwer machen würden, zu wählen oder gewählt zu werden, es sei denn, sie leugnen völlig ihre Verbindung zum palästinensischen Volk und ihre eigene Identität. Ihre Stimme wurde als entscheidend
10 | Die vergessenen Palästinenser
für den Versuch angesehen, die Regierungspartei Likud abzulösen, die seit 2009 in Israel an der Macht ist. Wir müssen bis 2026 warten, um zu sehen, ob dieser Trick erfolgreich ist. Aber darum geht es in diesem Buch nicht.
Die Entwicklungen, die ich gerade beschrieben habe, sind nur eine weitere Schicht des Leids, das fast zwei Millionen Palästinenser, die Bürger Israels sind, ertragen müssen. Schon seit der Veröffentlichung dieses Buches und lange vor Oktober 2023 wurde ihr Status innerhalb des jüdischen Staates stark untergraben und rechtfertigte die Behaup-tung vieler Aktivisten und einiger Wissenschaftler, dass Israel faktisch ein Apartheidstaat sei.
In diesem Vorwort möchte ich kurz die wichtigsten Prozesse zusam-menfassen, die diese Bevölkerung seit der Veröffentlichung dieses Bu-ches beeinflusst haben.
Der erste Prozess war der Rechtsruck im israelischen politischen Sys-tem im 21. Jahrhundert, der sich stets in der Verfolgung einer härteren Politik gegenüber den Palästinensern manifestiert, wo immer sie sich befinden. Im Fall der Palästinenser in Israel habe ich in diesem Buch bereits eine Gesetzgebung um 2010 beschrieben, die die Meinungsfrei-heit der Palästinenser erheblich einschränkte. Aber seitdem ist im Jahr 2018 Schlimmeres passiert, und zwar in Form eines neuen israelischen Staatsangehörigkeitsgesetzes, das das Recht der Palästinenser in Isra-el, sich als Palästinenser zu definieren, kategorisch negiert, wenn sie als Staatsbürger anerkannt werden und von seiner Unterstützung für ihre Institutionen profitieren möchten oder die vollen Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, die ein Staat seinen Bürgern bietet. Dabei handelt es sich um einen Prozess der Delegitimierung, der sich seit Ok-tober 2023 verschärft hat.
Der zweite Prozess begann vor einigen Jahren und kann als Krimi-nalisierung des öffentlichen Raums der Palästinenser in Israel definiert werden. Es handelt sich um eine israelische Politik der freien Hand ge-genüber kriminellen Banden, die das Leben in den palästinensischen Dörfern und Stadtvierteln kontrollieren. Einige der Bandenmitglie-der sind ehemalige Informanten des israelischen Geheimdienstes, die nach dem Oslo-Abkommen 1993 aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen abgezogen wurden und daher gute Beziehungen zur Poli-zei und zum Geheimdienst Shin Bet haben. Die israelische Armee und der Geheimdienst, die im Iran oder im Sudan einen Waffentransporter
Grusswort zur deutschen Ausgabe| 11
angreifen können, behaupten, sie könnten die Waffenlieferungen an diese Banden nicht stoppen!
Durch Erpressung und Einschüchterung terrorisieren sie die Be-völkerung. Die Polizei steht daneben und versucht nicht einmal, die Mordfälle aufzuklären. Seit 2012 wurden mehr als 1200 palästinen-sische Bürger Israels durch solche kriminellen Aktivitäten ermordet. Und die Zahlen steigen weiterhin exponentiell an.
Diese beiden Prozesse machen zusammen mit den bereits grund-legenden Nöten, mit denen diese Gemeinschaft seit 1948 konfron-tiert ist und die in diesem Buch detailliert beschrieben werden, das Le-ben als palästinensischer Bürger in Israel nahezu unmöglich. Es besteht auch große Angst, dass die neozionistische Regierung von 2022 alles tun wird, um diese Gemeinschaft zum Auswandern zu bewegen
Nur wenn die Welt versteht, dass sie einen anderen Ansatz zur ge-samten Palästina-Frage verfolgen und dazu beitragen muss, zwischen dem Fluss und dem Meer eine echte Demokratie für alle zu schaffen, wäre das Schicksal dieser Gemeinschaft gesichert. Darüber hinaus ist diese Gemeinschaft die einzige palästinensische Gemeinschaft, die die israelischen Juden nicht nur als Siedler oder Soldaten kennt. Ihre enge Beziehung zu vielen jüdischen Bürgern ist die beste Garantie für den Wiederaufbau einer arabisch-jüdischen Verständigung in einem befrei-ten Staat, der frei von Apartheid, Fanatismus und Rassismus ist. Sie sind die Brücke in eine bessere Zukunft und eine echte Versöhnung im zerrissenen Land – eine Errungenschaft, die enorme und positive Aus-wirkungen auf die gesamte Region haben würde.
Ilan Pappe, Dezember 2024
Vorwort
FEIND UND FREmD IM EIGENEN LAND
DIE FRÜHEN ZIONISTEN WAREN obligatorische Tagebuch-schreiber. Sie ließen die geschichtlichen Höhen der Reiseberichte, Zeit-schriften und Briefe hinter sich. Von dem Moment an, als sie Anfang des 20. Jahrhunderts Palästina erreichten, schrieben sie Tagebuch. Sie waren mit dem Land nicht vertraut. Ihre Reise aus Osteuropa war oft schwer und gefährlich. Aber sie wurden gut aufgenommen, zuerst in Jaffa, wo sie von den großen Schiffen mit Hilfe kleiner Boote anlande-ten und sich nach einer vorläufigen Bleibe oder einem Stück Land um-sahen. Die ansässigen Palästinenser boten den Ankömmlingen zumeist Unterkunft. Sie gaben Rat für die Bebauung des Landes, zumal die Zi-onisten davon wenig oder nichts wussten, denn in ihren Heimatlän-dern war es ihnen jahrhundertelang verwehrt, Bauern zu sein und Bo-den zu besitzen.[1]
Die Siedler verhielten sich im Gegenzug nicht freundlich. Wenn sie abends bei Kerzenlicht die ersten Einträge in ihre Tagebücher schrie-ben, bezeichneten sie die einheimischen Palästinenser als Fremde, die das Land bewohnen, das dem jüdischen Volk gehöre. Einige kamen mit der Vorstellung, dass das Land leer sei, und sie nahmen an, dass die Men-schen, die sie vorfanden, fremde Eindringlinge waren. Andere, wie der Gründer der zionistischen Bewegung, Theodor Herzl, wussten, dass Pa-lästina kein Land ohne Volk war, aber sie meinten, die einheimische Be-völkerung könne man verschwinden lassen, und Raum für die Rückkehr der Juden und die Wiederherstellung von Eretz Israel schaffen.[2]Mit Worten des verstorbenen Ibrahim Abu Lughod: »Die Negierung und völlige Missachtung der Palästinenser vor Ort durch die frühen zionisti-
VORWORT | 13
schen Siedler schockierte diejenigen jüdischen europäischen Denker je-ner Zeit, die wohlmeinend aber ziemlich ohne Einfluss waren«.[3]
Die Wahrnehmung der Palästinenser als unerwünscht und nicht willkommen ist ein entscheidendes Moment im zionistischen Diskurs und Verhalten geblieben, als Israel 1948 entstand. Mehr als ein Jahr-hundert später sind die Nachkommen einiger jener Palästinenser Bür-ger des jüdischen Staates, aber das bewahrt sie nicht davor, in ihrer ei-genen Heimat als gefährliche Bedrohung angesehen und behandelt zu werden. Diese Haltung prägt das israelische Establishment und kommt auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck.
Das ›Israeli College for National Security‹ (Hochschule für Nationa-le Sicherheit) ist das israelische ›West Point‹ (US-Militär-Akademie) für die meisten Offiziere in der Armee und die Beamten in den Sicher-heitsdiensten, sowohl für den Inlandsgeheimdienst, ›Shabak‹, als auch für den berühmten (oder in diesem Fall vielleicht eher berüchtigten) Mossad. Die künftigen Chefs der Armee und Sicherheitsdienste müssen diese Hochschule absolvieren. Sie arbeitet sehr eng mit dem Center for National Security Studies and Geostrategy(Zentrum für nationale Sicher-heitsstudien und Geostrategie) der Haifa Universität zusammen. Sie veröffentlichen Jahr für Jahr Berichte, die vor drohender »arabischer« Aneignung von Land im Norden und Süden Israels warnen. Mit Ara-bern sind hier palästinensische Bürger gemeint. Es ist das Gleiche wie die Warnung des FBI an die Regierung der USA, dass Ureinwohner, Bürger der USA, in wachsender Zahl Wohnungen und Häuser kauften.
Der Jahresbericht 2007 erklärt, dass »staatliche Einrichtungen au-ßerordentlich beunruhigt sind über zunehmende Versuche von Ara-bern (Bürgern), Land im Negev and in Galiläa zu kaufen«[4]. Dieser spezielle Bericht war der am meisten paradoxe von allen. Er wies da-rauf hin, dass im Süden sich vor allem Beduinen bemühten, privates Land zu kaufen, in Galiläa Beduinen und Drusen. Dies sind die beiden ethnischen Gruppen in Israel, die angeblich eine bessere Behandlung erfahren, weil ihre Mitglieder in der israelischen Armee dienen, wäh-rend für die übrigen palästinensischen Bürger eine Ausnahmeregel gilt, die oft als Vorwand für ihre Diskriminierung angeführt wird. (Wobei nur eine sehr kleine Minderheit unter den Beduinen im Süden Armee-dienst leistet; die Mehrzahl kommt aus dem Norden.) Wenn du Ara-ber bist, selbst wenn du in der israelischen Armee dienst, wirst du an-scheinend trotzdem, sobald du Land kaufst, zu einem inneren Feind.
14 | Die vergessenen Palästinenser
Selbst die wenigen Palästinenser, denen es durch Anrufung des israe-lischen Obersten Gerichts gelungen ist, die Erlaubnis zu erhalten, Land zu kaufen – oftmals das ihnen zuvor in den 1950er oder 1970er Jah-ren staatlich enteignete Land oder Eigentum –, sind nicht vor erneu-tem Verlust gefeit. Im September 1998 tobte bei der palästinensischen Stadt Umm al-Fahem im Gebiet des Wadi Ara ein Kampf. Die Armee und Polizei setzten Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition ein, um wütende Landeigentümer zu vertreiben, denen die Armee die Grundstücke genommen hatte, um daraus Schießübungsgelände der israelischen Armee (IDF – Israelische Verteidigungskräfte) zu machen. Der Armee käme es nie in den Sinn, jüdisches Eigentum für einen sol-chen Zweck zu enteignen. Ein Experte drückte es so aus: »In Sachen Landbesitz führt Israel Krieg gegen die palästinensischen Bürger.«[5]
Anerkannte Historiker, die nostalgisch über die erste Dekade Israels schreiben, halten die »Inbesitznahme arabischen Bodens« für die wich-tigste nationale Errungenschaft der ersten Regierungen.[6]Eine jahr-hundertealte Ideologie behauptet, dass das Land Israel ausschließlich dem jüdischen Volk gehöre. Die Judaisierung jener Teile, welche noch im Besitz von Arabern sind, sowie Araber daran zu hindern, weiteres Land zu erwerben, das sind heilige nationale Aufgaben, entscheidend für das Überleben des jüdischen Volkes. Im Jahr 2010 besitzen ›Araber‹ ca. 2,5 Prozent des Landes. In all den Jahren, in denen Israel besteht, ist es ihnen nicht gelungen, diesen Anteil zu erweitern trotz ihrer zah-lenmäßigen Zunahme, was in den Schlagzeilen israelischer Zeitungen gern als die »demografische Zeitbombe« bezeichnet wird.
Feind und fremd im eigenen Land zu sein, ist nicht nur eine tägli-che Herausforderung in puncto Recht auf Landbesitz, es hat auch da-mit zu tun, wen man heiraten kann und mit wem man eine Familie gründen darf. Mitten in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar 2007 wurde das Dorf Jaljulia von Militär und Polizei umstellt. Ziel der Be-lagerung war die Gefangennahme von acht palästinensischen Frauen, ursprünglich aus dem Westjordanland stammend, die jahrelang mit ih-ren Männern gelebt und in einer Zeit Familien gegründet hatten, als die Israelis Palästinenser aus den besetzten Gebieten darin bestärkten, als billige Arbeitskräfte im jüdischen Staat zu arbeiten und der Zugang nach und vom Westjordanland verhältnismäßig frei war. Die Frauen wurden festgenommen und in derselben Nacht ins Westjordanland ab-geschoben.
VORWORT| 15
Aufgrund dieses Vorfalls schrieb Oded Feller vom Verein für Bürger-rechte in Israel (Association for Civil Rights in Israel) an Eli Yishai, den Innenminister:
»Die Dunkelheit muss die Polizei blind gemacht und gehindert ha-ben zu sehen, wie schlimm die destruktive Ausübung von Gewalt in dunkler Nacht inmitten eines arabischen Dorfes wirkt. Das Einbre-chen in Häuser, der Schreck in den Gesichtern der kleinen Kinder, der Schock, Frauen aus ihren Betten gezerrt, die Männer und Kinder auf der Polizeistation in eiskalter Nacht wartend und für ihre Mütter und Frauen flehend, die Demütigung der überstürzten Abschiebung, die ohne ihre Mütter zurückbleibenden Säuglinge – all das blieb den Augen der Polizei in der Dunkelheit der Nacht verborgen.«[7]
Amany Dayif, ein palästinensisch-israelischer Wissenschaftler, schrieb: »Das neue Gesetz ist Ausdruck des israelischen Wunsches nach einem ›stillen Transfer‹ der Palästinenser aus Israel, mit anderen Wor-ten die Vertreibung der Palästinenser aus dem Staat in das abgeriegel-te Westjordanland.«[8]
Das Vorgehen gegen die Ehepaare mit Partnerinnen aus den besetz-ten Gebieten wurde politisch von Eli Yishai veranlasst, dem Innenmi-nister, der erklärte, dass solche Ehen »eine existentielle demografische Bedrohung für Israel« darstellten.[9]Im Ergebnis eines langen gesetzge-berischen Prozesses, von 2003 bis 2007, wurden Eheleute gezwungen auseinanderzugehen oder sich zu trennen. Gerichte ermächtigten die Behörden, die Ausweisung zu erzwingen.[10]
Diese Gesetze sind Ausdruck einer umfassenderen Gesetzesinitiati-ve, die 2007 zu verwandten Themen einsetzte und vom Justizminister und dem interministeriellen Ausschuss für Gesetzgebung voll befür-wortet wurde. Das betrifft das Loyalitätsgesetz, das von den Bürgern die Erklärung ihrer uneingeschränkten Anerkennung Israels als jüdi-schen und zionistischen Staat verlangt, das Verbot, in öffentlichen Ver-anstaltungen oder schulischen Lehrplänen und Schulbüchern an die Nakba – die Katastrophe von 1948 – zu erinnern, das Recht der Ein-wohnerschaft jüdischer Stadtteile, Palästinenser als Einwohner nicht zuzulassen, das Recht des Staates, Araber per Gesetz bei der Privatisie-rung von Grund und Boden zu diskriminieren (bekannt als Gesetz des Jüdischen Nationalfonds, 2007) und viele weitere.[11]
Weitere Rechte wurden den Palästinensern entzogen. Am 9. Mai 2010 haben 50 Nichtregierungsorganisationen (NROs) der Palästi-
16 | Die vergessenen Palästinenser
nenser in Israel, darunter alle größeren, ein Krisentreffen abgehalten, bei dem sie aus ihrer Sicht vor einer systematischen fortlaufenden Ver-letzung grundlegender Menschen- und Bürgerrechte der Palästinen-ser in Israel warnten. In ihrer Presseerklärung heißt es: »Verhaftungen mitten in der Nacht, Beschlagnahme mobiler Telefone und Compu-ter, Verbote solche Verhaftungen öffentlich zu machen, den Verhafte-ten verweigern, ihre Rechtsanwälte zu kontaktieren – all das erinnert uns an finstere Zeiten und Regime.« Das Treffen, das u.a. als Reakti-on auf die Verhaftung von Amir Makhoul (Vorsitzender von Ittijah,der Dachorganisation der palästinensischen NROs in Israel) organi-siert worden war, diente als Antwort der NROs auf das, was sie »als ge-zielten Angriff auf die Freiheit und die Rechte der arabischen Bürger in Israel« verstanden.
Zu den weiteren Restriktionen gehört, dass Palästinenser in Israel nicht das Recht haben, Proteste zu organisieren. Am Vorabend des is-raelischen Angriffs auf den Gazastreifen vom Januar 2009, Codename ›Gegossenes Blei‹ (Cast Lead), verhaftete die Polizei 800 Aktivisten, um sie daran zu hindern, am nachfolgenden Tag zu demonstrieren und Demonstrationen zu organisieren. Das Gefühl der Dringlich-keit seitens der Zivilgesellschaft war nicht nur der Welle von Gesetzen und Verhaftungen geschuldet, sondern auch der Beunruhigung in-folge der Zunahme von Erschießungen von Palästinensern durch die Polizei und durch jüdische Bürger, sowie das Verhalten der Verant-wortlichen zur Ermordung von Palästinensern. Dieses unterscheidet sich deutlich vom Verhalten gegenüber israelischen Juden. Im Okto-ber 2010 simulierte die israelische Polizei ein Szenario, bei dem Teile von Israel, in denen Palästinenser leben, dem Westjordanland zuge-ordnet wurden, während die illegalen jüdischen Siedlungen im West-jordanland in den jüdischen Staat eingegliedert wurden. Bei diesem Manöver erhielten Armee und Polizei Befehl, exzessive Gewalt anzu-wenden, so wie bereits im Oktober 2000, als die Palästinenser in Is-rael gegen die Polizei in den besetzten Gebieten protestierten und das Geschehen damit endete, dass die israelische Polizei 13 palästinensi-sche Bürger ermordete.
Seit 2000 wurden weitere 41 Bürger ermordet.[12]Der 41. war Salman al-Atiqa, ein kleiner Autodieb, der erschossen wurde, nachdem er ver-haftet und an Händen gebunden war. Während einige unter ähnlichen
VORWORT| 17
Umständen starben, waren andere einfache Bürger ohne Verbindung zu Straftaten. Bis auf zwei wurden die daraus folgenden Gerichtsver-fahren vom Generalstaatsanwalt wegen Mangels an Beweisen und zu geringem öffentlichem Interesse eingestellt. Angriffe auf Palästinenser durch jüdische Staatsbürger oder der Polizei kommen nie zur Verhand-lung vor Gericht.[13]
Zusätzlich zu all diesen Problemen werden die Folgen der anhal-tenden Politik von Diskriminierung und Ausgrenzung sichtbar, die es seit der Gründung des Staates Israel gibt. Die Hälfte der Familien un-terhalb der Armutsgrenze sind Palästinenser bei einem Bevölkerungs-anteil der palästinensischen Gemeinschaft von annähernd 20 Prozent. Zwei Drittel der Kinder, bei denen 2010 festgestellt wurde, dass sie un-ter Mangelernährung litten, waren Palästinenser.[14]
Das ist noch keineswegs das Gesamtbild. Als einzelne haben pa-lästinensische Bürger im jüdischen Staat Erfolge erzielt als Geschäfts-leute, Richter, medizinische Fachkräfte, Schriftsteller, Fernsehsprecher, Akademiker und sogar im Fußball (obgleich Palästinenser, die zur Na-tionalmannschaft aufgestellt wurden, es schwierig fanden, die tradi-tionell vor internationalen Wettkämpfen gesungene Nationalhymne mitzusingen, die die Sehnsucht des jüdischen Volkes nach Eretz Isra-el betont). Die Zahl der palästinensischen Studenten und Lehrkräfte nimmt zu, ebenso die Zahl der Palästinenser im öffentlichen Dienst.
Diese individuellen Erfolge haben das Selbstvertrauen innerhalb der palästinensischen Gemeinschaft gestärkt – und damit im Gegen-zug zu einer noch größeren Bedrohung in den Augen der jüdischen Gemeinschaft geführt, welche überwiegend immer noch von einer ideologischen Grundhaltung bestimmt ist, die den Palästinensern das Recht verweigert, Seite an Seite mit ihnen zu leben. Jüngste Umfra-gen zeigen, dass die Mehrheit der jungen Generation, jüdische Ober-stufenkinder, der Meinung ist, dass palästinensische Bürger in Israel nicht die vollen Rechte haben sollten. Deren freiwilliger oder erzwun-gener Transfer aus dem Land kümmert sie nicht. Anscheinend sind sie eifrige Anhänger des israelischen Außenministers, Avigdor Lieber-man, der öffentlich, etwa in einer Rede in der UN-Vollversammlung im Oktober 2010, seinem Wunsch Ausdruck gab, die Palästinenser aus Israel in ein palästinensisches »Bantustan« im Westjordanland um-zusiedeln und im Gegenzug die jüdischen Siedlungen im Westjordan-land nach Israel zurückzuholen.[15]
18 | Die vergessenen Palästinenser
Dieses Buch versucht die Wurzeln aufzuzeigen und dem Wachs-tum dieser traurigen Wirklichkeit nachzugehen. Ich vermute, Leser, die andere historische oder aktuelle Studien kennen, werden Aspek-te der Verhältnisse, unter denen Palästinenser in Israel leben, wieder-erkennen. Einige Aspekte könnten sie an kolonisierte Völker im 19. Jahrhundert erinnern, andere an Immigranten und Gastarbeiter im heutigen Europa. Der Unterschied besteht darin, dass in Israel der Staat in die einheimische Gesellschaft eingewandert ist. Insofern kann die israelische Politik gegenüber den Palästinensern nicht mit der An-ti-Einwanderungspolitik andernorts verglichen werden. Einige Aspek-te erscheinen schlimmer als die Apartheid in Südafrika, andere weni-ger schlimm. Die ›kleine Apartheid‹ der völligen Rassentrennung gibt es in Israel nicht. Die Diskriminierung findet eher latent und unsicht-bar statt, obwohl das gesamte Bildungssystem bis zur Ebene der Uni-versität und Hochschule völlig getrennt ist.
Latente Apartheid funktioniert folgendermaßen: ArCafé – eine re-nommierte Kaffee-Handelskette, in nahezu allen Einkaufszentren des Landes vertreten – erklärte im Juni 2006, nur Personen anzustellen, die Armeedienst geleistet hätten, was in Israel heißt Juden und die zwei kleinen Minderheiten der Drusen und Bedouinen. Die Kette umging auf diese Weise das Gesetz, das Diskriminierung aufgrund von Rasse oder Religion verbietet. Solche Erklärungen sind nie so explizit. Aber fast jedes Restaurant oder Café gibt an, »junge Leute nach dem Mili-tärdienst zu suchen«.[16]
Jede Geschichte der Palästinenser in Israel beginnt mit einem Kapi-tel über Diskriminierung und Enteignung. Es ist aber auch eine Ge-schichte von Selbstbehauptung und Standhaftigkeit. Arnon Soffer von der Haifa-Universität, einer der führenden Professoren in Israel, der die demografische Gefahr durch die Araber anprangert, erklärt: »Laut Pro-gnosen werden die Juden nur 70 Prozent der Bevölkerung ausmachen; das ist eine schreckliche Vorstellung.«[17]Dem kann man nur entgeg-nen, dass, wenn dies tatsächlich zuträfe, trotz seiner und vieler seiner israelischen Kollegen Bemühen, die Palästinenser in Israel loszuwer-den, der Entschlossenheit und Selbstbehauptung der letzteren geschul-det ist. Sie leben, wie ihre Theater, Filme, Romane, Gedichte und Me-dien zeigen, als eine stolze nationale Minderheit, obwohl ihnen in der selbsternannten einzigen Demokratie im Nahen Osten grundlegen-
VORWORT| 19
de kollektive und individuelle Menschen- und Bürgerrechte verwei-gert werden.
Aber die Zukunft dieser Gemeinschaft ist unsicher und gefährdet. Die maßgeblichen Vertreter in der Regierung Israels, Innenminister Eli Yishai, Außenminister Avigdor Lieberman und Minister für Innere Si-cherheit Yitzhak Aharonowitz, sprachen 2010 offen, in Israel selbst wie auch außerhalb, über die Strategie des jüdischen Staates im kommen-den Jahrzehnt die Palästinenser umzusiedeln, ihnen ihre Staatsange-hörigkeit zu entziehen und ihre Städte zu judaisieren. Wenn Politiker in Großbritannien oder in den USA auf solche Weise über Juden reden würden, wie jüdische Politiker über Palästinenser in Israel gesprochen haben, würden sie sofort zum Rücktritt gezwungen werden. In Israel können sie auf umso größere Zustimmung bei den Wählern rechnen. Noch haben diejenigen, die einer solche Politik nicht zustimmen wür-den, einen gewissen Einfluss, aber er nimmt Tag für Tag schrittweise ab. Dies Buch wurde im Bewusstsein der Dringlichkeit und Sorge um die Zukunft der Gemeinschaft geschrieben.
Einleitung
DAS BUCH IST NICHT DER ERSTE VERSUCH, die Geschich-te einer Gruppe zu erzählen, die am Anfang lediglich 100 000 Men-schen zählte und heute mehr als 1,5 Millionen umfasst. Es ist keine sehr große Gruppe, und doch verdient sie unsere Aufmerksamkeit. Sie war und ist Gegenstand vieler sozialwissenschaftlicher Studien – oder vielmehr ein Testfall – für eine Fülle von Theorien. Deshalb fokussie-ren sich bisher ausgezeichnete Arbeiten auf spezifische chronologische oder thematische Aspekte des Lebens der Gruppe. Der beste Weg, die eindrücklichen Forschungsergebnisse zu erfassen, wäre ein sorgfältig ediertes Buch. Ich hoffe, dies wird bald erscheinen. Einstweilen habe ich diesem Buch als Ergänzung der Darstellung einen Anhang hinzu-gefügt, der die wissenschaftliche Entwicklung der Forschung zu den Palästinensern in Israel kurz zusammenfasst.
Die meisten dieser Arbeiten haben es – nicht aus eigenem Verschul-den – unterlassen, das wissenschaftliche Interesse in eine allgemeine-re und politische Sichtweise zu übertragen. Für die Welt insgesamt, und für den Teil der Welt, welcher aktiv mit dem Thema Palästina be-fasst ist, waren die Palästinenser in Israel lange Zeit ein Rätsel. Sammy Smooha und Don Peretz nannten die Palästinenser in Israel »unsichtba-re Personen«.[1]Das könnte sich jetzt ändern. Nadim Rouhana spricht davon, dass »die Araber in Israel zugenommen haben bis dahin, dass sie sowohl von den Israelis als auch den Palästinensern nicht länger igno-riert werden können«.[2]Nach Rouhana endet damit eine Zeit, in der »die Araber in Israel eine unsichtbare, gesichtslose und potenziell ihrer palästinensischen Identität beraubte Gruppe« waren. Stattdessen wur-den sie zu einem »bewussten, aktiven und dynamischen Teil des paläs-tinensischen Volkes«.[3]Dennoch scheinen sie auf internationaler Ebe-ne immer noch ignoriert zu werden.
Einleitung| 21
Ein wichtiger Schritt, die besonderen Gegebenheiten der Gemein-schaft öffentlich zu machen, wurde durch zwei bemerkenswerte, kürz-lich zu diesem Thema erschienenen Bücher erreicht: Nadim Rouhana,Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in Conflict(1997) und As‘ad Ghanem, The Palestinian-Arab Minority in Israel (2001). Beide sind äußerst wertvolle Quellen für alle, die die Entwick-lung der politischen Identität und Orientierung dieser Gruppe in his-torischer Sicht verstehen wollen.[4]
Rouhanas Buch stellte die Entwicklung der palästinensischen Iden-tität im Staat Israel in den Mittelpunkt und widerlegte dabei die vor-herrschende wissenschaftliche Annahme, nach der die Araber in Isra-el zwischen ›Israelisierung‹ und ›Palästinisierung‹ hin- und hergerissen wären. Sein Buch zeigte, wie sich die zwei Bevölkerungsgruppen in Is-rael mit sehr geringem Austausch im Sinne kollektiver Identität entwi-ckelten. Daher wuchsen Juden und Palästinenser in Israel mit unvoll-ständiger nationaler Identität heran. Die Situation wurde verstärkt und verstetigt durch Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Staates, was unvermeidlich zu Konflikten führt, solange der ethnisch bestimm-te Staat Israel nicht durch einen bürgerlichen, binationalen Staat er-setzt wird.
As‘ad Ghanems Buch, vier Jahre später erschienen, hat zum Ver-ständnis der politischen Strömungen in der palästinensischen Gemein-schaft eine neue Dimension hinzugefügt. Es machte uns darauf auf-merksam, dass die Welt der Palästinenser in Israel nicht nur ständig in Beziehung zum jüdischen Staat und dessen Politik gesehen werden sollte. Es gäbe Themen wie Religion, Modernität und Individualität, die auch die Gemeinschaft selbst entzweien würden. Er stimmte mit Rouhana überein, was die Existenz eines gewissen palästinensischen Konsenses innerhalb des Staates Israel beträfe. Ghanems Forschung er-möglichte es ihm, die starke Bedeutung des säkularen Elements in der palästinensischen Gesellschaft wahrzunehmen, dies in einer Zeit glo-baler und lokaler israelischer Islamophobie. Er wies auch mit Sorge auf die Rückkehr des Clans hin als einer rückschrittlichen Machtbasis für Politik. Beide Bücher bieten als Rezept für die Zukunft einen binatio-nalen Staat anstelle des bestehenden jüdischen Staates an. Ich gehe in diesem Buch nicht auf meine eigene Vorstellung für die Zukunft ein. Es geht mir mehr um die Lehren aus der Geschichte als um die Tü-cken der Zukunft.
22 | Die vergessenen Palästinenser
Zu der bereits vorhandenen ausgezeichneten Literatur will ich die historische Sicht hinzufügen (und näher auf den historischen Hinter-grund, wie er in den beiden erwähnten Büchern dargestellt wird, einge-hen). In den zehn Jahren seit Erscheinen dieser wichtigen Veröffentli-chungen haben der Zionismus und der palästinensische Nationalismus in einer Weise zugenommen, die es uns erlaubt, die Palästinenser in Is-rael deutlicher als Opfer des Zionismus und als integrativer Teil der palästinensischen Bewegung zu verorten. Von daher setzt dieses Buch meine Forschung zu Palästina und Israel fort, welche ich in Die ethni-sche Säuberung Palästinas (englisch 2006, deutsch 2007)[5]begonnen habe. Nur über die Geschichte der palästinensischen Minorität in Is-rael gelingt es, zu erfassen, wie stark der lang gehegte zionistische und israelische Wunsch nach ethnischer Überlegenheit und Exklusivtät die gegenwärtige Lage vor Ort hervorgebracht hat.
Dieses Buch will Israels Palästinenser aus ihrer Rolle als Fallbeispiel lösen und ihre Historie darstellen. Das ist erst jetzt möglich, da die Gruppe bereits einen Werdegang von mehr als 60 Jahren als nicht-jüdi-sche Minorität in einem jüdischen Staat hinter sich hat. Der Grund da-für, dass ein kohärentes historisches Narrativ der Gruppe bisher nicht versucht wurde, hat zunächst mit der Kürze der Geschichte zu tun – Historiker benötigen Perspektiven und Dauer. Aber es gibt noch ei-nen Grund: Es ist eine sehr schwer zu definierende Gruppe ohne deut-liche ethnische, kulturelle, nationale, geografische oder gar politische Grenzen. Die Palästinenser in Israel – ihre Führer, Aktivisten, Politi-ker, Dichter, Schriftsteller, Wissenschaftler und Journalisten – suchen selbst nach einer zutreffenden Definition.
Und dennoch gibt es gute Gründe, ihre Geschichte zu erzählen. Die Palästinenser in Israel stellen einen sehr wichtigen Teil des palästinen-sischen Volkes und der palästinensischen Frage dar. Ihre zurückliegen-den Kämpfe, gegenwärtige Lage und ihre Hoffnungen und Ängste im Blick auf die Zukunft sind mit denen der übrigen palästinensischen Bevölkerung aufs Engste verbunden. Sie haben sowohl auf palästinen-sischer wie auf israelischer Seite eine marginale Rolle gespielt, dennoch müssen sie in jede Lösung aus der gegenwärtigen Sackgasse einbezo-gen werden.
Es gibt einen weiteren Grund, sich mit der Sozialgeschichte dieser besonderen Gruppe zu befassen. Israel behauptet, die einzige Demo-kratie im Nahen Osten zu sein. Als größte Minderheit stellt die Lage
Einleitung | 23
der Palästinenser den Lackmustest für den Wert dieser Behauptung dar. Ihre Geschichte ist auch eine von Multikulturalismus und Intra-kulturalität, Themen von grundlegender gesellschaftlicher Bedeutung über Israel und Palästina hinaus, die das Schicksal der Ost-West-Bezie-hung im Nahen Osten insgesamt betreffen.
Die Minorität ist eine heterogene Gemeinschaft, in der Christen Seite an Seite mit Moslems leben, Islamisten und Vertreter des Säku-larismus um politische Vorherrschaft wetteifern und in der Flüchtlin-ge darum ringen, wahrgenommen zu werden von einer Gemeinschaft, in der die Mitglieder mehrheitlich in denselben Dörfern leben, die ihre Vorfahren vor Hunderten von Jahren gebaut haben.
Es ist eine Gruppe, die sowohl von der palästinensischen Bewe-gung in den 1950er Jahren als auch von aktuellen israelischen politi-schen Kräften Verräter genannt wurden. Ihre erstaunliche Geschichte ist ein nahezu unmögliches Navigieren in den Fluten von Kolonialis-mus, chauvinistischem Nationalismus, fanatischer Religiosität und in-ternationaler Indifferenz. Es ist die Geschichte einer Gruppe, zu der ich nicht gehöre, aber in deren Mitte ich die meiste Zeit meines Er-wachsenenlebens verbrachte. Wie ich in dem kürzlich erschienen Buch erläuterte –Wissenschaft als Herrschaftsdienst – Der Kampf um die aka-demische Freiheit in Israel (deutsch 2011)[23]–, wurde ich wegen mei-ner wissenschaftlichen und intellektuellen Kritik der jüdischen Gesell-schaft von meiner eigenen Gemeinschaft geächtet bis dahin, dass ich entschied, im Ausland zu arbeiten. Ich war seit den 1990er Jahren im öffentlichen und politischen Leben in der palästinensischen Gesell-schaft involviert. Ich glaube, man kann zu Recht behaupten, dass mei-ne sozialen Verbindungen und mehr noch meine ideologischen Vor-stellungen in der jüdischen Gemeinschaft in Israel ungewöhnlich sind. Wenn auch nicht der einzige, so bin ich doch einer der sehr wenigen israelischen Juden, die eine so enge Verbundenheit mit der palästinen-sischen Minderheit in Israel fühlen. Die hat mich veranlasst, intensiv Arabisch zu lernen, regelmäßig arabische Literatur zu lesen und arabi-sche Medien zu hören, was aber noch wichtiger ist, ein Vertrauensver-hältnis mit etlichen Mitgliedern der Gemeinschaft zu entwickeln und eine starke Affinität und Solidarität für sie zu empfinden, bis dahin, dass ich zum Paria in meiner eigenen jüdischen Gemeinschaft wur-de. Ich habe das niemals bedauert, selbst als im Oktober 2009 bei der Gedenkfeier für 13 im Oktober 2000 in Arabeh getötete palästinensi-
24 | Die vergessenen Palästinenser
sche Bürger eine Gruppe junger islamistischer Aktivisten versuchten, mich niederzubrüllen. Ich war der einzige zugelassene jüdische Red-ner nach heftigem Widerstand seitens der islamischen Bewegung ge-gen jeden anderen. Ich sage das nicht im Sinne einer Klage oder weil ich mich ungerecht behandelt fühlte. Jene Aktivisten waren eine kleine Minderheit in einem ansonsten sehr aufgeschlossenen Publikum, und ich kann verstehen, warum sie mir gegenüber Misstrauen hegten. Der Grund ist, wenn man einer privilegierten, unterdrückerischen Mehr-heit angehört, tut man, was man tut, nicht in Erwartung stehender Ovationen, auch nicht in Erwartung von Dankbarkeit, sondern viel-mehr um den eigenen Seelenfrieden und der moralischen Genugtuung willen. Aus dieser Sicht ist dieses Buch geschrieben.
Ich will ein Wort zur Methodik hinzufügen. Vordergründig ist dies eine altmodisch erzählte Geschichte. Der Anhang des Buches umfasst so weit als möglich die theoretischen Paradigmen, wie sie andere an-bieten. Diesen fehlt hauptsächlich eine historische Perspektive, aber sie sind sehr nützlich, um die gegenwärtige Lage der Gruppe zu analysie-ren. Am Schluss versucht das Buch sein eigenes Paradigma anzubieten, das des jüdischen Mukhabarat (Geheimdienst auf Arabisch)-Staates (ein im Epilog des Buches erklärtes Modell) in Anbetracht der wich-tigsten Ergebnisse der historischen Untersuchung.
Unsere Erzählung bewegt sich zwischen zwei grundlegenden Per-spektiven, der des israelischen Regimes, insbesondere seiner Entschei-dungsträger, und der der israelischen palästinensischen Gemeinschaft insgesamt, mittels der politischen und gebildeten Elite und den Schrif-ten oder Interviews von und mit verschiedenen ihrer Vertreter. Die Analyse ist im Falle der israelisch-palästinensischen Gemeinschaft aus zwei Gründen nuancierter. Erstens sind der Staat, beziehungsweise die Entscheidungsträger und diejenigen, die vor Ort politisch handeln, aus der gleichen ideologische Perspektive – dem Zionismus – beeinflusst, und deshalb handeln sie meistens in Übereinstimmung. Zweitens hat das Buch die Absicht, so weit wie möglich eine Geschichte des Volkes darzustellen. Deshalb ist die Lupe mehr bei den Palästinensern ange-setzt und nicht bei denen, die die Politik ihnen gegenüber formuliert und exekutiert haben.
Das Buch enthält einen ständig variablen und mehrere dynami-sche Faktoren. Die historischen Perioden sind die einzigen konkreten Grundlagen des Buches, daher die chronologische und nicht eine the-
Einleitung | 25
matische Struktur. Innerhalb jeder Periode bewegt sich die Erzählung von einer Perspektive zu anderen – ich hoffe nicht künstlich schema-tisch, sondern mit Hilfe von Assoziationen, die manchmal das histori-schen Bildes unscharf machen, die aber, wie ich glaube, ein authenti-scheres Bild der Wirklichkeit abgeben. Die Geschichte wird nicht von theoretischen Einschüben unterbrochen, nur von Erläuterungen und Darstellungen bestimmter Ereignisse und Persönlichkeiten. Theorie kommt dann in den Blick, wenn Wissenschaft anfängt, im Verhältnis zwischen der israelisch-palästinensischen Gemeinschaft und dem jüdi-schen Staat eine Rolle zu spielen. Deshalb erscheinen zweimal alterna-tive wissenschaftliche Geschichtsbilder: Im theoretischen Anhang und an kritischen Punkten der Geschichte, an denen von Wissenschaftlern eingeführte Theorien Werkzeuge entweder in den Händen der Regie-rung wurden – etwa die Theorie der Modernisierung – oder derer, die der Regierungspolitik widersprachen – wie die Theorien des internen Kolonialismus und der Ethnokratie.
Erfahrene Leser wissenschaftlicher Werke werden die unüberbrück-bare Kluft würdigen zwischen einer sauber strukturierten Darstellung der Wirklichkeit und deren undurchsichtige, gebrochene und chaoti-sche Existenz als Erfahrung. Wenn die Forschung zu säuberlich vorgeht, ist der Geruch dahin, und das sterile Bild bringt keine Aufklärung, zu-mal in dieser Geschichte eines nahezu unmöglichen Navigierens zwi-schen widersprüchlichen Anforderungen der alltäglichen Bedrängnis und des Kampfes ums Überleben. Das Buch versucht nicht, die Palästi-nenser in Israel, oder die 1948er Araber, wie sie in der arabischen Welt genannt werden, zu idealisieren. Es will sie als Menschen würdigen dort, wo sie entweder vergessen, ausgegrenzt oder dämonisiert werden.
Das Buch ist zugleich der bescheidene Versuch die Realität aus Sicht der Minorität zu begreifen, nicht nur als Leidensgemeinschaft, sondern als natürlichen und organischen Teil des palästinensischen Volkes und seiner Geschichte. Man versteht nicht, was diese Gemeinschaft durch-gemacht hat, wenn man nicht mit der Geschichte spätestens 1947 ein-setzt, als das Gebiet, das zu Israel wurde, noch Palästina war. Hier be-ginnt unsere Erzählung.
Kapitel 1
AUS DER ASCHE DER NAKBA
DAS LAND, DAS PALÄSTINA WAR: 1947
ES IST FASZINIEREND, DIE AKTEN zu lesen, die der Geheim-dienst der Haganah, der jüdischen Untergrundorganisation während des britischen Palästina-Mandats, über palästinensische Ortschaften zusammengetragen hat. Die Mitarbeiter des Geheimdienstes legten zu jedem der eintausend palästinensischen Dörfer eine Akte an. Die Aufzeichnungen begannen 1940 und zogen sich über sieben Jahre hin. Jede Akte enthielt möglichst detaillierte Informationen, ange-fangen von den Namen der großen Familien, über die Berufe der meisten Bewohner und ihre politische Gesinnung, zur Historie, zur Qualität des Bodens, über die öffentlichen Gebäude bis hin zu den Früchten auf den Bäumen der Obstgärten, die traditionell die Dör-fer umgaben.[1]
Es sind wichtige Quellen, zuerst und vor allem, weil sie das Niveau und die Gründlichkeit der zionistischen Vorbereitung auf die Inbesitz-nahme Palästinas offenlegen. Die Akten enthalten Luftaufnahmen von jedem Ort, von der Umgebung mit Angaben über Zufahrt und Eingang, aber auch Einschätzungen des Wohlstandes und die Anzahl der Waffen, die die Männer und Jugendlichen in ihren Häusern verwahrten.
Nicht weniger wertvoll sind diese Akten als historische Quelle für die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse im ländlichen Palästina während der britischen Mandatszeit. Da die Akten aktualisiert wur-den, letztmalig 1947, bieten sie ein dynamisches Bild für Veränderung und Wandel. Wenn man die darin enthaltenen Angaben mit ande-ren Quellen abgleicht, zum Beispiel mit Zeitungen aus der Zeit, ein-
AUS DER ASCHE DER NAKBA | 27
schließlich der offiziellen Palestine Gazette der britischen Mandatsver-waltung, erscheinen das ländliche ebenso wie das städtische Palästina als eine Gesellschaft in Bewegung mit Zeichen wirtschaftlichen Wachs-tums und sozialer Stabilisierung nach Jahren der Depression und ge-sellschaftlicher Umbrüche.
Nahezu jedes Dorf hatte eine Schule, fließend Wasser und erstmals ein funktionierendes Abwassersystem, während die Felder reich tru-gen und Blutfehden beigelegt waren, wie die Dorfakten uns mitteilen. Auch in den Städten und Gemeinden entwickelte sich Wohlstand. Die ersten Absolventen von den Universitäten in der arabischen Welt, da-runter von der amerikanischen Universität in Beirut und der in Kairo, begannen ihre berufliche Laufbahn in Palästina. Sie bildeten eine neue Mittelschicht, wie sie Gesellschaften im Übergang in die vom euro-päischen Kolonialismus und Imperialismus errichtete neue kapitalis-tische Welt so nötig brauchten. Etliche wählten eine Laufbahn in der britischen Mandatsverwaltung als leitende oder untergeordnete Be-amte. Letztere schlossen sich sogar noch 1946 dem Streik ihrer jüdi-schen Kollegen für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen an. Der Wohlstand war anhand der zunehmenden Bautätigkeit sichtbar. Neue Wohnviertel, Straßen und eine moderne Infrastruktur waren überall erkennbar.
Stadt und Land waren am Vorabend der Nakba,der Katastrophe von 1948, noch sehr arabisch und palästinensisch geprägt. Politisch hingegen war die Machtbalance eine andere. Die internationale Ge-meinschaft diskutierte die künftige Rolle des Landes so, als gäbe es zwei gleiche Anwärter darauf. Die Vereinten Nationen übernahmen die Ver-antwortung, über die Zukunft Palästinas zu entscheiden, wenn die bri-tische Herrschaft 1948 enden würde. Schon im Februar 1947 kündigte die britische Regierung an, sie würde das Problem Palästina an die UN übergeben, welche ihrerseits zur Beratung über das Schicksal des Heili-gen Landes eine Sonderkommission einsetzte, dass United Nations Spe-cial Committee on Palestine (UNSCOP).
David Ben Gurion, Führer der jüdischen Gemeinschaft und später Israels erster Ministerpräsident, beklagte vor UNSCOP: »Es ist nicht fair. Die Juden stellen nur ein Drittel der Bevölkerung und haben nur einen sehr geringen Anteil am Land.«[2]Tatsächlich gab es 600 000 Ju-den und 1,3 Millionen Palästinenser. Die Juden besaßen weniger als sieben Prozent des Bodens, während das landwirtschaftlich genutzte
28 | Die vergessenen Palästinenser
Land größtenteils, in manchen Gebieten gänzlich, Eigentum von Pa-lästinensern war.
Ben Gurions Klage schockierte die Palästinenser und bringt sie noch heute in Rage. Genau wegen dieses demografischen und geografischen Verhältnisses meinten sie, dass jeder Plan unannehmbar und unmora-lisch sei, der es der übergroßen Mehrheit der Menschen in Palästina nicht erlaubte, über ihre Zukunft zu entscheiden. Außerdem waren die Juden in ihrer Mehrzahl Neuankömmlinge und Siedler, die meisten erst drei Jahren zuvor angekommen, während die Palästinenser die ur-sprüngliche und die eingesessene Bevölkerung darstellten.[3]Aber ihre Meinung wurde ignoriert. Es half nicht, dass die palästinensische Füh-rung entschied, UNSCOP zu boykottieren, und dass die Palästina-Po-litik hauptsächlich von der Arabischen Liga bestimmt wurde, die nicht immer das palästinensische Interesse im Blick hatte.
Die UN entschied, Ben Gurion entgegenzukommen: Sie gab den Weg frei für eine unbegrenzte Einwanderung von Juden und sie sprach 55 Prozent des Landes dem jüdischen Staat zu.
Die prinzipielle palästinensische und arabische Ablehnung des Tei-lungsplanes und der Widerspruch dagegen waren der jüdischen Füh-rung sehr wohl bekannt, noch ehe sie um ihre Meinung zum UN-Plan gefragt wurde. Als die jüdische Seite dem Plan zustimmte, wusste sie deshalb, dass wegen des arabischen und palästinensischen Widerstan-des wenig Hoffnung bestand, dass der Plan umgesetzt werden würde. Dennoch hat seitdem die israelische Propaganda Israels Zustimmung und die palästinensische Ablehnung des Plans als Indiz für die eigenen friedlichen Absichten gegenüber den unnachgiebigen Palästinensern angeführt. Vor allem aber wurde die palästinensische Ablehnung später von der israelischen Regierung als Begründung für ihre Entscheidung benutzt, Teile des Landes zu okkupieren, die im UN-Teilungsplan den Palästinensern zugeteilt waren.
Die arabische Welt erklärte ihre Absicht, gegen die Umsetzung des Planes kriegerisch vorzugehen, doch fehlten die Mittel oder der Wil-le, diese aufzuhalten. Drei Monate bevor die arabischen Armeen nach Palästina eindrangen, im Mai 1948, begannen die militärischen Kräfte der jüdischen Gemeinschaft mit der ethnischen Säuberung der Häu-ser, Felder und des Landes von Palästinensern. Auf diese Weise erwei-terten die Streitkräfte den Gebietsanteil, den die UN ihnen zugespro-chen hatte, um 23 Prozent. Im Januar 1950 umfasste der jüdische Staat
AUS DER ASCHE DER NAKBA | 29
annähernd 80 Prozent von Palästina. Diejenigen, die dortblieben, wur-den die »Araber in Israel«, die aus der Asche ihrer Katastrophe heraus ihr Leben aufbauten.
DER ZIONISTISCHE TRAUM UND DIE BINATIONALE REALITÄT: 1949
Die Fotografien von Anfang 1949 zeigen es unmissverständlich: Es sind darauf verängstigt blickende Palästinenser und Palästinenserinnen zu sehen, verwirrt, desorientiert und vor allem traumatisiert. Sie stan-den vor einer neuen Realität. Das Palästina, das sie kannten, war ver-loren und durch einen neuen Staat ersetzt. Die Veränderungen waren zu klar erkennbar, als dass sie jemand übersehen konnte. Viele ihrer Landsleute, etwa 750 000, waren 1948 vertrieben worden und durf-ten nicht zurückkehren. Sie wurden Flüchtlinge oder Bürger des Ha-schemitischen Königtums Jordanien, oder sie lebten unter Militärherr-schaft im ägyptischen Gazastreifen. Von einer Million Palästinensern, die in dem Gebiet lebten, das zum Staat Israel wurde (78 Prozent des britischen Mandatsgebietes), blieben 160 000 im Jahr 1949 zurück.
Es gibt noch Fotos der kleinen Bezirke inmitten der urbanen Zent-ren, abgesperrt durch Drahtverhaue und Zäune, in denen die Zurück-gebliebenen tagelang und manchmal wochenlang in den zerstörten und verödeten Städten zu hausen gezwungen waren. Diese anfängli-chen Versuche, die Palästinenser zusammenzufassen, die ihre Woh-nungen verloren hatten, aber innerhalb der Grenzen ihrer Ortschaften blieben, wurden von israelischen Soldaten bewacht. Sie nannten diese Absperrungen »Ghettos«. Diese verschwanden 1950, als das geopoliti-sche Klima humaner wurde, aber in dieser Zwischenzeit symbolisierten sie deutlicher als jedes andere Bild die Notlage, in der sich diese Paläs-tinenser wiederfanden.[4]Nicht weniger dramatisch war die Lage derje-nigen, die vertrieben wurden, weil sie nach Hause zurückzukehren ver-suchten, als die Kämpfe nachgelassen hatten.
Zu den neuen Aussichten kam der Lärm der Traktoren und Bulldo-zer hinzu, die für den Jüdischen Nationalfonds (Jewish National Fund, JNF) und andere offizielle israelische Stellen dem Regierungsauftrag folgten, die bisher palästinensischen Gebiete, Dörfer und Städte, so
30 | Die vergessenen Palästinenser
AUS DER ASCHE DER NAKBA | 31
die umliegenden Dörfer vertrieben worden war. Wenn man die Erin-nerungen dieser palästinensischen Bürger und Bürgerinnen hört oder liest, wie es ihnen am Beginn der jüdischen Staatlichkeit erging, sind das zumeist Erzählungen von Verlust, Panik und Verzweiflung.
Manche aus ländlichen Gebieten Vertriebene erhielten später die Erlaubnis zur Rückkehr, aber keineswegs alle. Eine traumatische Erfah-rung war es, fortzumüssen, zurückzukommen und festzustellen, dass das Haus in Besitz genommen war. Eine andere Erfahrung war, man konnte etwa ein Jahr lang im eigenen Haus wohnen bleiben und wur-de dann gewaltsam ausquartiert und aufs Land abgeschoben (mindes-tens so lange die Militärverwaltung dauerte, d.h. bis 1966). »Meine Mutter wurde hysterisch: ›Begreifst du nicht, dass wir niemals zurück-kommen werden? Dein Buch nicht [ich las inmitten des Chaos in ei-nem Buch], wir nicht, nichts‹« erinnert sich Umm Muhammad, der in der dritten Klasse war, als sie aus dem Halisa-Viertel in Haifa zwangs-weise in ein nahegelegenes Dorf evakuiert wurden.[7]Wie diese Mut-ter entdeckten viele, als sie in den 1960er Jahren versuchten zurück-zukehren, dass andere ihre Wohnungen und Geschäfte übernommen hatten – etwa Buchhandlungen, Anwaltskanzleien oder Lebensmittel-läden –, in denen sie seit Generationen gelebt und gearbeitet hatten. Kein Wunder, dass viele den Versuch zurückzukehren aufgaben und sich mit dem Gedanken abfanden, auf dem Land zu leben in Dörfern, die sich kaum selbst versorgen konnten, nachdem ihre Felder von den israelischen Behörden enteignet worden waren.
Am schlimmsten war es, in den Städten aus nächster Nähe den Ver-lust zu beobachten, wo Eigentum und Geschäft entweder im Müll lan-deten oder von jemand anderem angeeignet wurden. Manche Augen-zeugen wollen bis heute nicht bei Namen genannt werden. Hannan (nicht ihr wirklicher Name) ist heute Ruheständlerin in Haifa. Ihre Fa-milie lebte in einer Wohnung in einem Haus, das ihnen gehörte. Ihr Va-ter hatte in der Nähe eine kleine Fabrik für Baustoffe. Die Reste beider Gebäude sind heute noch zu sehen. Ihre Familie zog im Januar 1948 fort, wie reichere Leute von Haifa es taten, die die Mittel hatten zu reisen und in Beirut oder Kairo zu bleiben. Diese Oberschicht wollte nicht in das bevorstehende Kämpfen geraten und hoffte, später zurück-zukommen. Sie ließen all ihren Besitz in ihren Wohnungen zurück. Die große Mehrheit der Menschen in Haifa konnte sich einen solchen Ex-odus natürlich nicht leisten. Sie blieben, bis sie im April 1948 von den
32 | Die vergessenen Palästinenser
jüdischen Streitkräften vertrieben wurden. Bei ihrer Rückkehr erfuhr Hannahs Familie, dass sowohl ihr Haus als auch die Fabrik enteignet und von jüdischen Bewohnern übernommen worden waren. Wie viele andere wurde die Familie nie dafür entschädigt. Hannah erinnert sich, dass sie in ständiger Furcht gelebt hätten, erneut vertrieben zu werden, und dass ihnen die neue Bleibe genommen werden würde.[8]
Wie Hannah gab es viele ursprüngliche Einwohner von Haifa, die nicht in ihren Häusern bleiben durften. Sie wohnten in der Nähe und beobachteten mit Schmerzen, wie diese von Eindringlingen in Besitz genommen wurden. Aufgrund des starken internationalen Druckes, insbesondere aus den USA, kehrten im ersten Jahr israelischer Staat-lichkeit 25 000 vertriebene Palästinenser im Rahmen der Familienzu-sammenführung zurück. Dies war im Jahr 1949, als die internationale Gemeinschaft, besonders die UN, verlangten, dass Israel die bedin-gungslose Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Häuser zuließe (Resolution Nr. 194 UN-Vollversammlung vom 11.12.1948). Israel weigerte sich hartnäckig, sich an die Resolution zu halten. Als Kompromiss kam die Regierung der amerikanische Administration entgegen und ermöglich-te die Rückkehr einer kleinen Zahl von Flüchtlingen, die bereit waren, einen Treueeid auf den jüdischen Staat zu leisten.[9]
Sie kamen vor allem aus dem Libanon und stellten fest, dass ihre Woh-nungen während ihrer kurzen Abwesenheit von jüdischen Einwanderern übernommen worden waren. Infolgedessen mussten sich angesehene Familien, die in der Mandatszeit relativ luxuriös auf dem Mount Car-mel gewohnt hatten, mit schäbigen Räumlichkeiten in engen, ärmlichen Vierteln der Innenstadt von Haifa zufriedengeben. Der aus Haifa gebür-tige Schriftsteller und spätere politische Führer Emil Habibi hat diesen besonderen Aspekt der Tragödie festgehalten. Als er zurückkam, nach-dem die Kämpfe nachgelassen hatten, wurde er Zeuge, wie seine Möbel aus der Wohnung in der Abbas Street hinaus und den Berghang hinab-geworfen wurden.[10]Er fragte die neuen Bewohner, warum sie wegwar-fen, was ihm gehörte, und erhielt die Antwort: »In dem Haus wohnen wir jetzt.« Mit großer Mühe mietete er in der Straße eine Wohnung. Sol-che ähnlichen Geschichten könnten viele der Rückkehrer erzählen.
Habibi verlor mehr als seine Möbel. In einem Interview mit Shimon Balas, einem der wenigen irakischen jüdischen Intellektuellen in Isra-el, der seiner arabischen Herkunft und Kultur treu blieb, erinnerte er sich: »Nach 1948 zog ich nach Nazareth und dort erschrak ich, als ich
AUS DER ASCHE DER NAKBA | 33
mitbekam, dass meine beiden Töchter Angst hatten, mit einem Jun-gen in der Straße zu reden. Vor 1948 wohnten wir in der Abbas Street als christliche und moslemische Jungen und Mädchen und waren alle untereinander befreundet, gingen auf die gleichen Parties, unser Leben war damals anders, wir hatten keine Angst, mit anderen Kontakt zu ha-ben und uns zu befreunden.«[11]
Für manche war nicht Verlust und Enteignung des privaten Besit-zes prägend für die Zeit, sondern die Schändung von allem, was ih-rem Herzen heilig und wichtig war, so wie die Kirchen und Moscheen in den Städten und auf dem Lande. Pater Deleque, 1948 ein katho-lischer Priester in Jaffa, erinnert sich: »Jüdische Soldaten brachen die Türen meiner Kirche auf und raubten viele kostbare und sakrale Ge-räte. Dann warfen sie die Christusstatuen nebenan in einen Garten.« Er wusste von den wiederholten Zusicherungen der Regierung und des örtlichen Militärkommandeurs, die Heiligkeit der Moscheen und Kirchen zu respektieren, aber er stellte fest, dass »ihre Taten nicht ih-ren Worten entsprachen«.[12In der Regel wurden Kirchen mehr geach-tet als Moscheen, welche in dem neuen jüdischen Staat Israel in großer Zahl aus der palästinensischen Landschaft verschwanden.
Die destruktive Verwandlung der Vergangenheit in die neue Re-alität war für die Elite in den urbanen Zentren besonders schwer zu verstehen. In Haifa wurden die führenden Palästinenser am Abend des 1. Juli 1948 zu einem Treffen mit dem jüdischen Militär-Gou-verneur der Stadt aufgefordert. Diese Persönlichkeiten repräsentier-ten einige tausend zurückgebliebene Palästinenser, nachdem 70 000 andere Mitbürger vertrieben worden waren. Zweck des Treffens war, ihnen aufzutragen, die Übersiedlung der Araber aus der Stadt in ein Viertel zu erleichtern, nämlich nach Wadi Nisnas, den ärmlichsten Teil der Stadt. Einige derer, denen der Umzug befohlen wurde, hat-te lange Zeit am oberen Hang des Berg Carmel gewohnt, bzw. auf dem Berg selbst.
Den Bürgern wurde befohlen, bis zum 5. Juli 1948 umzuziehen. Die Führungspersönlichkeiten waren schockiert. Viele von ihnen ge-hörten der Kommunistischen Partei an, die den Teilungsplan unter-stützt hatte. Sie hatten gehofft, jetzt nach dem Ende der Kämpfe könne das normale Leben wieder beginnen. »Ich versteh nicht: Ist das ein mi-litärischer Befehl?«, protestierte Tawfiq Tubi, später Mitglied der Knes-set für die Kommunistische Partei. »Schauen wir auf die Lage, in der
34 | Die vergessenen Palästinenser
diese Menschen sind. Ich kann keinen Grund erkennen, auch keinen militärischen, der solch einen Umzug rechtfertigen würde.« Er ende-te seine Rede mit den Worten: »Wir fordern, dass die Menschen in ih-ren Häusern bleiben.« Ein anderer Teilnehmer, Bulus Farah, rief: »Das ist Rassismus«, und er nannte die Umquartierung »Ghettoisierung der Palästinenser in Haifa«.[13]
Selbst das trockene Dokument kann die Erwiderung des israeli-schen Militärkommandeurs nicht verhehlen – eiskalt, stahlhart:
»Ich sehe Sie hier sitzen und mir Anweisungen erteilen, während Sie eingeladen waren, die Befehle des Oberkommandos anzuhören und zu unterstützen. Ich habe nichts mit Politik zu tun und es geht mir nicht darum. Ich gehorche nur Befehlen ... Ich führe nur Befehle aus und muss sicherstellen, dass diese Befehle bis zum Fünften ausgeführt werden ... Wenn das nicht der Fall ist, werde ich selbst dafür sorgen. Ich bin Sol-dat.«
Am Ende des langen Monologs des Kommandanten fragte Shehada Shalah: »Wenn jemand Eigentümer des Hauses ist, muss er dann weg-gehen?« Der Kommandant: »Jeder muss gehen.«
Dann kam die Frage nach den Kosten. Die Anwesenden erfuhren, dass die Vertriebenen die Kosten für ihren erzwungenen Auszug selbst zu zahlen hätten. Victor Hayat versuchte, gegenüber dem Komman-danten zu argumentieren, dass es länger als einen Tag dauern würde, die Menschen zu benachrichtigen, und dass sie dann nicht mehr viel Zeit hätten. Der Kommandant antwortete, vier Tage seien eine lange Zeit. Der Schreiber protokollierte: »Alle arabischen Vertreter schrien auf: ›Es ist eine sehr kurze Frist‹, und der Kommandant antwortete: ›Ich kann es nicht ändern.‹«[14]
Nicht jeder hielt sich an den Befehl. Wadi Bustani, Rechtsanwalt, Dichter und Schriftsteller, wohnte in der schönen Allee, die vom Berg hinab zum Meer führt (heute Ben Gurion-Avenue, die den Bahai-Tem-pel mit dem Hafen verbindet). Er konnte den Gedanken wegzugehen nicht ertragen. Er wurde verhaftet und gefangen gehalten. Doch da er nicht nachgab, wurde ihm schließlich erlaubt, in seinem Haus wohnen zu bleiben. Weniger Glück hatte das geistliche Oberhaupt der Ortho-doxen Kirche, Mitglied der umfangreichen griechischen Gemeinschaft, die 1948 ebenfalls wegging. Ihm wurde aufgetragen, seine Kirche und sein Kloster zu verlassen und nach Wadi Nisnas zu ziehen. Die litur-gischen Gottesdienste musste er in einem »ungeeigneten Saal, der von
AUS DER ASCHE DER NAKBA | 35
Nord nach Süd, statt von West nach Ost ausgerichtet war, zelebrieren, was den Riten und Traditionen der Kirche widerspricht«.[15]
Andere gingen einfach fort, wie Emil Habibis Mutter. Wie sich der berühmte Schriftsteller und Dichter erinnert, konnte die Generation seiner Mutter es nicht ertragen, unter solchen Umständen in Haifa zu bleiben:
»Umm Wadie [Habibis Mutter] konnte den Schock jener Tage nicht verwinden [1948; sie war in Jerusalem, als im April die jüdischen Streit-kräfte Haifa besetzten]. Sie hatte ihr Leben hinter sich und die meis-ten ihrer Söhne und Enkel waren in der Diaspora verstreut. Einmal kam sie hinab in die Räumlichkeiten unseres alten politischen Clubs in Wadi Al-Nisnas, um an einem arabisch-jüdischen Frauentreffen teil-zunehmen. Es waren Tage einer stürmischen allgemeinen Wahlkampa-gne. Die jüdische Rednerin betonte unseren Kampf für die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat. Umm Wa-die unterbrach sie und sagte: ›Werden meine Söhne und Töchter zu-rückkehren?‹
Betroffen antwortete die jüdisch-ungarische Rednerin: ›Sie werden zurückkommen, wenn Frieden sein wird.‹ ›Lügen‹, rief Umm Wadie, ›mein Sohn Emile belügt mich nie. Er sagte mir, dass ihre Rückkehr, wenn überhaupt jemals, sehr lange dauern würde. Aber dann werde ich nicht mehr hier sein, um sie zu sehen. Ich werde in meinem Grab sein.‹
Seit diesem Treffen wurde es ihre Gewohnheit, heimlich, ohne dass ich davon wusste, in eine Ecke des Gartens von Abbas in der Nähe un-seres Hauses zu gehen. Sie lehnte sich an einen Stein im Schatten eines Olivenbaumes und betrauerte ihr Schicksal – einsam und getrennt von ihren Kindern, besonders von ihrem jüngsten Sohn Naim.«
Ende 1949 wurden die Zurückgebliebenen offiziell zur »arabischen Minderheit Israels«. Auf ihrem Personalausweis erschien unter der Rub-rik ›Nationalität‹ die religiöse Zugehörigkeit, nicht die nationale. Nach diesen Dokumenten gab es keine Palästinenser oder Atheisten unter den Bürgern des jüdischen Staates. In der offiziellen Sprache der staat-lichen Gesetze erschienen sie als bnei miutim, Angehörige der Minder-heiten – wohlgemerkt ›Minderheiten‹ im Plural, als gäbe es neben den Palästinensern weitere Minderheiten. Aber im Grunde genommen wa-ren sie Araber; ihre Identität war der eindeutigste Signifikant des Juden in Israel. In Europa waren Juden diejenigen, die nicht Christen waren, und in der arabischen Welt waren Juden die, die nicht Christen oder
36 | Die vergessenen Palästinenser
Moslems waren. Es war eine religiöse Definition. In dem neuen jüdi-schen Staat wurde Jude zur ethnischen Identität, und ein Jude war of-fensichtlich jemand, der nicht ›Araber‹ war – nicht irgendein Araber, sondern jemand, der nicht Palästinenser war. Ohne eine solche Defini-tion wäre die Frage, wer ein Jude sei – eine ständige Quelle für Schere-rei in der Entwicklung der israelischen Gesetzlichkeit und Verwaltung – ein unlösbares Problem zwischen religiöser und nationaler Definiti-on geblieben. Es gab natürlich arabische Juden oder Juden, die aus ara-bischen Ländern kamen, aber sie wurden entarabisiert, freiwillig und politisch von oben her gewollt. Sie wurden gecoacht, ihre arabischen Namen zu hebraisieren, sich die arabische Sprache, Geschichte und Wurzeln abzugewöhnen und eine strikt antiarabische Haltung einzu-nehmen als bestes Mittel, sich in die alte aschkenasische, d.h. europäi-sche Gesellschaft einzufügen.[16]
GEOGRAFISCHE VERTEILUNG
Die neue Minderheit lebte in sechs geografischen Räumen des Staats-gebietes. Der erste war eine zerstreute Existenz in Israels städtischen Zentren. Diese Metropolen veränderten sich 1948 dramatisch. Jahr-hundertealte Markthallen wurden zerstört, ganze Stadtviertel besei-tigt, um das Stadtbild zu entarabisieren, und nur die Häuser der Ober-schicht blieben erhalten, da sie von den neuen jüdischen Bewohnern heiß begehrt waren. Die zuvor von Kirchtürmen und Minaretten be-stimmte Silhouette wurde nunmehr durch klotzige Hochhaus-Mons-ter für die vielen Einwanderer abgelöst, ohne viel Rücksicht auf die Landschaft und die darin lebenden Menschen.
Sehr kleine Gruppen verblieben in den urbanen Räumen, die in den Militäroperationen vom Frühling und Sommer 1948 gesäubert wor-den waren, einige Hundert in Haifa und Jaffa, einige Tausend in She-fa-‘Amr im westlichen Galiläa, die beinahe ebenfalls vertrieben worden wären, aber schließlich bleiben durften, und etwa zehntausend in Na-zareth, gleichfalls zunächst verurteilt, als Bevölkerung der Säuberung anheimzufallen, durften sie doch bleiben, nachdem die israelische poli-tische Führung die frühere Entscheidung zurückzog und die Menschen dort verschonte. Der Kommandant der Brigade, die die Stadt besetzte
AUS DER ASCHE DER NAKBA | 37
(Brigade 7), telegrafierte am 17. Juli 1948: »Sollen wir die Einwohner der Stadt Nazareth vertreiben? Meiner Meinung nach sollten wir alle außer den Geistlichen vertreiben.« Ben Gurion antwortete: »Vertreibt die Leute aus Nazareth nicht.«[17]
Viele von denen, denen Ben Gurion zu bleiben erlaubte, waren Bin-nenflüchtlinge aus den umliegenden Dörfern von Nazareth. Auch in anderen Orten waren es Binnenflüchtlinge aus nahegelegenen Dör-fern, die die ›Araber‹ von Haifa und Shefa-‘Amr wurden. Sie landeten 1948 dort nach Vertreibung und Flucht oder später in einem Prozess der internen Migration. Nur sehr wenige gehörten zu den ursprüngli-chen Stadtbewohnern. Die Häuser, in die sie einzogen, gewöhnlich zur Miete, weil die meisten Wohnungen für Araber nicht käuflich waren, gehörten ehemals oft Palästinensern. Damit begannen die Probleme des Lebens der Palästinenser in den Städten in Israel.
Die zweite Gruppe war die ländliche Bevölkerung in Unter- und Obergaliläa, die die Militäroperationen der ethnischen Säuberung überlebt hatten, wobei die Gründe noch genauer untersucht werden müssen. In Ermangelung einer besseren Erklärung nehmen wir an, dass aufgrund ihres Widerstandes und wegen der Erschöpfung der is-raelischen Armee Tausende Palästinenser 1949 noch in Galiläa wohn-ten. Trotz staatlicher Bemühungen in den 1970er und 1980er Jahren das Gebiet zu judaisieren, ist das Landschaftsbild noch ›arabisch‹, so wie über 60 Prozent der