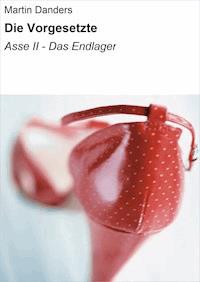Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anfang 1978 liegt der Erzähler im Sterbebett und träumt seine gesamte Lebensgeschichte, die 1923 begann. Als ein typischer Vertreter seiner Generation, war er gleich nach dem Abitur, jung und ohne am System zu zweifeln, in den Zweiten Weltkrieg gezogen. Bei der deutschen Kriegsmarine durchlief er eine harte Ausbildung, die stark sein weiteres Leben prägte. Den Krieg schilderte er später seinen Zuhörern als großes Abenteuer. Nach der Kapitulation war er zunächst in kanadischer Kriegsgefangenschaft. Im völlig zerstörten Kassel reparierte er Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Später war er am Wiederaufbau der Münchner Universität beteiligt. Nach seinem Physik-Studium bekam er rasch eine Stelle bei der AEG. Während sich seine Frau um die zwei Söhne kümmerte, machte er Karriere bei dem Elektro-Konzern. Der Erzähler genoss die zahlreichen privaten wie betrieblichen Partys, die ein wichtiger Teil der Wunderwirtschaftszeit waren. Seinen gut entwickelten Sexualtrieb lebte er hemmungslos, ohne Rücksicht auf seine Ehefrau zu nehmen, aus. Seine Kriegsgeneration hat in der Regel ihre seelischen Beschädigungen an die nächste Generation weitergegeben. Die negativen Auswirkungen auf die Kinder sollten nicht unterschätzt werden. Wissenschaftler vermuten, dass sogar noch die Enkelkinder betroffen sind. Gab es beim Erzähler neben seinem Kriegstrauma auch noch andere, schwerwiegende Gründe? Jeder Leser sollte sich sein eigenes Bild machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Danders
Die verlorene Generation
Max seine Geschichte von 1923-1978
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort:
1. Kapitel (1923-1938)
2. Kapitel (1939-1945)
3. Kapitel (1946-1950)
4. Kapitel (1951-1960)
5. Kapitel (1961-1965)
6. Kapitel (1966-1967)
7. Kapitel (1968)
8. Kapitel (1969)
9. Kapitel (1970)
10. Kapitel (1971)
11. Kapitel (1972)
12. Kapitel (1973)
13. Kapitel (1974)
14. Kapitel (1975)
15. Kapitel (1976)
16. Kapitel (1977)
17. Kapitel (1978)
Nachwort
Impressum neobooks
Vorwort:
Die Geschichte und die darin vorkommenden Menschen sind Realität. Exemplarisch für viele andere Zeitzeugen dieser Generation erzählt der Erzähler seine Lebensgeschichte (1928 - 1978). Von Fachleuten wird seine Altersgruppe, als eine kriegsbedingte, verlorene Generation bezeichnet. Angeblich bedarf es mindestens noch zwei weitere Generationen bis die Beschädigungen der Seelen endgültig verschwunden sind.
1. Kapitel (1923-1938)
1923 wurde ich in Königsberg in Ostpreußen geboren. Mein Vater, F., war ein Buchhalter, der während der Weltwirtschaftskrise lange arbeitslos war. Meine Mutter, M., war eine ehemalige Landmagd, die ursprünglich aus Nordhessen stammte. Meine Schwester C. ist zwei Jahre älter als ich. Für beide Frauen war ich das Wichtigste auf der Welt, deswegen beschützten sie mich fürsorglich vor allem Bösem. Vielleicht übertrieben sie ihre Besorgnis ein wenig, aber ich fühlte mich in meiner Welt ganz wohl.
Unsere Familie wohnte in einer bescheidenen Mietwohnung im Zentrum von Königsberg. Wir hatten genug Geld, um ein erfülltes Leben zu leben. Wir waren keine Reiche, aber das ist bekanntermaßen auch nicht unbedingt notwendig. Meine Eltern wünschten sich nichts sehnlicher, dass sowohl ich als auch meine Schwester später studieren werden. Deswegen gab ich im Gymnasium mein Bestes, insbesondere weil in meiner reinen Jungenklasse einige blaublütige Söhne waren. Wenn der Lehrer die Liste seiner Schüler durchging, wurde auch jedes mal der Titel, Name und Beruf des Vaters genannt. Wenn ich dann an der Reihe war, versank ich immer vor Scham in den Boden, denn mein Vater war weder ein Adliger noch ein promovierter Akademiker.
Als 14-Jähriger gewann ich 1937 in einem Preisausschreiben eine zweiwöchige Ostseefahrt auf dem Kreuzer ´Emden´. Ich freute mich riesig über meinen Gewinn, da Segeln und Schiffe meine große Leidenschaft waren. Die Stimmung auf der ´Emden´ war großartig, denn noch war Frieden. Niemand von der Mannschaft ahnte, welches Schicksal sie später ereilen wird. Die ´Emden´ fuhr unter voller Bewaffnung, da sich die politische Lage in Europa mittlerweile maßgeblich verschlechtert hatte. Ungefähr 1000 Mann mussten morgens zum Apell antreten. In meiner Koje hörte ich um 5 Uhr im Lautsprecher folgende Durchsage: „Reise, reise, aufstehen! Die ganze Pier steht voller nackter Weiber! Der Bäcker von Laboe ist da!“ Schnell sprang ich aus der Koje und zog meinen Matrosenanzug an. An Deck wehte ein eisiger Wind, sodass ich schnell wach wurde. In den Tagen auf See lernte ich den Drill bei der Marine kennen, den ich absolut in Ordnung fand und der mich für mein weiteres Leben stark geprägt hatte. Auch die Gemeinschaft unter den Seeleuten war für mich beeindruckend. Vom dritten Offizier wurde mir das ganze Schiff gezeigt, dabei sah man mir sicherlich meine Begeisterung an. Wieder hatte man einen sicheren Kandidaten für die Kriegsmarine gefunden. Die Stimmung an Bord änderte sich abrupt, als die Emden außergewöhnliche Anweisungen erhielt und ihre Alarmbereitschaft erhöhte. Damit war meine Zeit auf der ´Emden´ sofort beendet, denn man wollte wegen mir kein unnötiges Risiko eingehen. Nachdem wir den nächsten Ostseehafen erreicht hatten, brachte man mich zum Bahnhof und setzte mich in den nächsten Zug nach Königsberg. Dort angekommen fuhr ich mit der Straßenbahn nach Hause zu meiner Familie. Meine Mutter war natürlich froh, mich wieder im Armen halten zu können. Da mich die Fahrt auf der ´Emden´ sehr beeindruckt hatte, beschloss ich nach dem Abitur Nautik zu studieren, um später mal ein Offizier oder Kapitän bei der zivilen Seefahrt zu werden.
Meine Kindheit und Jugend in Ostpreußen war sehr schön. Niemand redete über einen möglichen Krieg. Ich war Mitglied in einem Segelverein und häufig mit einem Starboot auf der Ostsee unterwegs. Im Sommer badete ich oft mit meinen Kumpels am schönen Ostsee-Strand. Von unserer Jungengruppe war ich der schnellste Schwimmer.
Meine Eltern waren beide Sozialdemokraten, die aber politisch nicht aktiv waren. Wie es sich für einen Sohn gehört, dachte ich ähnlich wie sie. Ich hatte viele Freunde, die teilweise auch adelig waren. Mit den Mädchen war es schwierig in Kontakt zu kommen, weil sie ein anders Gymnasium besuchten. Aber ich bemerkte früh, dass ich ein großes Interesse am anderen Geschlecht hatte.
2. Kapitel (1939-1945)
Als der Krieg am 1. September 1939 ausbrach, war ich gerade mal ein 16 Jahre alter Gymnasiast. Wegen der Nachricht war in Königsberg ungefähr die Hälfte der Leute bedrückt und ängstlich. Die Nazis und ihre Sympathietanten stellten ebenfalls ca. 50% und waren begeistert über den Einmarsch der Wehrmacht in Polen. Obwohl meine Eltern als Sozialdemokraten absolute Kriegsgegner waren, mussten sie sich mit den neuen Gegebenheiten arrangieren. Auch die vielen Nazi-Horden aus SA und SS in den Straßen waren zwar lästig, aber nicht abwendbar. Ähnlich wie bei der Bevölkerung waren ungefähr die Hälfte der Lehrer überzeugte Nazis, die ihre politischen Ansichten offen kundtaten. Die anders denkenden Lehrer waren leider äußerst zurückhaltend geworden.
Die Anzahl der Kriegsgegner verringerte sich, als eine Siegesmeldung, die nächste ablöste. Immer mehr Leute glaubten, dass der Führer ein genialer Feldherr war, weil ihm scheinbar alles gelang. Sicherlich verschwanden zunehmend jüdische Familien, aber man machte sich darüber keine Gedanken. Die Leute erzählten sich auf der Straße, dass die Juden ins Ausland immigriert waren. Von Konzentrationslagern wussten wir zu diesem Zeitpunkt nichts. Auch mehrere jüdische Mitschüler aus meiner Klasse tauchten plötzlich nicht mehr auf.
Meine Schwester machte 1940 ihr Abitur und begann Chemie an der Universität in Königsberg zu studieren. Meine Eltern waren äußerst stolz, dass ihre Tochter aus einfachen Verhältnissen es geschafft hatte, einen Studienplatz zu bekommen. Damals war es nicht selbstverständlich, dass Frauen überhaupt studierten. 1940 war ich weiterhin überzeugt nach dem Abitur Nautik in Königsberg zu studieren.
1942 machte ich als 19-Jähriger mein Abitur. Meine Noten waren gut bis sehr gut. Viele von meinen Mitschülern konnten es gar nicht abwarten in den Krieg zu ziehen. Gleich nach der Abiturfeier gingen alle zu den verschiedenen Waffengattungen. Weder ich noch meine Mitschüler begannen wegen des Krieges ein normales Studium. Natürlich ging ich zur Kriegsmarine und begann dort eine Offiziersausbildung. Allerdings war ich zunächst nur ein schlichter Kadett zur See.
Mein größtes Interesse bei der Marine galt den U-Booten, die zu diesem Zeitpunkt sehr erfolgreich auf dem Atlantik unter der Führung von Admiral Dönitz waren. Deswegen entschied ich mich, meine Ausbildung auf U-Boote zu fokuszieren. 1943 wurde ich von der Kriegsmarine in Rotterdam auf einem Stützpunkt stationiert, um dort zum Ein-Mann-U-Boot-Fahrer ausgebildet zu werden. Die Niederlande waren zu diesem Zeitpunkt von Deutschland besetzt.
Der Marinestützpunkt befand sich direkt am Rotterdamer Hafen. Meine Kameraden und ich hatten uns häufig gelangweilt, denn es passierte neben unserer Spezialausbildung monatelang relativ wenig. Ich freundete mich mit einem Frank G. an, mit dem ich häufig über das Land zog. Erstaunlicherweise hatten wir im Gegensatz zu anderen Militärs viele Freiheiten.
Unsere Fortbewegungsmittel waren Fahrräder, die damals schon in Holland sehr beliebt waren. Als ich mal wieder mit Frank am frühen Abend über Feldwege fuhr, schlugen plötzlich neben uns Kugeln ein. Den oder die Scharfschützen konnten wir nicht sehen, obwohl das Gelände eine extrem flache Morphologie aufwies. Sofort warfen wir uns in einen Graben am Wegesrand und verharrten dort. Mit großer Wahrscheinlichkeit stammten die Kugeln von niederländischen Widerstandskämpfern. Wir waren als deutsche Besatzer bei der Bevölkerung sehr unbeliebt und nicht erwünscht. Nachdem wir eine Stunde im Graben verweilt hatten, krabbelten wir aus unserer Deckung und schauten vorsichtig in die Umgebung. Da niemand zu sehen war, stiegen wir rasch auf unsere Räder und fuhren weiter.
Frank war vom Typus her ein richtiger Draufgänger, der mich sehr beeindruckt hatte. Vor allem seine stets positive Grundeinstellung hatte mir gut gefallen, denn ich war im Gegensatz zu ihm ein typischer Pessimist. Einmal schauten wir uns interessiert eine niederländische Kirche an, allerdings nicht um zu beten. Frank hatte er bei einer Heiligen-Statur mit zwei nach vorne gestreckten Armen, den linken abgeschlagen. Danach grüßte die Figur mit dem rechten Arm permanent den Führer. Natürlich war uns vollkommen klar, dass solche Aktionen bei der Zivilbevölkerung nicht gerade gut ankamen, aber im Krieg herrschten eben andere Gesetze.
Unser Marinestützpunkt hatte eine Flugabwehrkanone auf dem Dach, um feindliche Bomber abzuschießen zu können. Bislang waren wir allerdings wenig erfolgreich, weil die Flugzeuge auf ihrem Weg von England nach Deutschland und zurück viel zu hoch über uns flogen. An einem Abend spielten wir gerade Karten und waren mal wieder reichlich vom Bier alkoholisiert. Plötzlich hörten wir einen einzelnen Bomber, der sehr langsam in geringer Höhe über unseren Stützpunkt flog. Sofort rannten Frank und ich zur Flak und schossen auf den nach England fliegenden Bomber, dem nur noch ein intakter Motor geblieben war, da er vermutlich zuvor irgendwo angeschossen wurde. Mit großer Sicherheit hatten wir ihn getroffen, denn er stürzte nicht weit von uns entfernt auf einer Wiese ab und explodierte sofort. Was mit der Besatzung passiert war, hatten wir niemals erfahren.
Ende 1944 glaubte keiner mehr von uns an den Endsieg. Die Stimmung auf dem Stützpunkt war zunehmend miserabel. Da Ostpreußen bereits teilweise von Russen besetzt war, konnte ich meinen zweiwöchigen Fronturlaub nicht mehr in Königsberg verbringen. Zu diesem Zeitpunkt war meine Familie zu Fuß auf der Flucht von Königsberg nach Sielen in Nordhessen. In diesem Dorf hatte meine Mutter bis zur Heirat meines Vaters gelebt, danach war sie zu ihm nach Königsberg gezogen. Gott sei Dank hatten sie es Wochen später tatsächlich geschafft, in Sielen anzukommen.
Statt nach Ostpreußen fuhr ich mit Frank in seine Heimatstadt nach Zerbst in Sachsen-Anhalt. Dort hatte er seine Familie und eine Freundin. Ich war froh ihn begleiten zu können, denn meine Stimmung war miserabel, weil ich mir wegen der Flucht meiner Familie große Sorgen machte. Als wir in Zerbst ankamen, trafen wir Franks Freundin Betta, die ihre hübsche Schwester Elisabeth mitgebracht hatte. Zu viert unternahmen wir harmlose Ausflüge und versuchten die beiden Mädchen mit unseren Erzählungen von der Front zu beeindrucken. Damit sie unseren Worten auch glaubten, stellte ich mich mit einem gestreckten Arm auf eine Wiese. Wie im Zirkus hielt ich zwischen zwei Fingern einen Apfel. Frank schoss mir aus der Hüfte mit einem Revolver den Apfel aus den Fingern. Die Vorführung war etwas gewagt, kam aber bei den Damen sehr gut an.
Während Frank mit Betta knutschte, flirtete ich mit Elisabeth, die mir sehr gut gefiel. Sie erwiderte eindeutig meine Bemühungen, sodass ich es wagte sie zu küssen. Elisabeth und ich unterhielten uns viel über den Krieg, den ich ihr als verloren darstellte. Gleichzeitig teilte ich ihr mit, dass ich mit meinem baldigen Tod bei der Marine rechne, weil ich demnächst mit einem Ein-Mann-U-Boot von Rotterdam nach Antwerpen fahren und einen Sprengsatz an ein feindliches Schiff der Alliierten befestigen werde. Ein Taucheranzug wird mich dabei vorm kalten Wasser schützen. Wenn der Zeitzünder aktiv ist, werde ich an Land schwimmen und mich durch die feindlichen Linien schlagen, um wieder nach Rotterdam zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt war Rotterdam noch von den Deutschen besetzt, während der Hafen von Antwerpen bereits von den Alliierten eingenommen wurde. Nach meiner Einschätzung lagen meine Überlebenschancen bei diesem Himmelfahrtskommando bei Null. Deswegen erklärte ich Elisabeth, dass eine Liebesbeziehung mit mir sinnlos wäre. Natürlich sollte sie mich als Held sehen, der für sein Vaterland sterben wird. Elisabeth war zwar bestürzt über meine Erzählung, sah aber keinen Grund Abstand von mir zu halten. Somit entwickelte sich trotz aller Umstände eine Liebesbeziehung, die wegen meiner vermutlich geringen Lebenserwartung nur von kurzer Dauer sein wird. Obwohl Frank für das gleiche Selbstmord-Unternehmen vorgesehen war, schien er darüber wenig besorgt.
Als Frank und ich Zerbst verließen, hatten Elisabeth und ich die jeweiligen Adressen getauscht. Wir wollten uns schreiben, so lange es irgendwie möglich sein wird. Die beiden Schwestern brachten uns zum Bahnhof und umarmten uns liebevoll auf dem Bahnsteig. Als unser Zug kam, stiegen Frank und ich ein und fuhren wenig später los. Die Frauen winkten uns noch lange hinterher. Elisabeth war eine wunderbare Frau. Ob es ein Wiedersehen geben wird, wusste ich wegen des bevorstehenden Einsatzes nicht. Allerdings hatte ich mich in sie Hals über Kopf verliebt.
Nachdem Frank und ich wieder auf dem Marinestützpunkt in Rotterdam waren, begann für uns die Vorbereitung auf unseren Ein-Mann-U-Boot-Einsatz, der wie Blei auf meiner Seele lag. Mehrere Male sollte unser Einsatz am nächsten Tag erfolgen, aber jedes mal wurde er verschoben. Zur Entspannung fuhren wir eines Abends mit den Fahrrädern über die Feldwege. Frank wollte mir unbedingt etwas Unglaubliches zeigen und sagte: „Du wirst dieses Ereignis sicherlich bis zu deinem Lebensende nicht mehr vergessen.“ Nach ein paar Kilometern stoppten wir und legten die Fahrräder in den Straßengraben. Anschließend schlichen wir durch ein Feld bis zu einem Maschendrahtzaun und legten uns davor flach auf den Boden. „Eventuell müssen wir etwas warten“, sagte er zu mir. „Du machst es aber spannend“, antwortete ich. Eine Stunde später begann es auf dem Gelände furchtbar zu fauchen, wie ich es noch niemals zuvor gehört hatte. Wir sahen eine Stichflamme, die sich senkrecht nach oben in die Luft ausbreitete. Von einer Rampe entfernte sich fauchend ein länglicher Gegenstand, der einen langen Feuerschweif hinter sich herzog. Schnell erreichte das Gerät eine große Höhe und war plötzlich nicht mehr zu sehen. „Das war eine V2-Rakete, die jetzt nach England fliegt. Dort wird sie eine fürchterliche Zerstörung hinterlassen, weil sie einen riesigen Sprengkopf hat“, erklärte Frank. „Diese Waffe ist ja der blanke Wahnsinn, aber kann man damit noch den Krieg gewinnen?“ fragte ich. „Wohl kaum“, antwortete er gelassen.
In den folgenden Wochen fuhren Frank und ich häufig zum Raketengelände, um die V2 beim Starten zu beobachten. Erneut gab es grünes Licht für unseren U-Boot-Einsatz, aber auch dieser Termin wurde ohne Begründung verschoben. Plötzlich wurde unser Marine-Stützpunkt von amerikanischen Jagdflugzeugen angegriffen, die erhebliche Zerstörungen hinterließen. Direkt nach dem Luftangriff wurden wir von alliierten Soldaten im Sturm überrannt. Dabei vielen nur wenige Schüsse, da es kaum eine Gegenwehr von deutscher Seite gab. Die meisten Toten und Verletzten verursachte der Luftangriff. Nachdem wir von amerikanischen Soldaten entwaffnet worden waren, kamen Frank und ich im Januar 1945 in kanadische Kriegsgefangenschaft. Vermutlich hatten mir die Alliierten mit ihrem Angriff das Leben gerettet, denn nun gab es Gott sei Dank keinen U-Boot-Einsatz mehr für mich.
Frank und ich wurden von den Kanadiern ausgezeichnet behandelt. Sie waren ausgesprochen freundlich zu uns und versorgten uns mit genug Essen und Zigaretten. Die Lager waren geradezu fürstlich im Vergleich mit den miserablen Zuständen im Osten, von denen wir bereits gehört hatten. Die Zeit verbrachten wir mit diversen Kartenspielen und exzessiven Saufgelagen. Militärische Ränge spielten bei den Kriegsgefangenen keine Rolle mehr.
Kurz nach der Kapitulation von Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945 wurden Frank und ich aus der Gefangenschaft entlassen. Jetzt trennten sich unsere Wege. Frank fuhr zu Verwandten in West-Deutschland, da er wegen der russischen Besetzung nicht mehr nach Zerbst konnte. Ich machte mich auf den Weg nach Nordhessen, um dort in Sielen auf meine Eltern und Schwester zu treffen. Die Zugfahrt durch das zertrümmerte Deutschland war erschreckend für mich. Alle Städte, die ich auf meiner Reise passierte, waren zerstört. Diese furchtbaren Bilder konnte ich in meinem weiteren Leben nicht mehr vergessen.
Mit einer etwas lädierten Zivil-Kleidung kam ich mit dem Zug in dem völlig zerstörten Kassel an. Wegen der Kriegsschäden fuhren weder Busse noch Bahnen mehr Richtung Norden ins Weserbergland, deswegen lief ich zwangsläufig mindestens 25 Kilometer von Kassel nach Sielen. Im Dorf angekommen, fragte ich einen Bauern nach dem alten Pfarrhaus, denn dort lebte meine Familie seit ihrer Flucht aus Ostpreußen. Die Adresse hatten sie mir bereits per Brief mitgeteilt. Zuvor war ich in meinem Leben noch niemals in Sielen gewesen. Der Bauer sagte freundlich: „Gleich hinter der Buntsandsteinkirche ist das alte Pfarrhaus.“ Ich bedankte mich höflich für seine Auskunft und lief weiter zu einem zweistöckigen Fachwerkhaus mit einem geziegelten Giebeldach.
Durchs Fenster sah mich zuerst meine Mutter, die sofort aus dem Haus geeilt kam. Ihre ersten Worte waren: „Ich bin froh, dass du lebst!“ Sie umarmte und küsste mich, obwohl sie eigentlich kein Typ von übertriebenen Gefühlsäußerungen war. Mein Vater klopfte mir auf die Schultern und war den Tränen nahe. Meine Schwester begrüßte mich genauso wie die Mutter. Wir waren alle Vier wegen unserer familiären Wiedervereinigung überwältigt. Das Wichtigste war, dass wir diesen furchtbaren Krieg überlebt hatten.
Nachdem ich die Wohnung betreten hatte, ging ich umgehend ins Bad, da ich mich furchtbar schmutzig fühlte. Ich füllte die Badewanne mit warmem Wasser und legte mich anschließend hinein. Später rasierte ich meinen Bart ab und zog mir komplett neue Kleidungsstücke an. Zur Feier des Tages kochte Mutter ein fürstliches Essen, um unsere Wiedervereinigung zu feiern. Hier auf dem Dorf gab es im Gegensatz zu den Großstädten genug Nahrungsmittel, sodass wir in den nächsten Monaten keinen Hunger befürchten mussten.
3. Kapitel (1946-1950)
1946 begann in Deutschland der große Hunger, von dem wir auf dem Lande verschont blieben. Im Radio wurde von Flüchtlingsströmen geredet, die sich nach Westen wälzten. Diese Menschen hatten alles verloren und suchten im Westen verzweifelt nach Orten, wo sie sich ansiedeln konnten. Auch auf dem Land in Nordhessen sah ich Flüchtlinge, denen es im Gegensatz zu uns sehr schlecht ging, insbesondere weil sie quasi nirgendwo erwünscht waren.
Meine Eltern wie auch meine Schwester arbeiteten zunächst im Dorf bei Bauern. Ich bekam einen Job im Ausbesserungswerk der Deutschen Reichsbahn in Kassel. Dort wurden beschädigte Lokomotiven wieder hergerichtet, die unbedingt für den Wiederaufbau benötigt wurden. Trotz der äußerst schweren Arbeit hatte es mir dort gut gefallen. Die Stimmung unter den Arbeitern war gut, weil jeder von ihnen über den Frieden froh war. Besonders auffällig war, dass auf einen Schlag sämtliche Nazis verschwunden waren. Vermutlich waren sie Tod, im Gefängnis oder sie hatten einfach nur ihre verräterischen Kleidungsstücke gewechselt. Im zerstörten Kassel waren als Uniformierte nur noch britische und amerikanische Soldaten zu sehen, die bemüht waren die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.
Seit meinem Besuch in Zerbst Ende 1944 schrieb ich regelmäßig Briefe an Elisabeth, die sie fleißig beantwortete. Wir erzählten uns gegenseitig auf unzähligen Seiten unsere jeweiligen Lebensgeschichten, wenn das überhaupt möglich war. Unsere anfängliche Verliebtheit entwickelte sich schnell zu einer richtigen Liebe, aber nur auf dem Papier. Seit Januar 1945 war sie in Mannheim bei Verwandten und hatte dort die Bombardierung der Stadt durch die Alliierten erlebt und überlebt. Als sie im Keller eines größeren Mietshauses bei einem Luftangriff mit vielen anderen Menschen saß, hatte sie verdammt großes Glück. Nach dem Angriff bemerkten die Bewohner, dass eine scharfe Fliegerbombe in der Kellerdecke steckte, die kurz zuvor das Dach und vier Stockwerksböden durchschlagen hatte. Der Blindgänger war nicht explodiert, aber immer noch hoch brisant. Wenn die Bombe explodiert wäre, hätte Elisabeth es im Keller sicherlich nicht überlebt. Nach der Kapitulation konnte sie nicht zurück nach Zerbst, da die Kleinstadt von den Russen besetzt war. Um Schwierigkeiten mit den russischen Besatzern in Form von Vergewaltigungen zu vermeiden, war sie in Mannheim geblieben. Sie arbeitete dort in einem Farbengeschäft, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Elisabeth war in dieser Zeit eine sehr wichtige Brieffreundin für mich, aber leider konnte ich sie nicht besuchen. Allerdings war dieser Umstand kein Problem für mich, denn ich kümmerte mich im Dorf insbesondere um die weiblichen Bewohner, denn kleinere Festivitäten fanden, trotz der widrigen Umstände, durchaus statt. Außerdem war ich ein vorzüglicher Tänzer, da ich eine Ausbildung zum Tanzlehrer absolviert hatte. Viele Damen waren von meinen Tanzkünsten schwer beeindruckt. Außerdem war ich ein großer Charmeur, der immer ein Kompliment auf den Lippen hatte. Deswegen gelang es mir spielend, die eine oder andere Frau ins Bett zu bekommen. Natürlich half mir dabei der zu dieser Zeit herrschende starke Frauenüberschuss, denn viele Männer hatten im Krieg ihr Leben verloren oder saßen lange in russischer Kriegsgefangenschaft.
Meine Schwester hatte noch vor der Flucht aus Ostpreußen Ende 1944 ihr Chemiestudium einschließlich der Doktorarbeit abgeschlossen. Somit hatte sie nun ein Doktortitel, aber eine entsprechende Anstellung als Chemikerin zu finden, war kurz nach dem Krieg im zerstörten Deutschland schier unmöglich. Aus diesem Grund war sie gezwungen erst mal in der Landwirtschaft zu arbeiten.
Wie meine Schwester wollte auch ich studieren, allerdings nicht Chemie sondern Physik. Leider waren 1946 viele Universitäten schwer zerstört, sodass ich nicht sofort einen Studienplatz bekam. Erst 1947 gelang es mir ein Studienplatz für Physik in München zu bekommen. Sofort schrieb ich meiner Brieffreundin Elisabeth von diesem glücklichen Ereignis. Sie antwortete im nächsten Brief, dass sie überraschenderweise auch einen Studienplatz in München bekommen hatte. Sie wollte dort Bildende Kunst an der HDK studieren. Ich entgegnete, dass ich mich über unser baldiges Zusammentreffen in München sehr freue.
1947 zog ich also in das immer noch zerstörte München und nahm mir ein bescheidenes Zimmer. Die ersten Wochen war ich ohne Elisabeth in München, da sie noch bis zum Monatsende im Mannheimer Farbengeschäft arbeiten musste. Als ich das erste Mal die Universität besuchte, traf mich fast der Schlag, weil viele Gebäude nach wie vor zerstört waren. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass hier überhaupt studiert werden konnte. Insbesondere die physikalische Fakultät war schwer getroffen. Eigentlich müssten hier die Studenten erst mal den Hörsaal wieder aufbauen, bevor der Lehrbetrieb beginnt.
Dummerweise verlor ich in München irgendwo meine Lebensmittelkarten, die zum Überleben dringend notwendig waren. Die Rationen waren sowieso schon knapp bemessen, aber ohne Karten war meine Situation ziemlich hoffnungslos. Ich tauschte auf dem Schwarzmarkt meine Uhr gegen Brot. Außerdem bekam ich ein Fresspaket aus Sielen von meinen Eltern geschickt. Trotzdem musste ich wegen des Missgeschicks hungern. Diese schwere Zeit hatte ich in meinem weiteren Leben niemals vergessen.
Ein paar Wochen später kam Elisabeth nach München. Unser Wiedersehen war etwas betrübt, weil ich wegen der Kartengeschichte mager wie ein Strich in der Landschaft war. Wir haben nach ihrer Ankunft zunächst mit ihren Karten die nötigsten Lebensmittel gekauft. Sie war buchstäblich meine Retterin in dieser kalorienarmen Zeit. Wir gingen zusammen zur ihrer HDK, die ebenfalls stark zerstört war. Auch sie wird wohl ihren Hörsaal mit ihren Kommilitonen erst aufbauen müssen. Trotz aller negativen Umstände waren wir glücklich wieder zusammen zu sein. Schnell entwickelte sich bei uns die bereits bekannte Leidenschaft, die wir Ende 1944 in Zerbst erlebt hatten.
Elisabeth bekam ein kleines Zimmer bei ihrem Kunstprofessor und beteiligte sich am Wiederaufbau der HDK. Sie war eine fleißige, begabte Studentin, die schnell Fortschritte bei ihrem Studium machte und häufig von ihren Professoren gelobt wurde. Sie freundete sich rasch mit anderen Kunststudenten an, da sie ein kontaktfreudiger Typ war. Sie lernte alle Techniken der Kunst und spezialisierte sich später auf den Entwurf von Stoffmustern.
Nachdem ich beim Wiederaufbau der physikalischen Fakultät mitgeholfen hatte, begann endlich mein Studium. Vom Krieg und seine Folgen hatte ich ziemlich die Nase voll, aber ohne Hörsaal gab es keine Vorlesung, so einfach war das. Ich lernte begierig, weil ich wegen der vergeudeten Kriegsjahre keine weitere Zeit mehr verlieren wollte. Außerdem wollte ich mit meinen Leistungen meine Eltern beeindrucken und hatte nicht vor, lange von ihnen finanziert zu werden.
In der Freizeit waren Elisabeth und ich häufig im Nymphenburger Park, um dort spazieren zu gehen. Wir verstanden uns immer besser und waren ein richtiges Liebespaar. Allerdings hungerten wir nach wie vor, denn unsere tägliche Kalorienration reichte überhaupt nicht aus. Elisabeth bekam von ihren Eltern kein Fresspaket, weil sie weiterhin in Zerbst in der Sowjetischen Besatzungszone wohnten und selber kaum etwas zu essen hatten. Dagegen schickte mir meine Mutter weiterhin Pakete mit Nahrungsmitteln, die ich großzügig mit Elisabeth geteilt hatte. Gesundheitlich ging es uns beide nicht gut, da wir wegen knapper Nahrung geschwächte Immunsysteme hatten und somit anfällig für Krankheiten waren. Wir waren beide zwei richtige Hungerhaken, die sich mühsam zur Vorlesung schleppten.
1948 heiraten wir standesamtlich in München ohne Anwesenheit unserer Familien. Unsere Trauzeugen waren Freunde und Elisabeths Kunstprofessor. Obwohl die äußeren Umstände sehr bescheiden waren, war unsere Hochzeit sehr schön. Nun konnten wir problemlos als verheiratetes Paar zusammen wohnen. Ich kündigte mein Zimmer und zog bei Elisabeth ein, die nach wie vor beim Kunstprofessor wohnte. So sparten wir meine Miete, denn Geld hatten wir ebenfalls sehr wenig. Eine Hochzeitsreise gab es nicht, stattdessen haben wir beide fleißig weiter studiert.
Regelmäßig fuhren wir als frischvermähltes Ehepaar zusammen nach Sielen in Nordhessen, um dort meine Eltern zu besuchen. Zu diesen Treffen kam auch meistens meine Schwester, die mittlerweile eine Anstellung in einem Labor bekommen hatte. Meine Eltern fanden Elisabeth ganz in Ordnung, dagegen war meine Schwester wenig überzeugt von ihr. Meines Erachtens war sie einfach nur eifersüchtig, weil ihr geliebter Bruder ungefragt eine wildfremde Frau geheiratet hatte. Zu Elisabeths Eltern in Zerbst wollten wir nicht hinfahren, da sie in der Sowjetischen Besatzungszone wohnten.
In München waren wir häufig in Tanzlokalen. Elisabeth wie auch andere Frauen waren begeistert von meinen Tanzkünsten. Allerdings wurde meine Ehefrau schnell eifersüchtig, wenn ich zu lange mit Konkurrentinnen getanzt hatte. Natürlich war ich weiterhin äußerst charmant zu anderen, hübschen Frauen, obwohl ich verheiratet war. In den Nachkriegsjahren wurden viele Feste gefeiert, weil die Leute schnell ihr Leid vergessen und ihren Spaß haben wollten. Der Zusammenhalt zwischen den Menschen war zu jener Zeit wesentlich stärker ausgeprägt, als es später der Fall war.
Bei einem Spaziergang im Nymphenburger Park küsste ich an einem Baum meine Gemahlin. Zuvor hatte ich stundenlang über mein neues physikalisches Wissen referiert. Elisabeth hatte mir aufmerksam zugehört, aber vermutlich kaum etwas verstanden. Obwohl sie dringend aufs Klo musste, wagte sie mich nicht wegen der für sie peinlichen Angelegenheit zu unterbrechen. Dummerweise konnte sie ihre Blase nicht mehr zurückhalten und pinkelte im Stehen in ihr Kleid. Danach versuchte sie vor mir ihr Missgeschick zu verbergen, aber wegen ihrem Verhalten bemerkte ich es dennoch. Was ich an dieser Geschichte nicht verstand war, warum sie sich nicht einfach rechtzeitig hinter einen Baum gesetzt hatte.
1950 beendete Elisabeth ihr Studium mit sehr guten Noten. Vermittelt durch ihren Kunstprofessor bekam sie in München eine Anstellung in einer Textilfirma und war dort für den Entwurf von Stoffmustern zuständig. Plötzlich verdiente sie das von uns dringend gebrauchte Geld, damit wir uns wenigsten die wichtigsten Grundbedürfnisse erfüllen konnten. Da ihre Chefs hochzufrieden mit ihrer Arbeit waren, hatte sie eine relativ sichere Stellung. Der Job machte ihr sogar großen Spaß, weil sie dort kreativ arbeiten konnte.
Ich ging weiter in die Universität und kämpfte mich schnell durchs Studium. Meine Professoren waren sehr zufrieden mit meinen Leistungen und kündigten an, mich nach meinem erfolgreichen Studium an eine bekannte, deutsche Aktiengesellschaft zu vermitteln. Elisabeth und ich wohnten weiterhin beim Kunstprofessor zur Untermiete, da wir leider immer noch zu wenig Geld für eine größere Wohnung hatten.
4. Kapitel (1951-1960)
1951 schrieb ich meine Diplom-Arbeit und bestand erfolgreich meine Diplom-Prüfungen mit der Gesamtnote „Sehr gut“. Sofort schrieb ich einen Brief an meine Eltern, um ihnen die freudige Nachricht mitzuteilen. Jetzt hatten sie einen richtigen Akademiker als Sohn, auf den sie stolz sein konnten. Endlich hatte ich es geschafft, obwohl ich nur aus kleinen Verhältnissen kam und der unsägliche Krieg anfänglich mein Studium verhindert hatte. Der größte Wunsch meiner Mutter war jahrelang, dass ich mal ein studierter Mann werde. Um dem ganzen noch eine Krone aufzusetzen, plante ich später mal eine Doktorarbeit zu schreiben. So ein Doktor-Titel würde die Leute noch mehr beeindrucken, da war ich mir ziemlich sicher.
Meine Professoren hielten ihr Wort und schickten mich mit den besten Empfehlungen zu einem Vorstellungsgespräch bei der AEG AG. In der Münchner Personalabteilung, bot man mir wegen meiner sehr guten Noten sofort eine fürstlich bezahlte Stelle an. Die AEG-Leute gestatteten mir sogar, während der Arbeitszeit meine Doktorarbeit anfertigen zu dürfen. Damals mussten die Firmen noch um junge Ingenieure und Physiker kämpfen, später war diese Vorgehensweise nicht mehr üblich. Allerdings gab es auch einen Haken bei dem Job, weil der Arbeitsplatz leider in West-Berlin im Weddinger AEG-Werk Brunnenstraße war. Wenn ich mich für den Job entscheiden würde, müsste ich von München nach Berlin umziehen.
Elisabeth und ich feierten in München mit Freunden meinen glanzvollen Uni-Abschluss. Sie freute sich über meinen Erfolg, aber war, als sie von meinem Jobangebot hörte, etwas betrübt, weil sie ihr geliebtes München verlassen müsste, wenn ich das Angebot annehmen würde. Außerdem würde sie ihren Job in der Textilfirma verlieren. „Lass uns nach Berlin gehen“, sagte sie überraschenderweise während der Feier. „Ist das dein Ernst?“ fragte ich. „Ja, ich will mit dir ein Kind haben, damit wir dann eine richtige Familie sind“, sagte sie. „Gut, dann werde ich den Job in Berlin annehmen“, antwortete ich. Wir teilten unseren Freunden die Neuigkeit mit und feierten weiter bis in die Morgenstunden. An diesem Abend war ich ziemlich betrunken, dagegen trank Elisabeth wie immer äußerst wenig, weil sie wegen des Alkohols schnell Kopfschmerzen bekam.
Nachdem Elisabeth ihren Job gekündigt hatte, zogen wir Anfang 1952 von München nach Berlin. Der Kunstprofessor und seine Familie waren sichtbar traurig, weil wir bei ihnen auszogen. Der Abschied war wie unter guten Freunden richtig herzlich. Wir versprachen sie zu besuchen, wenn wir mal wieder in München sein sollten. Unser Umzugswagen nach Berlin war sehr bescheiden, da wir nur wenig Möbel und Sachen hatten. Beim Transport fuhren wir im Laster mit, um die Bahnkosten zu sparen. Zuvor hatten wir bei einem Berlin-Besuch in der Boelckestraße im Bezirk Tempelhof eine kleine Wohnung angemietet, die sich in einem großen, funktionellen Miethauskomplex aus den 30-ziger Jahren befand. Die kleinen Zimmer hatten winzige Fenster. Erstaunlicherweise gab es eine moderne Zentralheizung und einen Balkon. Mit dem Umzugslaster passierten wir bei Hof den innerdeutschen Grenzübergang Hirschberg und wurden von den Grenzsoldaten der DDR gründlich kontrolliert. Anschließend fuhren wir auf einer völlig kaputten Autobahn weiter durch die sowjetische Besatzungszone. Der Laster drohte auseinander zu fallen und fuhr deswegen häufig nur noch maximal 10 Stundenkilometer. Schließlich erreichten wir den Grenzübergang Dreilinden und wurden von DDR-Grenzern erneut kontrolliert. Nach einer ewig langen Reise waren wir endlich in West-Berlin angekommen und fuhren über Zehlendorf bis nach Tempelhof zu unserer neuen Wohnung.
Mehrere Tage waren wir mit dem Einrichten der neuen Wohnung beschäftigt. Da wir nicht genug Möbel hatten, kauften wir noch einige Sachen dazu. An meinem ersten Arbeitstag fuhr ich im Anzug inklusive Krawatte mit der U-Bahn das erste Mal in die Brunnenstraße zur AEG. Ich wurde freundlich von den AEG-Leuten empfangen. Ein zukünftiger Vorgesetzter führte mich durch alle Bürogebäude und Fabrikhallen. Die Turbinenhalle mit ihren gigantischen Dimensionen hatte mich damals sehr beeindruckt. Nach dem Rundgang brachte er mich zu einem mir zugeteilten, modern eingerichteten Büro mit Telefon. Zuerst stellte ich meine Aktentasche auf den Schreibtisch und baute akribisch meine Büroutensilien auf, wie ich es bei der Kriegsmarine gelernt hatte. Meine Fachbücher stellte ich in ein Regal, damit jeder von meinem Wissen beeindruckt war. Im Laufe des Tages stellten sich mehrere, neue Kollegen bei mir vor, mit denen ich angeregte Fachgespräche führte. Natürlich gab ich dabei mein Bestes. Meines Erachtens kochten hier die Ingenieure und Physiker auch nur mit Wasser. Allerdings war es mir extrem wichtig, dass ich bei meinen Gesprächspartnern einen sehr guten Eindruck hinterlassen hatte. Bei der Arbeit war ich kein Mensch, der sich scheu in die Ecke setzte, sondern der sich temperamentvoll jedem Konflikt stellte. Wegen meiner lautstarken Auseinandersetzungen war ich später bei der AEG sehr berüchtigt.
Als ich mein Tagessoll an Stunden erreicht hatte, fuhr ich zurück nach Tempelhof und erzählte Elisabeth ausführlich von meinen Erlebnissen. „Mein erster Arbeitstag war ausgesprochen interessant. Ich habe bestimmt einen guten Eindruck bei den Kollegen hinterlassen“, sagte ich beim Abendessen. „Schön, dass es dir gefallen hat“, antwortete sie. Elisabeth war betrübt, dass sie nun keine Arbeit mehr hatte. Außerdem vermisste sie ihre ehemaligen Kollegen. Sie war gezwungen sich in die neue Situation einzufügen, denn ich verdiente bei der AEG für damalige Verhältnisse sehr viel Geld. „Wenn du ein Kind hättest, würdest du auf andere Gedanken kommen“, sagte ich. „Da hast du Recht! Außerdem haben wir jetzt genügend Geld, um ein Kind finanzieren zu können“, antwortete sie.