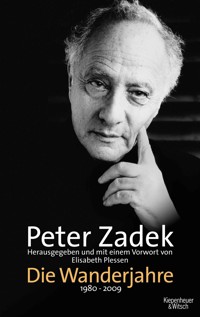
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Peter Zadeks Erinnerungen an die letzten 30 Jahre. Sein Vermächtnis an alle, die das Theater lieben.Der dritte Band der Memoiren von Deutschlands größtem Theaterregisseur – Arbeitsbericht, Selbstbeobachtung, Zeitdiagnose und Theatergeschichte.Als der große Peter Zadek 2010 in Hamburg im Alter von 83 Jahren starb, ging ein unvergleichliches Theaterleben zu Ende. Kein Regisseur hat das deutsche Theater fünf Jahrzehnte lang so aufgewühlt, revolutioniert und dominiert wie Peter Zadek. Kein Regisseur hat eine solche Vielzahl von unvergesslichen Inszenierungen geschaffen. Aber Peter Zadek war nicht nur Theaterregisseur – er hat auch großartige Filme wie Ich bin ein Elefant, Madame gedreht, er war Theaterintendant in Bochum, Hamburg und Berlin, er hat Regie unterrichtet und er hat zwei Bände hinreißender Memoiren veröffentlicht: My Way und Die heißen Jahre.Es ist ein großes Glück, dass Peter Zadek noch bis kurz vor seinem Tod an dem dritten und abschließenden Teil seiner Memoiren gearbeitet hat, so dass dieser Band nun posthum erscheinen kann – ein Geschenk an alle, die die Arbeit dieses Theatergenies erlebt und verfolgt haben.In Die Wanderjahre 1980–2009 schildert Peter Zadek sein Leben an der Seite der Schriftstellerin Elisabeth Plessen und seine Arbeit seit den frühen 80ern. Mit lakonischem Witz, voller scharfer Beobachtungen und überraschender Analysen lässt er Erfolge und Misserfolge, persönliche Erlebnisse und Ereignisse der Zeitgeschichte Revue passieren. Und immer wieder geht es um »seine« Schauspieler, die unvergessliche Gruppe, die immer wieder zusammenfand: Ulrich Wildgruber, Hermann Lause, Angela Winkler, Eva Mattes, Uwe Bohm, Gert Voss, Ilse Ritter, Susanne Lothar und viele andere. Nie hat Peter Zadek aufgehört, über Theater als öffentliche Kunstform nachzudenken: Was ist ein Schauspieler? Was bedeutet Regie? Was der Umgang mit der Sprache? Was kann Theater bewirken?Seine Antworten sind sein Vermächtnis an uns.Wie die beiden ersten Bände entstand auch Die Wanderjahre 1980–2009 auf der Grundlage von Gesprächen mit Helge Malchow. Herausgeberin des Bandes ist Elisabeth Plessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
» Buch lesen
» Das Buch
» Der Autor
» Impressum
Für Poppy, Oscar, FelixSolongo, Louise und Mogens
I have immortal longings in me.Shakespeare, Antony and Cleopatra
To fill the present and to be filled by itto the point where identity fades to nothing.
Ian McEwan, A Child in Time
INHALT
ICH SEHNE MICH NACH UNSTERBLICHKEIT
Vorwort von Elisabeth Plessen
ZURÜCK NACH BERLIN
Molière, Der Menschenfeind, nach Enzensberger, 1979 · Fallada, Jeder stirbt für sich allein, 1981· Die äußere Größe einer Inszenierung· Ghetto, 1984· Überhaupt mal etwas über Stückfassungen· Noch einmal über Musik
DIE ZWEITE FLUCHT AUS BERLIN
Baumeister Solness, 1983 am Münchner Residenztheater· Wieder Musi · Die Hochzeit des Figaro, 1983 in Stuttgart· Noch mal Musik · Zurück nach München· Die wilden Fünfziger · Yerma, 1985 · Autobiographie· Kopfspiel Stuttgart
HAMBURGER INTENDANZ 1985–1988
Ein kleiner Exkurs über Geld · Die Provinzialität der Kritik in Deutschland · Andi · Meine Genesung in Vecoli
ZWISCHEN HAMBURG UND BERLIN 167
Shylock · Ivanov, 1990 in Wien · Rosee Riggs · Offene und geschlossene Form · Der Mauerfall November 1989 · Brecht und das BE · DDR-Erfahrungen · Neugierde · Der blaue Engel, 1992 im Theater des Westens
DAS BERLINER ENSEMBLE 1992–1995
Das Fünfer-Direktorium 1992 bis 1995 · Das Fünfer-Direktorium, das Vierer-Direktorium und Einar Schleef · Das Wunder von Mailand, 1993 · Heiner Müllers Duell Traktor Fatzer · Der Jasager und der Neinsager, 1993 · Antonius und Cleopatra, 1994 · Fragen meines Verlegers Helge Malchow · Die Jasager- und Neinsager-Tournee · Mondlicht von Harold Pinter, 1996 · Nochmals Heiner Müller · Nochmals Einar Schleef · Die Lautstärke, ein zentraler Punkt für die Bewertung von Theaterarbeit · Irrationalismus · Unterschiedliche Arbeitsweisen von Schauspielern in Ost und West · Nochmals ein bißchen zum zeitgenössischen Theater · Das Ende des BE-Direktoriums 1995 · Deborah Kaufmann · Uwe Bohm und Eva Mattes· Gert Voss
DIE WANDERJAHRE
Der Kirschgarten im Akademietheater, 1996 · Wien · Alice in Wonderland Münchner Kammerspiele,1996 · Richard III. Münchner Kammerspiele,1997 · Kleine Unterhaltung mit Helge Malchow über Dekonstruktion/Regietheater · Englische Schauspieler · Die englische und die deutsche Art des Theaters · Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 1998 · Ein Flash Black zu den Anfängen meiner Liebe für Debussy · Offene Form · Allgemeines zur Arbeit mit Schauspielern/noch ein paar Fragen von Helge Malchow · Major Barbara/Julia Jentsch · Sarah Kane, Gesäubert, 1998 · Zwischenfrage: Warum habe ich nie Büchner inszeniert? · Nochmals Gesäubert, Ulrich Mühe · Neil La Bute, Bash Hamburger Kammerspiele,2001 · Hamlet, Angela Winkler, 1999 · Hamlet oder König Lear · Uli Wildgrubers Tod · Rosmersholm, 2000 · 2001, der 11. September · Der Jude von Malta, 2001 · Irakkrieg, Weltzustand · Nochmals 11. September · Die Nacht des Leguan, 2002 · Mutter Courage und ihre Kinder, 2003 · Ibsen · Peer Gynt · Der Totentanz, Strindberg 2005 · Zum Bühnenbildner Karl Kneidl · Was ihr wollt · Die Krankheit · Der Abbruch der Inszenierung von Was ihr wollt· Die zwei auserwählten Völker: Juden und Aristokraten· Die Entstehung einer Inszenierung· Major Barbara – eine Aufführung entsteht· Schaffensperioden· Luigi Pirandello, Nackt, 2008· Gedanken über das Alter, das Theater und den Tod
ANHANG/MATERIALIEN
WERKVERZEICHNIS
REGISTER
BILDNACHWEIS
[Inhalt]
Ich sehne mich nach Unsterblichkeit
Vorwort von Elisabeth Plessen
Peter und ich haben uns oft darüber unterhalten, welchen Titel wir dem dritten Band seiner Autobiographie geben könnten. Dieser Band sollte ja niemals der letzte sein, denn seine Autobiographie war auf das Engste mit seiner Arbeit verknüpft, neben unserem Leben. Er wollte immer weiter inszenieren, genauso wie er zu leben nicht aufhören wollte, und sollte die Kraft für die Bühne nicht mehr reichen, hätte er mit seinen Schauspielern eben Hörspiele hergestellt oder junge Leute, die Regisseure werden wollten, und junge Schauspieler unterrichtet. Er wollte noch einen vierten und fünften und sechsten Band, Helge Malchow sollte ihn interviewen und ich die Bücher schreiben. Helge Malchow hörte diesen Plänen schmunzelnd zu und machte sich seine stillen Gedanken. So wie Peter das Theater ständig neu erfand, wollte er auch sein Leben fortlaufend erfinden. Es passte nicht in ein einziges Buch, das dann ›Autobiographie‹ hieße.
Die Wanderjahre, der Titel war mir eingefallen, Our Way sagte Peter, denn die Jahre, die der Band von 1980 bis 2009 umfaßt, sind ja unsere Jahre, Jahre einer intensiven, symbiotischen Lebens- und Arbeitspartnerschaft, und da wir kaum getrennt waren, auch nicht bei seinen oder meinen Krankenhaus-Aufenthalten, wo der eine mit dem anderen einzog, riß der ständige Dialog nicht ab. Doch liegt der Tenor von Peters Erzählung eindeutig auf seiner Arbeit, er hat unser Privatleben stets abgeschirmt und behütet und, auch aus Angst, es könnte beschädigt oder benutzt werden, niemals an die Öffentlichkeit zerren wollen. Also habe ich mich fürs Wandern entschieden, Nomade, Zigeuner, der er war, und zusätzlich, weil eine unserer Lieblingsmusiken Schuberts Wanderer-Fantasie ist. Ein Witz-Titel zwischen uns war Koffer auf Rädern, der an seinen Vater erinnerte, denn der Vater befürchtete jederzeit während des Zweiten Weltkriegs wieder interniert zu werden, wie es ihm in England bereits im ersten Krieg geschehen war. Die Mutter hatte Rollschuhe unter diesen Koffer geschraubt, damit er nicht so schwer wäre – die heutigen Rollkoffer gab es ja damals nicht. Wie sein Vater hatte Peter stets einen gepackten Rollkoffer bereit, nur war seiner als Fluchtkoffer wohin-auch-immer gedacht, ein marineblaues schönes englisches Exemplar aus Paris.
Wie bei den beiden Bänden, die den Wanderjahren vorausgehen, My Way und Dieheißen Jahre, beruht auch dieser Band in seinem Ursprung auf Gesprächen, die Peter mit Helge Malchow führte. Ich habe ihn dann jeweils weiter befragt, weil ich noch mehr wissen wollte, und die Erzählung zu einer Erzählung gemacht.
Zu einer dritten Gesprächsrunde mit Helge Malchow, für Anfang Juli 2009 in unserem Haus in Vecoli geplant, kam es nicht mehr. So sind Die Wanderjahre im doppelten Sinn ein Vermächtnis, eines an uns und eines von mir an Peter, denn er hat den vollständigen Text, mit dem Inszenieren von Major Barbara in Zürich beschäftigt und der Erholung danach, nicht mehr zu Ende gelesen. Und Inszenieren war ihm immer wichtiger als jedes Buch, selbst als sein eigenes. Hinterher freute er sich, wenn er es in der Hand hielt, darin las und es verschenken konnte. Er blieb seinem Motto treu: Mein Leben war eigentlich ein Leben im Theater, das kann man nicht anders sagen. Wenn ich irgendwo auf der Welt ein Theater betrete, bin ich zu Hause. Das Theater ist für mich, wie man immer so schön sagt, die Welt … Er verwandelte sich, sowie er ein Theater betrat.
Er hatte noch so viele Pläne. Die Wunschliste der Stücke war lang, sie hätte Jahre und viele Theater auf Jahre füllen können. Endlich hatte er den Schauspieler gefunden, in dem er seinen neuen Ulrich Wildgruber sah, und darüber war er glücklich, wie verjüngt. Er hatte 2007 in der durch Krankheit leider abgebrochenen Inszenierung von Was ihr wollt Robert Hunger-Bühler, der den Malvolio spielte, für sich entdeckt. Er besetzte ihn als Andrew Undershaft in Major Barbara und plante mit ihm als seine nächste große Shakespeare-Inszenierung Timon von Athen. Dieses Stück lag ihm sehr am Herzen, weil es den Nerv des Zeitgeistes trifft, doch sagten ihm die augenblicklichen Herren der großen deutschsprachigen Bühnen dafür alle ab. Das begriff er nicht, und es enttäuschte ihn maßlos, zu Recht. Ferner dachte er für Hunger-Bühler an T. S. Eliots Cocktail Party und Pirandellos Heinrich IV. Den Tod eines Handlungsreisenden, den er auch mit ihm hatte machen wollen, verwarf er nach längerem Nachdenken schließlich doch, das Stück deprimierte ihn zu sehr, wie auch Tankred Dorsts Ich soll den eingebildet Kranken spielen. Und wie gern hätte er mit teilweise anderer Besetzung Was ihr wollt wieder aufgenommen und in Wien zur Premiere gebracht. Auch diesen Wunsch griff niemand auf. In seinem Hamburger Zuhause der letzten Jahre, im St. Pauli Theater, wollte er als Zwischenschritt zu den großen Inszenierungen kaum bekannte Einakter von Tennessee Williams auf die Bühne bringen, die vor Endstation Sehnsucht geschrieben waren, This Property is Condemned zum Beispiel oder The Traveling Companion, und Peter dachte über Caryl Churchills Stück Seven Jewish Children – A Play for Gaza für das kleine, alte Theater auf der Reeperbahn nach. Mit Uwe Bohm plante er wieder etwas sehr, sehr Großes, ein Uraltplan: Marlowes Tamerlan. Und ein langjähriger Plan war, seitdem Peter am Odéon in Paris mit Isabelle Huppert in der Rolle der Isabella Mésure pour Mésure inszeniert hatte, auch Endstation Sehnsucht mit ihr zu machen. Juliette Binoche, die so lange schon mit Peter arbeiten wollte, sollte die Stella spielen. Da Binoche mit der kleineren Rolle sicherlich nicht zufrieden gewesen wäre, hatte er vor, beide Schauspielerinnen alternierend die Blanche und die Stella spielen zu lassen. Er hatte sich bereits diverse Theater angeguckt, Produktionszeiten und -kosten und Co-Produktionen erwogen. Die Zofen war das zweite Stück, das Peter mit den beiden Stars machen wollte. Im kommenden September sollte er an der Wiener Staatsoper mit Hindemiths Cardillac Dominique Meyers neue Spielzeit eröffnen und freute sich darauf. Endlich wieder Musik im Zentrum! Sein Team stand fest. Er sprudelte die Stücke und die Themen, die ihn interessierten, einfach so heraus. Und ich hätte ihm die Texte, wenn es nötig war, gern ins Deutsche übertragen, da er meine Sprache so liebte. Es war noch so viel zu tun.
Dieser nun doch letzte Band der Autobiographie um- oder überspannt die große Schaffensperiode von 1980 bis 2009 und viele Stationen seines Lebens zwischen Berlin, Wien, München, Stuttgart, Paris, Salzburg, Hamburg und Zürich. Der Bogen reicht von der Berliner Freien Volksbühne unter Kurt Hübner, dem Schiller Theater unter Boy Gobert, dem Burgtheater unter Claus Peymann, den Münchner Kammerspielen unter Dieter Dorn bis zur eigenen Intendanz am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg Mitte der 8oer Jahre und führt weiter zum Fünfer-Direktorium am BE und weiteren Wiener Inszenierungen bei Klaus Bachler bis zu den kleineren Hamburger Theatern, den Kammerspielen und dem St. Pauli Theater unter Uli Waller. 30 Jahre prägender, tonsetzender europäischer Theatergeschichte. In der Zeit entstanden nicht nur die wilden Revuen wie Jeder stirbt für sich allein, Ghetto und Andi, sondern auch die unvergessliche Monsterunternehmung namens Lulu und dazwischen, quasi als Atempause und Rückbesinnung auf die Peter so wichtige, innere Intensität, die lange Reihe der Kammerstücke oder Kammermusiken. Ich will nur einige nennen: Yerma, Baumeister Solness, Wenn wir Toten erwachen, Ivanov, Der Kirschgarten, Rosmersholm und Hamlet mit Angela Winkler, was beides war – das Jahrhundert umfassend und in der Konzentration nach innen auf die reine Gegenwärtigkeit der Bühne gerichtet. Peter wußte sehr wohl, wie er die Zeit aufhob und den Tod, den er so absurd fand, wegspielte.
Es war eine unruhige Zeit, nicht nur markiert durch den Fall der Berliner Mauer, es war ein unruhiges Leben auf ständiger Suche, wobei Peter unbeirrt seinem basso continuo folgte: den Stücken der Autoren, denen er sich stellte, und seinen Lieblingen, den Schauspielern wollte er dienen, deren Phantasie freisetzen und beleben, gegen alle neuen Moden um ihn herum.
Unser Auto – und es waren immer die schönsten, unsozialsten Coupés, nur für uns zu zweit – glich, wenn er wieder zu einem neuen Theater unterwegs war, jedesmal einem Möbelwagen, vollgestopft mit Büchern, Manuskripten, LPs, CDs, Videos, DVDs, die zehn Paar Schuhe und zehn verschiedenen Mäntel – für jedes Wetter sollte ein Paar bzw. ein sehr bedacht ausgewählter Mantel schützen – gar nicht eingerechnet. Ich habe Peter gesagt, daß ich in meinem dritten Beruf zur Packerin und Fernfahrerin geworden sei. Wie viele Wohnungen haben wir im Lauf der Jahre gemietet! Allein in Wien waren es acht, die dann vom Salzfaß bis zur stimmigen Liste der diversen Ärzte aus dem Boden gestampft und mit unserem Leben gefüllt werden mussten. Und wie viele habe ich in den Städten angeschaut und verworfen, bis die ruhige, einigermaßen mögliche gefunden war.
Der Tod seiner Freunde und Weggefährten – Robert Muller, Kurt Hübner, Grüber, Guy Peellaert – nahm ihn sehr mit. Auch Harold Pinters Tod. Damit war für ihn eine große Ära nicht nur des englischen, sondern des zeitgenössischen Theaters unwiderruflich zu Ende gegangen. Im Gegenzug dazu beschäftigte er sich mehr und mehr mit seinen Jugendfreunden und bestellte sich ihre Bücher bei Amazon, auch wenn er die Freunde aus den Augen verloren hatte oder es sie nicht mehr gab – Bernice Rubens, die 1947 seine Salome gewesen war und erst später zu schreiben begann, der Lyriker Peter Vansittart, Bernard Levin, der ehemalige Kolumnist der Times und des Observers, Emanuel Litvinoff, der das jüdische East End seiner Kindheit in London porträtiert hatte …
Peter sagt in einem seiner letzten Interviews: Alter ist eine Belastung und ein Irrtum der Natur. Vollkommen unnötig. Genau wie Sterben. Ich finde, Sterben ist eine Absurdität. Wenn man endlich wirklich etwas vom Leben versteht, dann stirbt man. Es ist, als ob Gott zu feige wäre, zuzulassen, daß es Leute auf der Welt gibt, die ihn durchschauen.
Cleopatra träumt sich noch einmal zurück auf ihre Barke, noch einmal zurück zum Cydnus, um Antonius zu treffen, während der Nilwurm, der ohne Schmerzen tötet, an ihrer Brust liegt und sie schon gebissen hat. Ich wünsche mir, daß ich die Zeit um dreißig Jahre zurückdrehen könnte, um mein Leben mit Peter noch einmal zu beginnen.
Hamburg im Oktober 2009
[Inhalt]
[Inhalt]
ICH GING 1979 NACH BERLIN, suchte erst mal eine Wohnung und fand eine wunderbare, die schönste, die ich je in Berlin gehabt oder gesehen habe, über 200 m², eine riesige, typische Berliner Wohnung in der Fasanenstraße, auf dem zweiten Stock, mit einem riesigen runden Bad, einem runden grünen Bad. Alles war überdimensional. Ich weiß nicht, was der Herr, der vor mir dort lebte, getrieben hat, aber es war sehr schön. Dort zog auch zu Teilen Elisabeth Stepanek mit ein, mit der ich auf schwierigste Weise noch zusammen war. Dann fing ich an, bei Kurt Hübner an der Freien Volksbühne zu arbeiten. Berlin fand ich damals schon bedrückend. Jetzt weiß ich natürlich nicht, und ich wußte es damals auch nicht, ob es daran lag, daß ich gerade eine so wunderbare Zeit in Hamburg hinter mir hatte. Berlin konnte damit nicht konkurrieren, obwohl die Wohnung ganz wunderbar war. Meine Situation war eigentlich fabelhaft. Aber ich hatte mein Ensemble verloren. Die Familie war weg. Ich mußte jetzt zusehen, daß ich die Teile der Familie, sofern es möglich war, wieder zusammenholte. Für drei Inszenierungen bei Hübner habe ich es auch geschafft – Menschenfeind, Bunbury und Der Widerspenstigen Zähmung. Da kamen Wildgruber, Lause, Rosel Zech, Eva Mattes, Ilse Ritter und Elisabeth Stepanek, Dietrich Mattausch, Heinz Schubert und Johannes Pump wieder zusammen. Aber unser Rhythmus war gestört. Die Konzentration der Arbeit am Hamburger Schauspielhaus, die Ivan Nagel hergestellt hatte, war wirklich sehr groß gewesen. In Berlin zerfledderte sich irgendwie alles. Es war nicht mehr ein Gefühl von Ensemble. Die Schauspieler wurden einzeln an dieses Theater engagiert, sie lebten entweder in möblierten Wohnungen oder hatten ihre Frauen, Kinder und Familien woanders, so daß eine grundsätzliche Unruhe herrschte. Ich versuchte, die Familie zusammenzuhalten. Was aber sehr schwierig war.
Berlin Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre deprimierte mich. Das hatte natürlich viel mit meiner Vergangenheit und meinen Erinnerungen zu tun, die jetzt plötzlich zurückkamen. Erinnerungen an die Eltern und was ich von ihnen so gehört hatte. Das Gefühl, daß ich über Pflastersteine ging, über die meine Ahnen auch gegangen waren und über die ich im Kinderwagen geschoben worden bin, hatte zwar einen gewissen Reiz, aber es erzeugte auch eine gewisse Depression, weil von alldem überhaupt nichts übriggeblieben war. Dieses berühmte, tolle Berliner Publikum, über das die Leute immer redeten, und über das man in Memoiren liest, habe ich in Berlin nicht gefunden, weil dieses tolle Berliner Publikum zu einem großen Teil aus Juden bestanden hatte, und die waren nicht mehr da. Die waren nämlich tot. So war es eine Illusion, eine Selbstkarikatur der Berliner, zu behaupten, daß es ein tolles Berliner Publikum gäbe. Die einzige Stärke des Berliner Theaterpublikums war seine Schnelligkeit, die Berliner waren immer sehr schnell in ihren Reaktionen. Sie sind sehr schnell, wenn etwas komisch und witzig ist. Sie sind sehr schnell, wenn ein Schauspieler virtuos ist. Sie sind absolut unbrauchbar für irgend etwas, das den leisesten Hauch von Poesie hat, so daß zum Beispiel mein Lear – eine sehr poetische Aufführung –, als er von Bochum nach Berlin kam, dort überhaupt keine Wirkung hatte. In Berlin mußte man immer schnell, knapp, sehr direkt und ohne Umständlichkeit inszenieren, wie für Leute, die ganz schnell immer noch woandershin mußten. Sie waren mal kurz im Theater … Eigentlich war das so eine Pause für sie.
Ich lebte noch mit Elisabeth Stepanek zusammen, aber es war wieder eine Zeit des Übergangs, denn mittlerweile hatte ich Elisabeth Plessen getroffen. Ich steckte also wieder mitten in komplizierten Frauengeschichten.
Molière, Der Menschenfeind,nach Enzensberger, 1979
Das kam so zustande: Ich hatte ein paar Jahre zuvor im Old Vic eine moderne Bearbeitung dieses Molière-Textes von Tony Harrison gesehen mit Alec McCowan, den ich sehr bewundere, und Diana Rigg. Ich schleppte meinen Sohn mit hinein, der damals noch in die Schule ging, und wir fanden diese moderne oder modernisierte Fassung des Menschenfeindes erstaunlich aufregend, die erste moderne Molière-Fassung, die mich interessiert hat. So kam ich auf den Gedanken, so etwas auch auf Deutsch zu machen, und mir fiel Hans Magnus Enzensberger ein, den ich kannte. Vielleicht könnte der’s. Ich fragte ihn, ob er Lust hätte. Und Kurt Hübner hatte Lust, das Stück zu bringen. Und Ulrich Wildgruber wollte den Alceste spielen. Ich konnte die Rollen gut besetzen. Dann hat Magnus die Fassung geschrieben, die etwas anders wurde, als ich erwartet hatte. Es wurde ein Stück über Bonn, ganz spezifisch und sehr komisch, über Leute in der Bundeshauptstadt Bonn, die mit dem Parlament und der Politik in der Nähe leben wie auf einer Art Cocktailparty – eine äußerst witzige, manchmal vielleicht ein bißchen undurchlässig deutsche, komische Fassung des Menschenfeindes. Die Freie Volksbühne hatte die Arbeit bei Magnus in Auftrag gegeben, und es gab große Diskussionen über die hohe Vorauszahlung, die Magnus wollte, auch über mögliche Änderungen, die wir an seinem Text vornahmen. Die Inszenierung war schwierig, weil Magnus’ Texte nicht per se gute Bühnentexte sind, sie sind zu undurchlässig, sehr geschlossen. Man kann damit sehr wenig anfangen. Man muß einen Weg finden, die Sätze zu sprechen. Die Psychologie der Figuren und der Schauspieler kam in den Versen nicht vor. Und so quälte ich mich lange Zeit, bis ich darauf kam, den Text ganz simpel, wie Knittel-Verse, ein bißchen wie Wilhelm Busch, sprechen zu lassen. Und das funktionierte dann, weil die Schauspieler Dietrich Mattausch, Ulrich Wildgruber, Rosel Zech, Pola Kinski und so weiter alles Schauspieler waren, die viel mit mir gearbeitet hatten, und ihre Persönlichkeit so groß war, daß sie durch den Text nicht kleinzukriegen waren. Sie lebten nun ungeheuer hinter den sehr stilisierten und formalisierten Texten, so daß dabei zu meinem Erstaunen trotz des Textes eine Art von Realismus auf der Bühne herauskam. Das Bühnenbild hatte wieder Daniel Spoerri gemacht. Es bestand hauptsächlich aus Spiegeln und absurden modernen Möbeln, von denen die meisten mittlerweile bei mir in Vecoli sind. Als das Stück abgespielt war, kaufte ich sie, weil ich sie wunderbar fand und absurd genug, um bei mir zu stehen. Ich hatte große formale Probleme während der Proben wegen dieser sehr festen Form von Magnus’ Text, der kuriosen, exzentrischen Schauspieler und wegen Daniels Spiegel-Bild. Das zusammenzukriegen, war schwer. Ich habe mich damit rumgequält und hatte auch nicht soviel Zeit für diese Arbeit.
Im Gespräch mit Hans-Magnus Enzensberger anläßlich seiner Bearbeitung von Molières Menschenfeind
Nach ein paar Wochen schmiß ich das gesamte Bühnenbild raus und probierte das Ganze auf einer leeren Bühne, was mir ganz gut gefiel. Es hatte mit dem Gefühl zu tun, daß ich bei der Inszenierung nirgendwo eine Wirklichkeit oder eine Welt finden konnte, an die ich glaubte.
Ich holte Daniel, dessen Meinung mir sehr wichtig war, dazu. Er sah sich das an, und wir diskutierten lange über das Problem. Er fand es falsch, die Aufführung so stark zu reduzieren, und meinte, man könnte das Problem vielleicht ein bißchen beheben, wenn man die sehr ausgefallenen Highbrow-Kostüme, die ich von Peter Pabst machen lassen wollte, durch ganz moderne, etwas modische, heutige Kostüme ersetzte. Daraufhin setzte Daniel sich ins Auto und fuhr zu seinen Berliner Freundinnen und Freunden, plünderte deren Wandschränke und kam mit einem kompletten Set von Kostümen zurück. Etwas Ähnliches hatte er schon in Bochum bei Professor Unrat gemacht. Da nahm er sich auch ein Auto, fuhr nach Paris, kaufte die gesamten Kostüme auf dem Flohmarkt und schleppte sie an, und sie wurden angepasst. Beim Wintermärchen dagegen ließ er genaue historische Kostüme nach der Originalrenaissancemalerei nachschneidern. Das war völlig wahnsinnig. Es war schon immer eine sehr aufregende, auch sehr aufreibende Arbeit mit Daniel. Auch weil er ein unverdorbener Bühnenbildner ist. D. h. nicht jemand, der Hunderte von Bühnenbildern gemacht hat und sich immer wieder anpassen muß. Er hat sich überhaupt nicht angepasst. Aber er hatte ein großes Verständnis für meine Arbeit und für Theater überhaupt. Es war eine wundervolle Zusammenarbeit.
Das Stück kam raus. Es war ein absoluter, riesiger, schmetternder Erfolg. Die Aufführung dauerte wegen der ständigen Lacher im Publikum statt zwei – drei Stunden. Jeder Satz war eine Pointe, und die Leute waren aus dem Häuschen. Ich erinnere mich, daß ich ein paar Wochen später in Köln zu meinem Arzt ging, der das Stück gesehen hatte und zu mir sagte: »Herr Zadek, ich habe Sie schon erwartet. Die Inszenierung muß eine Qual für Sie gewesen sein. Der Text hat mit Ihnen doch überhaupt nichts zu tun.« Er hatte das Problem kapiert. Die Deutschheit dieses Unternehmens hatte mich während der Proben doch mehr, als ich bemerkt hatte, fertiggemacht. Die Deutschheit von Magnus, das Sprachkorsett und damit auch Denkkorsett, die formale Plumpheit.
Benjamin Henrichs warf mir in der ZEIT vor, daß durch Enzensbergers Übertragung das Zeitkritische und Karikaturenhafte im Vordergrund der Inszenierung gestanden habe und das Tiefe und Tragische bei Molière verschwunden sei.Ich sage zu einem solchen Vorwurf, daß Henrichs sich freuen sollte, daß endlich mal eine Fassung des Menschenfeindes gemacht wurde, bei der die Leute nicht vor Langeweile von den Stühlen kippen. Scheiße auf irgendwelche Tiefen oder Nichttiefen. Es ist wie bei Shakespeare: Wenn bei der achthunderttausendsten Aufführung von Hamlet jemand das Stück ganz banal und vordergründig inszeniert, kann man sicher sein, daß irgendein tiefschürfender Kritiker wie Benjamin Henrichs sich darüber aufregt, anstatt zu sagen: Hier haben wir endlich eine Fassung, die dieses Stück für uns heute interessant macht. Dabei fallen natürlich gewisse Dimensionen des Textes weg. Vielleicht schafft man in einem weiteren Versuch beides, kann ja sein. Interessant war, daß Colette Godard, die Chefkritikerin von Le Monde, und eine der besten Kritikerinnen der letzten dreißig Jahre in Frankreich, die Aufführung sah und als Französin fragte, ob man nicht eine Version dieser deutschen Fassung des Menschenfeindes auf Französisch machen könnte, um sie in der Comédie Française zu spielen. Dann würde das Stück vielleicht auch in Frankreich aus seinem schrecklichen altertümlichen Mief erlöst werden. Der Französin gefiel die Aufführung, ihr fehlte die deutsche Tiefe nicht … Warum soll Molière nicht witzig sein? Das Stück in Enzensbergers Worten war einfach sehr witzig. Molière auf Deutsch ist meistens langweilig und eben gerade nicht witzig, weil die Stücke durchgehend in gereimten Versen geschrieben sind. Deswegen gibt es keine anständige Übersetzung. Die deutschen Übersetzungen des Menschenfeindes sind alle ein bißchen peinlich oder sie gehen den Umweg und machen daraus Prosa. Aber damit ist die formale Luft heraus und das Stück sowieso im Eimer.
Fallada, Jeder stirbt für sich allein, 1981
Ich hatte über Jahre Auszüge aus Falladas Roman als Theaterszenen umschreiben lassen, woraus ganze Fassungen für eine Bühnenaufführung entstanden. Ich hatte mit Gottfried Greiffenhagen auch Frau Fallada in der DDR besucht, was allerdings nicht sehr ergiebig war. Und als ich nun aus Hamburg nach Berlin gegangen war, traf ich mich mit Boy Gobert, der vom Hamburger Thalia Theater ans Schiller Theater gewechselt war. Boy bot mir die Eröffnungsinszenierung für seine neue Intendanz an und dachte eigentlich an Shakespeare. Sicherlich dachte er dabei auch an sich als Schauspieler. Ich war aber mittlerweile sehr vorsichtig geworden, Shakespeare zu inszenieren, weil ich wußte, daß ich die Art von Shakespeare-Inszenierungen der zurückliegenden Jahre nur mit meinen eigenen Schauspielern machen konnte. Den Kaufmann von Venedig, König Lear, Hamlet, Othello, Das Wintermärchen hatte ich praktisch mit mehr oder weniger derselben Gruppe von Schauspielern inszeniert. Mit ihnen war einfach alles möglich. Und so hatte ich keine Lust, jetzt vor einem völlig anderen Hintergrund Goberts Idee zu realisieren. Daraufhin meinte Boy, ich könnte vielleicht wieder eine Revue auf die Bühne bringen, wie damals als Eröffnung meiner Spielzeit in Bochum. »Da habe ich etwas auf Lager«, sagte ich. »Darüber muß man nachdenken – Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada.« Und so setzten wir uns zusammen und dachten darüber nach, Gottfried, Anna Badora, die meine damalige Assistentin war, und ich, und ich sagte: »Ich kann das aber diesmal nicht wie bei Kleiner Mann, was nun? allein machen. Ich schaffe das nicht, ich habe die Kraft nicht dafür. Ich will die Geschichte vom Widerstand dieses alten Berliner Ehepaares gegen die Nazis gerne erzählen, sie ist spannend und verrückt, aber die Revueteile kann ich nicht selbst übernehmen. Dazu müssen wir jemanden holen – und das ist Jérôme Savary.« Ich kannte Jérôme aus Ivan Nagels Zeit in Hamburg, wo er häufig inszeniert hatte. Er war für mich die einzige Möglichkeit, zumal ich wußte, daß das Thema Deutschland für ihn die richtige Spannung besaß – er war nämlich zutiefst antideutsch. Ein Argentinier, der in Frankreich arbeitete, Kommunist, ein ruppiger Mensch, mit einer ungeheuren Leidenschaft für großes, magisches, zirzensisches Theater. Und er war tatsächlich einverstanden, die Revueteile zu übernehmen.
Eine ganz wichtige Person in unserem Team war Charles Lang. Charlie, ein Schweizer, war 1964 zum ersten Mal in Bremen im Theater am Goetheplatz bei einem Vorsprechtermin für Schauspieler aufgetaucht. Er machte, bevor er den Mund aufmachte, erst einmal zwei Rückwärts-Saltos auf der Bühne. Ich engagierte ihn sofort, besetzte ihn hier und da und erkannte dann schnell, daß er vor allem ein hervorragender Fechter und Fechtlehrer und überhaupt ein Bewegungsgenie war. Ich setzte ihn oft als Trainer für die Schauspieler ein, und eine Zeitlang gab er sogar vor jeder Probe eine Gymnastik-Akrobatik-Stunde. Später gab er auch Fechtunterricht und beschäftigte sich mit Feldenkraistechniken. Ab 1966 war er bei fast allen Produktionen dabei, die Kämpfe oder Fechtszenen erforderten wie Ein Patriot für mich von John Osborne (1966), König Lear (1974) oder Hamlet (1977), doch auch schon bei den großen Fernsehproduktionen wie Der Pott (1970), wo Charlie die Bewegungschoreographie machte, das heißt, er inszenierte zum Beispiel komplizierte Massenszenen für mich. Irgendwann wollte er selbst Regie führen. Er hat vor allem in Bremen inszeniert, später auch ein paarmal an der Freien Volksbühne bei Kurt Hübner, mit dem er eng befreundet war. Das ging aber völlig über Charlies Kräfte und an seinen Fähigkeiten vorbei, so daß er regelrecht zusammenbrach.
Der Wunsch von Theatermitarbeitern, irgendwann selbst Regisseur zu werden, ist ja ein sehr verbreitetes Phänomen. Es gibt praktisch niemanden, der am Theater arbeitet, der nicht irgendwann selbst Regisseur werden will. Jeder Bühnenbildner will Regisseur werden. Fast jeder Kostümbildner will Regisseur werden. Ganz sicher jeder Dramaturg und jeder Assistent. Jeder glaubt irgendwann, daß er es besser kann. Das ist ganz in Ordnung und auch ganz klar. Man lebt andauernd im Schatten von jemandem, der die Entscheidungen trifft und der das Kreative aus einem herausholt und es für seine Zwecke benutzt. Und das ist auf die Dauer schwierig. Bei einigen meiner Mitarbeiter, zum Beispiel Corinna Brocher und eben Charlie Lang, kam der Punkt, wo sie es ausprobierten – um dann mehr oder weniger schnell zu bemerken, daß es nicht geht. Bei Corinna ging es ganz schnell. Nach zwei Inszenierungen hatte sie es mitgekriegt und es gelassen. Bei Charlie ging es bis zum Nervenzusammenbruch. Es dauerte lange, bis er sich davon erholt hatte. Aber dann kam er gern zurück und wirkte wieder bei meinen großen Inszenierungen mit, eine ganz wichtige Zwischenfigur, ein Zwischenträger in meiner Arbeit. Tanzchoreographie allerdings ließ ich ihn nicht machen, weil ich mit seinem Geschmack auf diesem Gebiet nichts anfangen konnte. Wenn ich aber zum Beispiel eine komplizierte Schlägerei auf der Bühne brauchte, erarbeitete er das wunderbar mit mir zusammen. Durch die jahrelange Arbeit mit mir hatte er ein genaues Verständnis von meinen Vorstellungen und Arbeitsweisen und war deswegen auch immer ein wichtiger Berater. Vor allem, weil er eben auch ein sehr praktischer Mensch war. Beim Blauen Engel 1992 haben wir uns dann ein bißchen zerstritten, aber da zerstritt ich mich eigentlich mit allen, weil ich krank wurde. Ich mußte mich einfach wehren. Außerdem ist Charlie kein einfacher Mann, er ist sehr forsch und direkt, ein guter Freund über viele Jahre. Bei Inszenierungen, wo es dazu auch noch einen Choreographen gab, wie Barry Collins bei Jeder stirbt für sich allein und Hans Kresnik bei Ghetto, war Charlie immer in einer sehr schwierigen Situation, weil er so nur eine Art von Zwischenhändler war. Immer, wenn ich Probleme mit dem Choreographen hatte, habe ich Charlie benutzt. Ich bin recht rücksichtslos in solcher Hinsicht. Meine Mitarbeiter benutze ich oft gar nicht in ursprünglich vorgesehenen Funktionen, sondern für die Dinge, die gerade notwendig sind, um die Sache voranzubringen. Über die Konsequenzen denke ich lieber später nach.
Bernhard Minetti in der Fallada-Revue Jeder stirbt für sich allein
In der Besetzungsliste von Jeder stirbt für sich allein erfand Charlie für sich den Begriff der »Bewegungsregie«. Er war bei meiner Inszenierung mit Savarys Revuen nicht zuletzt deswegen unersetzbar, weil die Aufführung ein riesiges logistisches Problem darstellte, denn das Schiller Theater war noch gar nicht fertiggestellt – wir arbeiteten während der Proben praktisch auf einer Baustelle, und das bei ungefähr achtzig Leuten, die auf der Bühne standen – Tänzer, Sänger, Akrobaten, Zwerge … Wir hatten 35 Schauspieler, 8 Mann im Orchester, 6 Tangopaare, 10 Offiziere mit Damen, hinzu kamen die wechselnden Besetzungen für die einzelnen Revuen … Mit der einen Hälfte der Leute machte Jérôme die Revuen, die andere Hälfte waren die Schauspieler, mit denen ich arbeitete. Die meisten Schauspieler stammten aus dem Ensemble des Schiller Theaters, die Ausnahmen waren Angelica Domröse, Hilmar Thate und Otto Sander, der den SS-Kommissar Escherich spielte, eine wunderbare Rolle für ihn. Ich hatte mit Otto Monate und Monate gerungen, bis er sich entschied mitzumachen. Generell gesagt wußte ich, ich brauche zwei bestimmte Schauspieler für dieses Unternehmen: Otto Sander und Minetti. Bernhard Minetti gehörte zwar zum Ensemble, mußte aber auch zuerst überzeugt werden, die Rolle des Otto Quangel zu spielen. Minetti war damals schon Mitte siebzig, und seine Frau sollte die dreißig Jahre jüngere Angelica Domröse sein. Die Besetzungsfragen waren schon kompliziert genug, das Hauptproblem war aber, daß ich es mit vielen Schauspielern zu tun hatte, die ich überhaupt nicht kannte. Außerdem inszenierte ich nach einem Text, den diesmal nicht Tankred Dorst auf der Basis des Romans wie bei Kleiner Mann, was nun? angefertigt hatte, sondern Greiffenhagen und ich selbst. Unsere Bearbeitung war ein Monster von einem Buch, und trotzdem ging ich während der Proben wieder mit dem Roman in der Hand an die Arbeit, der ein noch größeres Monster war. Derweil probierte Jérôme Savary oft draußen in den Spandauer Filmstudios die Revuen. Ich bewegte mich andauernd zwischen den Proben am Schiller Theater und diesen Studios im Auto hin und her. Hinzu kam, daß Erwin Bootz, der wieder die Musik machte, gegenüber Kleiner Mann, was nun? nun nochmals zehn Jahre älter, krank und schwierig war. Er mußte jeden Tag von Assistenten aus dem Bett geholt werden und nahm dann erst mal sein Captagon. Dann konnte man drei Stunden mit ihm arbeiten, danach brach er zusammen und schlief ein. Sabine Sinjen, die 1995 starb, spielte die Emmy Göring, die im Roman nicht vorkommt. Ich hatte aber in der Recherchier-Phase zum Stoff Emmy Görings Erinnerungen An der Seite meines Mannes gelesen, die 1967 erschienen waren, und fügte daraus Passagen in die Aufführung ein, so wie auch noch weiteres Material, als ob der Roman nicht selbst schon lang genug gewesen wäre! Aus Emmy Görings Buch entstand zum Beispiel eine Szene, in der Emmy mit ihrem Kind Göring nach dem Krieg im Gefängnis besucht. Eine wunderbare Szene, die mit einem Steptanz von Görings Kind
Angelica Domröse
auf einem großen Klavier endet – eins von den vielen surrealistischen Elementen in der Aufführung. Leider waren die Revueteile und die Romanszenen nicht so gut ineinander verzahnt wie bei Kleiner Mann, was nun?, wo zum Beispiel die Schauspieler in den Revueteilen zugleich die Sänger waren. Das war hier leider nur selten der Fall, zum Beispiel in der herrlichen Revuenummer mit Erich Schellow über den Berliner Eckensteher. Dazu kam dann noch die Erfindung, Fallada selber als Figur auftreten zu lassen, um noch einen Blick von außen auf das Geschehen zu haben. Ich hatte den Dramatiker Hartmut Lange gebeten, diese Rolle zu schreiben. Ich sehe uns noch alle in Sizilien sitzen, in einem Haus am Meer bei Céfalù – Hartmut Lange, Greiffenhagen, der Maler Johannes Grützke –, und an den Zwischenbildern mit Hans Fallada arbeiten, mit denen wir einesteils eine Art zusätzlicher Verbindung zwischen dem Autor und der Erzählung herstellen wollten, andernteils aber auch eine Distanzierung. Ein Grund dafür war, daß mich Falladas Biographie fast mehr interessierte als die Geschichte des Romans. Leider funktionierten die Fallada-Teile dramaturgisch nicht richtig, nicht wegen Hilmar Thate, der neben der Rolle des kleinen Spitzels Enno Kluge Fallada spielte, sondern weil die Aufführung dadurch überlastet wurde. Hilmar Thate spielte sogar ausgesprochen gut. Die große, nächtliche Szene zwischen Enno Kluge und Kommissar Escherich, in der sich Kluge zum Schluß erschießt, war der Höhepunkt des Abends. Die beiden redeten fünfzehn Minuten auf einem Steg am Wannsee darüber, ob es nicht besser wäre, wenn sich der Spitzel Kluge erschösse – schauspielerisch sicher die sensationellste Szene neben der Szene zwischen dem alten naiven und tapferen Widerstandskämpfer Quangel und dem Kommissar, gespielt von Otto Sander. Die gesamte Aufführung litt unter einer zu großen Anzahl heterogener Elemente. Ich war vielleicht zu sicher geworden und glaubte, alles und jedes in einen stimmigen
Otto Sander
Zusammenhang bringen zu können – Savary, Lange, Fallada, lauter Schauspieler, die ich nicht kannte … Dazu kam noch das Problem des Bühnenbilds. Meine gewohnten Partner konnten alle nicht, und man hatte mir über Johannes Grützke erzählt. Sowohl Karsten Schälike, der ganz plötzlich in Bochum gestorben war, als auch Wilfried Minks bewunderten Grützke als Maler sehr. Er hatte aber auch schon Stücke geschrieben, wie ich dann erfuhr, hatte inszeniert, spielte Geige und machte kleine Performances. Barbara Naujok, seine Frau, kannte ich noch aus Bremen als Kostümassistentin. Ich fand Grützkes Bilder sofort aufregend und fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, für die Revue Prospekte zu malen. Ich bot ihm nicht das ganze Bühnenbild an, weil das eine äußerst komplizierte, technische Veranstaltung war, auf die er sich sicher nie eingelassen hätte. Für die Prospekte aber sagte er zu. Später gab es dann große Probleme mit den Prospekten, weil Hannes natürlich nicht wußte, wie man ein Gemälde, das vielleicht achtzig Zentimeter breit ist, auf Bühnengröße vervielfacht. Es ist ja keine technische Reproduktion, sondern bleibt ein – nur sehr viel größeres – Gemälde, für das man eine ganz andere Maltechnik benutzen muß als für ein kleineres Gemälde. Zuerst zeigte Hannes den Leuten im Malersaal seine Gemälde. Im Stil normaler Theatermalerei sollten die Maler das, was sie sahen, einfach zehnmal so groß malen. Ständig kamen nun irgendwelche Prospekte auf der Bühne an, die ganz anders als die Originale aussahen, die mir gefallen hatten. »Ich habe das Original gesehen«, sagte ich zu Johannes, »und ich will das nun hier genauso haben wie das Original. Nur zehnmal größer. Es muß bis zum letzten Pinselstrich identisch sein mit dem, was du zuerst im kleinen Maßstab gemalt hast.« Das ist eines der großen Probleme, das man immer am Theater hat: Bühnenbildner und Kostümbildner führen dem Regisseur oft Bauten oder Kostüme vor, die in wichtigen Details dem Modell, das man vorher gesehen hat, nicht entsprechen. Und das nicht, weil es jemand in der Werkstatt nicht genau nachgebaut oder nachgeschneidert hat, sondern weil der Bühnen- bzw. Kostümbildner nicht an den Gedanken gewöhnt ist, daß das Bild bzw. das Kostüm hundertprozentig genau dem entsprechen muß, was der Regisseur als Modell gesehen hat. Das ist ein Vorgang, den ein wirklicher Maler im Gegensatz zu einem Bühnenbildner sehr viel besser versteht, obwohl er die Technik der Herstellung unter Umständen noch gar nicht beherrscht.
Die Prospekte, die Grützke für Jeder stirbt für sich allein malte, waren die ersten Prospekte in meiner Arbeit.
Wilfried Minks arbeitete nicht mit Prospekten. Wilfried haßt Prospekte bis heute. Er lehnt das ab. Als Johannes Grützke ihm wie im Kaufmann von Venedig (1988 im Wiener Burgtheater) Prospekte in seinen schönen Bühnenraum hineinhängte, mußte er sich immer noch sehr zusammennehmen. Er akzeptierte es nur gerade so, weil er die Prospekte von Johannes Grützke für sich selbst betrachtet wiederum sehr schön findet, und weil er meine Arbeitsweise kennt. Aber er paßt doch ständig auf, daß sein Bühnenraum nicht zu stark von diesen Prospekten geprägt wird. Seine Aversion gegen gemalte Prospekte ist geblieben. Für mich ist aber gerade die Mischung zwischen räumlichem Denken auf der Bühne und Prospekten, die etwas ganz Künstliches, Zweidimensionales haben, entscheidend. Diese beiden Eindrücke beim Zuschauer im selben Moment auszulösen, ist für mich etwas ganz Wesentliches. Ich verlange einfach die Phantasie vom Zuschauer, ein Bild für Realität zu nehmen – das ist ein Wald, der da hängt –, und gegen diesen Vorgang stehen noch ein paar »echte« Bäume daneben oder dahinter. Das ist eben auch ein Wald. Die beiden Dimensionen im selben Raum zu haben – das finde ich aufregend und verlange es mittlerweile von jedem Bühnenbildner. Seit meiner Inszenierung von Pinters Mondlicht (1995) arbeite ich sehr viel mit dem Bühnenbildner Karl Kneidl zusammen. Er hat nicht Wilfrieds Problem mit dem reinen Raum. Er malt gern. Und jedesmal bin ich gespannt, wie er mit dem Problem des Prospekts fertig wird – ob im Kirschgarten, ob in Alice im Wunderland, Rosmersholm, Bash, Peer Gynt oder Nackt. Damals, 1981 in Berlin, mußte ich für den Bühnenraum und die gebauten Teile eine zweite Person finden. Ich erinnerte mich an Jürgen Flimms Bruder, Dieter Flimm, der eigentlich Architekt war und hauptsächlich in der Werbung arbeitete. Entscheidend war, jemanden zu finden, der Grützkes große Bilder akzeptierte und ein äußeres Konstrukt baute, das mit den Prospekten zusammen funktionierte. Ich muß sagen, es hat gerade so funktioniert. Ich hatte ein riesiges Team. Zu allen schon Genannten kam noch Savarys eigener Bühnenbildner, der die Bühne für Teile der Revue machte, ganz falsch und sehr schön. Dann Savarys Choreograph. Die Leitungscrew der Aufführung war fast so groß wie die gesamte Besetzung. Es war wirklich eine Schlacht. Gottfried Greiffenhagen gelangte an die Grenzen seiner organisatorischen Möglichkeiten. Gott sei Dank gab es ein paar Leute um den Intendanten Gobert herum, die das Wahnsinnsprojekt sehr unterstützten, im wesentlichen Eberhard Witt, der später als Intendant ans Münchner Residenztheater ging, der jung, frisch und frech war, und Gerhard Blasche, später lange bei Peymann in Wien, der ein sehr guter Diplomat war, ein charmanter Wiener, damals der Freund von Boy Gobert. Dann gab es einen sehr guten Verwaltungsdirektor namens Otmar Herren. Es war ein unbeschreibliches Unternehmen. Wir haben 24 Stunden am Tag gearbeitet. Ich hatte daneben eine Superkrise mit meiner damaligen Freundin Elisabeth Stepanek, die in der Zeit endgültig psychisch erkrankte. Sie sollte in der Aufführung das junge Mädchen spielen, kriegte das nicht mehr hin und war immer in Tränen und Hysterie. Wenn ich nach Hause kam, erlebte ich hysterische Szenen. Im Theater erlebte ich auch hysterische Szenen. Elisabeth Plessen, die ein Buch über die Proben schreiben wollte, schmiß ihren Plan und alle Notizen auf halber Strecke hin und flüchtete nach Amerika und kam danach auch nicht mehr in die Proben zurück. Die Inszenierung war ein Monster. Ich dachte nicht, daß ich sie überleben würde. Ich wurde im Laufe der Arbeit auch krank und bekam eine Blutvergiftung. Ich sehe mich noch in meiner Wohnung in der Fasanenstraße im Bett liegen, ein Bein hochgeschnallt, um zu verhindern, daß die Blutvergiftung größer wird, vollgestopft mit Penizillin, hohes Fieber, umgeben von zwanzig Leuten, die dies oder das wollten. Zum Schluß kam der Kampf um die Länge der Aufführung. Der erste Durchlauf dauerte acht Stunden, die Reduzierung auf fünf Stunden war der letzte Kampf.
Wenn ich mich frage, ob ich trotz allem zu dem Ergebnis stehe, antworte ich mit Jein. Im Vergleich zu Ghetto, das ich drei Jahre später wiederum bei Kurt Hübner an der Freien Volksbühne inszenierte, war es nicht so toll. Jeder stirbt für sich allein hatte Teile, die außerordentlich schön waren. Die Größe war überwältigend. Aber man hätte es zwei Jahre lang im Repertoire haben und langsam daran weiterarbeiten müssen. Wenn das Schiller Theater mein Theater gewesen wäre, hätte ich die Aufführung schrittweise verkleinert und präziser gemacht. Dann wäre es vielleicht eine ganz große Aufführung geworden. Aber auch so war es im Haus ein absoluter Rekord und ein enormer Erfolg. Die Zuschauer sind völlig ausgeflippt. Es war nicht eine Sekunde langweilig. Es hatte die tollsten Schauspieler und die tollsten Nummern von Jérôme. Es gab die Nummer mit zehn Adolf Hitlers auf der Bühne, die steppten. Das alte Ehepaar kommt wie im Roman aus einem Dorf in der Nähe von Berlin zum ersten Mal in die Stadt, weil die beiden Alten gehört hatten, daß ihre Tochter im Gefängnis saß und zum Tode verurteilt worden war. Sie waren noch
Die Blutvergiftung
nie aus ihrem Dorf herausgekommen und konnten sich nicht vorstellen, daß dieser Herr Hitler, den sie so wunderbar fanden, so etwas auch nur zulassen würde. So haben sie sich das erste Mal in ihrem Leben in einen Zug gesetzt und sind nach Berlin gekommen, um Herrn Hitler zu besuchen und mit ihm zu reden. Die Zugfahrt inszenierte Jérôme ebenfalls als Revuenummer, eine herrlich kabarettistische Zugfahrt mit ständig neuen Zwischenfällen unterwegs. Am Ende kamen die beiden in die Reichskanzlei, fanden aber niemanden und landeten in der Kantine, wo zehn Hitler-Doubles saßen. Daraus entwickelte sich die große Stepnummer der Hitler-Doubles. Solche Nummern gab es eine ganze Anzahl. Phantastisch die Szene, die den Einmarsch der Deutschen in Paris zeigte und mit der Jérôme die Franzosen fertigmachte, indem er vorführte, wie sie alle Türen aufmachten und Hurra schrien. Die Aufführung platzte regelrecht vor solchen Einfällen. Und daneben lief eben die zentrale Geschichte von Minetti als Quangel, Thate als Enno Kluge und Otto Sander als Kommissar Escherich, die schon für sich alleine anrührend und intensiv genug war, aber wenn man das Ganze nahm, war es einfach zuviel. Hätte man die Fallada-Geschichte, die zusätzlich eingebaut war, herausgenommen, wäre es schon viel besser gewesen.
Meine Idee, Fallada selbst mit hereinzunehmen, hatte mit moralischen Bedenken gegenüber der Rolle, die Fallada im Dritten Reich gespielt hatte, nichts zu tun. Ich fand es viel bedenklicher, wie herablassend er von anderen Schriftstellern behandelt wurde und immer noch behandelt wird. Das war für mich eine deutsche Haltung, die mich sehr nervte. Er hat ja offiziell keine Nazi-Propaganda gemacht, er hat sich zurückgezogen und irgendwelche albernen Geschichten geschrieben. Daß er ein Auftragsdrehbuch für die Nationalsozialistische Filmproduktion geschrieben hat, erfuhr ich erst später. Der Film wurde aber nie gedreht.
Aber es war alles harmlos. Fallada hat sich aufs Land zurückgezogen. Ich verstand das sehr gut. Besonders, weil er vor der Nazizeit von dem noblen Herren, Thomas Mann, nicht zu den Partys eingeladen wurde und nicht dabeisein durfte, weil er ja kein wirklicher Künstler war. Meine Sympathien gingen sehr stark zu ihm. Das war meine Haltung. Es ist uns in der Revue nicht gelungen, das richtig zu zeigen.
Die äußere Größe einer Inszenierung
Die äußere Größe einer Inszenierung hat schon einen gewissen Wert in sich selbst, auch wenn ich weiß, daß eine Inszenierung mit zwei Schauspielern auf einer leeren Bühne unter Umständen viel aufregender sein kann als eine Inszenierung mit vierzig Schauspielern, die fünf Stunden dauert, zwanzig Bilder hat und zu der ein Orchester gehört. Trotzdem gibt es für mich – und ich denke auch für viele andere Regisseure – das Gefühl einer stimmigen Eskalation, einer Logik des Größerwerdens. In Hamburg konnte man diese Eskalation von der Othello-Aufführung 1975 – kaum Bühnenbild, zehn, zwölf Schauspieler – bis zum Wintermärchen – Riesenaufwand, Riesenkosten, unendlich lang, viele Extras, Statisten und so weiter, auch eine aufgeblähte Inszenierung – genau beobachten. Dabei hatte das Wintermärchen, glaube ich, längst nicht die schauspielerische Qualität der Othello-Aufführung oder des Hamlets von 1976, aber sie hatte doch eine andere zusätzliche Dimension, die Dimension großen spektakulären Theaters. Ich erinnere mich an einen Artikel des englischen Theaterkritikers John Peter in der Sunday Times über eine Traumspiel-Inszenierung des kanadischen Regisseurs Robert Lepage, einem Regisseur, der ja laufend riesige aufwendige Inszenierungen herausbringt. Auch John Peter weist in seinem Artikel auf die allgemeine Tendenz hin, gerade unaufwendiges »kleines« Theater zu verteidigen, kommt aber wie ich zu der Schlußforderung: Wenn man einmal wirklich eine gelungene riesige, teure Inszenierung sieht, erkennt man doch, was für eine zusätzliche Qualität dies mit sich bringt. Es gab bei mir über die Jahre eine Tendenz: Wenn ich an einem Theater irgendwann Vertrauen in die Abläufe, Mitarbeiter und so weiter gewonnen hatte, wurden meine Inszenierungen Schritt für Schritt größer, riskanter und aufwendiger. Das war beim Wintermärchen in Hamburg so, das war in Bremen bei der Aufführung von Music Man der Fall, einem großen amerikanischen Musical, das wir sicherlich nicht in den ersten fünf Minuten in Bremen hätten produzieren können. Irgendwann hat man die Courage. Bei Jeder stirbt für sich allein war ich nun wieder so ein Risiko eingegangen, aber es war ein Risiko, das eigentlich zu weit ging. Auch, weil ich nicht den entsprechenden Vorlauf am Schiller Theater gehabt hatte. Ich hatte erst zweimal in Berlin inszeniert, aber an der Freien Volksbühne und nicht an diesem Haus, das sich zudem mitten in der Renovierung befand. Die Bühne war zum Beispiel bei den Proben noch nicht fertig, und auf der unfertigen Bühne arbeiteten wir mit irrsinnigem Aufwand. Andauernd kamen neue Bilder auf die Bühne: Zimmer, Räume, Häuser, alles rollte hin und her. Es war der absolute Wahnsinn. Ich hatte mir speziell jemanden für die Logistik der Probenabläufe geholt, die wir gar nicht mehr übersahen. Es war Manfred Schwiering, der aus der DDR gekommen war. Ich setzte ihn in die Mitte des Zuschauerraums hinter ein Mikrophon und sagte: »Du dirigierst jetzt die Probenabläufe.« Ich glaube, es wäre sonst nie zu einer Premiere gekommen. Auch wenn es komisch klingt: ich, der Regisseur, dirigiere nie meine Proben. Bei großen, technisch aufwendigen Aufführungen, bei denen, sagen wir, dreißig Bilder auf die Bühne kommen, die Beleuchtung und der Ton unendlich kompliziert sind, sitzt einer meiner Assistenten in der Mitte des Zuschauerraums hinter einem Pult mit Kopfhörern und ein, zwei, drei Mikrophonen vor sich. Die Mitarbeiter haben alle Knöpfe im Ohr, und der Assistent dirigiert die Probe. Ich sitze mit einem anderen Assistenten, der Notizen macht, an der Seite und gehe höchstens ab und zu zu dem dirigierenden Regieassistenten, um ihm Anweisungen zum Beispiel über das Tempo zu geben. Nur selten, wenn es um den Feinschliff geht, mische ich mich selbst ein. Bei den ersten Durchläufen solcher Inszenierungen funktioniert ja erst einmal gar nichts. Da kommt ein Podest auf die Bühne gefahren, und prompt fällt ein Stuhl um. Dann geht plötzlich das Licht aus. Dann bringt jemand einen Ton rein, der nicht dazugehört. Diese ersten Proben, in denen man nur generell festlegt, wie es laufen soll, leite ich meistens noch selbst. Danach übergebe ich an meinen Assistenten und schaue zu, wie alles weiter schiefgeht, und greife höchstens manchmal ein, um den Rhythmus zu verändern. Der Assistent, der neben mir sitzt, muß die Rhythmusangaben notieren und sich später genau erinnern, der Rhythmus ist etwas sehr kompliziertes. Ein Schauspieler kommt auf die Bühne, dann kommen drei weitere von links. Dann kommt etwas von oben herunter, dann kommt etwas von der Seite. In einer sehr kurzen Zeit passieren -zig Ereignisse und erzeugen so einen gewissen Rhythmus, den ich eigentlich nur aus dem Bauch dirigieren kann. Er ist nicht vorzuprogrammieren. Ich habe ihn zwar ungefähr im Kopf, weiß aber erst genau, was ich will, wenn ich es sehe und höre. Habe ich einen schlechten Assistenten, der in solchen Momenten etwa plötzlich sagt: Peter, wann hast du das Podest gebraucht, ist es aus, weil ich eine bestimmte Idee unter Umständen nicht wiederholen kann. In einem solchen Fall muß ich zum Beispiel die gesamte Szene noch mal von vorne inszenieren, weil sich der Rhythmus einer Szene oder eines Stücks durch die ganze Szene oder durch das ganze Stück aufbaut, wie in der Musik. Und in den späteren Stadien, wenn der Rhythmus steht, trainiert der Assistent alles, bis es klappt. Das ist eine Arbeit, die für mich viel zu anstrengend wäre. Hinzu kommt, daß man die Abläufe nicht wirklich sieht, wenn man sie selbst dirigiert. Man kann keinen Rhythmus kontrollieren, wenn man andauernd sagt, los, los, Ton ab. Das ist völlig unmöglich. Bei Jeder stirbt für sich allein, dem größten, was ich je in meinem Leben auf diesem Gebiet gemacht habe, hatte ich anfangs keinen Assistenten, der das gekonnt hätte. Meine üblichen Assistenten waren da leider überfordert. Man muß sich vorstellen, ich hatte Jérôme, der auf meiner rechten Seite saß und schrie: »Wo ist das Bühnenbild? Scheiß Deutschland, kein Bühnenbild. You are a lot of bloody amateurs.« Auf meiner linken Seite saß Barry Collins, der englische Choreograph, und sagte: »O, the girls aren’t here yet, o, what a shame. Where are they? I’m awfully sorry.« Dann kam irgendeine Nachricht, daß Herr Minetti gerade zum Mittagessen gegangen war. Und so ging es weiter. Manfred Schwiering hat mir dann aus der Klemme geholfen und die Abläufe vierzehn Tage lang trainiert. Das Ende vom Lied war, daß wir zum Termin nicht fertig wurden. So marschierten wir zu Gobert und erklärten: Es tut uns furchtbar leid, aber die Eröffnung des Schiller Theaters muß leider um zwei Monate verschoben werden. Gobert mußte es akzeptieren und hat sich damit praktisch die erste Spielzeit zerstört. Ein Killer für sein Theater. Aber ich hatte keine Wahl. Unter anderem waren die unzähligen Kostüme noch nicht fertig. Bei jedem Auftritt des Balletts und des Chors wurden neue Kostüme eingesetzt, die Musik paßte lange nicht zu den Theaterelementen. Es war viel schwieriger als ein Musical. Ein Musical ist ja überschaubar, man weiß, wo die Probleme liegen und wie man sie angeht. Hier aber war nichts überschaubar. Die drei Grazien, die nackt das Hitler-Porträt umtanzen sollten, erklärten eine Woche vor der Premiere, daß sie nackt nicht auftreten würden. »Das steht aber im Vertrag«, sagte ich. »Das interessiert uns nicht, wir treten nicht nackt auf«, antworteten sie. »Gibt es eine Lösung?«, fragte ich. Ihre Antwort: »Mehr Geld.« So haben wir ihnen mehr Geld gezahlt, eigentlich ein eher einfaches Problem, nur, wenn es dir eine Woche vor der Premiere passiert und du zu Gobert und seinem Verwaltungsdirektor gehen mußt, der sowieso schon viel mehr Geld ausgegeben hatte, als er je hatte, ist es plötzlich ein sehr großes Problem. Gobert bekam unheimlichen Ärger mit der Stadt Berlin, die ihn fertigmachte, weil er die halbe Subvention für seine erste Spielzeit schon für diese erste Produktion ausgab. Es ging um enorme Summen – es wurde immer mehr. Das Ganze wurde irgendwann auch in Hinsicht auf die Kosten für mich unüberschaubar, für uns alle. Ich habe aber daraus gelernt. Als ich in Hamburg als Intendant Andi inszenierte, holte ich mir jemanden, der von Tag zu Tag kontrollierte, daß nicht ein Pfennig zuviel ausgegeben wurde als geplant, und zwar meinen Sohn. Dem konnte ich trauen, der würde mich nicht verkaufen. Er lief Tag für Tag durch die Abteilungen und checkte, daß niemand mehr Geld ausgab, als für die Produktion zur Verfügung stand.
Ich stehe im Ruf, daß ich auf finanzielle Grenzen nicht achte. Das ist ein Irrtum. Wenn man bemerkt, wie die Kosten tagtäglich explodieren, ist das einfach furchtbar für einen Regisseur. Übrigens waren die Kosten nach der Premiere von Jeder stirbt für sich allein auch so hoch, daß das Schiller Theater sich die ständig ausverkauften Aufführungen nach einem Jahr nicht mehr leisten konnte, trotz überhöhter Preise.
Ghetto, 1984
Ich war während dieser Arbeit sicherlich nicht gerade in einem sehr liebenswerten Zustand. Ich war sehr erregt, was bei dem Thema vielleicht nicht erstaunlich ist. Es war das erste Mal, daß ich das Thema des Holocausts auf der Bühne so direkt behandelte. Die Arbeit war ungeheuer anstrengend für mich, und ich habe dabei nicht nur mit Hans Kresnik sehr viel getrunken und sehr viel geraucht. Nach der Aufführung mußte ich mich monatelang pflegen, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich fuhr mit Elisabeth in einem Zustand von langsam nachlassender Hysterie, Krankheit und Übelkeit durch Holland und Frankreich nach Italien, von Hotel zu Hotel, eher Hotelbett zu Hotelbett, weil ich da einfach liegenblieb. Ich kann nicht sagen, daß ich Ghetto sehr genossen habe. Wir probierten das Stück drei Monate lang, meistens in drei Parallelproben. In der Freien Volksbühne lief die Hauptprobe, also die Schauspielerprobe, an einem anderen Ort die Ballettprobe und wiederum woanders die Gesangsprobe. Ein Musical ist etwas sehr Anstrengendes, und wenn es noch ein Musical mit einem sehr ernsten und harten Hintergrund und praktisch eine Uraufführung ist, ist es erst recht kompliziert. Der Autor Joshua Sobol hatte das Stück schon einmal selbst in Tel Aviv inszeniert, das Videoband hatte ich gesehen. Das war kunstgewerblich und ganz unbrauchbar, so daß meine Inszenierung praktisch eine Uraufführung wurde – man mußte das Stück völlig neu erfinden. Der Text gibt darüber hinaus auch nicht zuviel her. Er ist zwar gut, besteht aber zum größten Teil aus Monologen, so daß man alle dramatischen Situationen neu erfinden mußte. Wir hatten ein großes Glück mit der Besetzung: Hermann Lause spielte den Erzähler und den Bauchredner und Ernst Jacobi den Bibliothekar Kruk, ganz wunderbar. Zuerst hatte ich für den jüdischen Kleiderfabrikanten Weißkopf, der mit seinen Arbeitern Uniformen für die deutsche Wehrmacht reinigte und flickte, Klaus Schwarzkopf besetzt. Als er erkrankte, übernahm Otto Tausig seinen Part. Das war auch viel besser. Und natürlich hatte ich Ulrich Tukur in seiner ersten großen Rolle, dazu Peter Kern, Michael Degen – alles Schauspieler, die ich gut kannte oder mit denen ich schon gearbeitet hatte.
Mit Michael Degen war es eine Ausnahme. Ich hatte 1959 in Köln, also 25 Jahre zuvor, in Der verlorene Brief von Caragiale mit ihm zusammen gearbeitet. Ich hatte auch nicht vor, jemals wieder etwas mit ihm zu tun zu haben. Ich hatte ihn zwischenzeitlich nur in der Don Juan-Aufführung von Ingmar Bergman gesehen, das war auch schon alles. Aber nun, für Ghetto, fiel er mir trotz aller negativen Erinnerungen sofort ein – und zwar als einzige Möglichkeit, den Chef der Ghettopolizei und Leiter des Ghettos Jacob Gens zu spielen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Michael nicht gekonnt oder gewollt hätte. Ich hätte das Stück wahrscheinlich nicht auf die Bühne gebracht. Ich wüßte heute auch keinen Schauspieler, denn diese Rolle des jüdischen Capo mit einem Schauspieler zu inszenieren, der nicht jüdisch ist, hätte mich genervt. Das hätte ich nicht gerne getan, und es gab eben keinen ersten deutschen jüdischen Schauspieler in Deutschland außer Degen.
Die musikalische Leitung übernahm Peer Raben. Arie Zinger, mein ehemaliger Assistent, hatte, da er in Israel aufgewachsen ist, große Kenntnisse über jüdische Musik und Kultur, die
Plakat zu Ghetto
ich so nie hatte, und Arie erzählte mir eines Tages über Giora Feidman, der in Deutschland ein unbekannter Name war, ein Klarinettist, der Klezmer-Musik spielte, aber auch der erste Klarinettist der israelischen Philharmoniker war. Arie gab mir Platten von ihm, die ich zum ersten Mal hörte und die mich sofort begeisterten. Wir dachten daran, einen Schüler von Feidman zu suchen, und trafen Feidman mit Peer Raben bei einem Konzert in Amsterdam. Dort stellte sich heraus, daß Feidman selber bereit war, die jüdische Musik in Ghetto zu übernehmen. Er spielte mir in Peer Rabens Münchner Wohnung vor und war von Anfang an eine der Hauptinspirationen für die ganze Arbeit. Giora ist ein sehr sentimentaler, auch opportunistischer Mensch, ein genialer Musiker, und all dies hatte eine große Wirkung auf die Aufführung. In Gesprächen mit ihm fiel dann der Name Esther Ofarim für die Rolle der jüdischen Sängerin Chaja, die zu den Partisanen flieht. Esther war sofort bereit, kam, glaube ich, aus den USA zu uns nach München, und ich mochte sie sofort sehr. Sie war eine ganz kuriose Person. Sie hatte eine etwas kalte, amerikanische Professionalität, wie halt Schlagersänger so sind – man erwartet, daß gleich der Agent um die Ecke kommt. Das war so mein erster Eindruck.
Natürlich war sie völlig aus dem Geschäft, man kannte sie aus den 60er Jahren als Schlagersängerin zusammen mit Abi Ofarim, aber sie lebte noch irgendwie in dieser Welt. Es war noch ihre Welt. Sie war auch sehr teuer. So läuft es ja oft in solchen Fällen: Tom Jones hört mit 30, mit 35 als großer Star auf, und zehn Jahre später kommt jemand und sagt, Mr. Jones, wollen Sie vielleicht noch mal bei uns singen? Und sofort kommt er natürlich mit seiner letzten Gage an und den vielen kleinen zusätzlichen Forderungen – genauso, wie es einmal gewesen war. Ich habe öfter versucht, jemanden zurückzuholen, dessen Karriere schon aufgehört hatte, und fand dann immer, daß diese Sänger oder Schauspieler genau an dem Punkt weitermachen wollten, wo sie vor Jahren aufgehört hatten. Ging man darauf nicht ein, waren sie beleidigt und sagten ab. Auch bei Esther Ofarim war es deswegen ganz und gar nicht so, daß sie sagte: oh, wie schön, toll, aber bitte. Es war eher kompliziert, äußerst kompliziert. Außerdem hatte sie Angst, weil sie noch nie als Schauspielerin aufgetreten war. Auf jeden Fall mochten wir uns dann aber sehr, ich glaube, sie hatte Vertrauen, sonst hätte sie es wahrscheinlich nicht gemacht, denn sie ist sehr ängstlich.
Das Stück war auch für sie ein Politikum, sonst hätte sie es bestimmt nicht gemacht. Die Anwesenheit von Giora Feidman, den sie kannte, war für sie ein Plus, allerdings auch, wie sich im Laufe der Aufführung herausstellte, ein Problem. Es gab schnell eine Riesenkonkurrenz zwischen den beiden, wer nun der Mittelpunkt dieser Aufführung war – für mich war das überhaupt keine Frage, denn der eine war der Musiker, die andere war die weibliche Hauptfigur des Stücks.
Mein erster Plan war, diese Aufführung am Residenztheater in München zu machen, unter anderem, weil Michael Degen dort engagiert war. Frank Baumbauer, der Intendant, ließ das Stück von Burkhard Mauer, seinem Chefdramaturgen, lesen, der dabei entdeckte, daß das Stück nur aus Monologen bestünde und völlig langweilig wäre. Mauer hatte früher bei mir in Bremen schon als Dramaturg gearbeitet, aber er hatte augenscheinlich immer noch nichts gelernt. So war Baumbauer sehr off-geturnt, hat das Stück nicht in seinen Spielplan gekriegt, die Termine paßten nicht und so weiter. Ich sagte, es muß spätestens in sechs Monaten, im März 1984, herauskommen. Ghetto war für mich ein aktuelles Stück, obwohl es gar nicht so aktuell scheint. So rief ich Kurt Hübner an, der das Stück innerhalb von zwei Tagen las und zusagte. Wir übersiedelten alle nach Berlin: Es war schwer, Michael Degen aus seinem Vertrag in München herauszuboxen, aber wir schafften es. Die Suche nach dem männlichen Hauptdarsteller, dem Ghettokommandanten Kittel, war die längste, eine endlose Suche, denn ich wußte genau, was ich wollte: Ich suchte einen Schauspieler, der auch Saxophon spielen und steppen konnte … und dazu deutsch aussehen mußte, er mußte wie ein kleiner deutscher Nazi-Junge aussehen. Dann erzählte mir Kurt Hübner, der sein Leben lang eine Spürnase für außergewöhnlich begabte Schauspieler hatte, über Ulrich Tukur, einen jungen, blonden Schauspieler, der zu der Zeit in Heidelberg engagiert war. Tukur sprach vor, er sang vor, und innerhalb von fünf Minuten wußte ich, der ist es, es war wie ein Wunder. Es folgte eine endlose Geschichte, ihn aus dem Vertrag in Heidelberg herauszuholen, zumal wir bei Hübner ensuite spielten – die Leute mußten also ganz frei sein und für eine bestimmte Zeit jeden Abend spielen können. Aber es kam zustande. Ich hatte einen amerikanischen Choreographen engagiert, der mir im letzten Moment, 14 Tage, bevor wir anfingen, absagte. Daraufhin fragte ich Hans Kresnik, und das absolute Wunder war, daß wir am Ende zusammen ein ganz gutes Resultat erzielten. Ich sage nicht einmal »trotz« Kresnik, es hatte ja auch mit ihm zu tun, was wir erarbeiteten. Außerdem hatte ich wieder Tutte Lemkow wie schon einmal bei Kleiner Mann, was nun?





























