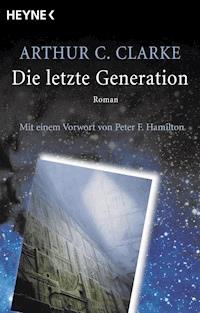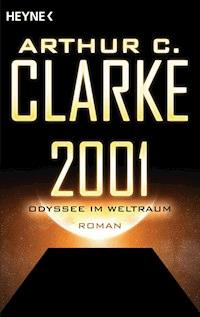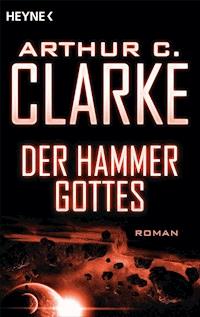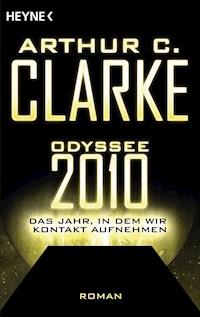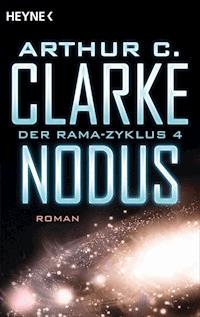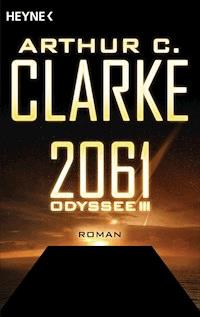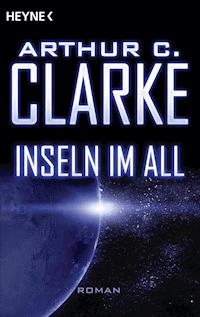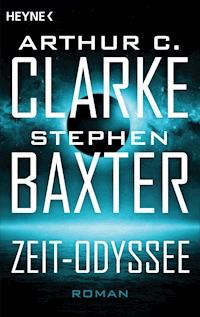
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Odyssee durch Raum und Zeit
Seit Jahrmillionen beobachtet eine uralte Zivilisation unseren Planeten. Niemand ahnt, dass sie da sind, bis die Fremden eines Tages aktiv werden. Von einem Augenblick zum nächsten gerät die Zeit aus den Fugen, als überall und in jeder Zeitperiode silberne Kugeln auftauchen, die auf Kommunikationsversuche nicht reagieren und sich auch nicht zerstören lassen. Sind sie für die Risse in der Zeit verantwortlich? Drei Astronauten aus dem Jahr 2037 in der asiatischen Steppe und eine Gruppe UN-Soldaten in Afghanistan fangen Funksignale auf, die nicht von Menschen stammen können. Unterstützt von den Armeen von Alexander dem Großen und Dschingis Khan machen sie sich auf die Suche nach dem Ursprung der Signale, stets beobachtet von den Fremden aus den Tiefen des Alls …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ARTHUR C. CLARKE
STEPHEN BAXTER
DIE
ZEIT-ODYSSEE
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Seit Jahrmillionen beobachtet eine uralte Zivilisation unseren Planeten. Niemand ahnt, dass sie da sind, bis die Fremden eines Tages aktiv werden. Von einem Augenblick zum nächsten gerät die Zeit aus den Fugen, als überall und in jeder Zeitperiode silberne Kugeln auftauchen, die auf Kommunikationsversuche nicht reagieren und sich auch nicht zerstören lassen. Sind sie für die Risse in der Zeit verantwortlich? Drei Astronauten aus dem Jahr 2037 in der asiatischen Steppe und eine Gruppe UN-Soldaten in Afghanistan fangen Funksignale auf, die nicht von Menschen stammen können. Unterstützt von den Armeen von Alexander dem Großen und Dschingis Khan machen sie sich auf die Suche nach dem Ursprung der Signale, stets beobachtet von den Fremden aus den Tiefen des Alls …
Die Autoren
Arthur C. Clarke war einer der bedeutendsten Autoren der internationalen Science Fiction. Geboren 1917 in Minehead, Somerset, studierte er nach dem Zweiten Weltkrieg Physik und Mathematik am King's College in London. Zugleich legte er mit seinen Kurzgeschichten und Romanen den Grundstein für eine beispiellose Schriftsteller-Laufbahn. Neben zahllosen Sachbüchern zählen zu seinen größten Werken die Romane »Die letzte Generation« und »2001 – Odyssee im Weltraum«, nach dem Stanley Kubrick seinen legendären Film drehte. Clarke starb im März 2008 in seiner Wahlheimat Sri Lanka.
Stephen Baxter, 1957 in Liverpool geboren, studierte Mathematik und Astronomie, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er zählt zu den international bedeutendsten Autoren wissenschaftlich orientierter Literatur. Etliche seiner Romane wurden mehrfach preisgekrönt und zu internationalen Bestsellern. Stephen Baxter lebt und arbeitet im englischen Buckinghamshire.
www.diezukunft.de
INHALT
Hinweis der Autoren
ERSTER TEIL – DISKONTINUITÄT
{ 1 } Die Sucherin
{ 2 } Der kleine Vogel
{ 3 } Das Auge des Bösen
{ 4 } Der Raketenwerfer
{ 5 } Die Sojus
{ 6 } Die Begegnung
{ 7 } Hauptmann Grove
{ 8 } Im Orbit
{ 9 } Paradox
ZWEITER TEIL – GESTRANDET IN DER ZEIT
{ 10 } Geometrie
{ 11 } Gestrandet im Raum
{ 12 } Eis
{ 13 } Lichter am Himmel
{ 14 } Die letzte Umkreisung
{ 15 } Die neue Welt
{ 16 } Der Wiedereintritt
{ 17 } Ein heftiger Regen
DRITTER TEIL – BEGEGNUNGEN UND BÜNDNISSE
{ 18 } Sendboten des Himmels
{ 19 } Das Delta
{ 20 } Die Stadt der Zelte
{ 21 } Rückkehr nach Jamrud
{ 22 } Die Landkarte
{ 23 } Die Konferenz
{ 24 } Die Jagd
VIERTER TEIL – DER ZUSAMMENFLUSS DER GESCHICHTE
{ 25 } Die Flotte
{ 26 } Der Tempel
{ 27 } Die Fischfresser
{ 28 } Bischkek
{ 29 } Babylon
{ 30 } Das Tor der Götter
{ 31 } Das Amateurfunkgerät
{ 32 } Kriegsrat
{ 33 } Ein Himmelsprinz
{ 34 } Was wohnt in Zeit und Raum
{ 35 } Zusammenfluss
{ 36 } Die Nachwirkungen
FÜNFTER TEIL – MIR
{ 37 } Das Laboratorium
{ 38 } Das Auge des Marduk
{ 39 } Vorstöße
{ 40 } Der Bootsteich
{ 41 } Zeus-Ammon
{ 42 } Die letzte Nacht
{ 43 } Das Auge des Marduk
SECHSTER TEIL – DAS AUGE DER ZEIT
{ 44 } Die Erstgeborenen
{ 45 } Durch das Auge
{ 46 } Das Klammerchen
{ 47 } Die Rückkehr
HINWEISDER AUTOREN
Dieses Buch, wie auch die Serie, deren Beginn es markiert, soll weder als Vorläufer noch als Nachfolger der Bücher der früheren »Odyssee« betrachtet werden. Es steht vielmehr sozusagen »im rechten Winkel« zu ihnen – indem es ähnliche Vorgaben in einer anderen Richtung weiterführt.
Städte und Throne und Mächte
sind in den Augen der Zeit
vergänglich wie eine Blume,
die nur einen Tag lang gedeiht.
Doch wie frische Knospen treiben
zu erfreuen des Menschen Aug',
erwachsen neue Städte
aus der Erde wertlosem Staub.
Rudyard Kipling
ERSTER TEIL
DISKONTINUITÄT
{ 1 } Die Sucherin
Dreißig Millionen Jahre lang war der Planet abgekühlt und ausgetrocknet, bis im Norden Eisschollen an die Kontinente zu drängen begannen. Der Waldgürtel, der sich einst fast ohne Unterbrechung von der Atlantikküste quer über Afrika und Eurasien bis in den Fernen Osten erstreckt hatte, war bereits zu einem immer weiter schrumpfenden Stückwerk zerfallen. Die Lebewesen, die früher dieses zeitenlose Grün bewohnt hatten, waren gezwungen, sich anzupassen oder wegzuziehen.
Die Artgenossen der Sucherin hatten beides getan.
Ihr Kleines an der Brust festgeklammert, kauerte die Sucherin im Schatten am äußersten Rand des Waldstücks. Die tief liegenden Augen spähten unter dem Knochenwulst hervor in die Helligkeit hinaus. Das Land außerhalb des Waldes war eine weite Ebene, gebadet in Licht und Hitze. Es war ein Ort erschreckender Schlichtheit, wo der Tod rasch und unvermittelt kam. Aber es war auch ein Ort, der Möglichkeiten bot. Eines Tages würde dieser Ort das Grenzland zwischen Pakistan und Afghanistan sein, von manchen »Nordwestgrenze« genannt.
Heute jedoch lag nicht weit vom ausgefransten Rand des Waldes entfernt ein Antilopenkadaver auf dem Boden. Das Tier war noch nicht lange tot – aus den Wunden drang immer noch dickliches Blut –, aber die Löwen hatten sich bereits satt gefressen, und die anderen Aasfresser der Grasebene – Hyänen und Vögel – hatten den Kadaver noch nicht entdeckt.
Die Sucherin streckte die Beine, stand aufrecht da und blickte sich um.
Die Sucherin war ein Primatenweibchen. Ihr von dichtem, schwarzem Haarwuchs bedeckter Körper maß kaum mehr als einen Meter, und sie hatte nur wenig Fett unter der schlaffen Haut. Ihr Gesicht war zu einer Schnauze vorgezogen, und die Gliedmaßen waren Relikte eines Lebens als Baumbewohner: Sie hatte lange Arme und kurze Beine. Eigentlich sah sie aus wie ein Schimpanse, doch die Abspaltung ihrer Art von diesen Vettern aus dem tieferen Urwald lag bereits mehr als drei Millionen Jahre zurück. Die Sucherin fühlte sich durchaus wohl, so aufrecht stehend; sie war ein echter Zweibeiner, und ihre Hüften und ihr Becken waren menschenähnlicher als die jedes Schimpansen.
Die Sucherin und ihre Artgenossen waren in erster Linie Aasfresser – und nicht besonders erfolgreiche. Aber sie verfügten über einen Vorteil, den kein anderes Tier auf der Welt vorweisen konnte. Geborgen im Kokon des keinerlei Wandel unterworfenen Urwaldes würde kein Schimpanse je so komplexes Werkzeug wie die einfache, jedoch mühsam hergestellte Axt erschaffen, die die Sucherin in ihren Fingern hielt. Und da war noch etwas: das Blitzen in ihren Augen, mit dem kein Menschenaffe konkurrieren konnte.
Es gab kein Anzeichen einer unmittelbaren Gefahr, und sie trat kühn hinaus in den Sonnenschein; das Kind klammerte sich an ihre Brust. Zögernd, einer nach dem anderen folgte ihr der Rest der Gruppe – entweder aufrecht auf zwei Beinen oder nach Affenart unter Zuhilfenahme der Fingerknöchel. Das Kleine quiekte und krallte sich schmerzhaft in das Fell der Mutter. Die Artgenossen der Sucherin kannten keine Namen – die Sprache dieser Lebewesen war kaum anspruchsvoller als der Gesang der Vögel –, aber seit dem Moment seiner Geburt hatte dieses Baby, das zweite der Sucherin, eine enorme Kraft an den Tag gelegt, wenn es galt, sich an der Mutter festzuhalten, und wenn die Sucherin ihre Tochter ansah, dachte sie dabei an etwas wie »Klammerchen«.
Behindert durch das Kind war die Sucherin eine der Letzten, die bei der Antilope anlangten, und die anderen hackten bereits mit ihren Steinsplittern an den Sehnen und der Haut herum, die die Beine des Tieres mit dem übrigen Körper verbanden. Diese Metzelei gab ihnen die Möglichkeit, sich möglichst schnell des Fleisches zu bemächtigen: Die Gliedmaßen konnten rasch in die relative Sicherheit des Waldes zurückgeschleppt und dort in aller Ruhe verspeist werden. Lustvoll beteiligte sich die Sucherin an der Arbeit, obwohl ihr das grelle Sonnenlicht unangenehm war. Eine weitere Million Jahre würde vergehen, ehe entfernte, erheblich menschlicher wirkende Nachkommen der Sucherin sich dauernd den direkten Strahlen der Sonne aussetzen konnten – in Körpern mit der Fähigkeit, zu schwitzen und Feuchtigkeit in Fettreserven zu speichern, in Körpern wie Raumanzügen für ein Überleben in der Savanne.
Das weltweite Schrumpfen der Wälder hatte für die Affen, die sie einst bewohnten, eine Katastrophe bedeutet, obwohl der evolutionäre Zenit dieser großen Tierfamilie schon weit in der Vergangenheit lag. Einige ihrer Mitglieder hatten sich dennoch angepasst. Die Sucherin und ihre Artgenossen benötigten zwar immer noch den schattenspendenden Wald, wo sie jeden Abend in die Wipfel der Bäume kletterten, doch tagsüber flitzten sie des Öfteren hinaus ins offene Grasland, wenn sich dort günstige Gelegenheiten boten, an Futter zu kommen. Es war eine riskante Art, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, aber es war besser als zu verhungern. Je weiter das Zerfallen des Waldes zu Bruchstücken fortschritt, desto mehr Waldrand stand zur Verfügung, und der Lebensraum für diese Grenzlandbewohner vergrößerte sich damit sogar. Und während sie gefährlich zwischen zwei Welten hin und her huschten, nahmen diese ohnmächtigen Affen, geformt von den blinden Skalpellen namens Variation und Selektion, immer neue Gestalt an.
Plötzlich ertönte mehrstimmiges Gekläff, und auf dem trockenen Boden war das Tappen flinker Pfoten zu vernehmen. Hyänen hatten verspätet den Geruch des Antilopenblutes wahrgenommen und näherten sich in einer großen Staubwolke.
Die aufrecht stehenden Affen hatten erst drei Antilopenbeine abgehackt, aber ihre Zeit war um. Das Kleine an die Brust gepresst rannte die Sucherin hinter ihrer Sippe her in das kühle uralte Dunkel des Waldes.
In dieser Nacht, als die Sucherin in ihrem Baumnest aus ineinander verflochtenen Zweigen lag, wurde sie durch etwas geweckt. Eingerollt neben der Mutter schnarchte das Klammerchen leise.
Es lag in der Luft, dieses Etwas, wie ein schwacher Duft, der sich in ihre Nasenlöcher zog und nach Veränderung roch.
Die Sucherin war ein Tier, das in seiner totalen Abhängigkeit von der Umwelt, in die eingebettet es lebte, auch leiseste Veränderungen wahrnahm. Aber es war mehr in ihr als nur diese animalische Sensibilität: Wenn sie mit Augen, die immer noch an die geringen Sichtweiten im Innern des Waldes gewöhnt waren, zu den Sternen aufblickte, dann verspürte sie eine rudimentäre Neugier.
Und hätte sie einen Namen benötigt, hätte er wohl »die Sucherin« gelautet.
Es war dieser Funke Neugier, diese Art Vorfahre einer verschwommenen Wanderlust, der ihre Artgenossen so weit aus Afrika hinausgeführt hatte. Als die Eiszeit kräftig zubiss, schrumpften die verbliebenen Waldstücke noch weiter oder verschwanden vollends. Um zu überleben, mussten die Waldrand-Affen auf schnellstem Weg die offene Ebene mit all ihren Gefahren durchqueren, um zur nächsten Baumgruppe zu gelangen und damit jene Illusion von Sicherheit zu erhalten, die ein neues Zuhause vorgaukelte. Doch selbst jene, die überlebten, machten selten mehr als eine solche Reise im Leben – eine einzige Odyssee von mehr oder weniger einem Kilometer Länge. Aber etliche überlebten und gediehen, und einige ihrer Kinder zogen weiter.
Auf diese Weise hatten sich, während tausend Generationen vorübertickten, die Waldrand-Affen langsam aus Afrika verbreitet und waren bis nach Zentralasien vorgedrungen oder hatten jene Landbrücke gequert, die bei Gibraltar Afrika und Europa verband. Es war ein Vorspiel der bewussteren Wanderungen in der Zukunft. Doch diese Affen waren stets spärlich an Zahl und hinterließen nur wenige Spuren. Kein Humanpaläontologe würde je vermuten, dass sie bis zu diesem Ort in Nordwestindien – und noch weiter – vorgedrungen waren, nachdem sie Afrika verlassen hatten.
Und nun, als die Sucherin zum Himmel hochsah, glitt ein einzelner Stern quer über ihr Gesichtsfeld – langsam, ruhig, so zielstrebig wie eine Katze. Der Stern war hell genug, um einen Schatten zu werfen, bemerkte die Sucherin. In ihrem Innern tobte ein Kampf zwischen Staunen und Furcht. Sie hob die Hand, aber der vorbeigleitende Stern war außer Reichweite.
So spät nachts lag Indien tief im Schattenbereich der Erde, doch dort, wo die Oberfläche des sich drehenden Planeten von der Sonne beschienen wurde, entstand ein Schimmern – kleine, sich kräuselnde Farbenwellen in Braun, Blau und Grün –, das an manchen Stellen aufflackerte wie winzige Türen, die sich plötzlich öffneten. Unterschwellige Veränderung umflutete den Planeten wie eine Woge des Unheils.
Rund um die Sucherin erschauerte die Welt; sie drückte ihr Kind fest an sich.
Am Morgen war die Sippe aufgeregt. Heute fühlte sich die Luft kühler an, irgendwie herber und geladen mit etwas, das ein moderner Mensch »Elektrizität« genannt hätte. Das Licht war merkwürdig hell und verwaschen, und selbst hier, mitten in den Tiefen des Waldes, regte sich eine Brise, die in den Blättern der Bäume raschelte. Irgendetwas war nicht so wie sonst, etwas hatte sich verändert, und die Tiere waren beunruhigt.
Beherzt ging die Sucherin in die Richtung, aus der die Brise kam. Schnatternd lief das Klammerchen unter Zuhilfenahme der Fingerknöchel hinter ihr her.
Als die Sucherin den äußersten Rand des Waldes erreichte, regte sich draußen, auf der morgenhellen Ebene, kein Halm. Die Sucherin blickte nach allen Seiten, während sich ein Fünkchen Verwirrung in ihrem Kopf festsetzte. Ihr dem Leben im Wald angepasster Geist tat sich schwer mit der Analyse von weiten Landschaften, aber es schien ihr, als wäre das Land heute anders. Gewiss war gestern mehr Grün da gewesen! Gewiss hatten im Windschatten dieser flachen Hügel dort drüben ein paar Waldreste gestanden! Und gewiss war gestern noch in diesem staubtrockenen Graben Wasser geflossen! Aber so ganz sicher konnte sie sich dessen doch nicht sein. Die Erinnerungen daran, die schon für gewöhnlich ziemlich bruchstückhaft waren, verblassten bereits.
In einiger Entfernung hing etwas in der Luft.
Es war kein Vogel, denn es machte keine Bewegung und flog auch nicht davon, und es war keine Wolke, denn es sah hart aus und fest umrissen und rund. Und es leuchtete, fast so hell wie die Sonne.
Magisch davon angezogen verließ die Sucherin den Dämmerschatten des Waldes und trat hinaus ins Freie.
Sie ging auf das Ding zu, umrundete es, betrachtete es aus allen Richtungen, blieb darunter stehen und inspizierte es. Es war etwa so groß wie ihr Kopf, und Licht floss daraus hervor – oder, besser, das Licht der Sonne brach sich darin wie in den Wellen eines Flusses. Es roch nach nichts. Es war wie eine Frucht, die an einem Ast hing – aber da stand kein Baum. Vier Milliarden Jahre Anpassung an das gleichbleibende Schwerefeld der Erde hatte die Sucherin mit einem Instinkt ausgestattet, der ihr sagte, dass nichts, was so klein und hart war, ohne Hilfe in der Luft schweben konnte: Dies war etwas Neues und daher Furchterregendes. Aber wenigstens fiel es nicht auf sie herab und machte auch sonst keine Anstalten, sie auf irgendeine Weise anzugreifen.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, reckte den Hals und starrte auf die Kugel; zwei Augen starrten zurück. Knurrend ließ sich die Sucherin zu Boden fallen. Die Kugel reagierte nicht, und als die Sucherin hochblickte, begriff sie es: Die Kugel warf ihr eigenes Spiegelbild zurück, nur verzerrt und verbogen; die Augen waren ihre eigenen gewesen, so wie sie sie gelegentlich schon auf einer glatten Wasseroberfläche gesehen hatte. Von allen Lebewesen der Erde konnte nur ihre Spezies sich in einer solchen Reflexion wiedererkennen, denn nur sie und ihre Artgenossen verfügten über ein echtes Ich-Bewusstsein. Aber sie hatte den dumpfen Eindruck, als wäre die schwebende Kugel durch das Spiegelbild, das sie enthielt, selbst ein riesiges Auge, das auf sie herabsah, während sie es betrachtete.
Sie erhob sich wieder und streckte ihre langen, zum Klettern auf Bäumen gemachten Arme danach aus, aber selbst auf den Zehenspitzen stehend konnte sie die Kugel nicht erreichen. Hätte sie mehr Zeit gehabt, wäre sie wohl auf die Idee gekommen, etwas zu holen, auf dem man stehen und es erneut versuchen konnte, einen Stein etwa oder einen Haufen Zweige.
Aber das Klammerchen kreischte.
Die Sucherin ließ sich zurückfallen und rannte, noch ehe sie sich dessen gewahr wurde, auf allen vieren unter Zuhilfenahme der Fingerknöchel zu ihrem Kind. Als sie sah, was soeben mit ihrer Tochter geschah, erschrak sie zu Tode.
Zwei Lebewesen standen über das Klammerchen gebeugt. Sie sahen aus wie Affen – sehr große, sehr aufrechte Affen, aber ihre Gesichter waren flach und haarlos. Ihrer hellroten Farbe wegen wirkten die Körper der Wesen auf die Sucherin blutüberströmt. Und sie hatten das Klammerchen! Sie hatten etwas wie Lianen oder Ranken über das Kleine geworfen, das zappelte, gellend schrie und biss, aber die beiden großen Wesen hatten keine Mühe, die Lianen festzuhalten, in denen es verfangen war.
Kreischend und mit gebleckten Zähnen setzte die Sucherin zu einem gewaltigen Sprung an.
Eines der rotbrüstigen Wesen sah sie und riss erschrocken die Augen auf. Es brachte einen Knüppel zum Vorschein und wirbelte ihn durch die Luft. Etwas unvorstellbar Hartes knallte seitlich gegen ihren Kopf, doch die Sucherin war schwer und schnell genug, dass der Schwung ausreichte, um sie gegen das Wesen krachen zu lassen und es zu Boden zu reißen. Aber sie hatte Sterne vor den Augen, und ihr Mund füllte sich mit dem Geschmack von Blut.
Im Osten brach plötzlich eine Decke aus wabernden schwarzen Wolken hinter dem Horizont hervor; fernes Donnergrollen war zu hören, und Blitze zuckten auf.
{ 2 } Der kleine Vogel
Im Augenblick der Diskontinuität befand sich Bisesa Dutt in der Luft.
Aus ihrer Position im Cockpit hinter den Piloten des Hubschraubers hatte sie nur eingeschränkte Sicht – was insofern kurios war, als der Einsatz nur einem einzigen Ziel diente, nämlich Bisesa eine Beobachtung des Bodens zu ermöglichen.
Doch als sich »Little Bird« – der kleine Vogel – höher schraubte und das Sichtfeld sich erweiterte, konnte sie den Stützpunkt mit seinen ordentlichen Reihen vorgefertigter Hangars sehen, alle mit der dem Militärwesen innewohnenden Pseudo-Ordnungsliebe exakt in geraden Linien aufgefädelt. Der UN-Stützpunkt existierte bereits seit drei Jahrzehnten, und diese »Provisorien« hatten mit der Zeit eine gewisse schäbige Vornehmheit erworben. Auch die Pisten, die in allen Richtungen vom Stützpunkt weg über die Ebene führten, waren mittlerweile feste Fahrbahnen.
Mit dem Höhersteigen des Vogels verschwamm der Stützpunkt zu einem Gemisch aus dem Weiß von Kalktünche und der Tarnfarbe der Zelte, das sich in der riesigen Handfläche des weiten Landes verlor. Es war eine trostlose Gegend, in der nur hie und da ein graugrüner Fleck davon zeugte, dass ein spärlicher Baumbestand oder ein paar Büschel kümmerliches Gras ums Überleben kämpften. Doch in der Ferne schob sich eine Bergkette mit weißen Gipfeln majestätisch über den Horizont.
»Little Bird« ruckte seitwärts, und Bisesa wurde gegen die gewölbte Seitenwand geschleudert.
Casey Othic, der Erste Pilot, widmete sich seinen Knüppeln, und kurz darauf verlief der Flug wieder in ruhigeren Bahnen, wobei der Vogel jetzt etwas niedriger über dem steinigen Boden dahinzog. Casey drehte sich um und grinste Bisesa an. »Tut mir Leid, aber solche Böen hatten die Wetterfrösche nicht im Programm. Kriegen auch nie was auf die Reihe, diese Holzköpfe. Ist alles in Ordnung da hinten?«
Seine Stimme dröhnte überlaut aus ihren Kopfhörern. »Ich fühl mich wie auf der Hutablage in einer Corvette.«
Sein Grinsen wurde noch breiter und entblößte eine Reihe perfekter Zähne. »Kein Grund, so zu brüllen! Ich hör dich über Funk.« Er klopfte gegen seinen Helm. »Funk! Habt ihr sowas noch nicht in der britischen Armee?«
Auf dem Sitz neben Casey bedachte Abdikadir Omar, der Copilot, den Amerikaner mit einem raschen Seitenblick und schüttelte missbilligend den Kopf.
»Little Bird« war ein Aufklärungshubschrauber mit voll verglaster Kanzel, dessen Vergangenheit als Kampfhubschrauber, der seit dem Ende des zwanzigsten Jahrhunderts im Einsatz gewesen war, noch nicht lange zurücklag. In diesem ruhigeren Jahr 2037 widmete sich der Vogel jedoch friedlicheren Aufgaben: Such- und Rettungsaktionen und Überwachung. Das Cockpit war vergrößert worden, sodass nun drei Personen darin Platz fanden – die beiden Piloten vorn und Bisesa, eingezwängt auf ihrem Sitz hinten.
Casey Othic flog den Veteran lässig mit einer Hand. Othics Rang war Hauptfeldwebel, abkommandiert von den US-Luft- und Weltraumstreitkräften zu dieser UN-Einheit. Er war ein vierschrötiger, muskulöser Mann. Er trug zwar den himmelblauen Helm der UNO-Truppen, hatte ihn jedoch mit einem aufgeklebten, ganz und gar nicht den Vorschriften entsprechenden Sternenbanner geschmückt, das sich in einer nicht vorhandenen Brise wellte. Das dicke Visier mit dem HMD, dem Gerät, das die Flugdaten ins Visier projizierte, bedeckte sein Gesicht bis zur Nasenspitze und wirkte beim Hinsehen völlig schwarz, sodass Bisesa nichts als seinen breiten wiederkäuenden Kiefer ausmachen konnte.
»Ich weiß genau, dass du mich angaffst, auch wenn du dieses blöde Visier runtergeklappt hast«, stellte Bisesa lakonisch fest.
Abdikadir, ein gut aussehender Paschtune, warf einen kurzen Blick nach hinten und grinste. »Wenn du lang genug mit einem Gorilla wie Casey zusammen bist, gewöhnst du dich daran.«
Casey sagte: »Ich bin der perfekte Gentleman.« Er beugte sich ein wenig zurück, um ihr Namensschild lesen zu können. »Bisesa Dutt. Was ist das, ein pakistanischer Name?«
»Indisch.«
»Ah, du bist also aus Indien. Aber dein Akzent klingt eher – na ja, nach Australien?«
Bisesa unterdrückte ein Seufzen; es gab keinen Amerikaner, der einen regionalen Akzent richtig zuordnen konnte. »Nach Manchester. Ich bin aus Manchester, in England. Britische Staatsbürgerschaft in dritter Generation.«
Casey begann zu reden wie Cary Grant: »Willkommen an Bord, Lady Dutt.«
Abdikadir stieß Casey mit dem Ellbogen an. »Mann, bist du ein Langweiler! Kein Klischee lässt du aus. Bisesa, ist das dein erster Einsatz?«
»Zweiter.«
»Ich bin schon ein Dutzend Mal mit diesem Arsch geflogen, und es ist immer dasselbe mit ihm, egal wer hinten sitzt. Lass dich nicht nerven von ihm.«
»Er nervt mich nicht«, sagte Bisesa gleichmütig, »es ist ihm nur fade.«
Casey lachte heiser auf. »Allerdings! Ist 'ne fade Sache hier auf dem Stützpunkt Clavius. Aber du müsstest dich doch hier draußen an der Nordwestgrenze wie zu Hause fühlen, Lady Dutt. Vielleicht finden wir ein paar Wuschelköpfe da unten, dann kannst du sie mit deiner Elefantenbüchse erledigen!«
Abdikadir grinste zu Bisesa nach hinten. »Was willst du schon von einem ungehobelten Christenklotz erwarten?«
»Und du bist ein hakennäsiger Mudschaheddin!«, knurrte Casey zurück.
Abdikadir schien Beunruhigung aus Bisesas Miene herauszulesen. »Keine Angst, ich bin wirklich ein Mudschahed – oder besser, ich war einer. Und er ist wirklich ein Christ. Aber wir sind die besten Freunde, ehrlich. Wir haben beide nichts gegen Andersgläubige, wir sind Oikumene. Aber sag es niemandem …«
Unversehens kamen sie in Turbulenzen. Es fühlte sich an wie ein Luftloch, in das der Helikopter plötzlich ein paar Meter tief gestürzt war. Die Piloten wandten ihre ganze Aufmerksamkeit den Instrumenten zu und verstummten.
Abdikadir, der Paschtune, war afghanischer Staatsbürger und in der Gegend geboren und aufgewachsen. Er hatte den gleichen militärischen Rang inne wie Casey Othic. In der kurzen Zeit, die Bisesa bislang auf dem Stützpunkt stationiert gewesen war, hatte sie ihn bereits ein wenig kennen gelernt. Er hatte starke, offene Gesichtszüge, eine kühne Nase, die man als »römisch« bezeichnen konnte, und einen schmalen Bartrest rund ums Kinn. Seine Augen waren verblüffend blau, und das Haar hatte einen rotblonden Stich. Er behauptete, bei diesen Farben handle es sich um eine Hinterlassenschaft der Armee Alexanders des Großen, die einst hier in der Gegend durchmarschiert war. Er war ein sanftmütiger Mensch, freundlich und zivilisiert, der seinen Platz in der inoffiziellen Hackordnung hier bereitwillig akzeptierte: Obwohl er als einer der wenigen Paschtunen, die sich auf die Seite der UNO gestellt hatten, sehr geschätzt wurde, musste er sich als Afghane dem Willen der Amerikaner beugen, und so kam es, dass er viel mehr Flugstunden als Copilot denn als Pilot aufzuweisen hatte. Die anderen britischen Militärangehörigen nannten ihn »Ginger« – Ingwer.
Der wilde Ritt ging weiter; Bisesa fühlte sich gar nicht wohl. Der Vogel war nicht mehr der Jüngste; im Cockpit stank es nach Öl und Hydraulikflüssigkeit, jede Metallfläche war abgenutzt und zerkratzt, und auf dem schmalen, völlig unzureichend gepolsterten Rücksitz entdeckte Bisesa tatsächlich Klebeband, das die Risse darin zusammenhielt. Dazu kam der ohrenbetäubende Rotorenlärm ein paar Meter von ihrem Kopf entfernt, gegen den auch der dicke Schallschutz im Helm nicht ankam. Eine alte Sache, dachte Bisesa, dass die Regierungen für den Krieg stets mehr Geld ausgeben als für den Frieden.
Als er den Hubschrauber hörte, wusste Moallim, was er zu tun hatte.
Die meisten Dorfbewohner rannten in alle Richtungen, um sich zu vergewissern, dass ihre geheimen Waffen- und Opiumvorräte gut versteckt waren. Aber Moallim hatte anderes vor. Er griff nach seiner Ausrüstung und rannte zu dem Schützenloch, das er schon vor Wochen gegraben und für einen Tag wie diesen vorbereitet hatte.
Innerhalb von Sekunden hockte er gegen die Wand des Lochs gepresst, das Abschussrohr des Raketenwerfers auf der Schulter. Es hatte Stunden gedauert, bis das Loch so tief ausgehoben war, dass der Höhenwinkel stimmte und der Feuerstrahl beim Abschuss ihn dennoch nicht treffen konnte. Unten im Loch, bedeckt von ein wenig dürrem Gras und losem Erdreich, das er über sich verteilt hatte, war er ziemlich gut getarnt. Die Waffe war von ehrwürdigem Alter, ein Relikt der russischen Invasion Afghanistans in den 80ern des vergangenen Jahrhunderts, aber wohlgepflegt und sauber gehalten war es immer noch eine tödliche Bedrohung. Wenn der Hubschrauber nahe genug an seine Stellung herankam, dachte Moallim, dann war ihm der Erfolg gewiss.
Moallim war fünfzehn Jahre alt.
Er war erst vier gewesen, als er die ersten westlichen Helikopter zu Gesicht bekommen hatte. Sie waren nachts gekommen, ein ganzes Rudel, und ganz dicht über seinen Kopf hinweggeflogen, schwarze Vögel gegen einen schwarzen Himmel, wie wütende Krähen. Der Lärm hämmerte in den Ohren, und der Wind, den sie verursachten, zerrte an den Kleidern und riss an den Haaren. Marktbuden wurden umgeweht, Kühe und Ziegen ängstigten sich zu Tode, und die Blechdächer hob es von den Häusern. Und Moallim hatte gehört – ohne es jedoch selbst gesehen zu haben –, dass einer Frau das Baby direkt aus den Armen gerissen und in die Luft gewirbelt wurde, von wo es nie zurückkehrte.
Und dann hatte die Schießerei begonnen.
Später waren wiederum Hubschrauber gekommen und hatten Flugblätter abgeworfen, die den »Zweck« des Luftangriffs erklärten: In der Gegend hatte sich der Waffenschmuggel verstärkt, es gab Hinweise darauf, dass Uranlieferungen über das Dorf abgewickelt wurden, und so fort. Der dadurch »notwendig gewordene« Luftschlag sei mit »äußerster Präzision« und »minimalem Waffeneinsatz« durchgeführt worden. Die Dorfbewohner hatten die Flugblätter zerrissen und zum Hinternabwischen verwendet. Alle hassten die Helikopter; sie waren unnahbar und arrogant. Doch damals, mit vier Jahren, hatte Moallim kein Wort, um zu beschreiben, was er fühlte.
Und sie kamen nach wie vor, die Hubschrauber. In letzter Zeit jene der UNO, angeblich hergebracht, um den Frieden zu sichern, aber alle wussten, dass es nicht ihr Frieden war und dass diese »Inspektionsflüge« schwer bewaffnet stattfanden.
Für diese Probleme gab es eine einzige Lösung, hatte man Moallim erklärt. Die Dorfältesten hatten Moallim den Umgang mit dem Raketenwerfer beigebracht. Es war immer schwer, ein bewegtes Ziel zu treffen, also hatte man den Aufschlagzünder durch einen Zeitzünder ersetzt, der irgendwo in der Luft explodieren würde: So lange man auch nur halbwegs in die Nähe des Zieles feuerte, reichte das; man benötigte keinen direkten Treffer, um ein Flugzeug abzuschießen – und einen Hubschrauber erst recht, und ganz besonders dann, wenn man auf den Heckrotor zielte, wo er am verwundbarsten war.
Doch Raketenwerfer waren groß und unhandlich und auffällig. Sie waren umständlich zu handhaben, und ihr Gewicht erschwerte das Zielen – und wenn man sich mit einem von ihnen auf dem Dach oder im Freien zeigte, war man erledigt. Also verkroch man sich und wartete ab, bis der Hubschrauber an einen herankam. Und wenn er in seine, Moallims, Richtung flog, würde die Besatzung – die darauf trainiert war, wegen des Risikos Gebäuden aus dem Weg zu gehen – nichts als ein Stück Rohr sehen, das in der Erde steckte. Vermutlich würde sie annehmen, es handle sich um ein kaputtes Wasserrohr von einem der vielen fehlgeschlagenen »humanitären« Projekte, die der Gegend über die Jahrzehnte hinweg aufgedrängt worden waren. Wenn sie über offenes Terrain flogen, würden sie sich in Sicherheit wiegen. Moallim lächelte.
Der Himmel vor ihnen kam Bisesa sonderbar vor. Dicke, schwarze Wolken stiegen aus dem Nichts auf und verdichteten sich zu einem dunklen Band am Horizont, wo es die Berge verdeckte. Und der Himmel selbst sah irgendwie farblos aus.
Verstohlen holte sie ihr Telefon aus einer Tasche ihrer Fliegerjacke. Sie legte es auf die Handfläche und flüsterte ihm zu: »Ich erinnere mich nicht, dass der Wetterdienst Sturmfronten vorausgesagt hat.«
»Ich auch nicht«, sagte das Telefon. Es war auf das zivile Rundfunknetz eingestellt, und nun begann der kleine Bildschirm fieberhaft, auf der Suche nach aktualisierten Wetterdaten hunderte von Kanälen abzuklappern, die unsichtbar über dieses Stückchen Erde hinwegstrichen.
Das Datum war der 8. Juni 2037. Glaubte Bisesa wenigstens.
{ 3 } Das Auge des Bösen
Den ersten Hinweis auf die seltsamen Ereignisse, die sich auf der Welt abzeichneten, erhielt Josh White in Form eines unsanften Erwachens: eine rüde Hand, die an seiner Schulter rüttelte, ein gottloser Radau, ein breites Gesicht, das auf ihn herabblickte.
»Also wirklich, Josh – nun wach schon auf, Mann! Das glaubst du nicht … Kuriose Sache … Wenn das nicht die Russen sind, fresse ich deine Wickelgamaschen!«
Es war Ruddy, natürlich. Das Hemd des jungen Journalisten stand offen, und er hatte kein Jackett an. Eigentlich sah er ganz so aus, als wäre er eben selbst erst dem Bett entstiegen. Aber sein Gesicht, das von dieser hohen, breiten Stirn beherrscht wurde, war schweißbedeckt, und hinter den Brillengläsern, die dick waren wie Flaschenböden, funkelten und tanzten seine Augen.
Blinzelnd setzte Josh sich auf. Durch das offene Fenster fiel Sonnenschein ins Zimmer. Es war später Nachmittag: Sein Schläfchen hatte eine Stunde gedauert. »Zum Henker, was auf dieser Erde kann so wichtig sein, dass es mich um mein Nickerchen bringt? Ganz besonders nach letzter Nacht … Gestatte, dass ich mir erst einmal das Gesicht wasche …«
Ruddy trat zur Seite. »Also gut. Zehn Minuten, Josh! Du verzeihst es dir nie, wenn du das versäumst! Zehn Minuten!« Und er stürzte aus dem Zimmer.
Josh fügte sich dem Unvermeidbaren, stand auf und tastete sich schlaftrunken durch den Raum.
Wie Ruddy war auch Josh Journalist, ein Sonderkorrespondent des Boston Globe, mit dem Auftrag, bunte Reportagen von der »Nordwestgrenze«, diesem fernen Winkel des Britischen Reiches, zu liefern – fern zwar, jedoch möglicherweise entscheidend für Europas Zukunft und somit selbst in Massachusetts von Interesse. Das Zimmer war kaum mehr als ein enges kleines Kämmerchen in einer Ecke des Forts, und er musste es sich mit Ruddy teilen, dem der Dank dafür zustand, dass es vollgestopft war mit Kleidern, halb ausgepackten Koffern, Büchern, Papierkram und einem kleinen Klappschreibtisch, auf dem Ruddy seine Berichte für den Civil and Military Gazette and Pioneer, seine Zeitung in Lahore, verfasste. Was das Zimmer betraf, war Josh jedoch froh, dass sie überhaupt eines hatten. Die meisten Truppen hier in Jamrud, sowohl Inder als auch Europäer, verbrachten ihre Nächte in Zelten.
Im Unterschied zu den Soldaten hatte Josh ein Recht auf seinen Nachmittagsschlaf, wenn er ihn brauchte. Doch nun konnte er hören, dass in der Tat etwas Ungewöhnliches im Gange sein musste: laute Stimmen, rennende Füße. Gewiss keine Militäraktion, auch kein neuerlicher Überfall der rebellischen Paschtunen, sonst hätte er längst schon Gewehrfeuer zu hören bekommen. Was dann?
Josh fand warmes, sauberes Wasser in der Schüssel vor, und sein Rasierzeug lag daneben bereit. Er wusch sich Gesicht und Hals und stierte sein triefäugiges Spiegelbild an, das ihm aus der halbblinden Scherbe an der Wand entgegenstarrte. Er hatte zart geschnittene Gesichtszüge mit, wie er meinte, einer Stupsnase, und die Tränensäcke heute Nachmittag waren seinem Aussehen keineswegs zuträglich. Im Grunde genommen hatte ihm der Schädel heute Morgen gar nicht so sehr gebrummt, denn er hatte mittlerweile seine Lektion gelernt und hielt sich ausschließlich an Bier, um die langen Abende im Offizierskasino zu überleben. Ruddy hingegen hatte seiner gelegentlichen Lust auf Opium nachgegeben – doch die Stunden, die er damit verbrachte, an der Pfeife zu saugen, schienen keine Folgeschäden an seiner neunzehn Jahre alten Konstitution zu hinterlassen. Josh, der sich mit seinen dreiundzwanzig wie ein Kriegsveteran fühlte, beneidete ihn darum.
Noor Ali, Ruddys Boy, hatte lautlos Wasser und Rasierzeug vorbereitet. Das war ein Grad von Bedienung, den der Bostoner Josh beinahe als peinlich empfand: Wenn Ruddy die schlimmsten Nachwehen seines Vergnügens ausschlief, erwartete er, von Noor Ali im Bett rasiert zu werden – sogar im Schlaf! Und es fiel Josh auch schwer, sich mit den Hieben abzufinden, deren Verabreichung an Noor Ali Ruddy von Zeit zu Zeit für nötig hielt. Aber Ruddy war ein »Anglo-Inder«, geboren in Bombay, und dies hier war Ruddys Land, mahnte sich Josh und erinnerte sich daran, dass er hier war, um zu berichten, und nicht, um Urteile zu fällen. Abgesehen davon war es nicht unangenehm, warmes Wasser und ein, zwei Tassen heißen Tee vorzufinden, wenn man aufwachte.
Er trocknete sich ab und zog sich rasch an, ehe er einen letzten Blick in den Spiegel warf und sich mit den Fingern durch sein widerspenstiges schwarzes Haar fuhr. Im letzten Moment kam ihm in den Sinn, seinen Revolver in den Gürtel zu schieben, dann wandte er sich zur Tür.
Es war der Nachmittag des 24. März 1885. Zumindest dachte Josh das immer noch.
Im Innern des Forts herrschte große Aufregung. Von allen Seiten liefen Soldaten über den bereits im Schatten liegenden viereckigen Platz zum Tor. Josh schloss sich dem fröhlichen Zug an.
Viele der Briten, die hier in Jamrud stationiert waren, gehörten dem 72. Highlander-Regiment an, und obwohl manche von ihnen lose, knielange Hosen wie die Eingeborenen trugen, waren andere in Khakijacken und enge Hosen aus rotkariertem Stoff gekleidet. Aber weiße Gesichter sah man weniger, denn Gurkhas und Sikhs waren zahlenmäßig den Briten drei zu eins überlegen. Wie auch immer, an diesem Nachmittag drängelten Europäer wie Sepoys ungeduldig aus dem Tor des Forts. Diese Männer, die endlose Monate lang fern von ihren Familien an diesem trostlosen Ort stationiert waren, hätten alles dafür gegeben, wenn endlich einmal irgendetwas »los« gewesen wäre, ein klein wenig Abwechslung von dem ewig gleichen Trott. Doch auf dem Weg über den Platz bemerkte Josh Hauptmann Grove, den Kommandeur des Forts, der mit sehr besorgtem Gesicht auf das Tor zusteuerte.
Die Strahlen der tief stehenden Sonne empfingen Josh, sobald er sich nach draußen gekämpft hatte, und blendeten ihn ein wenig. Eine trockene Kälte lag in der Luft, und er stellte überrascht fest, dass er zu bibbern begann. Der Himmel war blaugrün und wolkenlos, aber am westlichen Horizont bemerkte Josh einen dunklen Streifen, der aussah wie eine aufziehende Gewitterfront. Solch turbulentes Wetter war ungewöhnlich für diese Jahreszeit.
Die »Nordwestgrenze«: jener Ort, wo Indien auf Asien traf. Für die Briten stellte dieser gewaltige, von Nordost nach Südwest verlaufende Korridor zwischen den Bergketten im Norden und dem Indus im Süden die natürliche Grenzlinie ihres indischen Dominions dar. Aber es war eine verwundbare, blutgetränkte Barriere, von deren Stabilität die Sicherheit der kostbarsten Provinz des britischen Weltreiches abhing. Und das Fort von Jamrud klebte mitten drin.
Das Fort selbst war eine weitläufige Anlage mit dicken Steinmauern und mächtigen Wachtürmen an den Ecken. Außerhalb der Mauern standen kegelförmige Zelte in militärisch exakten Reihen. Jamrud war ursprünglich von den Sikhs erbaut worden, die lange hier geherrscht und ihre eigenen Kriege gegen die Afghanen geführt hatten; doch nun war es durch und durch britisch.
Dennoch war es nicht das Schicksal des Reiches, um das sich heute die Gedanken der Männer drehten. Die Soldaten strömten über den zertrampelten Flecken Erde, der dem Fort als Exerzierplatz diente, zu einer Stelle etwa hundert Yards vom Tor entfernt. Dort konnte Josh eine Kugel erkennen, die aussah wie jene über den Ladentüren der Pfandleiher und die frei schwebend in der Luft hing. Sie war silberfarben und glänzte hell im Sonnenlicht. Etwa fünfzig Kavalleristen, Offiziersburschen und Zivilisten hatten sich bereits unter dieser mysteriösen Kugel versammelt – ein lärmender Haufen in unterschiedlichster zwangloser Gewandung.
Und selbstverständlich befand sich Ruddy mitten drin. Sogar jetzt hatte er die Situation völlig unter Kontrolle, schritt unter der schwebenden Kugel auf und ab und kratzte sich am Kinn, während er durch seine Flaschenbodenbrille gedankenschwer wie Newton hinaufstarrte. Ruddy war ein kleiner Mann, nicht viel größer als einssechzig, und untersetzt, ja fast ein wenig dicklich. Er hatte ein breites Gesicht, ein keckes Schnurrbärtchen und eine breite, durch den jetzt schon zurückweichenden Haaransatz noch höher wirkende Stirn über den widerborstigen Augenbrauen. Widerborstig – ja, dachte Josh mit beinahe liebevoller Zuneigung, widerborstig, das war das Wort für Ruddy. Mit seiner steifen, wenngleich energischen Art, sich zu geben, wirkte er eher wie neununddreißig als wie neunzehn. Er hatte eine hässliche, nässende rote Schwellung auf der Wange, sein »Lahore-Übel«, von dem er annahm, es rühre von einem Ameisenbiss her, und das auf keine Behandlung ansprach.
Manchmal spotteten die Rekruten über Ruddys Aufgeblasenheit und Wichtigtuerei, aber es hatte ohnehin keiner der Männer viel Zeit für die Zivilisten. Dennoch mochten sie ihn recht gern; mit seinen Berichten für den CMG und mit den Geschichten aus den Mannschaftsunterkünften verlieh Ruddy diesen »Tommies«, die so fern der Heimat waren, eine Eloquenz, die sie selbst nicht besaßen.
Josh drängte sich durch die Menge vor zu Ruddy. »Was soll so kurios sein an unserem fliegenden Freund? Ein Zaubertrick?«
Ruddy grunzte missmutig. »Doch wohl eher ein Trick des Zaren! Allenfalls ein neuer Typus von Heliograph.«
Cecil de Morgan, der Händler, trat neben die beiden. »Wenn es Dschadu ist, dann würde ich gern das Geheimnis erfahren, das hinter der Magie steckt. He – du!« Er wandte sich an einen der Sepoys. »Deinen Kricketschläger – leih mir den doch mal …!« Er packte den Schläger und ließ ihn durch die Luft sausen – unter der Kugel und rundherum. »Sehen Sie? Da ist nichts, was sie in der Luft hält – kein unsichtbarer Draht oder Glasstab, wie gebogen auch immer.«
Die Sepoys waren sichtlich wenig amüsiert. »Asli nahin! Fareib!«
»Einige von ihnen sagen, das wäre ein Auge – das Auge des Bösen«, murmelte Ruddy. »Vielleicht brauchen wir ein nazzuu-watto, um seinen verderblichen Blick abzuwenden.«
Josh legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Mein Freund, ich glaube, du hast mehr von Indien in dir, als du zugeben willst. Es ist vermutlich nur ein Ballon, gefüllt mit heißer Luft. Nichts Aufregenderes als das.«
Aber Ruddy war von einem besorgt aussehenden jungen Offizier abgelenkt, der sich durch die Menge hindurchzwängte und offenbar nach jemand Bestimmtem suchte. Ruddy eilte auf ihn zu, um mit ihm zu sprechen.
»Ein Ballon, sagen Sie?«, wandte de Morgan sich an Josh. »Wie kommt es, dass er dann so still steht in dieser Brise? Außerdem – sehen Sie her!« Er schwang den Kricketschläger wie eine Axt hoch und ließ ihn gegen die schwebende Kugel donnern. Es verursachte zwar einen widerhallenden Knall, aber zu Joshs Verblüffung prallte der Schläger einfach ab, und die Kugel blieb so reglos in der Luft hängen, als wäre sie in Stein gehauen. De Morgan hielt den Schläger hoch, und Josh konnte sehen, dass er gespalten war. »Habe mir fast meine vermaledeiten Finger gebrochen! Und nun sagen Sie mir, Sir, haben Sie je so etwas zu Gesicht bekommen?«
»Eigentlich nicht«, räumte Josh ein. »Aber wenn es jemanden gibt, der das Ding einer profitablen Verwendung zuführen kann, dann sind es ganz gewiss Sie, Morgan!«
»De Morgan, Joshua.« De Morgan verdiente seinen üppigen Lebensunterhalt damit, Jamrud und die anderen Forts an der Grenze mit allem Möglichen und Unmöglichen zu beliefern. Er war rund dreißig – ein großer, etwas ölig wirkender Mensch; und selbst hier, meilenweit von der nächsten Stadt entfernt, trug er einen neuen Khakianzug in zartem Olivgrün, dazu ein himmelblaues Halstuch und einen Tropenhelm, der so weiß war wie Schnee. Er gehörte zu jenem Typ Mann, bemerkte Josh nach und nach, der magisch angezogen wurde von den Rändern der Zivilisation, wo fette Profite lockten und wo man es mit der Einhaltung der Gesetze nicht so genau nahm. Den Offizieren waren er und seinesgleichen ein Dorn im Auge, aber de Morgan mit seinem Vorrat an Bier und Tabak – ja selbst Prostituierten, wenn es die Umstände erlaubten – war bei der Mannschaft äußerst beliebt. Und was die Offiziere – und Ruddy – betraf, so wirkte ein gelegentliches Beutelchen Haschisch Wunder.
Nach de Morgans Schaunummer schien das Interesse zu erlahmen. Da die Kugel sich weder bewegte noch drehte, keine Anstalten machte, sich zu öffnen oder Geschosse abzufeuern, begann das Publikum sich rasch zu langweilen, wozu auch der ungewöhnlich kühle Spätnachmittag beitrug, der die Leute vor Kälte schaudern ließ. Der Nordwind wollte sich nicht legen, die Gesellschaft zerstreute sich, und einzeln oder zu zweit kehrten die Männer ins Fort zurück.
Doch plötzlich ertönte Geschrei vom anderen Ende der auseinander gehenden Gruppe: Wiederum war irgendetwas Ungewöhnliches aufgetaucht. De Morgan, dem bereits der Duft nach unerwarteten Geschäftsmöglichkeiten die Nüstern blähte, rannte schon in diese Richtung.
Ruddy zog Josh an der Schulter. »Genug dieser Zaubertricks«, sagte er. »Wir sollten zurückgehen. Es wartet bald eine Menge Arbeit auf uns, fürchte ich.«
»Was meinst du damit?«
»Ich sprach gerade ein Wörtchen mit Brown, der mit Townshend geredet hat, welcher irgendwas gehört hat, was Harley sagte …« Hauptmann Harley war der Politoffizier des Forts und unterstand dem Politbüro Khaiber, jener Abteilung der Provinzverwaltung, deren Aufgabe darin bestand, mit den Häuptlingen und Khans der paschtunischen und afghanischen Stämme diplomatischen Umgang zu pflegen. Nicht zum ersten Mal beneidete Josh Ruddy um seine guten Verbindungen zu den unteren Offiziersrängen. »Unsere Nachrichtenübermittlung ist zusammengebrochen«, flüsterte Ruddy atemlos.
Josh runzelte die Stirn. »Was soll das heißen? Haben sie schon wieder den Telegrafendraht durchschnitten?« Wenn die Verbindung nach Peschawar unterbrochen war, komplizierte das die Übermittlung der Reportagen an die Zeitung sehr. Der Redakteur drüben in Boston hatte wenig Verständnis für Verspätungen, die durch den Einsatz berittener Boten in die nächste Stadt verursacht wurden.
»Nicht nur das«, sagte Ruddy, »auch die Heliographen! Seit Sonnenaufgang haben wir kein einziges Lichtsignal von den Stationen im Norden und im Westen bekommen! Brown sagt, dass Hauptmann Grove Patrouillen ausschickt. Was da auch passiert ist, es muss ein großes Gebiet betreffen und eine koordinierte Sache sein.«
Die Heliographen waren einfache tragbare Signalgeräte, nichts anderes als Spiegel auf faltbaren Stativen. Überall auf den Hügeln zwischen Jamrud und dem Khaiberpass und hinüber nach Peschawar hatte man diese Heliographenposten eingerichtet. Das also war der Grund dafür, dass Hauptmann Grove vorhin im Fort so sorgenvoll dreingeblickt hatte!
Ruddy sagte: »Vergangene Nacht haben die wilden Paschtunen irgendwo draußen im Gelände etwa hundert Briten die Kehle durchgeschnitten; möglicherweise waren es aber auch die Mordbrigaden des Emirs. Oder, noch schlimmer, ihre russischen Auftraggeber persönlich.« Doch selbst jetzt, beim Gedanken an dieses grausame Geschehen, funkelten Ruddys Augen lebhaft hinter den dicken Gläsern.
»Dich reizt die Aussicht auf den kommenden Krieg, wie das nur bei einem Zivilisten der Fall sein kann!«, bemerkte Josh.
»Wenn die Zeit kommt, werde ich meinen Mann stellen«, protestierte Ruddy. »Aber bis dahin sind Wörter meine Gewehrkugeln – genauso wie für dich, Joshua, also halte mir keine Predigt!« Doch sein heiteres Naturell brach wieder durch: »Die Sache mit diesem Ding ist aber doch wirklich aufregend, wie? Das kannst du nicht leugnen! Endlich ist etwas los hier. Komm, machen wir uns an die Arbeit!« Er drehte sich um und eilte zurück zum Fort.
Josh schickte sich an, ihm zu folgen, als er vermeinte, hinter sich ein Flügelschlagen wie von einem großen Vogel zu hören. Er blickte sich um. Doch der Wind hatte plötzlich die Richtung geändert, und das seltsame Geräusch verflüchtigte sich.
Einige der Soldaten waren noch zurückgeblieben und trieben ihre Spiele mit der Kugel. Ein Mann kletterte auf die Schultern eines anderen, klammerte sich mit beiden Händen an die Kugel und hängte sein ganzes Gewicht an das »Auge«. Nach einer Weile ließ er los und plumpste lachend zu Boden.
Zurück in ihrer gemeinsamen Unterkunft steuerte Ruddy augenblicklich auf seinen Schreibtisch zu, zog einen Stapel Papier heran, schraubte das Tintenfass auf und begann zu schreiben.
Josh sah ihm zu. »Was wirst du berichten?«
»Das werde ich in einer Minute wissen.« Selbst während er sprach, fuhr er fort zu schreiben. Er war unordentlich, wenn er arbeitete; die türkische Zigarette im Mundwinkel, verspritzte er Tinte in alle Richtungen. Die Erfahrung hatte Josh gelehrt, seine eigenen Sachen außerhalb von Ruddys Reichweite aufzubewahren. Aber er konnte nicht umhin, den mühelosen Fluss zu bewundern, mit dem Ruddy seine Texte niederschrieb.
Lustlos legte Josh sich aufs Bett, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Im Unterschied zu Ruddy musste er seine Gedanken ordnen, ehe er sie zu Papier brachte.
So wie für die früheren Eroberer war das Grenzgebiet auch für die Briten strategisch lebenswichtig. Im Norden und Westen lag Afghanistan und mitten darin der Hindukusch, über dessen Pässe schon die Armeen Alexander des Großen und die Horden des Dschingis Khan und Tamerlans gezogen waren – alle wie magisch angezogen vom geheimnisvollen Reichtum Indiens im Süden. Fort Jamrud hielt eine Schlüsselposition zwischen Kabul und Peschawar, auf einer Linie zum Khaiberpass.
Aber die Provinz selbst war mehr als nur ein Durchzugsgebiet für fremde Heerscharen. Sie hatte eine eingesessene Bevölkerung, die dieses Land als ihr Eigen betrachtete: die Paschtunen, ein kämpferisches Volk, wild, stolz und klug. Die Paschtunen, die Ruddy »Pathanen« nannte, waren fromme Moslems und an ihren eigenen Ehrenkodex – den Pachtunwali – gebunden. Sie waren in Stämme und Clans gegliedert, und genau dieser Umstand verlieh ihnen Widerstandsfähigkeit und Beweglichkeit. Wie schwer auch eine Niederlage wog, die dem einen oder anderen Stamm zugefügt wurde, immer strömten noch mehr Krieger mit ihren altmodischen langläufigen Gewehren, den Dschesails, aus den Bergen nach. Josh hatte schon etliche Paschtunen zu Gesicht bekommen, die von den Briten gefangen genommen worden waren, und er hielt sie für die fremdartigsten Menschen, denen er je begegnet war. Dennoch hegten die britischen Soldaten ihnen gegenüber einen gewissen wachsamen Respekt; die schottischen Highlander behaupteten sogar, der Pachtunwali sei gar nicht so verschieden vom Ehrenkodex ihrer heimatlichen Clans.
Im Laufe der Jahrhunderte waren in diesem Landstrich, den ein Regierungsbeauftragter einmal »diese ungestutzte Dornenhecke« genannt hatte, zahlreiche Invasionsheere in Schwierigkeiten geraten. Und selbst jetzt reichte die Macht des gewaltigen britischen Imperiums nicht viel weiter als bis an die Ränder der Straßen; ansonsten wurde das Gesetz vom jeweiligen Stamm und von der Waffe diktiert.
Und nun war das Grenzgebiet wieder einmal Austragungsort internationaler Interessenskonflikte. Erneut hatte ein missgünstiges Imperium ein gieriges Auge auf Indien geworfen – diesmal das Russland des Zaren. Das Anliegen der Briten war klar: Unter keinen Umständen durfte dem Zarenreich oder dem von Russland unterstützten Persien gestattet werden, sich in Afghanistan zu etablieren. Dieses Ziel vor Augen hatten die Briten jahrzehntelang versucht sicherzustellen, dass Afghanistan von einem ihren Interessen wohlgewogenen Emir beherrscht wurde – und waren entschlossen, gegen Afghanistan selbst Krieg zu führen, falls dies misslang. Doch nun schien schließlich die seit langem vor sich hin schwelende Konfrontation heftig aufzulodern. In diesem Monat hatten sich die Russen langsam aber stetig durch Turkestan vorangeschoben und näherten sich nun Pandscheh, der letzten Oase vor der afghanischen Grenze – einer obskuren Karawanserei, die plötzlich im Mittelpunkt des Weltinteresses stand.
Josh fand dieses internationale Schachspiel überaus erschreckend. Ausschließlich der Zufall seiner geografischen Lage bestimmte diesen Landstrich zu einer Gegend, wo sich große Reiche aneinander reiben mussten, und trotz des kühnen Widerstandes der Paschtunen zerquetschte dieser entsetzliche Druck jene Menschen, die das Unglück hatten, hier geboren zu sein. Manchmal fragte sich Josh, ob das immer so bleiben würde, ob es diesem dürren Land für alle Zeiten beschieden war, ein Kriegsschauplatz zu sein – und er fragte sich, welche Schätze es wohl barg, die so heiß umstritten sein könnten.
»Aber vielleicht«, so hatte er einmal zu Ruddy gemeint, »werden die Menschen sich eines Tages vom Krieg abwenden, ihn beiseite werfen wie ein Spielzeug, dessen ein Kind überdrüssig geworden ist.«
Doch Ruddy hatte nur durch seinen Schnurrbart geschnaubt: »Pah! Und was werden sie dann tun? Den ganzen Tag Kricket spielen? Josh, Männer werden immer in den Krieg ziehen, weil Männer eben Männer sind und weil das Kriegführen eben Spaß macht.« Josh war naiv, ein scheuklappenbehafteter Amerikaner fern der Heimat, dem »schleunigst die Jugend ausgetrieben« werden musste, meinte Ruddy mit seinen neunzehn Jahren.
Nach weniger als einer halben Stunde hatte Ruddy seinen Kurzbericht beendet. Er lehnte sich zurück und starrte aus dem Fenster in das rötliche Licht, die kurzsichtigen Augen auf Bilder gerichtet, an deren Anblick Josh nicht teilhaben konnte.
»Ruddy, wenn es hier ernst wird – glaubst du, sie schicken uns dann nach Peschawar zurück?«
»Das hoffe ich doch nicht! Darum sind wir ja hier!« Er las aus seinem Manuskript: »›Welch eine Vorstellung: In weiter Ferne, jenseits des Hindukusch, haben sie sich in Marsch gesetzt – in ihren grauen oder grünen Röcken, die Armeen des Zaren unter dem Doppeladler; bald werden sie den Khaiberpass herabziehen. Doch im Süden formieren sich indes andere Kolonnen, Männer aus Dublin und Delhi, aus Kalkutta und Colchester, zusammengehalten von gemeinsamem Drill und gemeinsamen Zielen, bereit, für die Witwe in Windsor ihr Leben zu geben …‹ Die Schlagmänner stehen auf dem Spielfeld, die Schiedsrichter sind so weit, die Querhölzer sind in Position, der Torhüter ist bereit. Und wir stehen hier direkt an den Seilen der Spielfeldgrenze! Was sagst du dazu, eh, Josh?«
»Du kannst wirklich unangenehm sein, Ruddy.«
Doch noch ehe Ruddy antworten konnte, stürzte Cecil de Morgan ins Zimmer. Das Gesicht des Händlers war hochrot, er keuchte, und seine Kleider waren voller Staub. »Sie müssen sich das sofort anschauen, Sie beide! Kommen Sie mit und sehen Sie sich mit eigenen Augen an, was man gefunden hat!«
Seufzend wälzte Josh sich vom Bett. Würde dieser merkwürdige Tag denn überhaupt kein Ende nehmen?
Es war ein Schimpanse – das war jedenfalls Joshs erster Gedanke. Ein Schimpanse, gefangen in einem Tarnnetz, der teilnahmslos auf dem Boden lag. Ein kleineres Bündel in seiner Nähe enthielt ein weiteres Tier, vermutlich ein Junges. Man hatte die Netze an durchgesteckten Stangen ins Lager transportiert. Zwei Sepoys waren gerade dabei, das größere Tier aus seinem Netz zu schälen.
De Morgan stand wachsam und um Atem ringend dicht daneben, als wollte er seinen Besitzanspruch geltend machen. »Ein paar gemeine Soldaten auf Patrouille haben die beiden nur eine Meile nördlich von hier gefunden.«
»Das sind bloß Schimpansen«, stellte Josh fest.
Ruddy zupfte an seinem Schnurrbart. »Aber ich habe noch nie von Schimpansen in diesem Teil der Welt gehört. Gibt es in Kabul einen Zoo?«
»Der kommt aus keinem Zoo«, keuchte de Morgan. »Und es ist auch kein Schimpanse! Vorsichtig, Jungs!«
Die Sepoys hatten das Netz entfernt. Das Tier lag eingerollt da, die Knie an die Brust gezogen und die langen Arme über dem Kopf verschränkt; sein Fell war blutgetränkt. Die Männer hielten Holzknüppel in den Händen, die sie hin und her schwangen wie Schlagstöcke; Josh sah die Schrammen, die sie auf dem Rücken des Tieres hinterlassen hatten.
Jetzt schien das Tier zu bemerken, dass man das Netz entfernt hatte. Es ließ die Arme sinken, und in einer plötzlichen fließenden Bewegung rollte es sich vom Boden ab und kam in eine hockende Stellung, die Fingerknöchel leicht auf die Erde gestützt. Erschrocken traten die Männer einen Schritt zurück, und das Tier starrte sie an.
»Es ist ein Weibchen!«, flüsterte Ruddy.
De Morgan richtete den Finger auf einen der Sepoys. »Mach, dass es aufsteht!«
Widerstrebend trat der Sepoy, ein stämmiger Mann, wieder vor. Er streckte seinen Stock aus und stieß das Tier damit leicht in den Steiß. Es knurrte und schnappte mit seinen großen Zähnen danach, doch der Sepoy ließ nicht locker. Schließlich streckte die Kreatur anmutig – und mit einer gewissen Würde, glaubte Josh zu erkennen – ihre Beine und stand aufrecht.
Josh hörte, wie Ruddy nach Luft schnappte.
Kein Zweifel, sie hatte den Körper eines Schimpansen mit schlaffen Zitzen, geschwollenen Geschlechtsteilen und rosa Hinterbacken. Auch ihre Gliedmaßen hatten Affenproportionen. Aber sie stand aufrecht auf zwei für einen Affen eher langen, geraden Beinen, die deutlich sichtbar genau so mit dem Becken verbunden waren wie die eines Menschen.
»Gütiger Gott«, sagte Ruddy, »das ist das Zerrbild einer Frau! Eine Missgeburt!«
»Keine Missgeburt«, entgegnete Josh, »sondern halb Mensch, halb Affe. Ich habe darüber schon gelesen. Die modernen Biologen sprechen schon eine Weile davon – von Geschöpfen, die zwischen uns und den Tieren stehen.«
»Nun?« De Morgans Blick wanderte von einem zum anderen; Habgier und Spekulation lagen darin. »Haben Sie jemals schon so etwas zu Gesicht bekommen?« Er umkreiste das Geschöpf und musterte es prüfend.
Mit starkem Akzent sagte der stämmige Sepoy: »Sehen Sie sich vor, Sahib! Sie ist zwar nur vier Fuß groß, aber sie kann kratzen und beißen, glauben Sie mir!«
»Kein Affe, sondern ein Affen-Mensch …! Wir müssen sie nach Peschawar schaffen und von dort nach Bombay und dann nach England! Denken Sie nur, welch eine Sensation das für die dortigen Tiergärten wäre! Oder vielleicht sogar für die Theaterbühne … Es gibt nichts Vergleichbares – nicht einmal in Afrika! In der Tat, eine Sensation!«
Das kleinere Tier, das immer noch in seinem Netz steckte, war erwacht. Es rollte sich herum und quengelte mit schwacher Stimme. Das Weibchen reagierte so abrupt, als wäre ihm bisher nicht klar gewesen, dass auch ihr Kleines hier war. Sie streckte die Arme aus und machte einen Satz darauf zu.
Die Sepoys hämmerten sofort auf sie ein. Sie wirbelte herum und trat nach allen Seiten, aber die Schläge ließen sie schließlich zusammenbrechen.
Mit gesträubten Brauen fuhr Ruddy dazwischen. »Um Gottes willen, prügelt sie doch nicht so! Merkt ihr denn nicht, dass das eine Mutter ist? Seht ihr in die Augen – seht nur! Wird euch dieser Blick je wieder loslassen …?« Doch die Sepoys ließen weiterhin die Knüppel niedersausen, während der Affenmensch weiterhin versuchte, sich dagegen zu wehren, und de Morgan weiterhin lautstark zeterte, voller Angst, seine künftige Goldgrube könnte entkommen, oder, noch schlimmer, getötet werden.
Josh war der Erste, der das knatternde Geräusch im Osten wahrnahm. Er wandte sich um und bemerkte Staubwolken, die in die Luft gewirbelt wurden. »Da ist es schon wieder – ich habe das Geräusch vorhin schon gehört …«
Ruddy, aufgewühlt von diesem Ausbruch an brutaler Gewalt rings um ihn, murmelte: »Was, zum Teufel, ist jetzt wieder?«
{ 4 } Der Raketenwerfer
»Gehe auf Bodenrunde!«, rief Casey. »Wir sind fast auf Position!«
Der Hubschrauber fiel nach unten wie ein Hochgeschwindigkeitslift. Bäume, rostige Blechdächer, Autos und Berge alter Autoreifen flitzten durch Bisesas Gesichtsfeld. Der Hubschrauber neigte sich zur Seite und kreiste gegen den Uhrzeigersinn; er flog eine weitläufige Aufklärungsrunde. Doch so, wie Bisesa nunmehr auf ihren schmalen Sitz gepresst war, konnte sie nichts anderes als den Himmel sehen. Eine weitere Ironie, dachte sie. Sie seufzte und warf einen Blick auf die kleine Instrumententafel an der Wand neben ihr. Sensoren – von Kameras über Geigerzähler, Wärmedetektoren und Radar bis zu »Nasen«, die in der Lage waren, Chemikalien aufzuspüren – waren von einem an der Unterseite des Hubschraubers hängenden Behälter aus zum Boden gerichtet.
Der Vogel war Teil der weltumspannenden Kommunikations-Infrastruktur einer modernen Armee. Irgendwo über Bisesas Kopf befand sich ein großer C-2-Helikopter – »C-2« für »command and control« –, der jedoch seinerseits nur die Spitze einer kopfstehenden Technologie-Pyramide aus hoch fliegenden Überwachungsdrohnen, Aufklärungs- und Patrouillenflugzeugen und kamerabestückten und mit Radar ausgerüsteten Satelliten bildete, deren ganze elektronische Aufmerksamkeit auf diese Region gerichtet war. Die Flut von Daten, die Bisesa sammelte, wurde in Echtzeit durch die Computersysteme an Bord ihres eigenen Vogels sowie durch jene der übergeordneten Flugzeuge und in der Einsatzleitung unten auf dem Stützpunkt analysiert. Jegliche Anomalie würde zur nochmaligen Überprüfung umgehend an Bisesa zurückgemeldet werden – auf ihrem eigenen Kanal, über den sie zusammen mit ihren Instrumenten verfügte und der unabhängig von der Verbindung der Piloten zum Einsatzkommando funktionierte.
Das alles war hochkomplizierte Technik, aber so wie das Fliegen des Helikopters selbst war auch jene Seite des Einsatzes, die sich mit dem Sammeln von Daten beschäftigte, größtenteils automatisiert. Als die Aufklärungsrunde in die Automatik eingegeben war, kehrte die Routine zurück, und die Piloten nahmen ihre gelangweilten Sticheleien wieder auf.
Bisesa konnte gut verstehen, wie sie sich fühlten. Sie selbst war als Spezialistin für Boden-Luft-Kommunikation im Kriegsfall ausgebildet worden. Grundsätzlich sollte ihre Aufgabe darin bestehen, mit dem Fallschirm an gefährlichen Orten zu landen, um vom Boden aus Anweisungen für gezielte Luftangriffe und Raketenabschüsse zu geben. Bisesa hatte ihre Kenntnisse noch nie im Ernstfall anwenden müssen, ihre Ausbildung eignete sich jedoch auch ideal für diese Beobachterrolle. Sie musste dennoch immer daran denken, dass es nicht das war, wofür man sie eigentlich ausgebildet hatte.
Sie war diesem vorgeschobenen UNO-Stützpunkt der Friedenstruppen erst seit einer Woche zugeteilt, doch es kam ihr viel länger vor. Die Mannschaftsunterkünfte bestanden aus ehemaligen Flugzeughangars, hoch und kahl, die ewig nach Öl und Flugbenzin stanken; nachts war es zu kalt darin und tagsüber zu heiß. Abgesehen davon hatten diese seelenlosen Kästen aus rostigem Metall und Plastik etwas Deprimierendes an sich. Kein Wunder, dass die Bewohner den Stützpunkt »Clavius« nannten – nach dem großen multinationalen Außenposten auf dem Mond.
Körperliches Training, die Wartung der Ausrüstung und andere profane Kleinigkeiten standen zwar auf dem täglichen Stundenplan der Truppen, doch das reichte nicht, um ihre Zeit auszufüllen und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. So spielten sie in den blechern widerhallenden Hangars Volleyball oder Tischtennis, und irgendwo fanden immer scheinbar endlose Poker- oder Rommépartien statt. Obwohl das zahlenmäßige Verhältnis von Frauen und Männern etwa fünfzig-fünfzig betrug, war der Stützpunkt ein brodelnder Pfuhl hitziger sexueller Betätigung. Unter einigen der Männer schien ein Wettkampf im Gange zu sein, wer von allen in der ungewöhnlichsten oder schwierigsten Situation zum Höhepunkt gelangen konnte – wie etwa »'ne schnelle Nummer schieben«, während man am Fallschirm hing.
In einer solchen Atmosphäre, fand Bisesa, war es kein Wunder, wenn Männern wie Casey Othic langsam der Verstand käste.
Sie selbst hielt sich fern von dieser Art Leistungssport. Und mit Leuten wie Casey konnte sie es immer noch aufnehmen – auch heutzutage war die britische Armee kein Hort von Etikette und Harmonie zwischen den Geschlechtern. Bisesa hatte sogar das zurückhaltende Interesse Abdikadirs abgebogen; schließlich hatte sie Myra, ihre Tochter, ein stilles, ernstes, sehr liebevolles, achtjähriges Kind, für das jetzt tausende Kilometer weit weg in Bisesas Londoner Wohnung ein Kindermädchen sorgte. Bisesa hatte kein Interesse an irgendwelchen Spielchen oder komplizierten Sexpraktiken, um ihre fünf Sinne beisammen zu halten; für diese Aufgabe hatte sie Myra.
Wie auch immer, die Bedeutung des Einsatzes hier motivierte sie in höchstem Maße.
Wie schon seit Jahrhunderten war diese Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan auch im Jahr 2037 immer noch ein Spannungsherd. Zum einen stellte das Gebiet einen Testfall für die fortgesetzte, jedoch labile Waffenruhe zwischen Christentum und Islam dar, denn zur Erleichterung aller Menschen – mit Ausnahme der Hitzköpfe und Aufputscher auf beiden Seiten – hatte der entscheidende »Kampf der Kulturen« nie wirklich stattgefunden. Dennoch gab es an einem Ort wie diesem, wo Truppen aus zumeist christlichen Ländern ein großteils muslimisches Gebiet überwachten, immer jemanden, der nur darauf wartete, einen Kreuzzug oder einen Dschihad auszurufen.
Dazu existierten tödliche lokale Animositäten. Das gespannte Verhältnis zwischen Indien und Pakistan hatte der Krieg im Jahr 2020 mit der nuklearen Zerstörung der Stadt Lahore selbstverständlich keineswegs gebessert, auch wenn die beteiligten Parteien und ihre internationalen Hintermänner im letzten Moment vor einer ausgedehnteren Verwüstung zurückgeschreckt waren. Diese ganze komplizierte Mischung wurde zusätzlich belastet durch die Ambitionen, die misslichen Lebensumstände und die leichte Erregbarkeit der örtlichen Bevölkerung: der stolzen Paschtunen, die, obwohl hineingezerrt in die zivilisierte Welt, weiterhin an ihren Traditionen festhielten; sie waren immer noch gewillt, ihr Heimatland bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen.