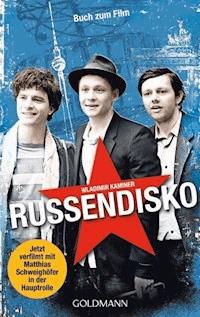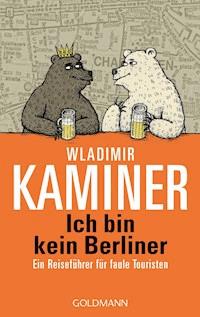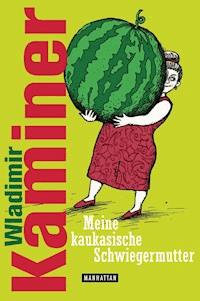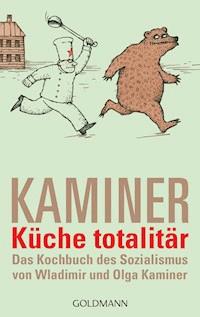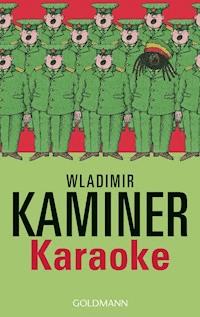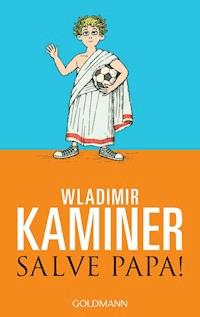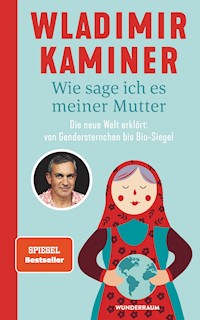8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Wladimir Kaminer sucht das Grüne: Schrebergarten war gestern – nun lockt das Leben auf dem Land
Ihren Schrebergarten mussten Wladimir Kaminer und seine Familie wegen »spontaner Vegetation« aufgeben. Nun versuchen sie erneut, das Paradies in kleinem Maßstab nachzubauen: in Glücklitz, einem kleinen Dorf vor den Toren Berlins. Keine Straßenkarte kennt diesen Ort mit dem kleinen Haus direkt am See und dem angeblich nördlichsten Weinberg der Welt. Dabei hat Glücklitz viel zu bieten – nicht zuletzt seine unverwechselbaren Einwohner, darunter Wladimirs Nachbar Herr Köpke, Matthias, der Schlüsselwart vom Haus des Gastes, Landbaron Heiner sowie der mollige Wirt der Dorfkneipe.
Für Wladimir Kaminer ist das Dorfleben jedenfalls ein Abenteuer samt Torpedokäfern und Rettichbeeten, der Organisation einer »Russendisko« in der Dorfscheune, verschwiegenen Fischen, einem Wetter wie im Bermudadreieck – und natürlich jeder Menge Geschichten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Ähnliche
Buch
Seit sie ihren Berliner Schrebergarten aufgeben mussten – ein Übermaß an »spontaner Vegetation« hatte für Probleme gesorgt –, waren Wladimir Kaminer und seine Familie auf der Suche nach einem neuen Paradies. Ein Garten Eden in kleinem Maßstab, wo niemand ihnen Vorschriften machen konnte. Schließlich wurden sie in Glücklitz fündig, einem Ort im Brandenburgischen. Hier pflanzt Wladimirs Frau Olga nun ungestört bunte Blumenbeete, sein Sohn hat eine Rettich-Plantage angelegt, und Wladimir lauscht den Gedanken der Fische im Glücklitzer See. Die Dorfbewohner schließen schon bald Freundschaft mit ihren neuen Nachbarn, und es dauert nicht lange, bis die Glücklitzer bei der ersten Dorf-Russendisko die Beine schwingen. Und auch ohne Disko sorgen unter anderem Herr Köpke, der Schlüsselwart Mathias und Landbaron Heiner dafür, dass es nie langweilig wird. Eines ist Wladimir jedenfalls aber schnell klar: Die Ruhe in Glücklitz ist trügerisch. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken – und die Geschichten liegen auf der Dorfstraße …
Autor
Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Toningenieur für Theater und Rundfunk und studierte anschließend Dramaturgie am Moskauer Theaterinstitut. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Berlin. Er veröffentlicht regelmäßig Texte in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und organisiert Veranstaltungen wie seine mittlerweile international berühmte »Russendisko«. Mit der gleichnamigen Erzählsammlung sowie zahlreichen weiteren Büchern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Alle seine Bücher gibt es als Hörbuch, von ihm selbst gelesen.
Näheres zum Autor und seinen Büchern finden Sie unter www.russendisko.de
WLADIMIR
KAMINER
MANHATTAN
Und mich sollte nicht jammern?
Gott
Denn ihr habt fünf Bäume im Paradies, die verändern sich nicht, weder im Sommer noch im Winter, und deren Blätter fallen nicht. Derjenige, der sie kennt, wird den Tod nicht schmecken.
Thomasevangelium, Vers 19
Alle hier beschriebenen Menschen, Pflanzen, Vögel, Insekten und Fische, Ortschaften, Fahrzeuge und Gebäude, Steine und Seen, Träume und Zweifel sind absolut real. Das trifft auch auf den Autor und seine vielköpfige Sippe zu.
Inhalt
Auf zum neuen Garten!
Kein perfekter Ort
Der Himmel über Glücklitz
Im Haus des Gastes
Fliegenfischen
Unsere Dorfrussendisko
Die Nachsicht der brandenburgischen Barsche
Chronik des Dorfes
Der geheime Handschuh
Das Paradies der Maulwürfe
Weinerkenntnisse
Worüber die Fische schweigen
Diesseits von Eden
Katzen
Kleine und große Fische in der DDR
Der Wein der Erkenntnis
Heile Welt und die kanadischen Bärenwürmer
Die vielfältige Tierwelt Brandenburgs
Unser Schwanensee
Der Forellenpuff
Der Weltuntergang wurde verschoben
Auf zum neuen Garten!
Seit ich in Deutschland bin, werde ich hier als etwas Besonderes, nämlich als Mensch mit »Migrationshintergrund« behandelt. Eigentlich schleppe ich diesen Hintergrund ein Leben lang mit mir herum. Früher in der Sowjetunion war ich ein Fremder, weil in meinem Pass unter Nationalität »Jude« stand, also etwas nicht ganz Dazugehöriges. In Deutschland bin ich zum Russen geworden. Als solcher werde ich toleriert oder geduldet, bewundert, verschmäht und manchmal auch integriert. Dabei ist ein Migrationshintergrund etwas, das alle Menschen besitzen. Sie sind dazu verdammt, ihr Leben lang immer wieder ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, sei es die Schule, die Familie oder Mutters Bauch. Sie brechen aus, um in der Fremde das Glück zu suchen. Und wenn sie selbst zu faul zum Verreisen sind, werden sie vertrieben, vom Staat, von der Verwandtschaft oder von der klugen Mutter Natur. Sie weiß, wenn Menschen zu lange an einem Ort bleiben, geht dieser Ort kaputt.
Auch die ersten Menschen wurden bekanntermaßen von Gott aus dem paradiesischen Garten Eden vertrieben, nachdem sie angefangen hatten, dort ihre Orgien zu veranstalten. Sicher fiel Gott damals diese Entscheidung nicht leicht, doch man kann ihn schon verstehen. Nicht auszudenken, wie der Garten ausgesehen hätte, wären die Menschen dort weiter geblieben. Sie zogen los, nahmen ein paar Pflanzen und die Schlange mit, ohne groß darüber nachzudenken, was genau passiert war. Sie lebten mal hier, mal dort. Doch schnell merkten sie, ganz ohne Garten macht das Leben keinen Spaß. Also fingen die Menschen an, überall wo sie sich ansiedelten eigene Gärten anzulegen. Sie nannten sie später Schrebergärten. An manchen Stellen gelang es ihnen beinahe, ihren eigenen Garten Eden auf Erden zu erschaffen. An anderer Stelle hatten sie Pech.
Wir mussten unseren Schrebergarten nach vier Jahren abgeben. Wir hatten Probleme mit »Spontanvegetation«. Obwohl, was heißt hier Probleme? Es war ein Interessenkonflikt mit der Prüfungskommission des Schrebergartenvereins. Die Mitglieder dieser Kommission hatten klare Vorstellungen davon, wie jeder Garten auszusehen hatte. Sie wollten, dass alle Gärten gleich angelegt waren und die gleiche Anzahl von Bäumen und Büschen und Beeten hatten. Wir wollten in unserer Parzelle die Natur mitgestalten lassen, so kam es zu spontaner Vegetation. All unsere Einwände und Auslassungen über die Vielfalt der Welt und dass nicht alle Gartenanlagen unbedingt gleich aussehen sollten, dass nicht jeder schöne Garten aus quadratischen Beeten mit Nutzgemüse bestehen muss, hatten nicht gefruchtet. Im Gegenteil, wir hatten damit sogar noch Öl ins Feuer gegossen. Irgendwann sagte meine Frau, die sowieso die Hauptgärtnerin war, sie wolle ihren Garten nicht mehr zusammen mit der Prüfungskommission bestellen, sondern lieber alleine. Sie beschloss, einen richtigen Garten zu suchen, einen möglichst großen Landgarten draußen in Brandenburg, ohne Gartenverein und ohne Prüfungskommission. Einen Garten, in dem jeder in jede Richtung spontan vegetieren konnte.
Gesagt – getan. Meine Frau recherchierte im Internet und fand ziemlich schnell das Gesuchte. Ein Haus mit Garten, in einem kleinen Ort namens Glücklitz, offiziell 300 Einwohner, gefühlt: 3. Das Haus stand direkt am Glücklitzer See auf einem Weinberg, der zum Haus gehörte, aber nicht zu verkaufen war. Die Verkäuferinnen, zwei Frauen, die sich rühmten, den nördlichsten Weinberg der Welt zu bestellen und den nördlichsten Rotwein der Erde zu produzieren, hatten das Grundstück selbst bebaut. Sie besaßen außer dem Weinberg noch ein Motorrad, drei Kinder, zwei Pferde und eine alte Mutter, die alle entweder kaputt beziehungsweise krank und auf fremde Hilfe angewiesen waren. Die beiden Frauen hatten sich sichtlich übernommen. Sie hatten ihren Traum vom Leben auf dem Lande realisiert, einiges dabei aber nicht berücksichtigt. Die Kinder mussten jeden Tag zur Schule, die Pferde zum Arzt, das Motorrad in die Werkstatt, und die alte Mutter konnte mit ihrem Rollstuhl auf dem Berg überhaupt nicht herumfahren. Eine falsche Bewegung und sie wäre ins Wasser gefallen. Glücklitz war eine von allen öffentlichen Einrichtungen befreite Zone, es gab dort weder Schule noch Arzt, von irgendeiner Motorradwerkstatt ganz zu schweigen. Es gab dort überhaupt keine Geschäfte, nicht einmal eine Bäckerei. Nur einen Friedhof, eine stets geschlossene Kirche und die freiwillige Feuerwehr, wo manchmal am frühen Samstagmorgen gefühlte drei Glücklitzer mit einer Kiste Bier auf einer Bank vor dem Eingang saßen und nachdenklich in die Ferne schauten. Nach langem innerem Kampf beschlossen die Frauen, das Haus zu verkaufen und mit dem Geld in einer rollstuhl- und kindergeeigneteren Gegend zu bauen.
Wir waren die idealen Käufer. Uns kümmerte die Abwesenheit von Bäckerei und Schule nicht. Wir wollten nichts um- oder dazubauen. Wir verlangten nicht das Gutachten des unabhängigen Architekten. Unsere Vorgängerinnen hatten in Glücklitz Großes vorgehabt, sie wollten ihren Lebenstraum verwirklichen. Wir wollten nur ein paar Pflanzen gießen, in der Sonne sitzen und ab und zu grillen, wie damals schon im Schrebergarten. Nur sollte uns dieses Mal keine Prüfungskommission dazwischenkommen. Das Geld fürs Haus hatten wir schnell zusammen, ein paar Freunde halfen uns. Wir hätten die Rebstöcke auch gekauft, einfach so aus Neugier, wie der nördlichste Rotwein der Erde schmeckte. Nur den Weinberg beschlossen die Frauen erst einmal für sich zu behalten. Wir hatten auch hier nichts dagegen.
Die einzige Frage, die uns Sorgen machte, war, wie wir unseren neuen Garten erreichen würden. Es fuhren nämlich keine Züge nach Glücklitz, ja, es gab überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel, die uns dorthin bringen konnten. Es gab zwar einen Bus, der aber nur auf Vorbestellung und selbst dann unregelmäßig zu einem Dorf in der Nähe fuhr. Selbst wenn wir diesen Bus benutzen würden, müssten wir die Grillanlage die letzten fünf Kilometer auf den Schultern tragen. Kurzum, man brauchte ein Auto, um in Glücklitz glücklich zu werden. Weder meine Frau noch ich besaßen jedoch einen Führerschein. Ich bin in einer Großstadt geboren und aufgewachsen, in Moskau, und verfügte von daher über keine Erfahrung mit dem Leben auf dem Lande, wo man sich nur mit dem Auto fortbewegen konnte. In der zehnten Klasse der sowjetischen Schule, als die meisten Mitschüler im Rahmen einer sogenannten »Berufsqualifizierung« ihren Führerschein machten, war ich gerade nicht anwesend. Und später war mir nicht mehr danach. Wozu braucht der Mensch schon ein Auto?
Meine Frau träumte dagegen bereits seit Längerem vom schnellen Fahren und war schon in mehreren Berliner Fahrschulen bei den Prüfungen durchgefallen. Dazu muss gesagt werden, dass sie von eher zierlicher Gestalt ist. Den Prüfern gefiel nicht, dass sie zu wenig in den Rückspiegel schaute, zu wenig Abstand zu den vorbeifahrenden Autos hielt und zu wenig über die Schulter blickte. Ich glaube, meine Frau hatte damals einfach Pech mit ihren Fahrlehrern. Ich hatte bereits während meiner Dienstzeit bei der sowjetischen Armee einige Fahrzeuge gelenkt und wusste daher ungefähr, wie das ging. Ich hatte sogar den Schulterblick drauf. Obwohl vor unserer Kaserne insgesamt nur zwei Fahrzeuge standen, blieb die Wahrscheinlichkeit, dass sie eines Tages zusammenstoßen würden, immer gleich 50:50, hatte unser Vorgesetzter behauptet. Entweder sie kollidieren oder sie kollidieren nicht, sagte der Oberst immer wieder. Ich war mir nicht sicher, ob meine Armee-Erfahrungen mir helfen würden, die Fahrprüfung zu bestehen. Bei einem Berliner Führerschein geht es nicht nur darum, die richtigen Pedale im Fahrzeug zu treffen, sondern vorausschauend zu fahren, um den anderen überforderten Berliner Autofahrern keine zusätzlichen Schwierigkeiten zu machen.
Die Wege der Menschen sind, wie Gottes Wege, unergründlich. Oft beginnt so ein Weg sehr weit vom Ziel entfernt. Unser Weg in den Garten begann mit dem Besuch einer Fahrschule. Meine Frau und ich gingen, ohne lange zu überlegen, in die nächstbeste Fahrschule, die sich in unserer Straße und nur drei Schritte von unserer Wohnung entfernt befand. Sie hieß »Fahrschule Milde« – trug also den Namen ihres Besitzers. Unser Fahrlehrer Martin, eine Seele von Mensch, war gelernter Bäcker und Konditor. Am liebsten backte er große Torten und hatte sich sogar mit einer eigenen Erfindung einen Namen in der Welt der Süßigkeitenproduktion gemacht. Martin hatte einen besonders feinen Kuvertüre-Schreibstift erfunden, eine Tube, mit der man auf großen Torten Geburtstagsgrüße, Namen oder einen ganzen Brief schreiben konnte, so deutlich und unverwüstlich, dass der Gruß oder der Name auch dann noch da waren, wenn die Torte längst gegessen war. Nach einigen Jahren Berufsleben stellte man bei Martin jedoch eine Mehlallergie fest, die ihm jede weitere Tätigkeit in der Konditorbranche unmöglich machte. Er ließ die Torten links liegen und wurde Fahrlehrer.
Als Erstes fragte ich ihn, ob ich nicht zu alt sei, um vorausschauendes Fahren zu lernen. Ging es überhaupt noch, einem Mann oder einer Frau, die nicht mehr zwanzig waren, das Autofahren in einer Großstadt beizubringen? Oft wird behauptet, ab einem bestimmten Alter seien Menschen nicht mehr lernfähig. In Singapur, wo man für alle möglichen großen und kleinen Verbrechen Bambushiebe verordnet bekommt, werden Verbrecher ab dem fünfzigsten Lebensjahr nicht mehr geschlagen, weil die Richter dort der Meinung sind, das bringe bei älteren Menschen sowieso nichts, da wäre ohnehin nicht mehr viel zu ändern.
Er habe schon mal eine Schülerin gehabt, die sah aus wie achtzig, fuhr aber, als wäre sie 29, beruhigte mich Martin und drückte mir die Autoschlüssel des Fahrschul-Audis in die Hand. Es war nicht einmal besonders schwer, den Verkehrsregeln entsprechend in der Stadt zu fahren. Das Problem dabei war nur, dass man kaum vorankam, wenn man all diese Regeln penibel beachtete. Überall gab es verkehrsberuhigte Zonen, Tempo-30-Zonen, Baustellen oder Fahrbahnschäden, Schulbusse und Kindergärten. Ich fragte Martin politisch korrekt, ob er schon wisse, wann das Verkehrsschild für Aussteigen und Schieben komme. Er lächelte und sagte mit seiner üblichen Logik, meine primäre Aufgabe als Fahrschüler sei es nicht, schnell voranzukommen, sondern die Fahrprüfung zu bestehen. Und dazu müssten wir uns mit erhöhter Aufmerksamkeit durch die Straßen bewegen, schön in die Spiegel schauen und immer alle Verkehrszeichen beachten. Wenn wir aber die Prüfung bestanden hätten, würde man mich meiner eigenen Verantwortung überlassen.
Und tatsächlich sah ich, dass die meisten Verkehrsteilnehmer, die nicht in einem Auto mit dem Schild »Fahrschule« auf dem Dach unterwegs waren, einen ganz anderen Fahrstil pflegten. Sie fuhren viel schneller, als die Verkehrsschilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung erlaubten, sie gingen weniger galant miteinander um und vergaßen ständig zu blinken, wenn sie die Spur wechselten. Sie hatten ja alle schon ihren Führerschein, obwohl man sich bei vielen wunderte, aus welcher unverantwortlichen Hand er oder sie dieses Dokument erhalten hatte.
Mit dem Audi der Fahrschule machte ich einen auf perfekten Fahrer. Ich lernte, Fußgänger als gleichberechtigte Teilnehmer des Straßenverkehrs zu akzeptieren, obwohl sie keine Räder haben. Ich lernte, Fahrradfahrer nicht zu überholen, obwohl sie provozierend mit ihrem Fahrradgestell vor meiner Nase wackelten. Und ich lernte, ausreichenden Abstand zu allem einzuhalten, was sich links und rechts von mir bewegte oder stand.
Abends gab es Theorie-Unterricht. Zu jedem Kapitel aus dem Lehrbuch hatte unser Fahrschullehrer eine lustige Geschichte aus dem Leben parat, die ihm oder einem Freund passiert war. Auf den Plakaten, die während des Theorieunterrichts an den Wänden des Fahrschulraums hingen, fuhren jede Menge Traktoren, Pferdewagen, Rennwagen und LKWs. Es war in vielen Situationen unklar, wer wem die Vorfahrt lassen musste. Ich lernte zu Hause die Prüfungsfragen und freute mich über dieses Studium. Schon lange hatte ich nichts mehr auswendig lernen müssen, und nun dieses vorausschauende Fahren. Theorie und Praxis klafften allerdings stark auseinander, wenn ich mich hinter das Lenkrad klemmte.
Ehrlich gesagt hatte ich, bevor ich zur Fahrschule ging, im Urlaub schon ein wenig geübt, im Nordkaukasus, wo wir bei der Familie meiner Frau traditionell jedes Jahr im August ein paar Wochen verbringen. Die kaukasische Familie ist groß und hat zwei Fahrzeuge, einen alten geschlagenen und geschundenen Opel Vectra, mit dem der Ehemann der jüngsten Tochter des Bruders meiner Schwiegermutter fährt, und einen nagelneuen französischen Siebensitzer von Renault, der vom Bruder der Schwiegermutter persönlich gelenkt wird. Ich dachte, bevor ich in eine deutsche Fahrschule gehe, werde ich im Urlaub das Nützliche mit dem Spaßigen verbinden und ein wenig mit dem einen oder anderen Wagen herumfahren. Man händigte mir widerstandslos die Autoschlüssel aus. Ich fuhr sowohl mit dem Opel als auch dem Renault, musste aber schnell einsehen, dass dieses Herumfahren mir keine neuen Erkenntnisse über das Autofahren einbrachte. Das Problem war: Man kann im Nordkaukasus kein vorausschauendes Fahren lernen. Es hat dort keinen Sinn zu blinken, ob nun als Links- oder Rechtsabbieger. Es gibt dort auch nur sehr wenige Verkehrszeichen, höchstens eines pro Dorf, und Vorfahrtsangelegenheiten werden nach der Größe des Autos geregelt: Das größte Auto hat immer Vorfahrt. Manchmal allerdings auch das schnellere, wenn es rasch genug an der Kreuzung Gas gibt.
Nein, für Berlin konnte man im Kaukasus nichts Brauchbares lernen. Als wir von dort zurückkamen, musste ich als Fahrschüler nun vielmehr die kaukasischen Fahrgewohnheiten mühsam wieder vergessen und auf die kleineren Verkehrsteilnehmer achten, die lebensmüden Omas, die einem unter die Räder laufen, die Fahrradfahrer, die mit dem Rad hin und her schwenken, und die unentschlossenen kleinen Frauen am Lenkrad großer schwarzer Fahrzeuge, die sich vor keiner Ampel entscheiden können, ob sie links oder rechts fahren oder doch einfach stehen bleiben sollen.
Anfangs drehte ich mich im Fahrersitz wie eine Natter in der heißen Pfanne, ich wollte so viele Blicke nach allen Seiten werfen, wie es nur ging. Ein paar richtige werden schon dabei sein, dachte ich. Mein Fahrlehrer erzählte mir jedoch, dass es so nicht ging. Man musste ein Grundvertrauen in andere Verkehrsteilnehmer haben, auch wenn es einem schwerfiel. Schnell hakten wir die notwendigen Stunden ab, lernten wenden und parken, und zwischendurch absolvierte ich die Theorieprüfung. Bei Tausenden von Theoriefragen musste man eigentlich nur bestimmte Wörter auswendig lernen, die immer für die richtige beziehungsweise falsche Antwort standen. Wenn zum Beispiel in einer der möglichen Antworten Ausdrücke wie »Schrittgeschwindigkeit« oder »erhöhte Aufmerksamkeit« standen, konnte man sicher sein, dass das die richtige war. Die Antwort »hupen und weiterfahren« deutete dagegen in jeder Situation auf falsches Verhalten hin. Diese Wendung kam so oft in dem Lehrbuch für angehende Autofahrer vor, dass sie zu einem geflügelten Wort in unserer Familie wurde. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, das einem leidtut, sagen wir seitdem: »Scheiß drauf. Hupen und weiterfahren.«
Trotz der vermeintlichen Einfachheit sah ich bei der Theorieprüfung viele, die sie nicht bestanden. Eine Russin weinte sogar im Korridor der Prüfstelle bittere Tränen und wurde dazu noch von ihrem Mann beschimpft.
»Das ist schon deine siebte Prüfung!«, schrie er, »eine solche Geldverschwendung können wir uns nicht leisten!«
»Ich verstehe die Fragen nicht«, gab die Blondine zu.
»Bist du blond oder was?«, rief der Mann. Es hörte sich nicht nach echter Liebe an.
Mit der bestandenen Theorieprüfung stand nun der praktischen Fahrprüfung nichts mehr im Weg. Ich absolvierte eine Fahrt auf der Landstraße, musste einen Traktor überholen und einem Pferd ausweichen, fuhr drei Stunden lang auf der Autobahn und lernte Auf- und Abfahrten richtig zu benutzen.
Die Zeit läuft anders, wenn man schnell fährt. Als meine Frau und ich mit der Fahrschule anfingen, flogen noch die Marienkäfer durch die Luft, halbnackte Berlinerinnen und Berliner lagen im Gras und sonnten sich. Der Sommer ging, ihm folgte der Herbst, schließlich bereitete sich die Stadt auf Weihnachten vor, und wir waren noch immer nicht mit der Fahrschule fertig. Der Schnee fiel für die Jahreszeit völlig unerwartet mitten im Dezember, und wie aus dem heiteren Himmel verschüttete und überraschte er die Stadt und das ganze Land. Züge blieben stehen, Weichen froren ein, den deutschen Flughäfen ging die Enteisungsflüssigkeit aus, und die Autobahnen machten dicht. Die Bahn riet sogar von Bahnfahrten ab, Fluggesellschaften warben fürs Nichtfliegen, Autofahrer wurden mit Warnungen terrorisiert.
Martin sagte, er hätte in diesem Jahr sowieso keine Termine für die Prüfung mehr, wir müssten sie aufs neue Jahr verschieben. Meine Nachtfahrt absolvierte ich noch kurz vor Weihnachten im bis zum Deckel verschneiten Berlin, auch ein paar zusätzliche Stunden im Schnee ließ ich mir nicht entgehen. Trotzdem meinte Martin, ein Perfektionist in seinem Fach, ich sei noch nicht so weit. Bei der letzten Fahrt hätte ich in einem mit Schnee bedeckten Volkswagen den Schulbus nicht erkannt und ihn deswegen nicht mit der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit überholt. Das wäre das Ende meiner Prüfung gewesen, erklärte mir Martin.
Also beschlossen wir, weiter zu trainieren. Die Stadt schmückte sich mit Girlanden, frohe Bürger schleppten große Tannen nach Hause, ich fuhr vorausschauend und freundlich von Prenzlauer Berg bis nach Marzahn und zurück, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Sogar im Schlaf träumte ich davon, wie mir als Linksabbieger auf einem Straßenbahngleis plötzlich der Motor absoff. Für alle Fälle fuhren wir eine Runde an der Prüfstelle vorbei.
»Wenn der Prüfer ins Auto steigt, wird er dich zuerst begrüßen, dann sich vorstellen und erkundigen, ob du Fragen hast. Da musst du ihm bloß eine Frage stellen: ob du nach rechts oder nach links fahren sollst«, erklärte Martin.
Von der Prüfstelle führte eine Einbahnstraße weg, deswegen musste man sich als Linksabbieger gleich links, als Rechtsabbieger rechts positionieren. Während Martin mich unterrichtete, fuhr eine Linksabbiegerin mit einem Prüfer im Auto direkt auf uns zu. Sie hatte die Spur verwechselt, war nach dem Abbiegen auf der falschen Seite angekommen und in den Gegenverkehr geraten. Nach drei Minuten war ihre Prüfung also schon gelaufen. Ich sah, wie die Frau beinahe weinte, und beschloss, erst einmal Weihnachten und Silvester zu feiern und dann mit neuer Kraft die Fahrlehre fortzusetzen.
Die langweiligsten deutschen Feiertage begannen wie immer damit, dass alle Geschäfte zumachten und die Straßen menschenleer wurden. Das ganze gesellschaftliche Leben fror ein. Obwohl ich ein Familienmensch bin, mag ich die deutsche Art, Weihnachten zu feiern, nicht. Natürlich ist es ab und zu mal nett, mit der Familie zusammen bei Kerzenlicht am Tisch zu sitzen, doch das soll nicht nach dem Kalender, sondern nach eigener Lust und Laune passieren. Die Deutschen feiern mir Weihnachten zu pedantisch und diszipliniert, auf Befehl quasi. Wie Soldaten hinter den Brustwehren verstecken sie sich zu Hause hinter ihren Gänsebraten. So hatte es Jesus mit seiner Geburt ganz sicher nicht gemeint. Als großer Verfechter der Nächstenliebe, die ebenfalls nicht nach dem Kalender, sondern das ganze Jahr über ausgeübt werden muss, hätte er sich bestimmt gewünscht, dass die Menschen, wenn sie schon seinen Geburtstag feierten, dies laut, lustig und vor allem alle zusammen taten und nicht jeder mit seiner eigenen Gans.
So dachte ich und kündigte kurzerhand zusammen mit einem Freund eine Lesung und Russendisko am Heiligen Abend in der Berliner Volksbühne an, für Menschen, die weder Familie noch Freunde, vielleicht überhaupt niemanden hatten, mit dem sie Weihnachten verbringen konnten. So schrieben wir es in den Veranstaltungshinweisen, in denen wir Werbung für den Abend machten. Für diese Initiative der Nächstenliebe wurde ich von meiner Frau verflucht. Sie schimpfte, sabotierte die Veranstaltung und meinte, dass ich die eigene Familie gegen wildfremde Menschen eintausche. Außerdem meinte sie, ganz egal wie viel Werbung wir dafür machten, es werde sowieso niemand zu uns in die Volksbühne kommen, weil Weihnachten in Deutschland schon immer ein Zuhause-sitz-Fest gewesen wäre und die Deutschen ihre Gewohnheiten nie freiwillig änderten. Wenn sie einmal etwas beschlossen, zum Beispiel am Heiligen Abend zu Hause zu bleiben, dann blieben sie eben zu Hause, ganz egal was passierte. Selbst wenn ihr Haus in Flammen aufging oder ihnen die Decke auf den Kopf fiel, bewegten sie sich nicht von der Stelle, schon gar nicht gingen sie am Heiligen Abend ins Theater, meinte sie.
Meine Frau mag des Öfteren recht haben, doch diesmal hatte sie sich geirrt. Auch die Deutschen sind inzwischen nicht mehr das, was sie einmal waren – ihre Treue zur Ordnung hat stark nachgelassen. Zu der Veranstaltung in der Volksbühne kamen so viele Leute, dass das Theater aus allen Nähten platzte. Nicht nur einsame Herzen kamen zu uns, manche Besucher brachten ihre ganzen Familien mit. Ich war so berauscht von diesem Erfolg, dass ich mich fühlte, als würde mir jeder Berg bloß bis zum Knie reichen. Warum also nicht doch noch in diesem Jahr den Führerschein machen – zwischen den Feiertagen?
Nach Weihnachten schüttete es noch mehr Schnee auf die Straße, obwohl eigentlich gar nichts mehr hineinpasste. Die meisten Autos sahen aus wie Schneeberge, man konnte sich kaum vorstellen, dass sie Räder hatten. Selbst erfahrene Fahrer trauten sich kaum noch ans Steuer. Ob es vielleicht angebracht war, das Schneechaos für eine problemlose Prüfung zu nutzen? Martin meinte, er könne zwar nicht mit Sicherheit behaupten, dass ich die Prüfung bestehen würde, aber es gäbe Hoffnung. Er hatte sogar einen Termin für mich am 30. 12. gefunden, um 8.00 Uhr früh. Ursprünglich hatte der Termin seiner Schwester gehört, die ebenfalls gerade den Führerschein machte, doch sie wollte diesen Termin plötzlich nicht mehr. Der Bruder meiner Schwiegermutter, der gerade zusammen mit ihr und seiner Frau aus dem Kaukasus zu uns gekommen war, um mit uns die Winterfeste zu feiern, behauptete, einen sicheren Weg zu kennen, die Prüfung zu bestehen. Dafür müsste man bloß einen Tag vor der Prüfung nichts Alkoholisches trinken und drei Mal klar und deutlich das Vaterunser aufsagen.
Ich ließ mir die russische Variante des Vaterunsers von meiner Schwiegermutter aufschreiben und telefonierte mit Freunden, die erst vor Kurzem ihren Führerschein im Schneechaos gemacht hatten. Ist es von Vorteil, bei solchem Wetter die Fahrprüfung zu machen oder nicht, wollte ich von ihnen wissen. Doch je mehr ich herumtelefonierte, desto widersprüchlichere Antworten bekam ich zu hören. Schreckliche Geschichten von hinterhältigen Prüfern, die einen bei jedem Wetter durchfallen lassen, häuften sich jedoch. Mein Freund Florian, der ebenfalls seinen Führerschein im Dezember gemacht hatte, erzählte mir, dass der Prüfer von ihm als Erstes den Schalter für die Kennzeichenlichter wissen wollte. Florian suchte und suchte, war aber bereits in die Falle getappt, es gibt nämlich in keinem Auto Extraschalter für Kennzeichenlichter. Meinem Freund Berndt schlug der Prüfer vor, auf leerer Straße eine Vollbremsung durchzuführen, also den Wagen auf 50 km/h zu beschleunigen und dann volle Pulle auf die Bremse zu treten. Die Vollbremsung gelang meinem Freund zwar, doch bei der Weiterfahrt vergaß er zu blinken, um den anderen nicht sichtbaren Autos seine Fahrbereitschaft zu signalisieren. Sofort war die Prüfung zu Ende. Ein anderer Freund hatte beim rechts Abbiegen die Ampel verpasst, die gleich nach der Kurve hinter einem verschneiten Busch hing und rot leuchtete.
Die Erfahrungsberichte bewiesen: Es gab kein gutes Wetter für eine Prüfung, alles kam immer anders als erwartet. Augen zu und durch, hupen und weiterfahren!, dachte ich und ging zur Prüfung. Es klappte alles glänzend. In der Silvesternacht betrank ich mich aus lauter Begeisterung über die neuen Möglichkeiten und aus Neugier auf mein erstes Autofahrer-Jahr. Zwei Wochen später war meine Frau ebenfalls so weit.
Das neue Jahr begann mit der Suche nach dem richtigen Auto. Die Suche war nicht einfach, denn mein erstes Auto sollte einerseits schick, andererseits nicht zu teuer sein. Daraus wurde schließlich ein Škoda Superb. Es dauerte etwas, bis der Wagen fertig gebaut war, aber dann kam endlich die Einladung vom Autohaus: Ich durfte den Wagen abholen. Die Dame, die mir die Papiere aushändigte, hatte ein Namensschild auf ihrer Bluse: »Frau Liebe«. Ich sah es als gutes Omen.
Ich bin schon immer direkt aus dem Bett als Erstes auf den Balkon gegangen, noch im Halbschlaf quasi, um mich zu orientieren. Einmal in den Himmel blicken und einmal auf die Straße, ob noch alles da war. Bis jetzt ist noch an jedem Morgen alles da gewesen, oben die grauen Wolken, unten nasser Asphalt und dazwischen mein Balkon. Nun war noch ein wichtiger Orientierungspunkt in meinem Leben dazugekommen: mein neues Auto in »Metallic-Cappuccino«.
Wenn der Wagen direkt gegenüber von meinem Balkon stand, hieß es, ich hatte gestern Glück bei der Parkplatzsuche gehabt. Gegenüber von unserem Haus befindet sich ein großes Stadion, und wenn dort abends Handball gespielt wird oder irgendein modischer Radiosender seine Hörer zu einem Konzert eingeladen hat oder, noch schlimmer, die jährliche Meisterschaft der deutschen Marschmusikkapellen ausgetragen wird, können die Einwohner ihre Parkplätze vergessen. Zwar ist unsere Straße wie inzwischen fast alle Straßen in Berlin mit Parkautomaten ausgestattet, was es für Fremde zum teuren Spaß macht, länger unter unseren Fenstern zu stehen. Doch Menschen, die schon für das Konzert oder das Spiel ihrer Lieblingsmannschaft hundert Euro hingeblättert haben, schreckt ein Fünf-Euro-Strafzettel nicht ab. Fast jeden Abend fand dort ein Konzert statt, also kreiste ich manchmal wie ein Verrückter um mein Haus herum, drei, vier, fünf Mal. Als Anwohner hatte ich schlechte Karten, trotz meiner Parkplakette. Was nutzte sie mir, wenn die ganze Straße belegt war? Um nicht im Nachbarbezirk parken zu müssen, haben meine Nachbarn längst den Konzertplan des Stadions ausgedruckt und im Treppenhaus auf dem Anzeigenbrett aufgehängt. Wer vor seiner Haustür parken will, sollte an Konzerttagen früher nach Hause kommen.
Die Berliner sind entspannte Menschen und nicht sonderlich neugierig. Niemand von meinen Nachbarn hat mein neues Auto bemerkt, außer vielleicht die Mexikaner, die bei uns an der Ecke vor einem Monat ihre mexikanische Bar Arriba aufgemacht haben. An dieser Kreuzung blieb ich oft vor der Ampel stehen, in deren Nähe die Besitzer des Ladens bei jedem Wetter draußen saßen und sich langweilten. Der Laden lief überhaupt nicht. Wir grüßten einander wie alte Freunde, schließlich kannte ich sie gut, denn eigentlich waren diese Mexikaner Inder, und als solche kennt sie die ganze Straße. Die Inder hatten schon seit einer Ewigkeit die beiden indischen Restaurants in unserer Straße mit den unspektakulären Namen Goa und Goa II. Als die Apotheke an der Ecke pleiteging, wollten die Inder sofort expandieren und ein drittes Restaurant eröffnen, wahrscheinlich ein Goa III. Doch die Bezirksleitung oder der Hausbesitzer hielt dagegen. Zu viele Inder.
»Wo bleibt die multikulturelle Vielfalt?«, argumentierten sie, »wir bestehen auf der Gleichberechtigung aller Völker!«
»Kein Problem!«, sagten die Inder und machten einen mexikanischen Laden auf, der nun mit demselben unendlichen Speiseangebot zu erschreckend niedrigen Preisen und mexikanisch klingenden Namen versucht, Kundschaft anzulocken. Doch die treue Kundschaft, die unsere Inder gut und gerne besuchte, als sie noch Inder waren, traute den gleichen Indern als Mexikaner nicht mehr über den Weg. So misstrauisch sind die Menschen hier, so tief sind die Vorurteile in unserer Gesellschaft verankert!