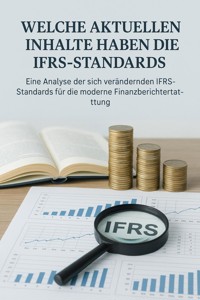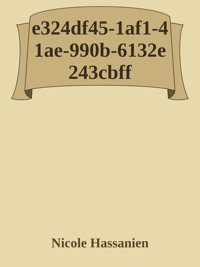
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Der vorliegende Text beleuchtet den aktuellen Stand und die Herausforderungen der Digitalisierung in deutschen Schulen auf Grundlage einer breiten Datenbasis. Dazu wurden zahlreiche Studien und Evaluationen herangezogen, die seit dem Jahr 2010 durchgeführt wurden. Allerdings zeigt sich, dass die schulische Nutzung digitaler Medien hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, da digitale Technologien in erster Linie für die Kommunikation und Unterhaltung verwendet werden. Die Studien fokussieren sich insbesondere auf die digitale Infrastruktur der Schulen, wobei die Internetanbindung, die Verfügbarkeit moderner Geräte sowie der Zugang zu funktionierenden WLAN-Netzwerken im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Die Aus-stattung der Schulen variiert erheblich zwischen den Bundesländern. Zudem sind viele Schulen nach wie vor mit veralteten oder fehlenden Geräten konfrontiert. Der techni-sche Support ist in vielen Fällen unzureichend. Lediglich in 37 % der Schulen werden die Aufgaben der IT-Administration von Fachkräften übernommen, was deutlich unter den Standards liegt, die in Unternehmen üblich sind. In Bezug auf neue Technologien lassen sich für die Zukunft vielversprechende Möglich-keiten ableiten. KI-gestützte Systeme könnten Lehrkräften dabei assistieren, Aufgaben wie die Bewertung oder das Erstellen von Unterrichtsplänen zu automatisieren. Die Anwendung von Technologien wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) eröffnet die Möglichkeit zur Schaffung immersiver Lernumgebungen, welche Schülern praxisnahere und interaktivere Lernmöglichkeiten bieten. Hybrid- und Blended-Learning-Modelle, welche Präsenzunterricht und Online-Lernen kombinieren, könnten zu einem Standard im Bildungswesen avancieren, ebenso wie Gamification-Ansätze, welche das Lernen durch spielerische Elemente motivierender gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Thema
Digitalisierung an den öffentlichen Schulen – Eine Analyse
über den Status – über die Herausforderungen und über die
Zukunftsgedanken neuer Digitalisierungsideen
Dr. Maged Hassanien
Inhaltsverzeichnis.............................................................................................................. 2
Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................... 4
Tabellenverzeichnis .......................................................................................................... 7
1 Summary ................................................................................................................... 8
2 Einleitung – Problemstellung - Forschungsfrage .................................................... 10
3 Grundlagen .............................................................................................................. 12
3.1 Was versteht man unter Digitalisierung im Allgemeinen? ............................. 12
3.2 Was versteht man unter Digitalisierung in öffentlichen Schulen? .................. 14
3.3 Was versteht man unter der Digitalisierung im Unterricht? ........................... 16
3.4 Welche digitalen Technologien können / sollten im Unterricht eingesetzt
werden? ....................................................................................................................... 18
3.5 Welche digitalen Technologien können / sollten in der öffentlichen
Schulverwaltung eingesetzt werden? .......................................................................... 22
3.6 Welche digitalen Technologien können / sollten in der öffentlichen Schule in
der Innen- und Außenkommunikation eingesetzt werden? ......................................... 25
4 Satus der Digitalisierung an den öffentlichen Schulen ........................................... 28
4.1 Status: GEW Sachsen-Studie aus 2022 ........................................................... 29
4.2 Status: Bertelsmann Stiftung-Studie aus 2022 ................................................ 33
4.3 Zusammenfassung der Digitalisierungs-Defizite an deutschen Schulen ........ 49
5 Herausforderungen für eine optimale Digitalisierung der öffentlichen Schulen in
Deutschland ..................................................................................................................... 57
5.1 Bertelsmann Stiftung 2022.............................................................................. 57
5.1.1 Verbesserung der digitalen Kompetenz von Lehrkräften -
Pflichtprogramm im Lehramtsstudium ................................................................... 57
5.1.2 Frei einsetzbare Budgets für die Schul-Fortbildungen – Entwicklung des
Unterrichts weiterentwickeln .................................................................................. 57
5.1.3 Begleitung der Schulentwicklung - Impulse von außen durch Coaching
und Vernetzung ....................................................................................................... 57
5.1.4 Gemeinsame Qualitätssiegel und deutschlandweite Plattformen zur
Bereitstellung geprüfter digitaler Lernmaterialien .................................................. 58
5.1.5 Professionalisierung der Infrastruktur - Mindeststandards in der Technik
und IT-Fachkräfte an den Schulen .......................................................................... 58
5.2 Statista 2023 – Digitaler Wandel an deutschen Schulen ................................. 59
59
5.2.2 Bessere Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte im digitalen Bereich ....... 60
5.2.3 Bessere IT-Betreuung in den Schulen ..................................................... 61
5.2.4 Bessere Vermittlung der Digitalkompetenzen an die Schüler ................ 62
5.2.5 Bessere digitale Bildungsgerechtigkeit durch die Digitalisierung an allen
Schulen 63
5.3 EU-Unterstützung für die Digitalisierung von Schulen 2023 ......................... 68
5.3.1 Aktionsplan der EU-Kommission für digitale Bildung an Schulen ........ 69
5.4 Das Gesamtkonzept der digitalen Schule – Baden-Württemberg ................... 72
5.4.1 Digitale Ausstattung und Infrastrukturelle Bedingungen – Technische
Voraussetzungen schaffen ....................................................................................... 72
5.4.2 Lehrkräfte und Schulverwaltung qualifizieren – Digitale Fortbildungen
73
5.4.3 Digitale Lernmethoden und Lerninhalte im Unterricht verankern – Digital
Lehren und Lernen .................................................................................................. 73
5.4.4 Digitale schulische Prozesse – Informationen und Kommunikation
schaffen – Digitale Organisationsprozesse ............................................................. 74
6 Digitale Schulen – Zukunftsgedanken in deutschen Schulen ................................. 75
6.1 Statista 2024 – Meta-Plattform für Bildung .................................................... 76
6.2 Statista 2024 – Gamification für Bildung ....................................................... 76
6.3 Statista 2024 – Lernen mit Künstlicher Intelligenz für Bildung ..................... 77
6.4 Leibniz-Institut 2020 – aktuelle Projekte im digitalisierten Bildungsbereich 78
6.5 Pädagogische Hochschule Oberösterreich – Friedrich-Schiller-Universität Jena
81
6.6 Telekom Stiftung: Digitale Bildung – Integration digitaler Technik und
Methoden: Ausstattungsmodellierung des „Future Classroom“ ................................. 84
7 Zusammenfassung ................................................................................................... 89
8 Fazit und Ausblick .................................................................................................. 93
Literaturverzeichnis ........................................................................................................ 99
Abbildung 1: Digitalisierung in öffentlichen Schulen – Digitale Infrastruktur im
Vergleich der Schulen (Quelle: GEW Sachsen, 2022). .................................................. 31
Abbildung 2: Arbeitszeit Lehrer – Erhöhung durch Digitale Zeit (Quelle: GEW Sachsen
2022). .............................................................................................................................. 33
Abbildung 3: Programmnutzung bei den Schülern (Quelle: Bertelsmann Stiftung, 2022,
S. 24). .............................................................................................................................. 34
Abbildung 4: Technologie- und anwendungs-Nutzung der Lehrer (Quelle: Bertelsmann
Stiftung, 2022, S. 25). ..................................................................................................... 35
Abbildung 5: Technikmotivierender Unterricht aus Sicht der Schüler (Quelle:
Bertelsmann Stiftung, 2022, S. 26). ................................................................................ 36
Abbildung 6: Digital-Medien-Wechsel im Unterricht (Quelle: Bertelsmann Stiftung,
2022, S. 26). .................................................................................................................... 37
Abbildung 7: Mediennutzung im Unterricht und im privaten Bereich (Quelle:
Bertelsmann Stiftung, 2022, S. 25). ................................................................................ 39
Abbildung 8: Lernformen-Nutzung im Unterricht (Quelle: Bertelsmann Stiftung, 2022,
S. 29). .............................................................................................................................. 40
Abbildung 9: Digitale Mediennutzung im Unterricht aus Sicht Lehrer / Schüler (Quelle:
Bertelsmann Stiftung, 2022, S. 28). ................................................................................ 42
Abbildung 10: Eigene Geräte Verwendung in der Schule (Quelle: Bertelsmann Stiftung,
2022, S. 36). .................................................................................................................... 43
Abbildung 11: Schüleraussagen über eigene Geräte-Verwendung im Unterricht (Quelle:
Bertelsmann Stiftung, 2022, S. 38). ................................................................................ 44
Abbildung 12: Lehreraussagen über eigene Geräte Verwendung im Unterricht (Quelle:
Bertelsmann Stiftung, 2022, S. 38). ................................................................................ 44
Abbildung 13: Motivation bei eigene Geräte Benutzung im Unterricht (Quelle:
Bertelsmann Stiftung, 2022, S. 38). ................................................................................ 45
Abbildung 14: Gefahren bei der Smartphonebenutzung im Unterricht (Quelle:
Bertelsmann Stiftung, 2022, S. 38). ................................................................................ 46
Abbildung 15: Lehreraussagen über Handynutzung im Unterricht (Quelle: Bertelsmann
Stiftung, 2022, S. 39). ..................................................................................................... 47
Abbildung 16: Schulleiter Einschätzung über die IT-Unterstützung in den eigenen
Schulen (Quelle: Bertelsmann Stiftung, 2022, S. 44). .................................................... 48
Abbildung 17: Statistisches Bundesamt – Befragung durch Bitkom 2021:
Digitalisierungseinfluss auf den Schulbereich (Quelle in: Statista 2024, S. 6). ............. 51
Abbildung 18: Statistisches Bundesamt: PISA-Studie – Lernplattformen und tragbare
Computer (Quelle in: Statista 2024, S. 7). ...................................................................... 52
Abbildung 19: Statistisches Bundesamt – Enormer Anstieg der Nutzung von digitalen
Lernformen (Quelle in: Statista 2024, S. 9). ................................................................... 53
Abbildung 20: Statistisches Bundesamt – Kaum Technologieeinsatz in der deutschen
Unterrichtspraxis (Quelle in: Statista 2024, S. 8). .......................................................... 53
Abbildung 21: Statistisches Bundesamt – Investitionen in die Digitalisierung der Schulen
(Quelle in: Statista 2024, S. 10). ..................................................................................... 54
werden (Quelle in: Statista 2024, S. 11). ........................................................................ 55
Abbildung 23: Statistisches Bundesamt – Digitaler Medieneinsatz - Bereiche (Quelle in:
Statista 2024, S. 12). ....................................................................................................... 56
Abbildung 24: Statistisches Bundesamt – Digitaler Medieneinsatz – Onlineplattform
(Quelle in: Statista 2024, S. 12). ..................................................................................... 56
Abbildung 25: Statistisches Bundesamt – Wesentliche Punkte der Digitalisierung -
Personal mit Digitalqualifikationen (Quelle in: Statista 2024, S. 15). .......................... 60
Abbildung 26: Statistisches Bundesamt – Bessere Fortbildung der Lehrkräfte – Umfrage
unter den Schulleitungen (Quelle in: Statista 2024, S. 17). .......................................... 61
Abbildung 27: Statistisches Bundesamt – IT-Fachkräfte zur fachgerechten IT-Betreuung
(Quelle in: Statista 2024, S. 18). ..................................................................................... 62
Abbildung 28: Statistisches Bundesamt – Digitale Kompetenzvermittlung bei den
Schülern (Quelle in: Statista 2024, S. 27). .................................................................... 63
Abbildung 29: Statista 2024 – die IT-Ausstattung ist abhängig vom Einkommen der
Eltern (Quelle in Statista 2024, S. 32). ........................................................................... 65
Abbildung 30: Statista 2024 – Digitale Lücke bezogen auf Geschlecht der Schüler,
Schullaufbahn und Erwerbsstatus der Eltern (Quelle in Statista 2024, S. 33). ............... 65
Abbildung 31: Statista 2024 – Digitale Kompetenzen – Hiervon haben nur ein Teil der
Schulen profitiert (Quelle in Statista 2024, S. 34). ......................................................... 66
Abbildung 32: Statista 2024 – Das Ranking der Länder – Digitalisierungsgrad der
Schulen in den Bundesländer (Quelle in Statista 2024, S. 35). ...................................... 66
Abbildung 33: Statista 2024 - Gutes und stabiles Internet (Breitbandverfügbarkeit) –
Einteilung nach Stadt- und Gemeindetyp (Quelle in Statista 2024, S. 36). .................... 67
Abbildung 34: Statista 2024 – Quote der Glasfaseranschlüsse – Nach Landeshauptstädten
Deutschlands (Quelle in Statista 2024, S. 37). ................................................................ 68
Abbildung 35: Aktionsplan 1 der EU mit 3 Prioritätsebenen (Quelle im: EU-
Sonderbericht 2023, S. 11). ............................................................................................. 69
Abbildung 36: Aktionsplan 2 der EU mit 2 überarbeiteten Kern-Prioritäten (Quelle im:
EU-Sonderbericht 2023, S. 12). ...................................................................................... 70
Abbildung 37: Etappenziele und Maßnahmen zur EU-Unterstützung der Digitalisierung
von deutschen Schulen (Quelle im: EU-Sonderbericht 2023, S. 83). ............................. 71
Abbildung 38: Statista 2024: Meta-Plattform für eine einheitliche, digitale
Bildungsplattform (Quelle in: Statista 2024, S. 40). ....................................................... 76
Abbildung 39: Statista 2024 – Gamification – Spaß am spielerischen Lernen (Quelle in:
Statista 2024, S. 41). ....................................................................................................... 77
Abbildung 40: Statista 2024 – KI-Anwendungen in schulischen Lernprogrammen (Quelle
in: Statista 2024, S. 42). .................................................................................................. 78
Abbildung 41: Digi-KomP – Kompetenzmodell (Quelle in: Brandhöfer et al., S. 1). ... 83
Abbildung 42: Merkmale der Zukunftsausstattung des optimalen digitalen
Klassenraumes (Quelle in: Telekom Stiftung 2020, S. 7)............................................... 85
Abbildung 43: Vernetungs-Apps / Analoge und digitale Lernräume für die
Unterrichtseinheiten in digitalen Klassenräumen (Quelle in: Telekom Stiftung 2020, S.
13). .................................................................................................................................. 86
Tabelle 1: Beispiel einer Tabelle. ............................ Fehler! Textmarke nicht definiert.
Der vorliegende Text beleuchtet den aktuellen Stand und die Herausforderungen der Di-gitalisierung in deutschen Schulen auf Grundlage einer breiten Datenbasis. Dazu wurden zahlreiche Studien und Evaluationen herangezogen, die seit dem Jahr 2010 durchgeführt wurden. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass nahezu alle Jugendlichen in der digitalen Welt aktiv sind, wobei sie vorrangig auf Smartphones als Plattformen zurückgreifen. Im Ver-lauf der Adoleszenz wird die Nutzung digitaler Medien für schulische Zwecke intensi-viert, wobei die Recherche von Informationen und die Anfertigung von Hausarbeiten be-sonders hervorzuheben sind. Allerdings zeigt sich, dass die schulische Nutzung digitaler Medien hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, da digitale Technologien in erster Linie für die Kommunikation und Unterhaltung verwendet werden.
Die Studien fokussieren sich insbesondere auf die digitale Infrastruktur der Schulen, wo-bei die Internetanbindung, die Verfügbarkeit moderner Geräte sowie der Zugang zu funk-tionierenden WLAN-Netzwerken im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Die Ausstat-tung der Schulen variiert erheblich zwischen den Bundesländern. Zudem sind viele Schu-len nach wie vor mit veralteten oder fehlenden Geräten konfrontiert. Der technische Sup-port ist in vielen Fällen unzureichend. Lediglich in 37 % der Schulen werden die Aufga-ben der IT-Administration von Fachkräften übernommen, was deutlich unter den Stan-dards liegt, die in Unternehmen üblich sind.
Ebenso stellt die Förderung der Medienkompetenz des Lehrkörpers eine bedeutsame Her-ausforderung dar. Ein Großteil der Lehrkräfte zeigt Unsicherheiten im Umgang mit digi-talen Tools, was sich negativ auf die Qualität des Unterrichts auswirkt. Die Studien bele-gen, dass sowohl die technische Bedienung von Geräten wie Smartboards als auch die Integration digitaler Lehrmethoden vielfach als problematisch erachtet werden. In einer aktuellen Studie äußerten rund 71 % der Schüler die Meinung, dass ihre Lehrer nicht über die erforderlichen digitalen Kompetenzen verfügen, um adäquat mit sozialen Medien um-zugehen. Des Weiteren äußern zahlreiche Lehrkräfte, dass ihre unzureichenden digitalen Kompetenzen eine Barriere für die Verwendung digitaler Medien im Unterricht darstel-len.
Die Teilnahme an Fortbildungen und Schulungen zu digitalen Themen ist für Lehrkräfte von essentieller Bedeutung, jedoch zeigt sich in der Praxis, dass lediglich etwa die Hälfte der Lehrkräfte regelmäßig an Weiterbildungen zu digitalen Themen teilnimmt. Besonders im Lehramtsstudium besteht noch erheblicher Nachholbedarf, da zukünftige Lehrkräfte nicht adäquat auf den Einsatz digitaler Medien im Unterricht vorbereitet werden. Ein wei-teres Problem stellt die fehlende didaktische Transformation dar. Der traditionelle Fron-talunterricht ist nach wie vor vorherrschend, und digitale Technologien werden häufig lediglich zur Recherche oder für einfache Präsentationen genutzt, ohne dass es zu einer tiefgreifenden didaktischen Veränderung kommt.
In Bezug auf neue Technologien lassen sich für die Zukunft vielversprechende Möglich-keiten ableiten. KI-gestützte Systeme könnten Lehrkräften dabei assistieren, Aufgaben wie die Bewertung oder das Erstellen von Unterrichtsplänen zu automatisieren. Die eröffnet die Möglichkeit zur Schaffung immersiver Lernumgebungen, welche Schülern praxisnahere und interaktivere Lernmöglichkeiten bieten. Hybrid- und Blended-Learn-ing-Modelle, welche Präsenzunterricht und Online-Lernen kombinieren, könnten zu ei-nem Standard im Bildungswesen avancieren, ebenso wie Gamification-Ansätze, welche das Lernen durch spielerische Elemente motivierender gestalten.
Ein wesentlicher Aspekt künftiger Entwicklungen wird die zunehmende Bedeutung der Datenanalyse im Bildungsprozess sein. Die Verwendung von Daten ermöglicht eine de-taillierte Verfolgung von Lernfortschritten sowie die Einleitung gezielter Fördermaßnah-men für Schüler:innen, die Unterstützung benötigen. Gleichzeitig sehen sich Schulen mit der Herausforderung konfrontiert, den Datenschutz und die Datensicherheit zu gewähr-leisten, insbesondere im Kontext der Nutzung von Cloud-Diensten und digitalen Plattfor-men.
Für die Schüler bedeutet die fortschreitende Digitalisierung des Schulalltags, dass sie sich zunehmend Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien aneignen müssen, um den Anforderungen des modernen Schullebens gerecht zu werden. Die Schüler werden lernen, ihre Aufgaben eigenständiger zu organisieren und ihre Medienkompetenz zu stärken, um kritisch mit digitalen Informationen umgehen zu können. Die Abgrenzung zwischen schulischen und außerschulischen Aktivitäten wird jedoch zunehmend erschwert, da di-gitale Lernressourcen jederzeit und überall verfügbar sind.
Die dargelegte Thematik verdeutlicht, dass die Digitalisierung das Potenzial besitzt, die Gestaltung des Unterrichts grundlegend zu verändern sowie flexiblere und stärker auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Lernansätze zu ermöglichen. Gleichzeitig müssen jedoch auch weiterhin bestehende Herausforderungen in Bezug auf die infrastrukturelle Ausstattung, die digitale Kompetenz von Lehrkräften sowie die Chancengleichheit be-rücksichtigt werden. Um das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen zu können, ist es erforderlich, dass Schulen ihre Infrastruktur weiter ausbauen und Lehrkräfte umfas-send fortbilden. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass alle Schüler und Schüle-rinnen gleichermaßen Zugang zu digitalen Ressourcen haben, um eine Verstärkung sozi-aler Ungleichheiten zu verhindern.
Die fortschreitende Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens grundlegend transformiert, sodass auch das Bildungswesen hiervon nicht ausgenommen ist. Der Begriff "Digitalisierung" umfasst an öffentlichen Schulen nicht nur den Einsatz von Computern und Tablets im Unterricht, sondern auch die Integration digitaler Technologien in Verwaltung, Kommunikation und didaktische Konzepte. Die Zielsetzung der Digitalisierung im schulischen Kontext besteht in der Op-timierung von Lernprozessen, der Steigerung der Unterrichtsqualität sowie der Vorberei-tung der Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen einer zunehmend digitali-sierten Welt. Zu den genannten Maßnahmen zählt der Einsatz von Lernmanagementsys-temen, cloudbasierten Tools, interaktiven Whiteboards sowie die Vernetzung von Schü-lern und Lehrern über digitale Plattformen. Die Digitalisierung ist jedoch mit einer Reihe von Chancen und Herausforderungen verbunden, die sowohl den Lehr- und Lernprozess als auch die organisatorischen Abläufe in Schulen betreffen und es erforderlich machen, adäquate Maßnahmen zu ihrer Bewältigung zu ergreifen.
Status der Technologien an Schulen
Der Digitalisierungsgrad öffentlicher Schulen variiert weltweit sowie innerhalb einzel-ner Länder erheblich. Einige Schulen verfügen bereits über eine moderne IT-Infrastruk-tur, welche den Einsatz von Tablets oder Laptops für jeden Schüler sowie digitalen Lernplattformen ermöglicht, wodurch der Unterricht erleichtert wird. Andere Schulen hingegen verfügen noch nicht einmal über eine zuverlässige Internetverbindung in den Klassenzimmern. Obgleich der Einsatz digitaler Technologien wie Lernmanagement-systeme, interaktive Whiteboards und Videoplattformen in zahlreichen Bildungsinstitu-tionen bereits zum Alltag zählt, besteht an anderen Schulen weiterhin Aufholbedarf. Diese hinken in puncto Digitalisierung hinterher, was sich in veralteten Geräten, unzu-reichenden Weiterbildungsmöglichkeiten für das Lehrpersonal sowie einer mangelnden technischen Unterstützung manifestiert. Die ungleiche Verteilung digitaler Ressourcen ist ein wesentliches Hindernis für die Förderung gleicher Bildungsmöglichkeiten für alle. Sie birgt das Risiko einer Verstärkung bestehender Disparitäten.
Probleme und Herausforderungen der Digitalisierung an Schulen
Obgleich die Relevanz digitaler Technologien kontinuierlich zunimmt, sind bei der Im-plementierung digitaler Bildungskonzepte an öffentlichen Schulen eine Vielzahl von Herausforderungen zu beobachten. Ein zentrales Problem stellt die unzureichende Infra-struktur dar. Viele Schulen verfügen nicht über ausreichend schnelle Internetverbindun-gen, leistungsfähige Geräte oder technische Unterstützung. Eine weitere wesentliche Herausforderung stellt der Datenschutz dar, insbesondere im Kontext der Nutzung von Cloud-Diensten und digitalen Plattformen, welche personenbezogene Daten von Schü-lern und Lehrern speichern. Als weitere Herausforderung ist der Mangel an systemati-scher Fortbildung für Lehrkräfte zu nennen, die vielfach nicht über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, um digitale Werkzeuge sinnvoll in den Unterricht zu integrie-ren. Des Weiteren ergeben sich Herausforderungen im Bereich der Chancengleichheit. Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch schwächeren Familien sind vielfach mit tal gestütztem Unterricht erheblich erschwert.
Zukunftsgedanken: Neue Technologien und Unterrichtskonzepte an Schulen
Die Digitalisierung des Bildungswesens lässt die Entwicklung innovativer Lehr- und Lernkonzepte sowie moderner Technologien erwarten, die das Potenzial haben, die Art und Weise, wie Schüler*innen lernen, nachhaltig zu verbessern. In Anbetracht der fort-schreitenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen er-scheint eine verstärkte Fokussierung auf personalisiertes Lernen zunehmend wahr-scheinlich. Die genannten Technologien erlauben eine automatische Anpassung der Lerninhalte und Aufgaben an die individuellen Bedürfnisse und Lernstände der Schüler. Gleichzeitig könnten immersive Technologien, wie Augmented Reality (AR) und Vir-tual Reality (VR), dazu beitragen, das Lernen interaktiver und praxisorientierter zu ge-stalten. Dies wird ermöglicht durch die Schaffung virtueller Klassenräume und Simula-tionen, die in der physischen Welt nur schwer umsetzbar wären. Des Weiteren wird eine Zunahme an hybriden Lernmodellen prognostiziert, welche sowohl Präsenzunterricht als auch Online-Lernen kombinieren. Die genannten Modelle erlauben die Realisierung flexiblerer Lernstrukturen, welche den spezifischen Bedürfnissen der Lernenden ent-sprechen.
Ableitung einer Problemstellung