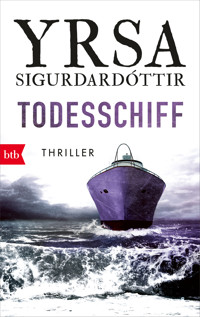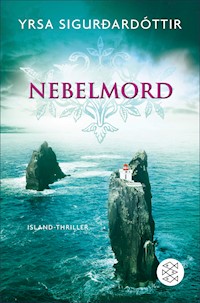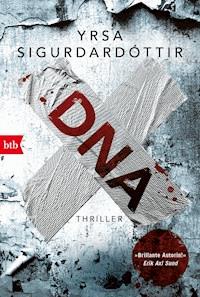
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar Huldar und Psychologin Freyja
- Sprache: Deutsch
Jetzt als 6-teilige Serie unter dem Titel "Reykjavík 112" in der ARTE-Mediathek.
Er schlägt erbarmungslos zu. Wie aus dem Nichts. Zuerst trifft es eine junge Familienmutter nachts in ihrer Wohnung in Reykjavik. Einzige Zeugin ist ihre siebenjährige Tochter, die wider Erwarten den Angriff übersteht. Als wenig später eine zweite Frau unter ähnlich brutalen Vorzeichen ihr Leben verliert, steht die Polizei vor einem Rätsel.
Kommissar Huldar, der die Ermittlungen leitet und sich erstmals in einem so wichtigen Fall beweisen muss, hat darüber hinaus ein weiteres Problem. Er ist gezwungen, mit der Psychologin Freyja zusammenzuarbeiten, mit der er vor kurzem nach einer Kneipentour unter falschen Angaben die Nacht verbracht hat. Währenddessen beschließt ein junger Amateurfunker, auf eigene Faust zu ermitteln, nachdem ihn kryptische Botschaften zu den beiden Opfern erreichen. Dass er sich damit selbst in Gefahr bringt, kann er nicht wissen.
Der erste Band der Erfolgsreihe um Kommissar Huldar und Psychologin Freyja.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Er schlägt erbarmungslos zu. Wie aus dem Nichts. Zuerst trifft es eine junge Familienmutter nachts in ihrer Wohnung in Reykjavik. Einzige Zeugin ist ihre siebenjährige Tochter, die wider Erwarten den Angriff übersteht. Als wenig später eine zweite Frau unter ähnlich brutalen Vorzeichen ihr Leben verliert, steht die Polizei vor einem Rätsel. Kommissar Huldar, der die Ermittlungen leitet und sich erstmals in einem so wichtigen Fall beweisen muss, hat darüber hinaus ein weiteres Problem. Er ist gezwungen, mit der Psychologin Freyja zusammenzuarbeiten, mit der er vor Kurzem nach einer Kneipentour unter falschen Angaben die Nacht verbracht hat. Währenddessen beschließt ein junger Amateurfunker, auf eigene Faust zu ermitteln, nachdem ihn kryptische Botschaften zu den beiden Opfern erreichen. Dass er sich damit selbst in Gefahr bringt, kann er nicht wissen.
Nummer-1-Bestsellerautorin Yrsa Sigurdardóttir zeigt erneut, mit welcher Raffinesse sie ihre Leser in Atem hält. DNA ist der Start einer neuen Serie um die Psychologin Freyja und Kommissar Huldar.
Zur Autorin
YRSA SIGURDARDÓTTIR, geboren 1963, ist eine vielfach ausgezeichnete Bestsellerautorin, deren Spannungsromane in über 30 Ländern erscheinen. Sie zählt zu den »besten Kriminalautoren der Welt« (Times Literary Supplement). Sigurdardóttir lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Reykjavík. DNA ist Start einer neuen Serie um die Psychologin Freyja und Kommissar Huldar von der Kripo Reykjavik.
Yrsa Sigurdardóttir
DNA
Thriller
Aus dem Isländischenvon Anika Wolff
Dieses Buch ist Palli gewidmet.
Beim Schreiben dieses Romans hat mich Bragi Guðbrandsson mit Informationen zu Jugendamt und Kinderhaus versorgt, Þorleikur Jóhannesson und Hallgrímur Gunnar Sigurðsson haben mir Fakten rund um die Telekommunikation geliefert – Ersterer insbesondere zum Amateurfunk, Letzterer zur staatlichen Kontrolle der Telekommunikation. Dafür meinen besten Dank! Mögliche Fehler in diesen Bereichen nehme ich auf meine Kappe.
Yrsa
1987
PROLOG
Wie die Orgelpfeifen saßen sie auf der Bank. Die Kleine ganz am Rand, daneben ihre beiden älteren Brüder. Ein, drei und vier Jahre alt. Die dünnen Beinchen hingen über die harte Kante. Im Gegensatz zu anderen Kindern zappelten sie nicht herum oder schlenkerten mit den Beinen. Die neuen Schühchen schwebten regungslos über dem glänzenden Linoleumboden. Kein Funke Neugier regte sich in den Gesichtern der Kinder, keine Langeweile oder Ungeduld. Sie starrten auf eine nackte weiße Wand, als liefe dort ein Tom-und-Jerry-Film. Von weitem sah es wie ein Foto aus: drei Kinder auf einer Bank.
Schon seit einer halben Stunde saßen sie so. Bald würde man sie aufstehen lassen, doch keiner der Erwachsenen, die sie aus der Ferne beobachteten, schien es damit eilig zu haben. Das Leben dieser Kinder war komplett auf den Kopf gestellt worden, doch das war nichts im Vergleich zu dem, was ihnen noch bevorstand. Sobald sie diesen Ort verließen, würde nichts mehr so sein wie zuvor. Diesmal würde die Veränderung zwar eine zum Guten hin sein, doch sie würde auch Verluste mit sich bringen. Allein die Zeit konnte zeigen, was schwerer wog. Und genau da lag das Problem. Niemand konnte vorhersagen, wie es laufen würde. Daher das Zögern bei denjenigen, die jetzt eine Entscheidung treffen mussten.
»Leider. Wir haben keine Alternative. Auch die Fachleute raten uns zu dieser Lösung. Die Kinder brauchen ein Zuhause, es nützt nichts, das noch länger aufzuschieben. Je älter sie werden, desto unwahrscheinlicher wird es, dass jemand sie adoptieren will. Seht euch doch an, wie unterschiedlich die Suche nach Familien für die Geschwister gelaufen ist. Die Leute wissen: Je jünger die Kinder sind, desto leichter gewöhnen sie sich an ein neues Leben. In zwei Jahren ist die Kleine so alt wie der jüngere der beiden Brüder, und dann sind wir mit ihr wieder in genau derselben Situation.« Der Mann holte tief Luft und wedelte mit einem Stapel Papier – Berichte und Diagnosen der Spezialisten, die sich die Kinder angesehen hatten. Die anderen nickten mit ernsten Gesichtern, nur die jüngste Anwesende nicht, die am beharrlichsten gegen die angepriesene Lösung argumentiert hatte. Sie hatte noch wenig Erfahrung in Jugendschutzangelegenheiten und trug noch den Optimismus in sich, den die vielen Enttäuschungen in den anderen längst erstickt hatten.
»Sollten wir nicht doch noch warten? Wer weiß, vielleicht finden wir ja noch ein Ehepaar, das sich zutraut, alle drei zu nehmen.« Sie warf einen Blick in Richtung der Kinder, die noch immer wie versteinert auf der Bank saßen. Die junge Frau hatte die Arme fest verschränkt, als wollte sie verhindern, dass Hoffnung und Zuversicht aus ihr heraussickerten. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie die Geschwister ausgesehen hatten, als der Fall bei ihnen gelandet war: schrecklich abgemagert, das dunkle Haar zerzaust und ungewaschen, die Kleider schmutzig. Hellblaue Augen in verschmierten Gesichtern, auf denen Tränen Spuren hinterlassen hatten. Die junge Frau wandte sich wieder der Gruppe zu. »Das muss doch einfach klappen.«
»Damit bin ich durch«, erwiderte der Mann mit den Berichten gereizt. Er blickte zum dritten Mal während dieser Sitzung auf seine Armbanduhr – er hatte seinen Kindern einen Kinobesuch versprochen. »Um die Kleine reißen sich alle, aber die Jungs will kaum einer haben. Wir können dankbar sein, dass wir diese Lösung gefunden haben. Die Suche nach irgendeinem imaginären Ehepaar ist zwecklos. Jeder, der Kinder adoptieren will, meldet sich bei uns, und diese Liste haben wir zigmal durchforstet. Unsere Lösung ist in dieser Situation einfach das Vernünftigste.«
Dem konnte niemand widersprechen, und alle nickten ernst, bis auf die junge Frau. Sie wirkte richtig verzweifelt. »Aber sie sind sich so nah. Ich habe Sorge, dass die Trennung sie auf Lebenszeit beschädigen wird.«
Diesmal wurden die Berichte so energisch durch die Luft geschwenkt, dass die Haare aller Anwesenden aufflogen. »Zwei Psychologen sagen, dass es für die beiden Jüngsten sogar gut wäre, getrennt zu werden. Der Junge begluckt das Mädchen auf eine Art, die nicht mehr normal ist. Er versucht, ihr die Liebe und Fürsorge zu geben, die er selbst nicht bekommen hat, dabei ist er selbst noch ein Kleinkind. Sie entkommt kaum seinem Eifer, und er ist völlig gestresst vor lauter Sorge um seine Schwester. Er ist drei Jahre alt.«
Der Mann machte eine Pause und holte Luft. »Und das steht nicht etwa irgendwo zwischen den Zeilen – das ist überdeutlich. Beiden würde es guttun, ohne den anderen zu sein. Seine Beziehung zu ihr ist nicht gesund. Den beiden Brüdern hat die ganze Sache ja deutlich mehr zugesetzt als der Kleinen. Sie sind schließlich älter.«
Aus dem Augenwinkel nahmen einige der Kollegen Bewegung auf der Bank wahr. Der jüngere Bruder war näher an seine Schwester herangerückt. Jetzt legte er den Arm um ihre Schultern und drückte sie fest an sich. Als hätte er durch die Glasscheibe gehört, was sie gesagt hatten.
Jetzt schaltete sich eine weitere Kollegin ein: »Ich denke, wir sollten uns nicht anmaßen, diese Einschätzung anzuzweifeln. Das sind Fachleute, und die Situation dieser Kinder liegt jenseits dessen, was wir uns vorstellen können. Lasst es uns jetzt schnell durchziehen. Es wäre albern, weiter nach irgendeiner Zauberlösung zu suchen. Die gibt es einfach nicht.« Die Frau sprach schnell und klopfte ungeduldig mit einem Fuß den Takt zu ihren Worten – auch sie hatte es eilig.
»Aber was passiert später, wenn sie älter geworden sind und dahinterkommen, dass die Trennung möglicherweise auch hätte verhindert werden können? Die meisten von uns wissen zur Genüge, was passiert, wenn Menschen einen Hass aufs System kriegen. Dann dreht sich das Leben nur noch darum«, warf der älteste Anwesende ein. Er sehnte sich nach dem Ruhestand und hoffte, dass dies der letzte schwierige Fall war, mit dem er sich herumschlagen musste. Sein Haar war schon vor langer Zeit weiß geworden, er nahm Blutdrucksenker, und sein Gesicht sah aus, als hätte die Zeit Runen hineingeritzt.
»Die Adoptiveltern werden die Herkunft der Kinder geheim halten. Das ist für alle das Beste, vor allem für die beiden jüngsten. Das sollte also kein Problem sein. Die Kinder werden sich bestimmt ohnehin nicht an ihre ersten Lebensjahre erinnern. Das Mädchen ist schließlich erst gut ein Jahr alt, nur bei dem großen Jungen könnte es anders sein. Aber auch das ist nicht gesagt. Seine Erinnerungen werden verzerrt sein und langsam verblassen. Was wisst ihr noch aus der Zeit, als ihr vier Jahre alt wart?«
»Eine ganze Menge.« Die junge Frau war offenbar die Einzige, die über so frühe Kindheitserinnerungen verfügte. Die anderen konnten sich höchstens an traumähnliche, verschwommene Bruchstücke erinnern. Doch auch sie wusste nichts mehr aus der Zeit, als sie ein Jahr alt gewesen war. Das kleine Mädchen, um das sich alle rissen, würde am besten davonkommen – nicht nur, weil sie ein so süßes Persönchen war. Den Jungen hatten die letzten Jahre arg zugesetzt, das merkte man deutlich: beim jüngeren an seiner ungebremsten Liebe und Fürsorge, beim älteren an seiner Gleichgültigkeit gegenüber allem und jedem. Der knappe Bericht der Polizisten, die nach einem Anruf der Mutter zum Ort des Geschehens gefahren waren, hatte alle schockiert, und niemand verspürte Lust, sich die Schilderungen noch einmal ins Gedächtnis zu rufen.
In der Tat, es wäre ein Segen, wenn die Zeit diese Erinnerungen aus den Köpfen der Geschwister löschen könnte.
Doch leider bezweifelte die junge Frau, dass es so kommen würde. Das Trauma der Kinder musste gigantisch sein. »Ich erinnere mich vor allem an schlimme Dinge, die passiert sind, zum Beispiel als ich mir mit drei Jahren den Finger in der Tür einer Bäckerei eingeklemmt habe, oder als ich als Fünfjährige mitansehen musste, wie meine Freundin angefahren wurde. Und das ist nichts im Vergleich zu dem, was diese Geschwister mitgemacht haben. Ich befürchte, dass sich die Jungs daran erinnern werden. Vielleicht sogar ihre Schwester, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist.«
»Wie sieht es eigentlich mit den Verwandtschaftsverhältnissen aus, sind die inzwischen geklärt?«, fragte die ungeduldige Kollegin eilig, um zu verhindern, dass die Anwesenden sich in Kindheitserinnerungen verloren. »Wahrscheinlich sind sie noch nicht einmal richtige Geschwister, daher stellt sich sowieso die Frage, wie viel Aufwand wir betreiben sollten, um sie zusammenzuhalten.«
Mit seiner Antwort schaffte es der Mann mit den Berichten endlich auch einmal, bei seiner jungen, besorgten Kollegin zu punkten: »Ich denke, es ist nebensächlich, ob sie denselben Vater haben oder nicht. Sie empfinden sich als Geschwister. Aber solange der Vater der beiden Jüngeren offiziell unbekannt ist, wissen wir es einfach nicht. Der Arzt, der sich die Kinder angesehen hat, hält es für wahrscheinlich, dass die beiden jüngeren Vollgeschwister sind und der älteste ihr Halbbruder ist. Das erklärt auch der Mann, der als der Vater des ältesten Jungen gilt. Er hat ausgesagt, nach der Geburt seines Sohnes mit der Mutter nicht mehr sexuell verkehrt zu haben – nachdem sie gezwungen war, zu ihrem Vater zurückzukehren.« Er schwieg und verzog das Gesicht. Schluckte, dann sprach er weiter. »Man müsste Gentests machen, um die Verwandtschaft der Kinder eindeutig zu klären, aber dafür haben wir weder Zeit noch Geld. Und das Ergebnis will ohnehin niemand wissen. Es ist besser, davon auszugehen, dass sie normale Väter haben. Nicht nur der Älteste, sondern alle drei.«
Stille. Sie alle kannten die Geschichte der Kinder und ihrer Mutter. Die Geschichte des Großvaters und des schrecklichen Verbrechens an seiner Tochter, dessen er verdächtigt wurde. Nun lag das Schicksal dreier kleiner Kinder mit vernarbten Seelen in ihren Händen. Was sollten sie tun?
Die junge Kollegin brach das Schweigen: »Was ist mit dem Vater, diesem Þorgeir? Ist es ausgeschlossen, dass er seine Meinung ändert?«
»Wir haben alles versucht. Er kann oder will den Jungen nicht nehmen. Geschweige denn alle drei. Er hatte keinerlei Kontakt zu seinem Sohn und ist sich noch nicht einmal hundertprozentig sicher, ob er wirklich der Vater ist. Er hat die Vaterschaft anerkannt, weil er eine kurze Beziehung zur Mutter hatte, aber er sagt, dass er nie sicher wusste, ob er ihr einziger Liebhaber war. Wenn man ihn zwingen will, den Jungen aufzunehmen, muss man erst einen Vaterschaftstest machen. Das verzögert die Sache, und mal ganz abgesehen vom möglichen Ergebnis sehe ich auch nicht, dass er ein wünschenswerter Vater für die Kinder wäre. Und sollte er nicht der Vater sein, wäre das Ganze ohnehin zwecklos. Dann würde er ihn erst recht nicht aufnehmen. Wäre das gut für den Jungen? Ich denke nicht.« Die Männer warfen sich Blicke zu und schienen diese Argumentation besser nachvollziehen zu können als die Frauen, die vor sich hin starrten.
»Es ist die beste Lösung.« Diesmal verkniff er es sich, mit den Blättern zu wedeln. Stattdessen klopfte er auf den Stapel. »Wir haben leider keine Zeitmaschine, die uns vorhersagt, dass es ihnen gut ergehen wird. Das Einzige, worauf wir bauen können, ist die Einschätzung der Experten. Alle Adoptiveltern sind überprüft worden und haben hervorragende Empfehlungen bekommen. Ich schlage vor, dass wir es hinter uns bringen. Die Personalien der Kinder werden im System geändert, und mit der Zeit wird ihre bemitleidenswerte Herkunft in Vergessenheit geraten. Für die Kinder wäre es ein Segen, ihre Vergangenheit nie herauszufinden, und die Trennung wird ihnen das Vergessen leichter machen. Je früher sie ein neues Leben beginnen, desto besser. Sind wir uns in diesem Punkt nicht alle einig?«
Die junge Kollegin öffnete den Mund, um etwas zu sagen, ließ es aber dann bleiben. Die anderen nuschelten schnell etwas Zustimmendes, als wollten sie jeglichen weiteren Protest im Keim ersticken. Die junge Frau drehte sich um und schaute durch die Glasscheibe zu den drei Kindern. Das kleine Mädchen versuchte vergeblich, sich aus dem Arm ihres Bruders zu befreien, der es nur noch fester an sich drückte. Es sah beinahe so aus, als würde er ihr wehtun. Vielleicht war an der Einschätzung der Experten doch mehr dran, als sie hatte eingestehen wollen. Sie wandte sich wieder der Gruppe zu und nickte müde.
Damit war die Sache beschlossen.
Während die nötigen Formalitäten erledigt wurden, löste die Gruppe sich auf. Die junge Frau blieb im Flur stehen und würde so als Einzige Zeugin des Moments werden, in dem die Kinder in ihr neues Leben geschickt wurden. Das alte ließen sie nicht ohne Protest zurück – so wie Kinder auch den warmen Mutterleib nicht stumm aufgaben. Vor allem dem kleineren Jungen schien die Trennung zuzusetzen. Er heulte und schrie, als er seine Schwester auf dem Arm eines Kinderarztes den Flur hinunter verschwinden sah. Das Mädchen starrte über die Schulter des Arztes zurück und winkte mit versteinertem Blick. Dadurch wurde alles nur noch schlimmer. Ein Mann im Kittel musste alle Kraft aufwenden, um den Jungen festzuhalten. Als der Kleine merkte, dass er keine Chance hatte, wurde aus seinem Schreien ein Weinen.
Die junge Frau stand wie erstarrt. Auch sie trug die Verantwortung für das, was hier geschah, und sie musste Manns genug sein, den Folgen in die Augen zu sehen. Der ältere Junge nahm die Situation etwas besser auf. Doch obwohl er sich nicht körperlich wehrte und auch nicht weinte, sagte die Panik in seinem Blick alles, was gesagt werden musste. Vermutlich waren die Geschwister noch nie zuvor getrennt gewesen.
Ohne eine Träne zu vergießen, verfolgte die junge Frau, wie die Jungen auf demselben Wege verschwanden wie ihre Schwester.
Als sie schließlich aufbrach, war auf ihrem Weg durchs Krankenhaus nichts mehr von den Kindern zu sehen. Auch nicht am Ausgang oder auf dem halbleeren Parkplatz davor.
Ihr neues Leben hatte sie mit Haut und Haaren verschluckt.
2015
1. KAPITEL
Elísa braucht einen Moment, um sich zu orientieren. Sie liegt auf der Seite, die zerknüllte Decke zwischen den Beinen und das zusammengestauchte Kissen unter der Wange. Im Raum ist es dunkel, durch den Spalt zwischen den Gardinen sind der schwarze Himmel und Sterne zu sehen, die aus der unendlichen Weite des Alls zu ihr herunterfunkeln. Auf der anderen Seite des Doppelbetts eine glatt gestrichene Decke und ein unberührtes Kopfkissen. Die Stille ist ihr fremd; sie vermisst das Schnarchen, das ihr schon den Schlaf und den letzten Nerv geraubt hat. Und auch die Wärme ihres Mannes, der immer wie ein Ofen glüht. Wegen ihm muss sie nachts oft ein Bein unter der Decke hervorschieben. Aus alter Gewohnheit hat sie sich auch diesmal so hingelegt, doch jetzt ist ihr kalt.
Als sie sich richtig zudeckt, spürt sie die Gänsehaut an ihren Beinen. Das erinnert sie an Sigvaldis Nachtschichten, doch diesmal wird er nicht in aller Herrgottsfrühe zurückkommen, gähnend und mit Ringen unter den Augen. Nach Krankenhaus riechend. Erst in einer Woche wird er von der Konferenz zurück sein. Als er sich gestern am Busbahnhof mit einem Kuss von ihr verabschiedet hat, war ihm anzusehen, dass er die Abschiedsszene kürzer halten wollte als sie. Wenn sie ihn richtig einschätzt, kommt er nach einem neuen Rasierwasser aus dem Duty-free-Shop duftend zurück, und sie muss eine Woche lang mit der Nase in der Ellbogenbeuge schlafen, bis sie sich an den neuen Geruch gewöhnt hat.
Sie vermisst ihn, doch irgendwie freut sie sich auch auf das vorübergehende Alleinsein. Es liegen Tage vor ihr, an denen nur sie entscheidet, was auf dem Bildschirm erscheint, und sie keine Rücksicht auf Fußballspiele dieser oder jener Mannschaft nehmen muss. Abende, an denen sie einfach nur Brot mit Käse essen kann, ohne sich den Rest des Abends das Gemecker über einen angeblich knurrenden Magen anhören zu müssen.
Doch so eine freie Woche hat nicht nur Vorteile – sie muss sich ganz allein um die drei Kinder kümmern: sie wecken, fertig machen, bringen und abholen, bringen und abholen, bei den Hausaufgaben helfen, bespaßen, die Computerzeit kontrollieren, kochen, baden, Zähne putzen, ins Bett bringen. Zweimal in der Woche müssen Margrét zum Ballett und Stefán und Bárður zum Karatetraining gebracht werden. Sich damit abzufinden, dass die Kinder im Grunde weder besonderes Talent für diese Freizeitbeschäftigungen haben noch ein echtes Interesse daran zeigen, ist für Elísa eine der härtesten Zerreißproben – zumal der Spaß ja auch nicht gerade kostenlos ist. Jedenfalls wirkt es auf sie immer so, als würden die Kinder sich langweilen. Nie sind sie im Takt mit der Gruppe, sie landen häufiger als die anderen auf dem Boden, und dann stehen sie verdutzt und mit roten Wangen da und starren ihre Kameraden an, die immer alles richtig machen. Vielleicht ist es aber auch andersherum, vielleicht sind ihre Kinder die Einzigen, die sich richtig bewegen.
Elísa liegt still und spürt, wie sich die Schwere des Schlafes langsam löst. Auf dem Nachttisch leuchtet der Wecker, der beim Aufwachen normalerweise ihren Hass abbekommt. Doch diesmal hat sie nicht den Drang, ihn auf den Boden zu pfeffern. Die grün strahlenden Ziffern sehen im Dunkeln radioaktiv aus. Sie sagen ihr, dass sie noch ein paar Stunden weiterschlafen darf. Ihr müder Kopf weigert sich, auszurechnen, wie viele genau es sind. Außerdem hat sie eine viel wichtigere Frage: Warum ist sie eigentlich aufgewacht?
Elísas müde Augen brennen vom grellen Schein des Weckers. Sie rollt sich auf die andere Seite und schlägt sich erschrocken die Hand vor den Mund, als sie die schwarzen Umrisse von jemandem sieht, der am Bett steht. Doch sie beruhigt sich schnell wieder, als sie begreift, dass es Margrét ist, ihre Erstgeborene, die schon immer anders getickt hat als andere Kinder. Und selten glücklich ist. Wegen Margrét also ist sie aufgewacht. »Margrét, Schatz, warum schläfst du nicht?« Ihre Stimme klingt ganz rau. Sie sieht ihrer Tochter in die Augen. Im Dunklen wirken sie ganz schwarz. Rotes Haar lockt sich um das totenblasse Gesicht und steht zu allen Seiten ab.
Margrét krabbelt über die glatte Decke ihres Vaters zu ihr herüber. Sie beugt sich zu ihr und flüstert ganz leise: »Es ist jemand im Haus.« Ihr warmer Atem kitzelt Elísa im Ohr. Er riecht noch ganz zart nach Zahnpasta.
Elísa setzt sich auf. Ihr Herz pocht, obwohl sie weiß, dass niemand im Haus ist. »Du hast geträumt, Liebes. Du weißt doch noch, was wir besprochen haben: Was man im Traum erlebt, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das sind zwei getrennte Welten.« Schon als sie ein kleines Kind war, hat Margrét mit Albträumen zu kämpfen gehabt. Ihre beiden Brüder schlummern ein und rühren sich erst am nächsten Morgen wieder, genau wie ihr Vater. Doch zur Tochter ist die Nacht selten so gnädig. Wie oft schon hat das schrille Schreien des Mädchens sie und Sigvaldi aus dem Schlaf gerissen? Die Ärzte meinten, dass es mit dem Alter besser werden würde, doch seitdem sind bereits zwei Jahre vergangen und es hat sich nichts geändert.
Die kupferroten Locken wirbeln durch die Luft, als das Mädchen den Kopf schüttelt. »Ich habe nicht geschlafen. Ich war wach.« Sie flüstert noch immer und legt den Finger an ihre schön geschwungenen Lippen. »Ich war Pipi machen, da hab ich ihn gesehen. Er ist im Wohnzimmer.«
»Manchmal vertut man sich. Das passiert mir auch oft …« Elísa verstummt mitten im Satz. »Psst …« Sie sagt das mehr zu sich selbst. Draußen vom Flur ist nichts zu hören. Das Geräusch ist nur Einbildung gewesen. Die Tür steht einen Spalt offen, und sie späht hinaus, doch sie sieht nichts als Dunkelheit. Natürlich. Wer sollte dort auch sein? Sie besitzen nichts Besonderes, und ein Haus, das so dringend einen neuen Anstrich bräuchte, wird auch keine Diebe in Versuchung bringen. Dabei ist ihr Haus eines der wenigen in der Straße, bei dem nicht in jedem Fenster der Aufkleber eines Sicherheitsdienstes klebt.
Margrét beugt sich wieder zum Ohr ihrer Mutter. »Ich hab mich nicht vertan. Es ist jemand hier drinnen. Ich hab ihn vom Flur aus gesehen.« Margréts Stimme ist leise, aber ganz klar, das Mädchen wirkt überhaupt nicht schlaftrunken.
Elísa knipst die Nachttischlampe an und tastet nach ihrem Handy. Kann es sein, dass der Wecker falsch geht? Im Laufe der Jahre hat er wirklich einiges aushalten müssen; Elísa hat keine Ahnung, wie oft er schon auf dem Boden gelandet ist. Vielleicht hat es gar keinen Zweck, Margrét wieder ins Bett zu bringen. Vielleicht ist es an der Zeit, sich ans Morgenwerk zu machen, Dickmilch in drei Schalen zu gießen, braunen Zucker darüber zu löffeln und zu hoffen, dass ihr genügend Zeit bleiben wird, sich das Shampoo aus den Haaren zu waschen, während die drei frühstücken. Das Handy liegt weder auf dem Nachttisch noch auf dem Boden. Dabei ist Elísa sich sicher, es abends mit ins Schlafzimmer genommen zu haben. Sie wollte es griffbereit haben, falls Sigvaldi mitten in der Nacht anrufen sollte, um ihr mitzuteilen, dass er gut angekommen ist. Oder etwa nicht? »Wie spät ist es eigentlich, Margrét?«
Gegen Spitznamen wie Magga hatte das Mädchen sich immer gewehrt.
»Ich weiß nicht.« Margrét wendet den Blick von ihrer Mutter ab und starrt in den dunklen Flur. Dann dreht sie sich wieder um und flüstert: »Wer kommt mitten in der Nacht zu Besuch? Niemand Gutes.«
»Nein. Niemand kommt. Punkt.« Elísa merkt selbst, dass sie kein bisschen überzeugend klingt. Was, wenn das Kind doch recht haben sollte und jemand bei ihnen eingebrochen ist? Sie steht auf. Der Fußboden ist eiskalt, und sie krümmt die Zehen. Sie hat nur ein T-Shirt von Sigvaldi an und bekommt schon wieder eine Gänsehaut. »Bleib du hier liegen. Ich gehe nachschauen. Wenn ich zurückkomme, können wir wieder schlafen und müssen uns keine Sorgen mehr machen. Bist du dann zufrieden?«
Margrét nickt und zieht sich die Bettdecke ihrer Mutter bis zu den Augen. »Aber pass auf. Er ist nicht gut«, murmelt sie unter der Decke.
Ihre Worte hallen nach, als Elísa in den Flur geht und versucht, wie das Selbstbewusstsein in Person auszusehen, hundertprozentig überzeugt davon, dass kein Fremder im Haus ist. Doch Margrét hat Zweifel in ihr gesät. Warum konnte das nicht in der vorigen Nacht passieren, als Sigvaldi zu Hause war? Ist das zu viel verlangt? Elísa schlingt die Arme um ihren Körper, um sich vor der Kälte zu schützen, jedoch ohne Erfolg. Sie schaltet das Licht ein, die Helligkeit schmerzt in den Augen.
Die Tür zum Zimmer der Jungen knarrt leise, als Elísa sich vergewissert, dass sie friedlich schlafen. Jeder liegt in seinem Bett, mit geschlossenen Augen und offenem Mund. Vorsichtig schließt sie die Tür.
Im Bad ist niemand, doch in Margréts Zimmer starren ihr unzählige Augen entgegen, die zu den Puppen und Teddys gehören, die fein säuberlich aufgereiht im Regal sitzen. Ihre Blicke scheinen sie zu verfolgen, als sie die Tür schnell wieder schließt. Ob sie womöglich für Margréts Albträume verantwortlich sind? Elísa selbst würde keinen großen Wert darauf legen, nachts im Halbschlaf in diese starren Gesichter zu schauen. Im Dunkeln wirkt es beinahe so, als würde hinter ihrer Niedlichkeit etwas Böses hervorblitzen. Es wäre auf jeden Fall einen Versuch wert, die Kameraden irgendwo anders unterzubringen und auszuprobieren, ob Margrét dann besser schläft. Gleich heute Abend nach der Arbeit will sie sich darum kümmern.
Im Flur und den übrigen Zimmern, die von ihm abgehen, ist niemand zu sehen, keine Spur von irgendeinem unheimlichen nächtlichen Besucher. Doch welche Spuren sollte er auch hinterlassen? Fußabdrücke? Zigarettenstummel auf dem Boden? Einen zerbrochenen Blumentopf in der Ecke? Wohl kaum. Als sie weiter in Richtung Wohnzimmer und Küche geht, ist sie vollkommen entspannt. Das Licht der Straßenlaternen reicht aus, um sie davon zu überzeugen, dass das schon wieder bloß eins von Margréts Hirngespinsten gewesen sein muss. Im Dunklen kann die Fantasie manchmal besonders lebhaft sein. Im Wohnzimmer ist niemand, die leere Popcornschale steht noch immer vor dem Fernseher, und Legosteine sind um den Couchtisch verteilt. Alles ist noch genau so, wie sie es vor dem Schlafengehen hinterlassen hat. Diese verdammten Hirngespinste. Ein Lächeln schleicht sich auf ihre Lippen, doch genauso schnell verschwindet es wieder. Die Schiebetür zwischen der Küche und dem Erker im Wohnzimmer, den sie als Esszimmer nutzen, ist zugeschoben.
Diese Tür ist sonst nie geschlossen.
Elísa geht auf die Tür zu, langsam und vorsichtig. Ihre Zehen kleben auf dem kalten Parkett, und die Angst wächst mit jedem Schritt. Sie legt ein Ohr an die weiße Tür. Zuerst ist nichts zu hören, doch dann schreckt sie zurück. In der Küche werden Stühle gerückt.
Was tun? Ihr Körper will zurück ins Bett kriechen und sich die Decke über den Kopf ziehen. Der nächtliche Besucher wird sicher bald aus der Küche herauskommen. Ihr Hab und Gut könnte Elísa nicht gleichgültiger sein. Der Einbrecher soll ruhig alles nehmen, was er will, wenn er sich bloß schnell aus dem Staub macht. Aber was zum Teufel hat er in der Küche zu suchen? Sie hört, dass er sich an den Tisch gesetzt hat. Oder hat sich womöglich Margrét oder einer der Jungs an ihr vorbeigeschlichen? Nein, völlig ausgeschlossen.
Zu ihrem Schrecken scheint der ungebetene Gast hinter der Schiebetür aufzustehen. Ihr fällt nichts Besseres ein, als das Ohr wieder an die Tür zu drücken. Schubladen gehen auf und zu, Besteck klirrt. Oder Messer. Dann wird die kleine Schiebetür zur Kammer aufgeschoben. Welcher Einbrecher interessiert sich für Konserven und Cornflakes? Für Besen, Kehrblech, Lappen, Putzeimer und Staubsauger? Doch statt sich zu beruhigen, bekommt Elísa noch mehr Angst. Menschen, die sich irrational verhalten, sind gefährlicher als solche, die gewissen Regeln folgen. Sie löst sich von der Tür und huscht ins Wohnzimmer zurück. Das Handy müsste auf dem Couchtisch liegen. Oder im Badezimmer. Vor zwei Jahren haben sie ihren Festnetzanschluss abgeschafft. Zum ersten Mal vermisst sie ihn. Elísa wirft einen Blick in die Diele und überlegt, ob sie hinausrennen und um Hilfe rufen soll, in der Hoffnung, die Nachbarn zu wecken. Aber dann müsste sie die Kinder zurücklassen. Mit einem Mann, der womöglich in der Küche ein Messer aufgetrieben hat. Elísa macht einen Schritt auf die Eingangstür zu, doch dann bleibt sie stehen; sie kann die Kinder nicht allein lassen. Also macht sie kehrt und schleicht in Richtung Flur. Sie hat ihn fast erreicht, als die Schiebetür aufgeschoben wird. Mit einem Satz springt sie in den Flur und schließt leise die Tür hinter sich, ohne nachzusehen, ob ihr der Mann schon auf den Fersen ist – dafür fehlt ihr der Mut.
Es dröhnt in Elísas Kopf, während sie verzweifelt versucht, zu entscheiden, was nun zu tun ist. Wie soll sie entkommen? Das Schlafzimmer lässt sich nicht abschließen, der Schlüssel fehlte bei ihrem Einzug, und es gab nie einen Grund, ihn nachmachen zu lassen. Das Badezimmer lässt sich mit einem Drehknauf verriegeln, doch sich dort einzuschließen wäre genauso falsch, wie aus dem Haus zu rennen. Dann wären die Kinder genauso schutzlos. Trotzdem stürzt Elísa zum Badezimmer, um ihr Handy zu suchen, doch da ist es auch nicht. Mit zitternden Händen wirft sie Handtücher um sich und reißt Schubladen auf – vergeblich, das verdammte Telefon ist nirgends zu finden. Als ihr das Chaos bewusst wird, das sie gerade angerichtet hat, schießen ihr Tränen in die Augen. Wann soll sie das wieder aufräumen? Als hätte sie nicht schon genug um die Ohren.
Elísa merkt, dass sie im Begriff ist, den Verstand zu verlieren. Sie lugt in den Flur und schafft es nicht, den Schrei zu unterdrücken, als sich die Tür zur Diele öffnet. Dieser Schrei ist weder laut noch schrill, sondern klingt, wie vielleicht ein panisches Kaninchen klingen könnte. Elísa will nicht sehen, wer durch die Tür kommt, und schlüpft durch die hintere Badezimmertür ins Schlafzimmer. Sie hört die Schritte des Eindringlings und dann ein Rumpeln; er muss etwas hinter sich herziehen. Doch was? Das Herz schlägt ihr bis zum Hals.
»Margrét?«
Das Mädchen ist nirgends zu sehen.
»Margrét?«
Elísas Stimme versagt, was ihrem ohnehin schwindenden Mut nicht gerade zuträglich ist. Soll sie zuerst nach ihrem Handy oder nach Margrét suchen? Sie kann sich nicht entscheiden, doch bevor sie weiter nachdenken kann, öffnet sich die Tür in ihrem Rücken. Der Mann kommt herein. Er bleibt stehen, und das Rappeln wird lauter, als würde er etwas über die Schwelle ruckeln. Elísa kann sich nicht umdrehen, ihr Körper ist wie gelähmt, am liebsten würde sie einfach nur die Augen zukneifen. Sie kennt das Geräusch, doch sie kommt nicht darauf. Ihr Gehirn scheint ganz damit beschäftigt zu sein, die wichtigsten Bereiche auszuschalten – genau die, die sie jetzt am dringendsten benötigen würde.
Völlig versteinert hört Elísa jemanden hinter sich ihren Namen flüstern. Das Flüstern ist gedämpft, als hätte sich der Mann einen Schal vor den Mund gebunden. Sie meint, die Stimme nicht zu kennen. Doch wie klingen Stimmen schon im Flüsterton? Ganz anders als sonst, oder? Margrét hatte sich eben auch ganz anders angehört, als sie ihr ins Ohr geflüstert hat. Doch der warme, süße Hauch von vorhin ist meilenweit von der Furcht entfernt, die ihr dieses tiefe Flüstern einjagt.
Wer ist das, und was will er? Er muss sie kennen, zumindest weiß er, wie sie heißt. Oder hat er ihren Namen irgendwo in der Küche gelesen? Auf einer Rechnung oder der Postkarte von Gunna, die am Kühlschrank hängt?
Eine kräftige Handschuhhand legt sich um ihren Hals; dann fühlt sie etwas schmerzhaft in ihrem Rücken. Ein Messer. »Please«, wispert sie und denkt sich den Rest: Tu mir bitte nicht weh. Vergewaltige mich bitte nicht. Bring mich bitte nicht um. Tu bitte, bitte, bitte meinen Kindern nichts. Die Messerspitze verschwindet von ihrem Rücken, zurück bleibt ein vager Schmerz. Dann lockert er auch den Griff um ihren Hals. Doch im nächsten Moment verbindet er ihr die Augen. Elísas Panik wird noch größer, als ihr bewusst wird, dass er das mit dickem, starkem Klebeband tut, das er Runde um Runde um ihren Kopf wickelt. Wie soll sie das Zeug bloß wieder abbekommen? Wenn sie es runterreißt, werden ihre Wimpern und Augenbrauen daran kleben bleiben. Elísa merkt, dass ihr Kopf verrückt spielt. Die Tränen, die nirgendwohin können, lösen den Klebstoff auf, der ihr in den Augen brennt. »Please. Please. Ich sage es niemandem. Nehmen Sie alles, was Sie wollen. Alles. Nehmen Sie alles.«
»Nein, danke«, hört sie es hinter ihrem Rücken murmeln.
Elísa bekommt weiche Knie. »Bitte. Bitte nehmen Sie alles!« Er wickelt das Klebeband noch eine Runde um ihren Kopf, und sie zuckt zusammen, als er es abschneidet. Er streicht ihr unsanft über den Nacken, um das lose Ende zu befestigen. Dann wird sie herumgedreht und auf das Bett gestoßen. Die Matratze gibt nach, als er sich neben sie setzt, und sie zieht den Kopf ein, als er ihr leicht übers Haar streichelt. Doch genauso plötzlich ist die fast zärtliche Berührung vorbei, er greift ihr mit der Faust in die Haare und reißt ihren Kopf herum.
Wieder flüstert er ihr ins Ohr, diesmal etwas lauter. Die Stimme ist ihr wirklich fremd, es klingt, als hätte der Mann eine Maske oder Sturmhaube auf. »Ich will dir was erzählen. Eine kurze Geschichte. Eine ziemlich tragische Geschichte. Hör gut zu.« Elísa nickt. Er packt noch fester zu, ihre Kopfhaut brennt. Warum will er ihr eine Geschichte erzählen? Warum fragt er nicht nach den PIN-Nummern oder wo die Wertsachen sind? Alles würde sie ihm verraten. Sie würde ihm alle Karten geben und Zugang zu ihren Konten. Er kann das Silber haben, das sie von ihren Großeltern geerbt hat. Das bisschen Schmuck, das ihr im Laufe der Zeit zugefallen ist. Alles. Sie würde ohne Zögern alles hergeben. Wenn er dafür sie und die Kinder verschont. Alles andere ist in diesem Moment egal. Liebend gern würde sie sich die Brauen und Wimpern ausrupfen, wenn er bloß gehen würde.
Zwischen zwei Schluchzern schafft sie es, zu fragen, ob er ihren Kindern etwas antun wolle. Sie hört nicht, was er antwortet, was ihre Furcht noch steigert. Dann sagt er gar nichts mehr. Auch seine Geschichte scheint er nun nicht mehr loswerden zu wollen, und so schweigen sie beide. Elísas Herz droht zu zerspringen. Dann hört und spürt sie, dass der Mann aufsteht, und in ihr glimmt ein Fünkchen Hoffnung auf, dass er vielleicht geht. Es dabei belässt. Doch sie wagt es nicht, diesen Gedanken, diese Hoffnung zu schüren. Jeden Moment kann er sie wieder packen. Noch einmal rappelt es, und dann klingt es, als würde etwas in die Steckdose neben der Tür gesteckt. Elísa geht in Gedanken alle elektronischen Geräte in ihrem Haushalt durch, die Schaden anrichten könnten – die Bohrmaschine, die sie Sigvaldi zu Weihnachten geschenkt hat, der Pürierstab, ihr Lockenstab, das Bügeleisen, der Sandwichmaker, der Wasserkocher. Was davon wäre am schlimmsten? Was am besten? Elísa atmet so hektisch, dass sie das Gefühl hat, ohnmächtig zu werden. Dann fällt ihr ein, dass die meisten dieser Horrorgeräte zu kurze Kabel haben, um bis zu ihr ans Bett zu reichen, und ist ein kleines bisschen erleichtert. Doch dieses Gefühl währt nur kurz.
Als der Mann zurück zum Bett kommt, verliert sie die Beherrschung. Sie startet einen verzweifelten Fluchtversuch, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Er sieht, sie nicht. Er ist größer und stärker. Nichtsdestotrotz wirft sie sich übers Bett und versucht, auf die andere Seite zu kommen. Der Mann gibt einen ärgerlichen Schrei von sich und wirft sich auf Elísa, die auf der Bettkante hängt, halb auf dem Bett und halb daneben. Ein Arm liegt unter ihr, der andere hängt auf den Boden. Der Mann schlägt ihr mit aller Kraft in den Rücken, dass die Wirbel krachen und Elísa die Luft wegbleibt. Dann setzt er sich auf sie und raubt ihr jegliche Bewegungsfreiheit. Sie hört, wie er noch mehr Klebeband von der Rolle reißt. Obwohl es hoffnungslos ist, sucht sie den Boden mit der freien Hand nach etwas ab, das sich zum Zuschlagen eignet, doch wie erwartet findet sie nichts. Sie tastet mit den Fingern unters Bett, vielleicht ist das Glück ja mit ihr. Plötzlich stößt sie an etwas Bekanntes, ein warmes, weiches Bündel. Sie schafft es gerade noch, einen Finger an die Lippen zu legen und »psst« zu flüstern, bevor ihre Arme nach hinten gerissen und an den Ellbogen zusammengebunden werden.
Der Mann zerrt sie hoch und schüttelt sie derartig durch, dass sie das Gefühl hat, ihr Gehirn gegen die Schädeldecke schlagen zu hören. Alles ist schwarz, und sie befürchtet, dass das nicht mehr nur am Klebeband liegt; dass ihre Augen erloschen sind und auch ihre Ohren sich jeden Moment ausschalten. Die wenigen Geräusche, die das Wüten des Mannes begleiten, werden immer dumpfer, doch sie kann den Mann verstehen, als er sie zu sich herüberwuchtet und die Geschichte faselt, die er ihr versprochen hat. Ihr angedroht hat.
Als er fertig ist, steht er auf, dreht sie auf den Rücken und presst ein Knie auf ihre Brust, um weitere Fluchtversuche zu verhindern. Dann nimmt er das Klebeband und wickelt es ihr stramm um Ohren und Nase. Runde um Runde. Es knackt in ihren Ohren, doch das Geräusch, das ihre Nase von sich gibt, ist deutlich schlimmer. Und grässlich schmerzhaft. Der Druck auf ihre Brust lässt nach, und durch das Klebeband hört sie endlich von Ferne, welches Gerät der Mann hinter sich hergezogen hat. Davor hatte sie sich nicht gefürchtet. Als der Mann wieder zupackt, wird ihr schlagartig klar, dass das ein schwerer Irrtum war.
2. KAPITEL
Helgi war spät dran. Er hatte schlecht geschlafen, hatte ständig irgendwelche komischen Geräusche gehört, die weg waren, sobald er sich aufsetzte, und als er dann endlich wieder richtig eingeschlafen war, wollte er gar nicht mehr aufwachen. Viermal hatte er den Handywecker weggedrückt, doch als er es zum fünften Mal tun wollte, stellte sich das Handy quer und schrillte einfach weiter.
Er sollte auf der Arbeit ein Meeting leiten, vielleicht nicht das bedeutendste seiner Karriere, aber doch ein relativ wichtiges. Er arbeitete für einen Sicherheitsdienst, der sich gerade auf eine Ausschreibung zur Entwicklung eines Sicherheitssystems für ein großes Altenheim bewarb. Heute mussten sie endgültig das Angebot festzurren, das sie am Mittag abgeben wollten. Gestern Abend hatte er den Text zur Sicherheit noch einmal durchgelesen – und dabei alle Seiten von oben bis unten vollgekritzelt.
Der Wind packte ihn, als er seiner Frau Védís im Hinausgehen ein Tschüss zurief. Védís musste freitags erst um zehn zur Arbeit. Sie war Dänischlehrerin, und die Schulleitung fand es offenbar unzumutbar für die Gymnasiasten, am letzten Schultag in der Woche frühmorgens mit einer Fremdsprache zu ringen. Die Tür knallte zu, bevor Védís die Chance bekam, zu antworten; Helgi hatte keine Zeit, zu warten, bis sie in ihren Hausschuhen zur Tür geschlappt kam, um ihm einen Abschiedskuss zu geben. Während des kurzen Sprints zum Auto drückte er den Blätterstapel fest an sich, er war froh, als er saß und die Dokumente auf dem Beifahrersitz in Sicherheit waren. Falls der Verkehr mitspielte, würde er gerade noch rechtzeitig kommen.
Der Motor schnurrte freundlich, und als sich die Räder in Bewegung setzten, atmete er auf. Es würde schon hinhauen. Doch er hatte die Einfahrt noch nicht verlassen, als er voll auf die Bremse steigen musste. Mitten auf der Straße standen Stefán und Bárður, die beiden Jungs aus dem Nachbarhaus. Helgi beugte sich vor und sah, dass sie im Schlafanzug und barfuß waren. Es war höchstens um die null Grad und stürmisch. Was dachten sich bloß die Eltern? Die Jungs standen da wie Ölgötzen, mit eingezogenen Köpfen, und schauten ihn hilflos an. Das musste ein Scherz sein. So ein Pech konnte er doch nicht haben. Nicht heute. Er warf einen Blick zum Nachbargrundstück, in der schwachen Hoffnung, Sigvaldi oder Elísa aus dem Haus rennen zu sehen, doch die Tür war geschlossen und es tat sich nichts. Die Autos der beiden standen in der Einfahrt, sie mussten also zu Hause sein. Vielleicht hatten auch sie die Nacht über wach gelegen und verschlafen.
Helgi dachte daran, vorsichtig einen Bogen um die Kinder zu fahren und einfach seinen Weg fortzusetzen. Er konnte ja sofort Védís anrufen und sie bitten, der Sache auf den Grund zu gehen, dass er im Rückspiegel die Nachbarjungs gesehen zu haben glaubte, sich aber nicht ganz sicher sei. Aber auf einmal heulte der Jüngere der beiden los. Mist. Ein weinendes Kind konnte er kaum stehen lassen. Andererseits … das Meeting war wichtiger, als er es sich hatte eingestehen wollen. Das Geschäft war in letzter Zeit nicht gerade rundgelaufen, und es war klar, dass es Kündigungen geben würde, wenn es nicht gelang, ein paar neue, vielversprechende Kunden zu gewinnen. Wenn er die Sache versaute, war klar, wer zuerst fliegen würde.
Er drehte das Steuer nach rechts und fuhr so langsam wie möglich an. Ganz vorsichtig rollte er an den Brüdern vorbei, die mit offenen Mündern dastanden. Der kleinere war sogar so verdutzt, dass er das Heulen vergaß. Sie waren noch klein genug, um zu glauben, dass Erwachsene immer gut sind. Abgesehen von bösen Männern vielleicht, die nichts mit einem gewöhnlichen Nachbarn wie ihm gemein hatten. Sie mussten noch einiges lernen.
Als Helgi an den Jungen vorbei war, gab er Gas und rief seine Frau an.
Der Polizist sah aus, als hätte er seine besten Zeiten schon hinter sich. Er schnaufte ununterbrochen und stöhnte immer wieder. Ein älterer Herr, dem im Laufe der Jahre schon so manches unter die Augen gekommen war. Durch die tausend geplatzten Äderchen um die Nase herum sah es aus, als wäre ihm Schamesröte in die Wangen gestiegen. Er und sein Kollege waren als Erste am Schauplatz eingetroffen, nachdem sich eine Frau gemeldet und berichtet hatte, die Kinder ihrer Nachbarn bei sich zu haben und nun nicht zu wissen, wohin mit ihnen. Es hatte keinen Anlass gegeben, mit einem Großaufgebot anzurücken. Alles deutete darauf hin, dass die Eltern verschlafen und die armen Kleinen sich ausgesperrt hatten; was sich als Trugschluss erwiesen hatte, wie der Polizist den Kollegen von der Kriminalpolizei zu erklären versuchte, die nun eintrafen. Sein Partner, ein junger Mann, der erst vor knapp einem Monat seinen Dienst angetreten hatte, war schon wieder auf dem Weg zur Polizeistation. Der Geruch des Erbrochenen, das er auf der Eingangstreppe hinterlassen hatte, hing noch in der Luft.
»Die Frau ist mit den Jungs rübergegangen und hat ein paarmal geklingelt und geklopft. Sie hat gehört, dass es drinnen geschellt hat, aber sie dachte, die Klingel sei zu leise, um die Eltern zu wecken. Sie war sich ganz sicher, dass sie schlafen, weil ihre Autos vor der Tür standen.« Der Polizist stemmte die Hände in seine üppigen Hüften und schüttelte den Kopf. »Aber so war es nicht. Die Jungs wussten von nichts, sind von allein aufgewacht und wohl in ihrem Zimmer eingesperrt gewesen. Sie sind durchs Fenster geklettert, als sie die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie jemand herauslässt.«
»Und weiter?« Kriminalkommissar Huldar hielt so viel Abstand zum Kollegen von der Streifenpolizei wie möglich, ohne dass es auffiel. Mit jedem Schnaufen wehte eine strenge Fahne zu ihm herüber, die vermuten ließ, dass der Mann hauptsächlich Knoblauch zum Frühstück gegessen hatte. Er hätte ein Fenster aufgerissen, wenn der Tatort nicht versiegelt gewesen wäre. Ob das an der Gesamtsituation etwas geändert hätte, war eine andere Frage. Dafür hatte der junge Polizist gesorgt.
Durchs Fenster sah er seinen Kollegen und wichtigsten Mitarbeiter Ríkharður. Dessen Hand zuckte immer wieder in Richtung Nase, als wollte er sie sich am liebsten zuhalten. Er schaffte es gerade so, dieser Versuchung zu widerstehen, was vernünftig von ihm war. Er durfte den anderen nicht noch einen Grund geben, sich über ihn aufzuregen. Huldar beobachtete, wie er mit einem Stock die vertrocknete Hecke nach Spuren absuchte, und wunderte sich wieder einmal, warum der Mann bei der Kriminalpolizei angeheuert hatte.
Ríkharður gehörte in ein Ministerium und nicht mit einem Bein in die Hecke an den Schauplatz eines Mordes. Der Anzug und der einen Tick zu lange Mantel passten absolut nicht zu diesen Umständen. Auf dem Kommissariat ging dieser Stil gerade noch durch, aber gerade noch. Dasselbe galt für seine perfekte Frisur, die nie auch nur einen Millimeter variieren durfte, und für die übergepflegten Hände. Auf ein ordentliches Aussehen wurde bei der Polizei gewiss Wert gelegt, zum Beispiel durfte man sich nicht Haare und Bart orange färben, aber Ríkharður ging einen Schritt zu weit. Wahrscheinlich lag das an seiner Herkunft: Er war der Sohn zweier Richter. Auch er selbst hatte zuerst Jura studiert, nur noch ein Jahr hatte gefehlt, als er plötzlich umgesattelt und sich an der Polizeischule eingeschrieben hatte. Er habe eine Veränderung gebraucht und werde das Jurastudium zu einem späteren Zeitpunkt abschließen, hatte er gesagt. Diese Zeit schien noch nicht in Sicht. Er wirkte gar nicht auf dem Absprung, obwohl er von den Kollegen immer schief angeguckt wurde und all das Widerliche, das ihm im Arbeitsalltag begegnete, kaum ertragen konnte.
In einer Situation wie der jetzigen übernahm er immer gern Aufgaben, die ihn so weit wie möglich von jeglichen Spuren der Gewalt wegbrachten, und so suchte er nun in Eiseskälte den Garten ab, in völlig ungeeigneter Montur. Es hätte Huldar nicht gewundert, wenn Ríkharður anschließend ein Feuchttuch gezückt und sich den Schmutz abgeputzt hätte.
Dabei schien es, als wäre er in Sachen Reinlichkeit inzwischen etwas entspannter geworden. An diesem Morgen war Ríkharður mit einem Fetzen Klopapier am Hals zur Arbeit erschienen. Jeder andere hätte sich beim Rasieren schneiden können, ohne dass irgendjemand Notiz davon genommen hätte, doch bei Ríkharður hob Huldar unwillkürlich die Brauen.
Das Privatleben des Mannes lag in Scherben; das forderte ganz offensichtlich einen hohen Tribut. Seine Frau hatte ihn verlassen, kurz nachdem sie zum dritten Mal eine Fehlgeburt erlitten hatte – die perfekte Beziehung lag in Schutt und Asche. So etwas würde natürlich jedem zusetzen, da war Ríkharður gewiss keine Ausnahme. Vielleicht war damit aber seine Belastungsgrenze erreicht, sodass die tadellose Fassade nun Risse bekam. Vielleicht aber auch nicht. Er hatte schon so manchen Sturm in seinem Privatleben durchgestanden, und so würde es auch diesmal sein. Dreimal hatte er seinen Kollegen stolz verkündet, dass er Vater werden würde, und dreimal hatte er Huldar zugeflüstert, dass seine Frau das Ungeborene verloren hatte. Bei zwei von drei Malen hatte Huldar Mitleid mit ihm gehabt. Beim dritten Mal war er erleichtert gewesen.
Huldar beobachtete, wie Ríkharður mit dem Stock das Laub von seinen Sohlen kratzte. Er musste an Ríkharðurs Exfrau denken, die ähnlich perfekt aussah wie ihr Verflossener, und errötete leicht, während er sich wieder seinem unangenehm riechenden Gegenüber zuwandte.
»Nach dem Anruf der Frau sind wir also hergefahren und haben versucht, die Leute aus dem Bett zu klingeln. Aber es hat niemand aufgemacht, und es war auch nichts zu hören. Während Dóri an der Tür gewartet hat, bin ich eine Runde ums Haus gegangen und habe in alle Fenster geguckt, vor denen keine Vorhänge sind. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen, leider auch keine Menschen. Aber da vorm Schlafzimmerfenster die Gardinen zugezogen waren, konnte ich nicht ausschließen, dass die Eltern bewusstlos im Bett lagen. Als das Klopfen gegen die Fensterscheibe nichts brachte, habe ich mir langsam wirklich Gedanken gemacht. Man sah, dass die Jungs tatsächlich aus dem Kinderzimmerfenster geklettert waren. Es stand noch offen, aber Dóri oder ich konnten uns da nicht durchquetschen.«
»Verstehe.« Huldar sah nicht von seinem Notizbuch auf. »Und dann?«
Der Ältere runzelte die Brauen, als wollte er sichergehen, den Hergang auch ja richtig wiederzugeben. »Wir haben die beiden Handynummern angerufen, die auf das Haus gemeldet sind – sie scheinen keinen Festnetzanschluss zu haben. Die eine Nummer läuft auf Elísa Bjarnadóttir und die andere auf ihren Ehemann Sigvaldi Freysteinsson. Keiner von beiden ging ran. Bei Sigvaldi sprang ziemlich direkt die Mailbox an, bei Elísa hat es lange geklingelt. Also habe ich es noch mal versucht, aber durchs Schlafzimmerfenster war kein Klingeln zu hören. Das machte das Ganze noch merkwürdiger, denn die meisten Leute sind doch am selben Ort wie ihr Handy, oder?« Auf diese merkwürdige Frage gab Huldar keine Antwort, und der Mann fuhr fort. »An dem Punkt hatte ich den Verdacht, dass wahrscheinlich eines der Autos kaputt und entweder der Mann oder die Frau mit einem Leihwagen zur Arbeit gefahren war, der andere war zu Hause geblieben und hatte verschlafen. Ich dachte, dass vermutlich sein Handyakku leer wäre und es keinen anderen Wecker gäbe. Entweder das oder dass ihm oder ihr etwas zugestoßen wäre und auch dem entsprechenden Handy. In der Dusche ausgerutscht, mit dem Handy in der Hand, oder so.«
»Verstehe.« Das war gelogen, denn wer duschte schon mit seinem Handy? Und warum ging beim Handy der Frau nicht die Mailbox ran, wenn der Akku leer oder es kaputt sein sollte?
»Die Nachbarin hatte auch noch die Tochter erwähnt, die ebenfalls zu Hause sein müsste, und ich fand es am wahrscheinlichsten, dass sie im Leihwagen mitgefahren war, vermutlich zur Schule.« Das Mädchen war, wie sich herausgestellt hatte, nicht im Haus, ihr Bett war leer, und auf Rufe gab es keine Reaktion. Ein Anruf in ihrer Schule hatte ergeben, dass sie nicht zum Unterricht erschienen war, also wurde ein Suchbefehl rausgeschickt. Ein Teil der Polizisten, die inzwischen am Tatort eingetroffen waren, durchkämmte das Viertel, falls sie wie ihre Brüder auf Wanderschaft gegangen sein sollte. Das stand ganz oben auf der Wunschliste. Über andere Möglichkeiten wollte Huldar jetzt nicht nachdenken.
Der alte Polizist sprach weiter. »Je länger wir von draußen an Türen und Fenster klopften, desto sicherer war ich mir, dass da drinnen niemand bei Bewusstsein war. Ich habe mehr und mehr dazu tendiert, dass das Mädchen mit einem Elternteil unterwegs und dem anderen zu Hause etwas passiert war. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass da drinnen jemand schlief, bei all unserem Getrommel und Gelärme. Das fand ich mehr als unwahrscheinlich.«
»Und da haben Sie dann beschlossen, die Tür öffnen zu lassen?«
»Ja. Ich habe den Beschluss gefasst. Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Verdacht, dass die Frau oder der Mann bewusstlos im Haus lag oder noch Schlimmeres passiert war. Ich dachte sogar schon an Selbstmord. Alles, nur das nicht.«
Schon wieder stöhnte der Mann, und diesmal bahnte sich der Knoblauch endgültig seinen Weg zu Huldar, der sich unwillkürlich nach hinten lehnte. Die Versuchung war groß, ihm eins der Nikotinkaugummis anzubieten, die Huldar seit Neuestem immer in der Tasche hatte; ein Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören. »Nein, mit so etwas hätte wohl keiner gerechnet.« Huldar hatte keine Lust, dem Kollegen vorzuwerfen, dass er nicht am Arbeitsplatz der Leute angerufen hatte, bevor er seine Schlüsse zog. Ein Anruf im Landeskrankenhaus hätte gereicht, um herauszufinden, dass der Mann im Ausland auf einer Konferenz war. Dann hätte die Suche nach dem Mädchen früher beginnen können.
»Ich bin zu der Nachbarin rüber, während Dóri auf den Schlüsseldienst gewartet hat. Sie wirkte eher neugierig als besorgt und hat mir Löcher in den Bauch gefragt. Ich hab herumgedruckst und nicht gesagt, was ich befürchtete, zumal ja auch die kleinen Jungs da waren, die haben da gerade Cornflakes gegessen.« Er beschrieb, wie die Jungen ihn beim Frühstücken mit großen Augen angestarrt und wie verunsichert sie gewirkt hätten, als man sie schließlich mit einem Streifenwagen weggebracht hatte. Als die Frau die ganze Gesellschaft bis zum Auto verfolgt und immer wieder nachgefragt habe, was da eigentlich los sei, hätte er sie am liebsten mundtot gemacht. Damit habe die Frau den Jungen nur noch mehr Angst gemacht. Am Ende hatte man sie zurück ins Haus gescheucht. Jetzt hing sie ständig am Fenster. Vermutlich wunderte sie sich, was Ríkharður da trieb, sie dachte sicher nicht, dass er zur Polizei gehörte. »Bevor wir reingegangen sind, nachdem der Schlüsseldienst uns aufgemacht hatte, habe ich noch mal gerufen – keine Antwort. Ich habe an die Flurtür geklopft, die war zu, genau wie die Schlafzimmertür.«
»Haben Sie Handschuhe getragen?«
Der Mann bekam ein noch röteres Gesicht. »Nein.« Immerhin versuchte er nicht, sich herauszureden.
»Ihre Fingerabdrücke haben wir, oder? Und auch die von Ihrem Kollegen?«
»Ja, meine auf jeden Fall. Zu Dóri kann ich nichts sagen. Eigentlich müsste man seine Abdrücke genommen haben, als er bei uns angefangen hat.«
»Gut.« Huldar sah von seinem Notizbuch auf. »Was haben Sie gemacht, nachdem die Tür geöffnet war und Sie gesehen haben, wie es dort aussah? Haben Sie etwas angefasst?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein. Dóri hat sich die Hand vors Gesicht gehalten und ist in den Flur und dann nach draußen gerannt. Ich bin zu der Frau gegangen, um nachzusehen, ob sie noch lebt, obwohl ich das für ausgeschlossen hielt. Gleichzeitig habe ich die Sache schon telefonisch auf der Station gemeldet.«
»Haben Sie den Puls überprüft?«
»Ja.«
»Wo?«
»Am Hals. Hab keinen gefunden. Sie hat sich auch kalt angefühlt, daher bin ich davon ausgegangen, dass sie tot ist. Zu einem anderen Ergebnis hätte man kaum kommen können. Ich hätte noch nicht einmal den Puls suchen müssen, hab das nur aus Gewohnheit gemacht. Wenn man das so sagen darf.«
»Haben Sie sie noch woanders berührt?«
Wieder wurde der Mann rot. »Ja.«
»Dann müssten Sie noch mal reingehen und dem Rechtsmediziner die Stellen zeigen. Er wird die Leiche nach Fingerabdrücken absuchen.« Huldar schlug sein Notizbuch zu. »Kommen Sie.«
Sie gingen ins Schlafzimmer. Angesichts des Gestanks, der ihnen entgegenschlug, vermisste Huldar beinahe den Knoblauchmuff.
Elísa lag quer auf dem Ehebett. Ihr Kopf war mit silberfarbenem Klebeband umwickelt, Augen, Nase und Ohren waren nicht zu sehen. Nur der oberste Teil der Stirn war frei, darüber struppige Haare. Am furchterregendsten aber sah es in der Mundgegend aus. Mit demselben Klebeband war dort das Staubsaugerrohr fixiert, das man ihr in den Rachen geschoben hatte. Der Staubsauger selbst stand am Fußende, dazwischen der Schlauch, der sich wie ein Wurm über das Bett schlängelte. Verständlich, dass der junge Polizist die Flucht ergriffen hatte.
Es war für niemanden zu übersehen, dass die Frau keinen friedlichen Tod gestorben war. Zum Glück sah man kaum etwas von ihrem Gesicht. Unter dem grauen, glänzenden, breiten Klebeband war es mit Sicherheit vom schrecklichen Todeskampf entstellt.
Der Rechtsmediziner beugte sich über die Frau. Er war gerade erst eingetroffen und hatte sich nicht die Zeit genommen, die Montur anzulegen, die er normalerweise unter solchen Umständen trug. In der Ecke stand sein Assistent und polierte die Linse eines Fotoapparats.
Der Rechtsmediziner schüttelte den Kopf. »Nicht gut.«
»Nein.« Huldar hatte dem nichts hinzuzufügen. Er machte einen Schritt ins Zimmer, um den Blick auf den Polizisten im Türspalt freizugeben. »Er war der Erste am Tatort. Es sind Fingerabdrücke von ihm am Hals der Toten. Und er hat sie angefasst, um die Körpertemperatur zu prüfen. Soll er Ihnen zeigen, wo?«
»Nein. Nicht jetzt. Bis wir fertig sind, will ich nicht noch mehr Leute hier drinnen haben. Alles andere muss warten. Auch Sie sollten zurück in den Flur gehen.«
Huldar gehorchte sofort. Er verfluchte sich für seine Gedankenlosigkeit. Er war kaum besser als der Alte. Abgesehen vom Mundgeruch vielleicht. Der Rechtsmediziner stieg in seinen Schutzanzug, während der Assistent sich daranmachte, Elísa von allen Seiten abzulichten. Der helle Blitz schmerzte in den Augen, doch man gewöhnte sich daran. Als er mit der Leiche fertig war, wandte er sich anderen Dingen zu, unter anderem den Wänden und dem Boden. Dann verschwand er neben dem Bett, hockte sich hin, um darunter zu fotografieren. Plötzlich sprang er auf, leichenblass. »Shit!« Er zeigte nach unten. »Da ist ein Kind drunter.«
Huldar vergaß die Anweisung des Mediziners und stürmte ins Zimmer. Er riss die weiße Husse hoch, die bis zum Boden reichte. Unter dem Bett lag ein kleines Mädchen im Nachthemd. Ganz zusammengekrümmt, den Kopf eingezogen und die Hände auf die Ohren gepresst. Huldar atmete auf, als sich der zarte Körper regte. Das musste die Tochter von Elísa und Sigvaldi sein. Nach der wie verrückt gesucht wurde. Um die Ermittlungen am Tatort nicht zu stören, war das Schlafzimmer noch nicht abgesucht worden. Es war auch niemandem in den Sinn gekommen, das Kind könnte die Rufe der Polizisten ignorieren und in seinem Versteck bleiben.
Huldar hatte noch keine Chance gehabt, etwas zu sagen, als ihm ein Kollege vom Flur aus zurief: »Du musst dir unbedingt angucken, was wir in der Küche gefunden haben!«
Huldar konnte sich nichts vorstellen, was wichtiger sein konnte als das, was er unterm Bett gesehen hatte. Die Küche musste warten.
3. KAPITEL
Eine Stubenfliege kämpfte sich am kleinen Kellerfenster ab. Ihre Kraft schwand, das Summen und die leichten Schläge gegen die Scheibe wurden immer leiser und unregelmäßiger, der Kampf ging zu Ende. Es war nicht auszumachen, wonach sich diese Fliege so sehr sehnte dort draußen, dass sie bereit war, ihr Leben dafür zu opfern. Der von welken Büschen umgebene Garten lag unter einer weißen Schneedecke. Nicht wirklich der passende Lebensraum für eine kleine Fliege. Im Keller war es wenigstens warm. Trotzdem versuchte sie es immer wieder, scherte sich nicht um die toten Artgenossen auf der staubigen Fensterbank, die einst denselben Fluchtversuch unternommen hatten. Vermutlich war es an der Zeit, Staub zu wischen. Karl beschloss, noch zu warten, bis sich die Fliege zu den Toten gesellt hatte. Sonst musste er gleich zweimal wischen – er, der so ungern ein Staubtuch in die Hand nahm.
Karl gewöhnte sich nur schwer an die Stille im Haus. Früher hätte er die Fliege sicher gar nicht bemerkt. Sein Blick wanderte zu den vergilbten Deckenplatten. Kein Mucks von der oberen Etage zu hören. Wie oft hatte er sich das gewünscht? In vollkommener Stille dasitzen und sich ohne das ständige Lärmen von oben auf das konzentrieren zu können, was er hören wollte. Ohne den klobigen Kopfhörer aufsetzen zu müssen, von dem er immer Ohrenschmerzen bekam. Nichts störte außer der Fliege, davon abgesehen war sein Traum in Erfüllung gegangen. Seltsamerweise stellte sich nicht die Zufriedenheit ein, mit der er gerechnet hatte. Keine Freudenfeuerwerke im Kopf, kein behagliches Lächeln auf den Lippen. Eigentlich hätte es ihn nicht wundern dürfen, denn wenn seine Träume mal wahr wurden, schmeckten sie gern wie abgestandene Cola. Diesmal war die Enttäuschung besonders groß, weil er sich schon so lange danach gesehnt hatte.
Seit er sich als Jugendlicher mit dem Amateurfunkvirus infiziert hatte, waren ihm die zwar leisen, aber ständigen Geräusche von oben tierisch auf den Nerv gegangen. Zuerst hatte er ein einfaches CB-Funkgerät in seinem Zimmer aufgestellt, mit dem jedermann auf 27 Megahertz funken konnte, doch die normale Zimmertür reichte nicht annähernd, um sich gegen die Außenwelt abzuschirmen. Er hätte genauso gut ein Bettlaken an den Türrahmen hängen können. Damals hatte ihm seine Mutter noch den Kopfhörer verboten, sodass er noch nicht einmal wählen konnte, ob er lieber gestört werden oder Ohrenschmerzen auf sich nehmen wollte. Sie war nicht davon abzubringen, dass er an seiner Umgebung teilhaben müsse, alles andere sei gefährlich. Sie schwang Reden über Hausbrände und allerhand andere Katastrophen, die er nicht mitbekäme, wenn er nicht hören würde, was im Haus vor sich ginge. Mit besonderer Inbrunst sprach sie davon, dass ein Einbrecher kommen und sie kaltblütig ermorden könnte, ohne dass Karl die Schreie seiner Mutter hören würde. Keine ihrer apokalyptischen Vorhersagen bewahrheitete sich, abgesehen von einem Einbruch Mitte November. Doch der Dieb erbeutete lediglich eine halbe Flasche Cognac und ein paar Münzen aus der Kleingeldschale, die auf der Kommode in der Diele stand. Weder Karl noch seine Mutter waren zu Hause gewesen, daher wussten sie natürlich nicht, ob den Einbrecher während seines Raubzugs auch noch die Mordlust überkommen hätte.
Als Karls älterer Bruder auszog, konnte er den Keller in Beschlag nehmen. Ursprünglich hatte sich Karl für CB-Funk interessiert, doch dann wurde er ein richtiger Funkamateur, die Geräte mehrten sich, und die Ausstattung wurde immer umfangreicher im Vergleich zu der kleinen alten Anlage, mit der er als Jugendlicher eingestiegen war. Er hatte das Morsen gelernt, eine Prüfung abgelegt und mit der Einsteigerlizenz das Recht erworben, auf einigen Frequenzen mit geringer Sendeleistung zu morsen. Darauf folgten Prüfungen zur langersehnten G-Lizenz, mit der man auch sprechen und mit größerer Leistung senden durfte. Sein kleines Zimmer war vollgestopft mit Geräten, Büchern und sonstigen Unterlagen rund ums Funken, daher kam es Karl sehr gelegen, damit runter in den Keller zu ziehen. Dort konnte er ganz für sich sein und in Ruhe lernen. Doch obwohl es im Keller deutlich besser war, fühlte sich Karl immer noch vom regen Verkehr in der Etage darüber gestört. Es war erstaunlich, wie viel Lärm eine einzige Person machen konnte. Von Arnar hatte man eigentlich kaum etwas gehört; zumal er ohnehin die meiste Zeit über seinen Büchern saß, mürrisch und schweigsam. Ihre Mutter war da ein ganz anderes Kaliber. Sie wuselte den ganzen Tag herum und lief ständig von einem Zimmer ins andere, um dieses zu holen oder jenes zu erledigen. Höchstens beim Telefonieren hielt sie mal die Füße still. Aber viel leiser war es dann auch nicht.