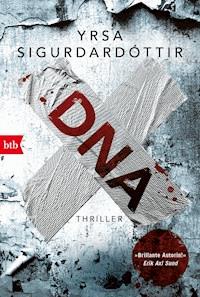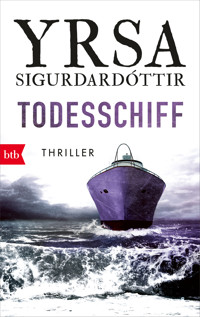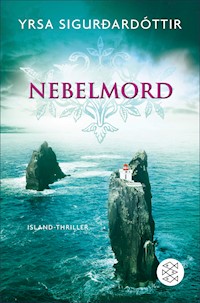10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Anwältin Dóra Gudmundsdóttir ermittelt
- Sprache: Deutsch
Erstmals als E-Book bei btb: Der 5. Fall für Dóra Guðmundsdóttir, eine außergewöhnliche Ermittlerin für außergewöhnliche Fälle
Tödliche Flammen, eiskalte Lügen - die Reykjavíker Anwältin Dóra Guðmundsdóttir muss einen alten Fall wieder aufnehmen. Jakob, ein junger Mann mit Down-Syndrom, soll einen Brand in seinem Wohnheim gelegt haben, bei dem fünf Menschen starben. Inzwischen lebt Jakob in einer Psychiatrischen Einrichtung für Straftäter, zusammen mit dem Sexualstraftäter Jósteinn. Ausgerechnet der engagiert Dóra, um Jakobs Unschuld zu beweisen. Dóra beginnt sie zu recherchieren und stößt auf mysteriöse Hinweise: Sie erhält kryptische Nachrichten auf ihrem Handy und eine junge Mutter glaubt, dass ihr kleiner Sohn vom Geist seines verunglückten Kindermädchens heimgesucht wird. Und dann gibt es eine heiße Spur, die Dóra ins isländische Justizministerium führt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tödliche Flammen, eiskalte Lügen – die Reykjavíker Anwältin Dóra Guðmundsdóttir muss einen alten Fall wieder aufnehmen. Jakob, ein junger Mann mit Down-Syndrom, soll einen Brand in seinem Wohnheim gelegt haben, bei dem fünf Menschen starben. Inzwischen lebt Jakob in einer Psychiatrischen Einrichtung für Straftäter, zusammen mit dem Sexualstraftäter Jósteinn. Ausgerechnet der engagiert Dóra, um Jakobs Unschuld zu beweisen. Dóra beginnt sie zu recherchieren und stößt auf mysteriöse Hinweise: Sie erhält kryptische Nachrichten auf ihrem Handy und eine junge Mutter glaubt, dass ihr kleiner Sohn vom Geist seines verunglückten Kindermädchens heimgesucht wird. Und dann gibt es eine heiße Spur, die Dóra ins isländische Justizministerium führt …
Yrsa Sigurdardóttir, geboren 1963, ist eine vielfach ausgezeichnete Bestsellerautorin, deren Spannungsromane in über 30 Ländern erscheinen. Sie zählt zu den »besten Thrillerautoren der Welt« (The Times). Sigurdardóttir lebt mit ihrer Familie in Reykjavík. Sie debütierte 2005 mit »Das letzte Ritual«, der Beginn einer Reihe von Kriminalromanen um die Rechtsanwältin Dóra Guðmundsdóttir und begeisterte ebenso mit ihrer Serie um die Psychologin Freyja und Kommissar Huldar von der Kripo Reykjavík. Ihr Thriller »Schnee« verkaufte sich über 60 000 Mal und war monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Auch ihre weiteren Thriller »Nacht« und »Rauch« waren gefeierte SPIEGEL-Bestseller.
Yrsa Sigurdardóttir
Feuernacht
Thriller
Aus dem Isländischen von Tina Flecken
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel Horfðu á mig bei Veröld, Reykjavík
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Wiederveröffentlichung Juli 2025
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright der Originalausgabe © Yrsa Sigurðardóttir 2009
Published by agreement with Salomonsson Agency
Erstmals auf Deutsch erschienen 2011 im
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
Covergestaltung: www.sempersmile.deunter Verwendung eines Motivs von Shutterstock.com (rsvy, Zhukova Valentyna, freedomnaruk)
MA · Herstellung: han
ISBN 978-3-641-28092-5V001
www.btb-verlag.de
Anmerkungen
Die isländischen Buchstaben werden wie folgt ausgesprochen:
Æ bzw. æ wie ai in Kaiser
Ð bzw. ð wie englisches stimmhaftes th in this
Þ bzw. þ wie englisches stimmloses th in thick
Weil sich alle Isländer üblicherweise mit dem Vornamen anreden, wurde auch in dieser Übersetzung die Du-Form gewählt.
Dieses Buch widme ich meiner Großmutter
Vilborg G. Guðjónsdóttir (4. November 1909 – 24. Juli 1982).
Yrsa
Personen der Handlung
Dóra Guðmundsdóttir Reykjavíker Anwältin und alleinerziehende Mutter
Matthias Reich Dóras Freund aus Deutschland
Sóley und Gylfi Dóras Kinder
Sigga Gylfis Freundin
Orri Dóras kleiner Enkel
Bragi Dóras Kollege in der Anwaltskanzlei
Bella ihre Sekretärin
Heimbewohner und ihre Angehörigen
Jakob junger Mann mit Down-Sydrom
Grímheiður Jakobs Mutter
Lísa junge Frau, die im Wachkoma liegt
Sigríður Herdís blindes und gehörloses Mädchen
Ragna junge Frau mit Locked-in-Syndrom
Natan geistig behinderter Epileptiker
Tryggvi Autist
Einvarður Tryggvis Vater
Fanndís Tryggvis Mutter
Lena Tryggvis Schwester
Heimmitarbeiter
Glódís Heimleiterin
Friðleifur Nachtwächter
Linda Entwicklungstherapeutin
Ægir Tryggvis Therapeut
weitere Personen
Jósteinn Insasse im Sogn, einer Anstalt für psychisch kranke Straftäter
Ari Jakobs Anwalt
Margeir Radiomoderator
Sveinn Kameramann
Berglind, Halli und Pési Familie, in deren Haus es spukt
Prolog
Samstag, 8. November 2008
Die Katze versteckte sich hinter einem kahlen, aber dichten Busch in der Dunkelheit. Sie war vollkommen ruhig, nur ihre gelben Augen huschten hin und her; aufmerksam hielt sie Ausschau nach den Geschöpfen der Nacht. Die Menschen, die ihr zu fressen gaben, hatten es schon längst vergessen, aber die Katze wusste, dass sich in der Dunkelheit Wesen verbargen, die das Tageslicht mieden. Sie machten sich erst bemerkbar, wenn die Stille der Nacht anbrach, ungefähr dann, wenn die Schatten verschwanden oder die Macht übernahmen, je nachdem, wie man es betrachtete. Die Katze genoss diese Zeitspanne, obwohl sich ihr immer wieder das Fell sträubte, während sie auf das Unvorhersehbare lauerte, auf das Böse, das eine günstige Gelegenheit abpasste. All jene, die das Tageslicht scheuten, waren jetzt unterwegs; die dunklen Ecken verschmolzen mit der Nacht, alles war düster und einsam.
Plötzlich hörte die Katze ein leises Knacken. Sie fuhr ihre Krallen aus und grub sie in die feuchte, kalte Erde. Obwohl sie nichts erspähte, blieb sie wachsam, atmete noch langsamer und ruhiger und drückte ihren schlanken Körper so dicht wie möglich an den Boden. Die kühle Luft, die ihre Lungen nach dem langen Schlaf auf dem Sofa angeregt hatte, wurde drückend, und jeder Atemzug hinterließ einen unangenehmen Geschmack auf ihrer rauen Zunge. Instinktiv drang ein leises Fauchen aus ihrer Kehle, verzagt machte sie sich bereit, vor der Scheußlichkeit Reißaus zu nehmen, die sich dort irgendwo verbarg, unsichtbar wie die Besitzer der Stimmen aus dem Radio der Menschen. Blitzschnell drehte sich die Katze um, jagte aus dem Busch und floh, so schnell sie konnte, weg vom Haus.
Berglind setzte sich im Bett auf und war hellwach. Wenn sie normalerweise nachts aufwachte, glitt sie langsam vom Traum ins Wachsein, aber jetzt war sie aus dem Tiefschlaf hochgeschreckt und fühlte sich so, als hätte sie gar nicht geschlafen. Im Elternschlafzimmer war es vollkommen dunkel, draußen der sternenlose, tiefschwarze Himmel. Die Leuchtzeiger des Weckers standen auf halb vier. Hatte ein Weinen aus dem Kinderzimmer sie geweckt? Berglind lauschte, hörte aber nichts als das leise Ticken des Weckers und die tiefen Atemzüge ihres Mannes.
Sie schlüpfte unter der Bettdecke hervor, vorsichtig, um Halli nicht zu wecken. Er hatte in den vergangenen Monaten schon so viel durchmachen müssen, dass sie ihn auf keinen Fall stören wollte. Obwohl es so zu sein schien, konnte sie kaum glauben, dass die Geschichte endgültig vorbei war. Sie wollte mit niemandem mehr darüber sprechen, auch nicht mit ihrem Mann, denn sie befürchtete, dass die Leute sie für hysterisch halten und ihr noch weniger glauben würden. Sogar Halli, der dieselben Dinge erlebt hatte wie sie, versuchte immer öfter, sachliche Erklärungen dafür zu finden, die meist so weit hergeholt waren, dass sie ans Lächerliche grenzten. Er hatte ihre Meinung nie vollständig akzeptiert, aber aufgehört, dagegen zu protestieren, weil ihm keine andere Möglichkeit mehr blieb, als sich die merkwürdigen Ereignisse häuften. Immerhin musste man ihm zugutehalten, dass er stets hinter ihr gestanden hatte, obwohl ihre Ehe in der letzten Zeit ins Wanken geraten war. Sie schienen zwar das Schlimmste überwunden zu haben, aber Hallis Arbeitszeiten waren reduziert worden, und obwohl Berglind eine angeblich sichere Stelle bei der Regierung hatte, konnte man nie wissen, ob die nicht doch noch von Kürzungen bedroht war.
Berglinds Augen gewöhnten sich rasch an die Dunkelheit, und sie verließ geräuschlos das Zimmer. Es würde nichts bringen, sich wieder hinzulegen. Sie wollte ein Glas Wasser trinken, nach Pési schauen und sich vergewissern, dass er tief und fest schlief. Das reichte hoffentlich, um wieder müde zu werden. Wenn nicht, würde sie im Computer ein paar Patiencen legen oder im Internet surfen, bis ihre Augenlider schwer wurden. Sie wusste, wie sie sich mit etwas Sinnlosem, Stupidem ablenken konnte – sonst hätte sie es kaum so lange in diesem Haus ausgehalten. Berglind versuchte, die Schlafzimmertür ohne Knarren hinter sich zuzuziehen. Als sie das Haus gekauft hatten, wollten sie sämtliche Türen auswechseln, aber daraus war nie etwas geworden. Im Flur war es eiskalt, die Fliesen brannten unter ihren Füßen, und sie ärgerte sich, nicht nach ihren Hausschuhen gesucht zu haben. Tief im Inneren wusste sie, dass sie das nie getan hätte – sie war noch lange nicht so weit, im Dunkeln neben ihrem Bett umherzutasten. Hoffentlich würde das irgendwann möglich sein. Hoffentlich war wohl nicht das richtige Wort, es musste möglich sein. Sonst würde sie durchdrehen.
Das Wasser in der Küche war lauwarm, und Berglind ließ es eine Weile laufen. Währenddessen starrte sie hinaus auf die vertraute Straße und die Häuser der Nachbarn auf der anderen Seite. Überall war es dunkel, nur in der Garage direkt gegenüber schien jemand vergessen zu haben, das Licht auszuschalten. Hinter einem offenstehenden Fenster schwang ein russischer Kronleuchter in einer leichten Brise hin und her. Ansonsten lag die Häuserreihe im Dunkeln. Der gelbliche Schein der Straßenlaternen reichte nicht bis in die Gärten und erlosch hinter dem Bürgersteig. Dort begann die Finsternis. Berglind schaute hangabwärts über die Hausdächer und vergaß das Wasser, während sie ihren Blick über den Vesturlandsvegur schweifen ließ, bis zu der Stelle, an der die Straße unterhalb ihres Wohnviertels Richtung Kjalarnes abschwenkte. Ein Auto fuhr vorbei, und Berglind meinte, ein quietschendes Geräusch zu hören, als der Wagen durch die regennassen Fahrrillen rollte, die damals vielleicht ihren Teil zu dem Unfall beigetragen hatten, obwohl ganz anderes Wetter gewesen war. Die Straße musste dringend ausgebessert werden, aber in der nächsten Zeit würde wohl kaum etwas passieren. Berglind löste ihren Blick vom Fenster und hielt das Glas unter den Wasserstrahl.
Wenn sie doch nur die Weihnachtsfeier abgesagt hätten. In ihrer Erinnerung hatten sie eigentlich gar keine Lust gehabt, sich aber von Freunden überreden lassen. Und wenn es doch anders gewesen war, wollte sie das gar nicht wissen – es war leichter, mit den Folgen klarzukommen, wenn andere dafür verantwortlich waren, dass sie beschlossen hatten, sich schick zu machen, einen Babysitter zu besorgen und hinzugehen. Seitdem hatten sie keinen Babysitter mehr gebraucht. Ihre Freizeitaktivitäten beschränkten sich auf das Haus und auf Orte, zu denen sie ihren vierjährigen Sohn mitnehmen konnten.
Es war unmöglich, sich Abende vorzustellen, an denen sie sich amüsierten, während ein Babysitter ihr Kind betreute – nicht nach dem schicksalhaften Abend und den darauffolgenden Ereignissen. Zum tausendsten Mal zerbrach sich Berglind den Kopf darüber, ob alles anders verlaufen wäre, wenn sie die Weihnachtsfeier abgesagt oder zu Hause nichts getrunken hätten, um sich den Aperitif im Restaurant zu sparen, aber diese Überlegungen führten zu nichts. Sie hatten die Einladung angenommen und Vorbereitungen getroffen, um abends ausgehen zu können. Berglinds Blick wanderte automatisch wieder zum Fenster, und sie starrte auf den schwarzen Asphalt der Schnellstraße, die sich wie ein dunkler Fluss an ihrem Viertel vorbeischlängelte. Sie schloss die Augen, und in ihrem Kopf tauchte sofort wieder das Bild auf, das sie an jenem schrecklichen Abend gesehen hatte. Die Blinklichter des Krankenwagens und der Polizeiautos, die den blassen Schein der Lichterkette am Dachfirst des gegenüberliegenden Hauses im dichten Schneefall übertrumpften. Dieselbe Gewissheit, mit der Berglind rückblickend daran glaubte, dass sie eigentlich gar nicht an der jährlichen Weihnachtsfeier teilnehmen wollte, sagte ihr auch, dass ihr damals sofort klar gewesen war, dass der Unfall auf der Schnellstraße mit der Babysitterin zu tun hatte, die verspätet und noch nicht eingetroffen war.
Sie schlug die Augen auf und trank gierig Wasser. Die Gesichter der verzweifelten Eltern des Mädchens, die sie nach dem Unfall ein paar Mal getroffen hatten, würden Berglind für den Rest ihres Lebens verfolgen, wahrscheinlich bis ins Grab. Selbstverständlich gab ihnen niemand die Schuld an dem Unfall, jedenfalls nicht direkt, aber Berglind sah in den tränennassen Augen der Mutter, dass sie Berglind und Halli auf gewisse Weise dafür verantwortlich machte – dass sie die Einladung nicht hätten annehmen oder die Babysitterin zumindest hätten abholen sollen. Dann hätte ihre Tochter die Straße nicht überquert und wäre noch am Leben. Sie war immer nur in ihr Wohnviertel gekommen, um auf Pési aufzupassen. Aber weil Berglind und Halli sich hatten überreden lassen, befand sich das Mädchen genau zu der Zeit an genau dieser Stelle, als ein skrupelloser Mensch sie überfuhr, ohne sich noch einmal umzudrehen oder nachzuschauen, ob er dem Kind, das wie ein Häufchen Elend auf der Straße lag, vielleicht hätte helfen können. Der Fahrer und sein Wagen wurden nie ausfindig gemacht, zum Zeitpunkt des Unfalls war an diesem Straßenstück kein Verkehr gewesen, und trotz wiederholter Aufrufe in den Medien meldeten sich keine Zeugen. Das Mädchen starb einsam auf dem vereisten Asphalt und atmete schon nicht mehr, als der Fahrer des nächsten Wagens auf sie aufmerksam wurde. Er konnte froh sein, nicht über sie gefahren zu sein, denn ihr schlanker Körper war bereits von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Berglind schloss die Augen wieder und rieb sie mit ihren klammen Fingern. Wie breit war ein Auto? Zwei Meter? Drei Meter? Der Weg vom Haus des Mädchens zu ihnen betrug mindestens einen Kilometer, wenn nicht gar zwei. Was für ein tragisches Schicksal, dass sie genau dann die Straße überquerte, als dieser rücksichtslose Fahrer angefahren kam.
Berglind öffnete die Augen und leerte das Glas. Obwohl der Unfall ihr immer noch zu schaffen machte, war der schreckliche Tod des jungen Mädchens nicht das Schlimmste. Diese Tragödie ließ sich erklären: Etwa eine Tonne Stahl prallte mit hundert Stundenkilometern auf ein fünfzig Kilo leichtes Mädchen. Das Ergebnis war vollkommen logisch. Natürlich war es ein trauriges Ereignis, aber dennoch ein Teil dessen, womit der Mensch zurechtkommen musste. Viel schwieriger war es, sich mit dem abzufinden, was dann folgte: Das Mädchen – oder vielmehr ihr Geist – schien beschlossen zu haben, ihr Versprechen, auf Pési aufzupassen, einzulösen, sobald es dämmerte. Vielleicht durfte sie nicht in Frieden ruhen, weil sie eines unnatürlichen Todes gestorben war. In den wenigen Horrorfilmen, die Berglind gesehen hatte, wurden Menschen zu Wiedergängern, wenn ihr Tod ungeklärt war. Am Anfang verstanden Berglind und Halli nicht, was los war, und hielten die Aussagen des Jungen, Magga sei bei ihm, für eine Folge ihrer Gespräche über den Unfall. Er war noch zu klein, um den Tod zu begreifen. Es war völlig normal, dass Pési Magga vermisste; sie hatte auf ihn aufgepasst, seit er ein Jahr alt war, und er war total begeistert von ihr. Doch Berglind wurde mulmig zumute, als der Junge ständig wiederholte, Magga gehe es schlecht, sie habe so viel Aua. Erst da spitzte sie die Ohren und schüttelte die Lethargie ab, die sie nach dem Unfall befallen hatte. Allmählich häuften sich mysteriöse, unheimliche Vorfälle, bis die Sache nicht mehr zu verleugnen war.
Sobald es dämmerte, wurde es kühl im Kinderzimmer, und die Fensterscheibe beschlug. Sämtliche Versuche, die Heizung zu reparieren, blieben erfolglos, der Installateur stand eine Stunde lang herum, kratzte sich am Kopf und ließ sie dann ratlos zurück, mit einer Rechnung über vier Stunden Arbeitszeit. Das alte Mobile, das über dem Bett des Jungen hing, bewegte sich, obwohl kein Luftzug im Raum war, und andauernd gab es Stromschwankungen; das Licht flackerte, und ständig mussten Glühbirnen ausgetauscht werden. Sobald der Tag anbrach, wurde die Luft im Raum drückend und änderte sich auch nicht, wenn man das Fenster aufmachte. Es war, als ginge der Sauerstoff zur Neige, und jeder Atemzug hinterließ einen ekelhaften, metallischen Geschmack im Mund. Für all dies konnte man logische Erklärungen finden. Das Haus war schon in die Jahre gekommen und musste dringend renoviert werden. Andere Vorfälle ließen sich jedoch keineswegs auf den Zustand des Hauses schieben. Morgens waren Pésis Teddybären ordentlich aufgereiht, und seine Kleider lagen gefaltet auf einem Hocker in der Ecke, obwohl sie am Abend vorher auf einem Haufen auf dem Boden gelegen hatten. Und das war noch nicht alles. Pési schreckte nachts oft jäh aus dem Schlaf hoch, aber seine Eltern mussten ihm nicht etwa etwas zu trinken geben, ihn zurück ins Bett bringen oder beruhigen, sondern fanden ihn lächelnd in seinem Bett sitzend, mit den folgenden Worten auf den Lippen: »Ihr müsst nicht aufstehen, Magga passt auf mich auf.«
Daraufhin holten sie ihn nachts zu sich, was dem Geist des Mädchens zu missfallen schien. Ständig wachten sie auf, weil die Bettdecken ohne besonderen Grund langsam auf den Boden rutschten. Unter dem Bett war ein kratzendes Geräusch zu hören, erst kaum merklich, dann immer lauter und heftiger. Das Geräusch verstummte, sobald Halli aufstand, unters Bett schaute und schläfrig murmelte, das seien bestimmt die verdammten Mäuse. Aber er sah nie irgendein Tier. Dieselbe Kühle, die sie in Pésis Zimmer wahrgenommen hatten, griff nun auf das Elternschlafzimmer über, ebenso wie die beschlagenen Fensterscheiben und die Stromschwankungen. Obendrein bildeten sich an der Türschwelle kleine Pfützen, die im Dunkeln aussahen wie Blut, sich aber bei Licht als Wasser entpuppten. Sie holten zwei Dachdecker, die aufs Dach kletterten, aber keine undichten Stellen fanden.
Im Nachhinein betrachtet war es unglaublich, wie lange sie das alles ertragen hatten, ohne sich anderweitige Hilfe zu holen. Eines Morgens verkündete Berglind, sie halte es nicht mehr aus, das Haus würde sofort verkauft, unabhängig von der Wirtschaftskrise und der Stagnation auf dem Immobilienmarkt. Als sie aufgewacht waren, hatte ihre Kleidung am Schrank im Schlafzimmer gehangen – und zwar nicht irgendwelche Kleidung, sondern Hallis Anzug mit Hemd und Krawatte und ein dazu passendes Kleid von Berglind. Genau dieselben Sachen, die sie an dem Abend getragen hatten, als sie zu der Weihnachtsfeier wollten. Als sie ins Bett gingen, hatte definitiv noch nichts am Schrank gehangen. Halli war zum ersten Mal genauso entsetzt wie Berglind, was ihr noch mehr Angst einjagte. Er gab zu bedenken, dass sich ihre Lage durch den Verkauf des Hauses nicht unbedingt zum Besseren wenden würde, und anstatt der Verlockung nachzugeben, beschlossen sie, ein Medium zu Hilfe zu holen, um den Geist – oder was auch immer es war – zu vertreiben.
Das Medium meinte, eine geplagte, unzufriedene Seele in Pésis Nähe zu spüren, deren Anwesenheit sie aber nicht abwehren könne. Dasselbe behauptete eine Hellseherin, die ihnen eine Cousine von Berglind nachdrücklich empfohlen hatte. Beide gaben ihre Einschätzung nicht umsonst ab, und die finanzielle Lage der Familie war nicht so rosig, dass sie die Dienstleistungen sämtlicher Personen, die in den entsprechenden Kleinanzeigenspalten der Zeitungen inserierten, in Anspruch nehmen konnten. Der letzte Ausweg war der Gemeindepfarrer, den sie zum letzten Mal bei Pésis Taufe gesehen hatten. Der Mann war zunächst vorsichtig und schien das Ganze für einen Scherz zu halten. Berglinds blanke Angst blieb ihm jedoch nicht verborgen, und er änderte sein Verhalten, wollte aber nichts versprechen. Er besuchte sie ein paarmal und spürte die Kälte und die elektrische Ladung in Pésis Nähe am eigenen Leib. Daraufhin suchte er Rat beim Bischof, und schließlich führte die Staatskirche die erste Haussegnung seit über einem Jahrhundert durch, um einen Geist auszutreiben. Nachdem sie alle Zimmer durchschritten hatten, verkündete der Bischof feierlich, die Seele des Mädchens würde nicht wieder in ihr Haus kommen. Und wer hätte es gedacht – genau so war es auch.
Im Handumdrehen fühlte sich alles ganz anders an, wobei man schwer festmachen konnte, was genau sich verändert hatte. Die Atmosphäre im Haus war einfach wieder so wie früher. Natürlich war es schwierig, nicht mehr ständig mit etwas Unheimlichem in den eigenen vier Wänden zu rechnen, und es würde wohl einige Zeit brauchen, bis die Hände nicht mehr zitterten. Doch zweifellos würde die Zeit diese Wunde heilen, und Berglind gab sich mit einer langsamen, aber stetigen Besserung zufrieden.
Im ersten Stock knarrte das Parkett. Das Geräusch kam aus Pésis Zimmer. Berglind stellte ihr Glas ab und drehte sich langsam um. Plötzlich hatte sie einen trockenen Mund, und die Gänsehaut kam zurück. Verdammter Unsinn. Es würde wohl noch eine Weile dauern, bis sie sich komplett erholt hatte. Mit langsamen Schritten ging sie die Treppe hinauf. Als sie an der Tür zum Kinderzimmer angelangt war, hörte sie den Jungen leise reden. Anstatt zu lauschen, öffnete sie vorsichtig die Tür. Pési stand auf Zehenspitzen am Fenster und spähte hinaus. Als er die Tür hörte, verstummte er und drehte sich um. Berglind schlug die Hand vor den Mund, als sie die beschlagene Fensterscheibe sah.
»Hallo, Mama.« Pési lächelte traurig.
Berglind eilte zu ihrem Sohn und riss ihn unsanft vom Fenster weg. Sie drückte ihn an sich und versuchte gleichzeitig, die Scheibe trockenzuwischen, aber die Dunstschicht verschwand nicht. Sie war von außen auf dem Glas.
Pési schaute seiner Mutter in die Augen. »Magga ist draußen und kann nicht rein. Sie möchte auf mich aufpassen.« Er zeigte zum Fenster und verzog das Gesicht. »Sie ist ein bisschen sauer.«
1. Kapitel
Montag, 4. Januar 2010
Von der Straße aus gesehen war das Haus unscheinbar. Ausländische Touristen mochten es für einen Bauernhof halten, dessen Bewohner sich im Schweiße ihres Angesichts und in Eintracht mit Gott und den Menschen abrackerten. Möglicherweise fanden sie das Wohnhaus ungewöhnlich groß, würden aber keine weiteren Gedanken daran verschwenden und einfach weiterfahren, ohne sich noch einmal umzudrehen. Es war sogar sehr wahrscheinlich, dass Einheimische dasselbe denken würden, da man in der Öffentlichkeit nicht viel über den Hof sprach. Wenn er mal in den Medien erwähnt wurde, dann meist im Zusammenhang mit tragischen Schicksalen. Die Leser überflogen die reißerischen Texte über das merkwürdige und unbegreifliche Verhalten der Menschen, die dort lebten, und blätterten weiter zu etwas Erfreulicherem. Wenn sie die Zeitung zugeschlagen hatten, blieb von den Beschreibungen des Orts und seiner Bewohner nicht viel hängen; es war angenehmer, diese Leute schnell wieder zu vergessen. Sogar im öffentlichen System wurden die Belange der Anstalt hinten angestellt; natürlich war man von der Wichtigkeit der dortigen Arbeit überzeugt, aber es herrschte eine stillschweigende Übereinkunft, dass sich die Beamten möglichst wenig damit auseinandersetzen sollten. Tief im Innern wusste auch Dóra, dass sie das Anliegen, das sie hierherführte, abgelehnt hätte, wenn die Auftragslage in der Kanzlei besser gewesen wäre. Nur die Neugier auf einen mysteriösen Fall hätte sie womöglich angespornt – schließlich bat nicht jeden Tag ein Insasse einer Anstalt für psychisch kranke Straftäter um ihre Unterstützung.
Die Geschichte der Anstalt war kurz: Bis zum Jahr 1992 wurden Gefangene mit psychischen Problemen in ausländischen Einrichtungen oder im Gefängnis Litla-Hraun untergebracht, beides schlechte Alternativen. Im Ausland hatten die Gefangenen mit Sprachbarrieren und der Distanz zu Freunden und Familie zu kämpfen, und das Gefängnis Litla-Hraun war keine medizinische Einrichtung. Dóra konnte sich gut vorstellen, dass die eigenartige Umgebung und die raue Atmosphäre innerhalb der Gefängnismauern der Behandlung von psychisch kranken Straftätern nicht gerade zugutekamen. Die sieben Plätze im Sogn waren jedenfalls immer belegt.
Die Kurve war scharf, und der Wagen kam auf dem losen Kies ins Schleudern. Dóra packte das Lenkrad fester und konzentrierte sich auf die Fahrt über die kurze Zugangsstraße. Sie wollte nicht schon bei ihrem ersten Besuch im Graben landen und sich herausziehen lassen müssen. Das Ganze war sowieso schon seltsam genug. Die Frau, die ihr einen Termin mit dem Insassen gegeben hatte, war zwar sehr freundlich gewesen, aber man hatte ihr anhören können, dass solche Anfragen alles andere als üblich waren. Dóra hatte eine gewisse Nervosität an ihr wahrgenommen, was angesichts des Lebenslaufs des Mannes, den sie treffen wollte, nicht weiter verwunderlich war. Er war kein normaler Insasse, der mit sporadischen psychischen Problemen zu kämpfen hatte oder aufgrund von Drogen- oder Alkoholkonsum auf die schiefe Bahn geraten war. Jósteinn Karlssons Weg hatte schon in jungen Jahren trotz zahlreicher Eingriffe der Behörden ins Verderben geführt.
Dóra hatte sich mit seiner Vergangenheit vertraut gemacht, was keine unterhaltsame Lektüre war. Allerdings hatte sie nur Zugang zu zwei Fällen, da die Straftaten, die er als Minderjähriger begangen hatte, nicht einsehbar waren. Jósteinn war wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und sexuellem Missbrauch eines Kindes angeklagt worden. Ihm wurde vorgeworfen, einen sechsjährigen Jungen von der Straße in seine Wohnung gelockt zu haben, allerdings mit unklarer Absicht, denn ein Nachbar rief frühzeitig die Polizei. Dieser wachsame Mitbürger war schon lange misstrauisch gewesen und behauptete, Jósteinn sei für das Verschwinden seiner beiden Katzen verantwortlich, die schwer misshandelt direkt unter Jósteinns Balkon gefunden wurden. Obwohl Jósteinn gewissermaßen auf frischer Tat mit einem fremden Kind in seiner Wohnung ertappt wurde und ein Zeuge ihn stark belastete, kam er verhältnismäßig glimpflich davon. Das Kind machte nämlich keine Aussage, weder vor Gericht noch sonst wo. Ein Psychologe versuchte, mit dem kleinen Jungen zu reden, bekam aber nichts aus ihm heraus; er presste nur die Lippen zusammen, sobald das Gespräch auf den Vorfall kam. Der Psychologe ging davon aus, dass Jósteinn dem Jungen eine Heidenangst eingejagt und ihm gedroht hatte. Daher ließ sich nicht eindeutig beweisen, dass sich Jósteinn in seiner Wohnung an dem Kind vergangen hatte. Die Bemühungen der Anklage, Jósteinn ein Sexualverbrechen nachzuweisen, blieben vergeblich, zumal das Kind keine Verletzungen aufwies. Trotzdem glaubte niemand im Gerichtssaal Jósteinns Geschichte, das Kind habe sich verlaufen und er hätte ihm helfen wollen, seine Eltern zu finden. Da keine eindeutigen Beweise vorlagen, bekam Jósteinn eine sechsmonatige Bewährungsstrafe wegen Freiheitsberaubung.
Zwölf Jahre später vergriff sich Jósteinn an einem Jungen im Teenageralter, und diesmal gab es keine wachsamen Nachbarn im Wohnblock. Dóra konnte sich zwar gut an den Fall erinnern, las aber erst jetzt das Urteil, obwohl es fast zehn Jahre alt war. Sie war sich ziemlich sicher, dass Jósteinn den Jungen umbringen wollte, aber wieder griff das Schicksal ein. Die Frau, die das Treppenhaus putzte, kam einen Tag früher als gewohnt, hätte aber wahrscheinlich gar nichts bemerkt, wenn sie wie üblich nur gestaubsaugt hätte. Aber ein Kleinkind hatte an der Wand neben Jósteinns Wohnungstür Eis verschmiert, weshalb sie ungewöhnlich lange dort putzte. Als sie den Staubsauger ausschaltete, hörte sie Jammern und unterdrückte Schmerzschreie, und nach kurzem Zögern beschloss sie, lieber die Polizei zu rufen, anstatt selbst anzuklopfen und zu überprüfen, was dort los war. In ihrer Aussage stand, sie hätte noch nie solche Laute gehört, sie müssten von großen Qualen herrühren. Die Polizei drang also erneut in Jósteinns Wohnung ein, und diesmal erwischte sie ihn im Bett.
Beim Lesen des Urteils war Dóra auf ein merkwürdiges Detail gestoßen. Während der Ermittlungen hatte die Polizei einen anonymen Hinweis auf Fotos bekommen, die Jósteinn gehörten. Sie waren über einen längeren Zeitraum aufgenommen worden und zeigten deutlich, wie viele Kinder er im Lauf der Jahre auf unterschiedlichste Weise missbraucht hatte. Diese Fotosammlung brachte die Ermittlung einen großen Schritt voran, da die anderen Punkte aus Jósteinns Anklage sonst wohl nur zu ein paar Jahren Gefängnis geführt hätten. Nach der Entdeckung der Fotos bekam die Polizei endlich auch einen Durchsuchungsbefehl für Jósteinns Arbeitsplatz. Er arbeitete damals bei einer Computerfirma, und dort fand man eine gigantische Menge von Kinderpornographie, wodurch die Anklage erheblich verschärft werden konnte. Bei der Gerichtsverhandlung wurde ein psychiatrisches Gutachten vorgelegt, dem zufolge Jósteinn wegen schwerwiegender psychischer Störungen für schuldunfähig erklärt wurde. Der Richter entschied, dass er in einer Anstalt für psychisch kranke Straftäter untergebracht werden sollte, bis er therapiert und für seine Umgebung als ungefährlich einzustufen sei.
Bei dem merkwürdigen Telefonat mit Dóra hatte Jósteinn gesagt, er wolle einen alten Fall wieder aufrollen, aber Dóra wusste nicht, ob er damit den ersten oder den zweiten Fall meinte. Beides wäre ohnehin zwecklos. Im ersten Fall hatte er ein unglaublich mildes Urteil bekommen, und der zweite Fall war so offenkundig, dass es keine Anhaltspunkte gab, die auf ein zweifelhaftes Verfahren oder Urteil schließen ließen. Dóra konnte sich am ehesten vorstellen, dass Jósteinn den Beschluss über seine Strafunfähigkeit anfechten und dadurch entweder in einen normalen Strafvollzug kommen oder freigesprochen werden wollte. Nach dem kurzen Telefonat ließ sich schwer sagen, ob sich sein seelischer Zustand verbessert hatte; er klang ganz normal, nur etwas ungeduldig und überheblich. Wahrscheinlich war er noch genauso krank wie am Tag seiner Einlieferung. Aus der Diagnose des Psychiaters ging hervor, dass Jósteinn unter schwerer Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen litt, die man wahrscheinlich durch Medikamente und Therapie eindämmen, aber unmöglich heilen konnte.
Dóra stieg aus dem Wagen und nahm ihre Aktentasche vom Rücksitz, in der sich die Ausdrucke der beiden Urteile und ein großes Notizbuch befanden. Sie musste bestimmt nicht viel notieren und würde den Fall höchstwahrscheinlich unter einem Vorwand ablehnen. Die Beschreibungen dessen, was Jósteinn mit dem Jugendlichen gemacht hatte, ließen ihr keine Ruhe, und sie wollte nicht dazu beizutragen, dass der Mann freigelassen wurde. Im Grunde hätte sie die Sache von Anfang an ablehnen sollen. Dóra knallte die Autotür zu und ging zum Eingang. Sie war nicht in der Lage, den psychischen Zustand einer Person zu beurteilen, und wusste nicht, wie sie die Situation einschätzen sollte: War Jósteinn inzwischen psychisch gesund, voller Reue und hatte es verdient, eine zweite Chance zu bekommen, oder war er ein unheilbarer Krimineller, den es nach weiteren Opfern verlangte?
Dóra klingelte an der Tür und schaute sich um. Sie sah, wie zwei Männer in aller Ruhe zu einem kleinen Gewächshaus schlenderten und mit ihren Eimern darin verschwanden. Wenn sie nicht alles täuschte, hatte der eine Mann das Down-Syndrom. Die Haustür ging auf, und eine Frau in einem weißen Kittel, den sie offen über einer Jeans und einem verschlissenen Pulli trug, stand in der Türöffnung. Der Kittel sah genauso mitgenommen aus wie der Pulli; zahllose Waschgänge hatten das Logo des Landeskrankenhauses ausgebleicht.
Die Frau stellte sich als wachhabende Krankenschwester vor und bat Dóra herein. Sie begleitete sie zur Garderobe und unterhielt sich höflich mit ihr über die Fahrt und das Wetter. Anschließend führte sie Dóra durchs Haus und öffnete eine Tür zu einem freundlichen, aber ziemlich verlebten Wohnzimmer, wo das Gespräch stattfinden sollte. Durch ein großes Fenster konnte man den Garten und das kleine Gewächshaus sehen, in dem die beiden Männer sich jetzt über einige hübsche Pflanzen beugten. Die Frau erzählte Dóra, das Gewächshaus sei von einer großzügigen älteren Dame finanziert worden, deren zweijährige Tochter vor über sechzehn Jahren von einem psychisch kranken Mann ermordet worden war. Das Mädchen hatte den Mann nicht gekannt und nie zuvor gesehen. Die Großzügigkeit der Frau nach all diesen Jahren sei wirklich bewundernswert. Als Dóra diese Geschichte gehört hatte, war sie gar nicht mehr begeistert von dem Wohnzimmer, das kaum Schutz vor möglichen Angriffen bot. Am liebsten hätte sie das Gespräch hinter einer kugelsicheren Glaswand geführt. »Bin ich hier sicher?«, fragte sie und musterte die bestickten Kissen, die auf den Sofas und Stühlen verteilt waren.
»Ich bin direkt nebenan«, sagte die Frau, ohne eine Miene zu verziehen. »Ruf einfach, wenn was ist, dann reagieren wir sofort.« Sie merkte, dass Dóra immer noch irritiert war, und fügte hinzu: »Jósteinn tut dir nichts. Er ist seit fast zehn Jahren hier und hat noch nie jemandem was getan.« Nach kurzem Zögern sagte sie: »Jedenfalls keinem Menschen.«
»Und Tieren?«
»Wir versuchen, dieses Verhalten zu unterbinden. Es gibt hier keine Tiere, weil sie so leicht zu Opfern werden. Aber wir sind hier auf dem Land, manchmal verschlägt es Tiere von den Nachbarhöfen hierher.« Die Frau ließ Dóra keine Gelegenheit, das Gespräch fortzusetzen. »Bitte setz dich schon mal, ich hole Jósteinn.« Er ist schon ziemlich aufgeregt.
Die Frau verschwand, und Dóra überlegte, welcher Platz am sichersten wäre. Sie wollte auf keinen Fall, dass sich der Mann neben sie setzte. Ein verschlissener Sessel, der etwas abseits stand, schien die beste Wahl sein, und Dóra legte ihre Aktentasche auf den Couchtisch davor. Sie wollte lieber stehen, wenn der Mann ins Zimmer kam; sie hatte mal gelesen, wie wichtig das bei der ersten Begegnung mit einem Fremden war, wenn man vermeiden wollte, dass dieser im Gespräch die Oberhand bekam. Wer saß, blickte automatisch zu dem anderen auf, was der Theorie nach das Kräfteverhältnis festlegte.
Jósteinn kam mit der Krankenschwester ins Zimmer, die ihn vorstellte und wiederholte, sie befände sich in Rufweite. Dóra hatte den Eindruck, dass sich bei diesen Worten ein Grinsen über Jósteinns Gesicht zog, obwohl die Krankenschwester einen Ton angeschlagen hatte, als würde sie ihnen einen Kaffee anbieten. So viel zu dem ausgeglichenen Kräfteverhältnis. Dóra riss sich zusammen und bot Jósteinn einen Platz an. Der Mann setzte sich mit spöttischem Gesichtsausdruck und ohne sie anzuschauen auf das Sofa gegenüber. Er war schlank, und obwohl er weite, schlabberige Kleidung trug, meinte Dóra, an seinem sehnigen Hals und seinen muskulösen Händen zu erkennen, dass er stark war. Seine Haare waren dunkel und glatt zurückgegelt. Es sah aus, als sei er gerade aus dem Schwimmbad gestiegen. An einer Stelle war das durchsichtige Zeug an seiner Wange heruntergelaufen und hatte einen glänzenden Streifen in seinem knochigen, etwas hinterlistigen Gesicht hinterlassen. Jósteinn hatte Dóra immer noch nicht angeschaut.
»Fühlst du dich wohl?« Trotz der höflichen Frage klang sein Tonfall eher so, als wolle er sich über Dóra lustig machen. »Ich habe selten Gäste, deshalb ist es mir sehr wichtig, dass du dich wohl fühlst. Wir hätten uns eigentlich im Besprechungsraum treffen sollen, aber da ist es so ungemütlich, dass ich lieber hierhin wollte.« Er zwinkerte mit seinen grauen Augen, starrte auf den Couchtisch zwischen ihnen und schürzte die dünnen Lippen. »Ich habe so selten Gäste«, wiederholte er und lächelte scheinheilig. »Eigentlich nie.«
»Sollen wir nicht direkt zum Thema kommen?« Dóra war normalerweise viel höflicher, wenn sie als Anwältin Fremde kennenlernte, aber Jósteinn war ihr einfach unsympathisch. Sie wusste, dass sie aufpassen musste, nicht zu unfreundlich zu sein. »Ich habe mich so gut wie möglich mit deinem Fall vertraut gemacht, aber ich weiß ja nicht, worauf du hinauswillst. Es wäre am besten, das erst mal klarzustellen. Du bist seit ungefähr acht Jahren hier, stimmt das?«
»Ja, nein, ich habe nicht so genau mitgezählt. Zahlen liegen mir nicht. Sie sind wie Fallen, aus denen ich nur schwer wieder herauskomme.«
Dóra wollte gar nicht wissen, was der Mann damit meinte. Sie brauchte keine weiteren Beweise dafür, dass er immer noch krank war – ob er noch gefährlich war, war eine andere Frage, aber Dóra war sich ziemlich sicher. »Glaub mir, es sind ungefähr acht Jahre.« Sie beobachtete, wie Jósteinn beiläufig nickte. »Möchtest du wieder ein freier Mann sein?«
»Ich fühle mich hier inzwischen genauso frei wie anderswo.« Jósteinn wartete darauf, dass Dóra protestierte, aber als sie schwieg, redete er weiter: »Freiheit hat viele Seiten, dabei geht es nicht nur um dicke Wände und Gitter vor den Fenstern. Die Freiheit, nach der ich mich sehne, gibt es wohl nicht, deshalb bin ich nirgendwo richtig frei. Und hier ist es nicht schlimmer als anderswo.«
Dóra hatte keine Ahnung, wie sie das Gespräch wieder in vernünftige Bahnen lenken sollte. »Hast du hier eine Beschäftigung? Gibt es Freizeitangebote, Basteln oder so?« Sie konnte sich den Mann wirklich nicht mit Schere und Kleber vorstellen, es sei denn, er klebte seinem Opfer den Mund zu, damit es nicht schreien konnte, während er es mit der Schere malträtierte.
Jósteinn lachte wie ein schlechter Schauspieler beim Casting für eine Komödie. Das Lachen brach genauso plötzlich ab, wie es gekommen war, und der Mann straffte sich ein wenig. »Hier kann man schon einiges machen, einer bestickt sogar Kissen, und wie du siehst, ist er schon ziemlich lange hier. Ich repariere defekte Computer, die wir von Ministerien und öffentlichen Behörden geschenkt bekommen. Das kann ich ganz gut.« Er zeigte aus dem Fenster. »Jakob arbeitet im Gewächshaus und züchtet Kräuter und Salat.«
Dóra drehte den Kopf zur Seite und sah die beiden Männer aus dem kleinen Gewächshaus kommen. Ihre Eimer schienen jetzt viel schwerer zu sein als vorher. Nun war eindeutig zu erkennen, dass der Fülligere das Down-Syndrom hatte. »Wie praktisch.« Am liebsten hätte sie Jósteinn gefragt, was der Mann verbrochen hatte. Soweit sie wusste, waren Menschen mit Down-Syndrom im Allgemeinen friedlich und fröhlich.
»Er ist mein Freund, ein guter Freund.« Zum ersten Mal, seit Jósteinn den Mund aufgemacht hatte, wirkte er ehrlich, was aber nicht lange anhielt. Er wandte den Blick von seinem Freund ab und fragte: »Ist es möglich, einen alten Fall wiederaufzunehmen? Eine Strafe in einen Freispruch zu verwandeln, wenn man unschuldig ist?«
Dóra war auf diese Frage vorbereitet, hatte sogar darauf gewartet. »Ja, wenn es genügend Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Rechtssystem versagt hat.«
»Ich bin jetzt ein reicher Mann, wusstest du das?«
Dóra schüttelte den Kopf, unsicher, ob der Mann noch ganz bei Verstand war. »Nein, ich habe mich nicht mit deinen Finanzen beschäftigt. Hast du mit Computern gut verdient?« Schon möglich, dass nicht so viel nötig war, damit sich der Mann für reich hielt.
»Ich habe meine Mutter beerbt. Alles, was ich bin, und alles, was ich besitze, stammt von ihr.« Ein einschmeichelnder Ausdruck trat auf sein Gesicht, und Dóra musste an den Hinweis auf seine schwere Kindheit und den Erbanteil seiner psychischen Erkrankung denken. Wahrscheinlich war er bei einer überforderten Mutter aufgewachsen, einer weiblichen Ausgabe seiner selbst. »Sie ist zufällig unter ein Auto gekommen und hat Schmerzensgeld gekriegt, weil sie danach gelähmt war. Kurz darauf ist sie dann gestorben, und alles, was ihr gehört hat, gehört jetzt mir. Ihre persönlichen Sachen lasse ich verbrennen, aber das Geld behalte ich.«
»Hast du einen Finanzvormund?«, fragte Dóra.
»Nein, aber einen Betreuer. Der hat mich allerdings noch nie besucht oder angerufen.« Jósteinn schien das völlig gleichgültig zu sein, er behandelte es wie eine Tatsache, die man erwähnen sollte. »Ich will das Geld dafür benutzen, einen alten Fall aufzurollen. Ich kann sonst nichts damit anfangen. Zum Glück ist meine Verurteilung zu lange her, als dass der Junge, mit dem ich damals zu tun hatte, mich verklagen und Schmerzensgeld fordern könnte. Oder seine Familie. Soweit ich weiß, ist er immer noch in Behandlung.« Jósteinn grinste, so als fände er das witzig.
Jemand klopfte ans Fenster, und Dóra zuckte unübersehbar zusammen. Jósteinn wirkte höchst zufrieden. »Jakob ist nur neugierig, wer mich besuchen kommt. Ich habe, wie gesagt, noch nie Besuch gehabt.« Er grinste. »Was natürlich verständlich ist.«
Dóra konnte ihren Blick nicht vom Fenster und dem lächelnden Gesicht mit den dicken Brillengläsern hinter der Scheibe lösen. Der Mann legte seine erdverkrusteten Hände auf die Fensterscheibe und zog sie nach unten, so dass sich braune Streifen auf dem Fenster bildeten. Dann winkte er Dóra fröhlich zu. Sie winkte zurück.
»Warum ist er hier?«
Die Frage war ihr einfach so rausgerutscht, aber Jósteinn ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. »Er hat fünf Menschen auf dem Gewissen. Brandstiftung. Ziemlich heftig das Ganze.«
»Ach ja.« Dóra erinnerte sich dunkel an das Unglück, da in Island selten so viele Menschen bei einem Hausbrand umkamen, aber der Fall war im Bankencrash untergegangen. »Wann war das noch mal?«
»Vor ungefähr anderthalb Jahren.« Jósteinn winkte ab, so als spiele der Zeitpunkt keine Rolle. »Er ist erst zwanzig und wird wohl einen Großteil seines Lebens hier verbringen. Menschen wie er haben oft ein schwaches Herz, vielleicht stirbt er frühzeitig.«
Wieder schien das Gespräch in heikle Regionen abzudriften, und Dóra sagte schnell: »Ich sollte dich wohl darauf hinweisen, dass es in deinem Fall nicht viel Anlass zu einer Wiederaufnahme gibt. Du bist auf frischer Tat ertappt worden, wenn man das so sagen kann, und eine neue Erklärung für die Geschehnisse bringt nichts, es sei denn, du hast sehr gute Beweise. Das Urteil erscheint mir unanfechtbar, und ich kann auch keine Ungereimtheiten im Prozessverlauf feststellen.«
Zum zweiten Mal lachte Jósteinn, diesmal durchdringender. Ein unangenehmer Mundgeruch wehte zu Dóra herüber, und sie verzog instinktiv das Gesicht. Der Geruch erinnerte an den Komposthaufen ihrer Nachbarn, dessen Verrottungszustand sie je nach Windrichtung gut verfolgen konnte. Als Jósteinn aufgehört hatte zu lachen, war sein Gesicht wieder ausdruckslos. »Nicht mein Fall, Jakobs Fall, der Brand.« Er strich sich mit der Hand durch das verklebte Haar und wischte die Hand dann an der Armlehne des Sofas ab. »Er hat das nicht getan. Ich weiß ein paar Dinge über die Hintergründe der Tat, die du bestimmt lieber nicht hören willst. Jakob hat keinen Brand gelegt, und ich möchte, dass du das beweist.« Plötzlich beugte er sich abrupt vor und griff nach Dóras Hand. Er versuchte, für einen kurzen Moment ihren Blick zu erhaschen, und schaute dann auf ihre ineinander verschränkten Hände. Dóra spürte das klebrige Gel an seinen Handflächen, das sich wie zäher Schweiß anfühlte. »Vielleicht scheut ein gebranntes Kind nicht immer das Feuer.«
2. Kapitel
Mittwoch, 6. Januar 2010
Ihr Name war Grímheiður Þorbjarnardóttir. Sie war misstrauisch, hatte es energisch abgelehnt, ihren Mantel abzulegen, und saß dick eingepackt in einem sauberen, aber verschlissenen Wollmantel in Dóras überheiztem Büro. Den selbstgestrickten Schal, die dazu passende Mütze und die gefütterten Lederhandschuhe hatte sie immerhin sofort in ihren Schoß gelegt. Grímheiðurs rote, geschwollene Finger nestelten an den Fransen des farblich unpassenden Schals herum, während ihre Augen nach einer Stelle suchten, wo sie die Sachen ablegen konnte.
»Bist du sicher, dass ich deinen Mantel nicht aufhängen soll?« Es war einer dieser Wintertage, an denen der nasskalte Nordwind mit der Sonne kämpfte, aber keiner von beiden die Oberhand gewann. Dóra konnte die Fenster nicht öffnen, denn der starke Wind fegte gegen die Hauswand, und der kleinste Fensterspalt hätte ihr kleines Büro sofort in einen Kühlschrank verwandelt. Geschlossene Fenster waren allerdings auch nicht viel besser, denn dann verwandelte sich das Büro in der erbarmungslosen Sonne in eine Sauna. Dóra und Bragi, der Miteigentümer der Kanzlei, hatten es immer noch nicht geschafft, Vorhänge zu kaufen, weshalb kalte Sonnentage im Büro unerträglich waren.
»Nein.« Die knappe Antwort grenzte an Unverschämtheit. Grímheiður schien es zu merken, denn ihre Wangen, die von der Hitze schon ganz rot waren, wurden noch dunkler. »Ich meine, nein danke, ist schon in Ordnung.«
Dóra nickte, ließ ihre ausgestreckte Hand sinken und beschloss, zum Thema zu kommen. »Wie ich dir schon am Telefon gesagt habe, wurde ich gebeten, den Fall deines Sohnes im Hinblick darauf zu untersuchen, ob er möglicherweise unschuldig verurteilt wurde.« Sie machte eine kurze Pause, falls Grímheiður etwas einwerfen wollte, aber die Frau reagierte nicht. »Da du der gesetzliche Vormund bist, möchte ich den Fall nur mit deiner Zustimmung übernehmen. Ich spreche auch noch mit dem Anwalt, den das Oberste Gericht als Jakobs Betreuer bestimmt hat. Wie du weißt, soll er kontrollieren, dass Jakobs Aufenthalt im Sogn nicht länger dauert als unbedingt notwendig. Eine eventuelle Wiederaufnahme des Falls würde er bestimmt begrüßen.«
Grímheiður starrte schweigend und mit undurchdringlichem Gesicht auf die Tischplatte, und Dóra war sich nicht sicher, ob sie ihr überhaupt zuhörte. »Da die Entwicklung deines Sohnes Jakob …« Kurz vor dem Treffen hatte Dóra sich bemüht, die richtigen Worte zu finden, um Jakob zu beschreiben, ohne ihn zu verletzten. Jetzt, als es darauf ankam, konnte sie sich nicht mehr richtig erinnern und musste noch einmal ansetzen. »Da Jakob das Down-Syndrom hat, ist deine Meinung sehr wichtig, aber ich spreche natürlich auch mit ihm persönlich, wenn du möchtest, dass wir die Sache weiterverfolgen. Und wie gesagt, für euch wäre das völlig kostenfrei, deine Zustimmung hat keinen Einfluss auf Jakobs Finanzen. Wie ich dir schon am Telefon gesagt habe, ist dein Sohn anscheinend mit diesem Jósteinn befreundet, und der will unbedingt die Kosten für die Untersuchung übernehmen. Es ist mir wichtig, dir zu sagen, dass ich aus dem Mann nicht ganz schlau werde. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur reine Menschenliebe hinter seinem Verhalten steht, aber das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig beurteilen.«
»Ich habe ihn mal getroffen.« Die Frau kniff ihre Lippen so fest zusammen, dass sie fast nicht mehr zu sehen waren. »Ich mag ihn überhaupt nicht, aber Jakob hält ihn für einen guten Freund, und Jakob ist ein guter Menschenkenner, auch wenn er geistig behindert ist.« Grímheiður verstummte und nestelte wieder an den Fransen ihres Schals herum.
Dóra wusste nicht, was sie dazu sagen sollte, ohne dass es peinlich werden oder ihre Unkenntnis über geistige Behinderungen offenlegen würde. Sie wollte sich erst näher mit dem Thema beschäftigen, wenn klar war, ob etwas aus dem Auftrag würde, und das hing von dem Treffen mit dieser Frau ab, die ihr schwitzend gegenübersaß. »Aber gehen wir mal davon aus, dass Jósteinn keine niederen Beweggründe hat. Wie ist deine Meinung dazu? Was glaubst du, welchen Einfluss das auf deinen Sohn hätte? Es wäre ja vollkommen ungewiss, ob sich für ihn etwas ändern würde. Ich kann nicht beurteilen, wie er eine Wiederaufnahme des Falls aufnehmen würde – geschweige denn, wie enttäuscht er wäre, wenn sich an seiner Situation womöglich doch nichts ändert.«
Grímheiður hörte auf, an den Fransen herumzunesteln, und ballte stattdessen die Fäuste, so dass ihre Knöchel ganz weiß wurden. Dann lockerte sie ihren Griff plötzlich wieder und sackte in sich zusammen. »Als ich gemerkt habe, dass ich mit Jakob schwanger bin, hatten mein Mann und ich die Hoffnung auf ein Kind schon längst aufgegeben. Wir waren beide über vierzig und haben uns wahnsinnig gefreut. Als mir wegen meines Alters zu einer Fruchtwasseruntersuchung geraten wurde, kam heraus, was los war.« Die Frau atmete kurz ein und hob den Kopf. »Mir wurde dazu geraten, das Kind abtreiben zu lassen, nicht offen heraus, aber trotzdem nachdrücklich. Mein Mann und ich konnten uns das nicht vorstellen und haben alle Warnungen, dass unser Leben sich vollkommen ändern würde, ignoriert – genau deshalb wollten wir ja ein Kind. Es war mir völlig egal, dass ich aufhören musste zu arbeiten, obwohl wir zwei Einkommen gut hätten brauchen können. Wir haben beide nicht viel verdient. Aber eine Abtreibung kam überhaupt nicht in Frage. Jakob war unser Kind, unabhängig von der Anzahl der Chromosomen.«
Dóra bewunderte die Frau. Sie war sich ziemlich sicher, dass sie sich anders entschieden hätte, aber das ließ sich ja auch nicht vergleichen, denn sie hatte schließlich schon zwei Kinder. Vielleicht hatte sich die Entscheidung negativ auf Grímheiðurs Ehe ausgewirkt, denn sie war alleine unter der Telefonnummer registriert, die Dóra angerufen hatte. »Bist du noch mit Jakobs Vater verheiratet?«
»Er ist gestorben, als Jakob zehn war. Wieder mal wegen falscher Ratschläge, die Behörden machen einem ja ständig Vorschriften. Mein Mann war Installateur und wurde wegen eines kleinen Auftrags von seiner Firma nach Hveragerði geschickt. Das war Anfang Mai, und alle Firmenwagen hatten schon Sommerreifen. Aber die Vorschriften haben keinen Einfluss auf das Wetter, und plötzlich gab es Glatteis. Er hat sich mit dem Auto überschlagen und war sofort tot.« Die Frau wandte den Kopf ab und starrte aus dem Fenster. »Er hatte Bedenken wegen des Wetters und hat die Polizei angerufen, um zu fragen, ob er Spikes benutzen dürfte, aber sie haben es ihm verboten.« Sie schwieg einen Moment und fuhr dann fort: »Als Jakob zwanzig wurde, hat man sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um ihn in einer Behinderteneinrichtung unterzubringen. Sein Sozialarbeiter hielt es für das Beste, dass Jakob bei mir auszieht. Dieser Schlaumeier war der Meinung, ich würde ihn zu sehr bemuttern, was seine Entwicklung beeinträchtigen würde. Ich frage mich immer noch, wie das überhaupt gelaufen ist, ich weiß nämlich, dass damals jede Menge Leute auf einen Platz gewartet haben. Aus irgendwelchen Gründen wurden die abgelehnt und Jakob angenommen. Ich glaube inzwischen, dass diese ganze sogenannte Unterstützung das Gegenteil bewirkt. Man bekommt nie das, was man will, und will nie das, was man bekommt.«
»Du warst also dagegen, dass Jakob ins Heim kommt?« Eigentlich war die Frage überflüssig, aber Dóra wollte jegliche Missverständnisse vermeiden.
»Ja, allerdings, und Jakob auch, aber das hat die Behörden nur noch mehr angestachelt, und am Ende habe ich klein beigegeben. Wenn ich gewusst hätte, was die Zukunft bringt, hätte ich mich natürlich vehement zur Wehr gesetzt. Ich wollte meinen Sohn einfach bei mir haben, weil ich glaube, dass ich mich besser um ihn kümmern kann als irgendwelche Fremden. Ich habe dann auch weniger Unterhalt für ihn bekommen. Nachdem Jakob ausgezogen war, bekam das Heim einen Großteil seines monatlichen Unterhalts, und der Rest hat noch nicht mal gereicht, um ihn vernünftig anzuziehen.«
»Wie lange hatte Jakob schon in dem Heim gewohnt, als es abgebrannt ist?« Dóra bemühte sich, nicht zu sagen: als er das Heim in Brand steckte.
»Ungefähr ein halbes Jahr, länger nicht.«
»Und hat er sich dort wohl gefühlt, oder war der Zeitraum dafür zu kurz?«
»Er hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt, es ging ihm sehr schlecht. Vielleicht nicht so schlecht wie nach dem Brand, als er ins Sogn gebracht wurde, aber auch nicht gut. Jakob braucht Stabilität.«
»Dann wäre es vielleicht nicht sinnvoll, dass ich den Auftrag annehme, oder? Das würde Jakobs Leben definitiv durcheinanderbringen.«
Die Frau schaute Dóra eindringlich an. Ihr Gesicht war vom Leben gezeichnet, tiefe Falten zogen sich von den Augenwinkeln zu den Schläfen und fächerten sich auf wie die Sonnenstrahlen, die Dóras Tochter auf ihren Bildern an den Himmel malte. Breitere und noch tiefere Falten liefen quer über die Stirn, doch trotz ihres faltigen Gesichts hatte sie Augen wie ein Teenager: Das Weiße war ganz klar, und die Pupillen hatten scharfe Konturen. »Ich habe heute einen Anruf aus dem Sogn bekommen. Sie haben mir geraten, dich davon abzuhalten, den Fall zu übernehmen, Jakob zuliebe. Ich war mir nicht ganz sicher, aber nach diesem Anruf habe ich mich entschieden.«
»Du bist also dagegen?« Dóra war sowohl erleichtert als auch enttäuscht. Manchmal war es gut, wenn andere Menschen Entscheidungen für einen trafen, aber Dóra war irritiert, dass jemand versucht hatte, die Frau zu beeinflussen – auch wenn es in gutem Glauben geschehen war.
»Nein, keineswegs. Ich möchte, dass du den Auftrag annimmst und bei deinen Nachforschungen auf niemanden Rücksicht nimmst, weder auf mich noch auf Jakob. Ich höre nicht mehr auf die Ratschläge von Leuten, die immer alles besser wissen. Von jetzt an bestimme ich.«
Dóra lächelt dumpf. »Ich finde trotzdem, du solltest noch mal darüber nachdenken. Das ist eine weitreichende Entscheidung, und es gibt noch mehr Dinge, die du bedenken musst. Du solltest die Vor- und Nachteile abwägen, und Nachteile gibt es ziemlich viele.«
»Das habe ich schon gemacht, meine Entscheidung steht fest. Ich möchte, dass du es machst. Ich wäre doch ein Esel, wenn ich das in Jakobs Namen ablehnen würde, ich könnte es mir nie leisten, eine Wiederaufnahme des Falls zu bezahlen.« Grímheiður starrte Dóra mit blauen, kindlichen Augen an. »Jakob ist unschuldig und hat ein Recht auf eine Wiedergutmachung. Ich habe nicht mehr sehr lange zu leben, und wenn ich nicht mehr da bin, gibt es niemanden, der sich um ihn kümmert. Ich werde alles dafür tun, dass wir den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen können.«
Es war nicht das erste Mal, dass jemand behauptete, sein Verwandter sei unschuldig und wie ein treuherziges Kaninchen aus einer Laune des Schicksals heraus fälschlicherweise in die Klauen des Gesetzes geraten. Dóra musste an den harmlosen Kerl denken, den sie im Sogn gesehen hatte, und fand den Vergleich mit dem Kaninchen gar nicht so abwegig.
»Bevor ich mich endgültig entscheide, möchte ich mir die Unterlagen anschauen, die du mitgebracht hast.« Sie beobachtete, wie sich die Frau nach einer altmodischen Aktenmappe aus Plastik reckte, die schon eingerissen war.
»Ich habe nichts weggeworfen, das habe ich einfach nicht über mich gebracht.« Die Frau legte die Mappe auf den Schreibtisch. Sie war so schwer, dass es einen lauten Knall gab. »Du liest das ja mit ganz anderen Augen als ich und findest bestimmt Beweise für das, was für mich völlig offensichtlich ist.« Sie wollte aufstehen, hatte aber den Schal und die Mütze auf ihrem Schoß vergessen. Die Sachen fielen auf den Boden, und die Frau bückte sich umständlich, um sie aufzuheben. Als sie sich wieder aufgerichtet hatte, sagte sie: »Jakob hat das Heim nicht in Brand gesteckt und niemanden umgebracht. Er hat es verdient, zurück nach Hause zu kommen.«
»Hoffentlich«, entgegnete Dóra nur. Was der arme Mann verdient hatte, musste sich erst noch herausstellen.
Dóras Augen waren ganz trocken, weil sie so lange auf den Bildschirm gestarrt hatte. Sie hatte die Aktenmappe noch nicht aufgeschlagen. Dafür würde sie bestimmt einige Zeit brauchen, und außerdem hatte sie Angst, dass die Mappe Fotos oder Beschreibungen von verbrannten Menschen enthielt, worauf sie noch nicht richtig vorbereitet war. Deshalb hatte sie zunächst ein paar E-Mails beantwortet und etwas über das Down-Syndrom gelesen. Vielleicht hatte die Krankheit Begleiterscheinungen wie Aggressivität oder seelische Störungen, was erklären könnte, warum sich Jakob zu der Brandstiftung hatte hinreißen lassen. Trotz langem Suchen fand Dóra nichts, was darauf schließen ließ, erfuhr aber einiges über das Down-Syndrom, das auf einer Chromosomenveränderung beruhte. Es führte diverse Krankheiten wie geistige Behinderung, Herzfehler und verminderte Muskelspannung mit sich. Die Lebenserwartung eines Menschen mit Down-Syndrom betrug ungefähr fünfzig Jahre, wobei es in diesem Bereich erhebliche Fortschritte gab – vor einem halben Jahrhundert hatte die Lebenserwartung noch bei fünfundzwanzig Jahren gelegen. Der Grad der geistigen Behinderung war individuell sehr unterschiedlich, Menschen mit Down-Syndrom hatten einen IQ zwischen 35 und 70. Zwischen diesen beiden Zahlen lagen Welten, weshalb die allgemeinen Texte nicht viel über Jakob aussagten.
Dóra machte sich mit verschiedenen Gesetzen vertraut, die Jakob betreffen konnten, und stellte schnell fest, dass sich im Hinblick auf Behinderte gesellschaftlich viel verändert hatte. Das Gesetz von 1936 hieß beispielsweise Gesetz zu Idiotenheimen und das von 1967 Gesetz zu Idiotenanstalten. Damals gab es keine andere Möglichkeit als eine Unterbringung im Heim, unabhängig von Alter und Geschlecht des Betroffenen. Es gab keine Tagesbetreuung oder anderweitige Unterstützung, so dass die Eltern behinderter Kinder keine andere Wahl hatten, als ihre Kinder wegzugeben. Dies hatte sich Gott sei Dank geändert, aber man war zweifellos noch weit davon entfernt, allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dóra fand heraus, dass etwa ein halbes Prozent der isländischen Bevölkerung eine geistige Behinderung hatte, was recht viel war. Spezielle Heime mit Wohngruppen existierten seit 1980, so dass man bereits einige Erfahrungen gesammelt hatte. Dabei handelte es sich um kleine Gruppen, meist nicht mehr als sechs Personen, die mindestens sechzehn Jahre alt sein mussten und ständige Betreuung benötigten. Aufbau und Unterhalt dieser Einrichtungen waren staatlich finanziert, wobei die Gelder aus unterschiedlichen Töpfen stammten. Insgesamt gab es in Island ungefähr neunzig solcher Wohngruppen mit etwa 450 Bewohnern.
Das Telefon auf dem Schreibtisch gab plötzlich ein merkwürdiges Geräusch von sich, und Dóra erschrak, denn der Klingelton war schrill und laut und ganz anders als sonst. Bella, die Sekretärin, musste die Einstellungen geändert haben, um ihr einen Schreck einzujagen. Dóra unterdrücke ihre Wut und nahm den Hörer ab. »Deine Eltern sind hier und wollen mit dir reden. Soll ich sie zu dir reinschicken oder ihnen sagen, dass du nicht da bist?«
Dóra war vollkommen klar, dass ihre Eltern gerade direkt vor Bella standen. Die Frau war echt nicht mehr zu retten. »Schick sie rein.« Es war zwecklos, sich über Bella zu ärgern, zumal Dóra wusste, dass sie nicht mehr aufhören konnte, wenn sie einmal angefangen hatte.
Kurz darauf erschienen ihre Eltern in der Türöffnung. Sie wirkten nervös und entspannten sich auch bei ihrem kurzen Smalltalk über das Wetter und den eisigen Nordwind nicht. Als ihr Vater endlich zum Thema kam, verstand Dóra sofort, warum er so nervös war.
»Ihr könnt den Kredit also nicht abbezahlen?« Dóra nahm den Kreditvertrag und unterdrückte ein Seufzen. »Habt ihr denn nicht damit gerechnet, dass das passieren könnte, als ihr das Haus gekauft habt?« Die Immobilie, die mit einem gigantischen Kredit finanziert wurde, war ein exklusives Sommerhaus in Spanien. Der Kaufpreis erschien Dóra sehr hoch, obwohl sich der Euro-Kurs im Gegensatz zur Krone nicht verdoppelt hatte. »Die Raten sind wirklich heftig, vor allem als Rentner.«
»Wir wollten das Haus vermieten und die Raten dadurch abbezahlen. Darum sollten sich eigentlich die ehemaligen Besitzer kümmern«, erklärte ihr Vater, während ihre Mutter eifrig nickte.
Dóra knirschte mit den Zähnen. »Aha.« Sie suchte in dem Kaufvertrag nach den entsprechenden Paragraphen. »Hiernach wurde die Immobilie komplett kreditfinanziert, das ist ziemlich riskant, auch unabhängig von der Kursentwicklung. Außerdem ist es fraglich, ob die Miete die Ratenzahlungen überhaupt abdeckt, und wenn dann noch die Wirtschaftskrise und abnehmende Touristenzahlen in Spanien dazukommen …« Dóra musterte ihre Eltern eindringlich. »Wie ist es denn bisher mit der Vermietung gelaufen? Hat die Miete für die Raten gereicht?«
Ihre Eltern waren peinlich berührt und hockten zusammengesunken auf ihren unbequemen Stühlen. »Tja, also …«
»Wie viel konntet ihr damit abdecken? Alles? Die Hälfte? Ein Drittel?« Dóra wollte nicht noch weiter runtergehen. »Was soll ich denn jetzt machen? Warum habt ihr mir nicht früher erzählt, dass ihr ein Sommerhaus in Spanien gekauft habt? Ihr sitzt echt in der Klemme, aus diesem Kaufvertrag kommt ihr nicht mehr raus.«
»Wir wollten dich damals nicht damit belästigen. Wir dachten, du könntest den Kredit vielleicht in ein Festdarlehen oder so was ändern lassen …« Ihr Vater lächelte zerknirscht. Anscheinend war er sich darüber bewusst, dass das nicht möglich war, während sich Dóras Mutter noch in der irrigen Annahme befand, der Vorschlag sei realistisch. Sie nickte noch eifriger.
»Das geht nicht.« Dóra hatte keine Lust, sich länger als nötig mit dieser absurden Idee zu beschäftigen. »Ich hoffe, ihr habt wenigstens regelmäßig die Raten bezahlt, sonst sieht’s noch schlimmer aus. Ihr müsst so schnell wie möglich einen Teil abbezahlen, wenn ihr nicht auf eine Privatinsolvenz zusteuern wollt.«
»Kann man denn da gar nichts machen? Irgendwelche Gesetzeslücken?«
»Nicht, dass ich wüsste. Die Juristen, die solche Kreditverträge aufsetzen, sind nicht blöd, und die Bank hat euch in gutem Glauben Geld geliehen. Die Verkäufer, die euch das Haus aufgeschwatzt haben, sind auch sehr vorsichtig gewesen. Im Vertrag steht ganz klar, dass sie keine Verantwortung dafür übernehmen, ob das Haus vermietbar ist oder nicht.« Dóra legte die Papiere beiseite und versuchte, sich zu beherrschen. »Ihr müsst euch doch irgendwas überlegt haben. Ich weiß, dass das Haus zum Verkauf steht, und das ist gut, aber es lässt sich bestimmt nicht so schnell verkaufen, und ihr werdet lange nicht so viel dafür bekommen, wie ihr bezahlt habt. Der spanische Immobilienmarkt ist genauso tot wie der isländische.« Dóra atmete tief durch. Ihre Eltern waren nicht die Ersten, die bei ihr auftauchten und eine magische Lösung für ihre unüberwindbaren Finanzprobleme haben wollten. »Was habt ihr euch denn vorgestellt?«
»Tja, wir haben da so eine Idee.« Sie wechselten einen Blick. »Dieses blöde Haus in Spanien lässt sich nur wochenweise vermieten, aber unser Haus hier in Island steht auch zum Verkauf, und wir haben schon ein gutes Angebot bekommen, das es uns ermöglichen würde, den Kredit so weit abzubezahlen, bis wir einen realistischen Preis für das Sommerhaus erzielen können. Wir haben auch eine vernünftige Wohnung gefunden, die so günstig ist, dass die ganze Sache aufgehen sollte. Das einzige Problem ist, dass wir unser Haus sofort abgeben müssen, aber die Wohnung erst in zwei Monaten bekommen. Das heißt, falls wir das alles so machen …« Dóras Mutter hatte aufgehört zu nicken und beobachtete gespannt die Reaktion ihrer Tochter.
»Und wo wollt ihr solange wohnen?« Dóra schluckte. Sie war Einzelkind.
»Tja, wir dachten, wir könnten vielleicht bei dir unterkommen.« Jetzt lächelten sie beide breit. »Das würde uns wirklich nichts ausmachen, und wir könnten uns auch im Haushalt nützlich machen.«
Dóra konnte sich nicht erinnern, je in einer so brenzligen Lage gewesen zu sein. Natürlich wusste sie, dass sie ihren Eltern helfen musste. Sie hatten sie ihr ganzes Leben lang unterstützt und es verdient, dass sie Verständnis für sie aufbrachte. Die moralische Zwickmühle, in der sie sich befand, hing mit ihren eigenen Wohnverhältnissen zusammen. Sie lebte zwar in einem recht großen Haus, aber es gab einfach schon zu viele Familienmitglieder: neben ihr selbst noch ihre beiden Kinder, die zehnjährige Sóley und der neunzehnjährige Gylfi, plus dessen Freundin Sigga und deren bald dreijährigem Sohn Orri. Kürzlich war auch noch Dóras deutscher Freund Matthias dazugekommen, mit dem sie seit ein paar Jahren zusammen war. Wenn jetzt auch noch die vierte Generation bei ihnen einzog, hatten Dóra und Matthias überhaupt kein Privatleben mehr.
»Verstehe«, war ihr einziger Kommentar.
»Das ist natürlich nur eine Notlösung, vielleicht wäre es ja noch nicht mal für die kompletten zwei Monate«, murmelte ihr Vater und versuchte, souverän zu wirken. »Ich suche mir einfach einen Job, und wir mieten uns ein Hotelzimmer oder übergangsweise eine möblierte Wohnung.«
Die Nachrichten von steigenden Arbeitslosenzahlen waren offenbar an ihm vorbeigegangen. Dóra wollte ihn nicht ärgern und darauf hinweisen, dass sich die Zeiten, seit er in Rente gegangen war, geändert hatten. Außerdem gab es zurzeit kaum Nachfrage nach Leuten, die ihr ganzes Leben lang in einer Bank gearbeitet hatten, selbst wenn sie es am Ende ihrer Karriere bis zum Filialleiter gebracht hatten. Im Grunde konnte ihr Vater nichts anderes, als sich mit dem Geld anderer Leute zu beschäftigen, was es umso schwieriger machte zu begreifen, warum er sich zu diesem hoffnungslosen Deal hatte hinreißen lassen. Zudem waren ihre Eltern auch noch doppelt reingelegt worden – sie hatten ihre Ersparnisse in einem Aktienfonds angelegt, der sich angeblich ohne jegliches Risiko stark verzinsen sollte, und dann hatte man ihnen auch noch einen Kredit aufgeschwatzt für alles, was das Herz begehrte. Das Geld, das sie in dem Fonds angelegt hatten, war auf ein Drittel der ursprünglichen Summe zusammengeschrumpft, und jetzt steckten sie richtig in der Klemme. Sämtliche Ersparnisse waren weg, und die Schulden bei der Bank lähmten sie.
Nachdem ihre Eltern die deprimierende Lage erläutert hatten, verstand Dóra, warum sie so nervös gewesen waren. Zuerst hatte sie gedacht, sie hätten mit ihr über ihr Testament reden wollen – ein lächerlicher Gedanke angesichts der Tatsache, was sie in Zukunft einmal erben würde. »Wir werden schon eine Lösung finden«, murmelte sie und presste ein Lächeln hervor.
»Ich weiß, dass es eng bei euch ist, aber wir können uns doch vielleicht in der Garage einquartieren«, schlug ihr Vater erwartungsvoll vor. »Ich könnte sie so einrichten, dass man gut darin wohnen kann. Gylfi würde mir bestimmt dabei helfen und dein Freund, dieser Deutsche, vielleicht auch.« Dóras Eltern waren Matthias gegenüber nicht sehr aufgeschlossen, und das hatte zwei Gründe: Zum einen sprachen sie kein Deutsch und ziemlich schlecht Englisch, und zum anderen befürchteten sie, er könnte ihre einzige Tochter, die Enkelkinder und den Urenkel aus Island wegholen. Außerdem war er ihnen suspekt, weil er keinen Job bei der neuen Bank angeboten bekommen hatte, die aus den Ruinen der alten hervorgegangen war. Er war einfach zu teuer und eben Ausländer. Matthias hatte noch keine geeignete Arbeit gefunden, und die Aussichten waren alles andere als rosig.