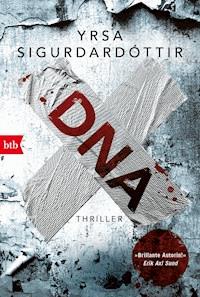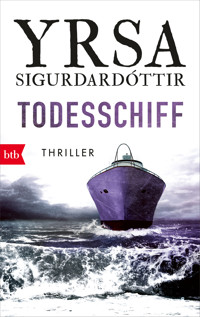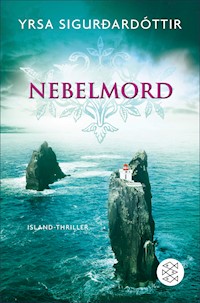
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Island-Thriller
- Sprache: Deutsch
Sie ist Ingenieurin. Sie ist Schriftstellerin. Sie ist Isländerin. Yrsa Sigurdardóttir ist Islands Nummer1-Bestsellerautorin. Plötzlich fiel ihm wieder ein, wie der Traum endete. Sie waren ursprünglich vier Reisende gewesen. Aber nur zwei kehrten an Land zurück. Nur dumm, dass er sich nicht erinnern konnte, ob er selbst einer von ihnen gewesen war. Die Leuchtturminsel war ein winziger Punkt in den eiskalten und aufgewühlten Wellen des Atlantiks. Hier, auf dieser winzigen Schäre vor Islands Südküste, würden sie eineni Tag und eine Nacht verbringen. Doch in dieser ersten Nacht tobt ein Unwetter, und am nächsten Morgen ist einer von ihnen verschwunden. Zur gleichen Zeit verschwindet in Reykjaviík eine Familie… Der neue Island-Thriller von Yrsa Sigurdardóttir hat alles, was eine nervenzerreißende Lektüre braucht: typisches Island-Flair, spektakuläre Kulisse und eine aufwühlende Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Yrsa Sigurðardóttir
Nebelmord
Island-Thriller
Aus dem Isländischen von Tina Flecken
FISCHER E-Books
Inhalt
Ich widme dieses Buch meinen Eltern Kristín Halla Jónsdóttir und Sigurður B. Þorsteinsson, von denen man meinen könnte, ich hätte sie mir aussuchen dürfen.
Yrsa
Personen der Handlung
Helgi
Fotograf
Ívar
Handwerker
Tóti
Handwerker
Heiða
Technikerin
Nína
Polizistin
Þröstur
ihr Mann, Journalist
Berglind
ihre Schwester
Örvar
ihr Chef
Aldís
eine Kollegin
Nói
IT-Experte
Vala
seine Frau, Fitnesstrainerin
Tumi
ihr Sohn
Steini
ihr Nachbar
Bylgja
ihre Nachbarin
Stefán
Journalist
Þorbjörg
seine Frau
Lárus (Lalli)
Anwalt
Klara
seine Frau
Prolog
28. Januar 2014
Zentrale:Wo seid ihr?
TF-LÍF: Die Felseninseln liegen direkt vor uns. Wir sind gleich da.
Haltet die Augen offen. Sucht die Wasseroberfläche ab, solange die Sicht so gut ist. Vielleicht seht ihr den Vermissten.
Machen wir. Trägt er eine Schwimmweste?
Nein, wahrscheinlich nicht. Ihr sucht nicht nach einem Lebenden. Er gilt als tot.
Okay. Noch haben wir nichts gesehen. Könnte er inzwischen untergegangen sein?
Schon möglich. Er liegt seit zwei Tagen im Wasser und hat vermutlich keine Luft mehr im Körper. Und es ist noch zu früh, dass er wieder hochtreibt. Das Meer ist verdammt kalt. Ich glaube nicht, dass sich schon Gase gebildet haben.
Habt ihr euch die Strömungen angeschaut?
Wir vermuten, dass er in der Hafnarvík-Bucht an Land treibt. Oder am Landeyjar-Strand. Es gibt keine genauen Angaben, wann er ins Meer gestürzt ist.
Verstanden.
Gerade ist noch eine Meldung reingekommen. Der Polizeiwagen steht schon am Hangar. Knacken, undeutlich. Ich hab dich nicht verstanden, die Verbindung ist schlecht.
War nicht so wichtig. Wir haben noch drei Seemeilen vor uns und können die Insel jetzt gut erkennen.
Seht ihr die Leute?
Nein, dafür sind wir noch zu weit weg.
Wie geht’s dem Polizisten? Ist er noch munter?
Ich glaub schon, ich frag ihn mal. Knacken, undeutlich. Ja, es geht ihm gut. Er hat noch Farbe im Gesicht. Mal sehen, wie’s nach dem Abseilen aussieht.
Ja. Lachen.
Wir drosseln das Tempo. Westlich der Insel treibt etwas im Wasser, ungefähr eine Seemeile von hier. Das schauen wir uns mal genauer an.
Ja, wäre aber ungewöhnlich, wenn das der Mann ist. Er müsste schon viel weiter weg sein.
Ich nehme mal das Fernglas. Knacken, Rauschen. Scheiße, das ist ein Mensch.
Tot? Oder lebt er vielleicht noch?
Definitiv tot. Er treibt auf dem Rücken. Keine natürlichen Bewegungen.
Tja, damit war zu rechnen. Das muss der Vermisste sein. Aber holt ihn erst, wenn ihr euch abgeseilt und die Leute raufgeholt habt. So lautet die Order. Verstanden?
Verstanden. Wir drehen um. Der kommt nicht weit. Knacken. Verdammt, hörst du mich?
Ja, was ist?
Wir haben noch eine Leiche entdeckt. Im Wasser direkt neben der Insel, sie hängt wahrscheinlich an einem Felsvorsprung.
Was? Bist du sicher?
Ganz sicher. Das ist ein Mensch. Und er ist tot.
Verdammte Scheiße. Ihr habt nur einen Transportsack dabei, oder?
Ja, es war nur von einer Leiche die Rede. Was sollen wir machen?
Beide raufholen. Deckt eine mit einer Decke ab und schnallt sie auf die Bahre. Ich hole eine Genehmigung ein, während ihr euch abseilt. Vielleicht müsst ihr auch erst zurückfliegen und noch eine zweite Tour machen. Sonst könnte es Schwierigkeiten mit den Passagieren geben. Aber mein Gefühl sagt mir, dass die Finanzabteilung auf einer Tour besteht.
Wir warten auf weitere Anweisungen. Wir fliegen jetzt über die Insel. Mein Gott, da liegt einer auf der Treppe vor dem Leuchtturm. Neben ihm kniet jemand. Scheint ein Mann zu sein, und neben ihm kniet eine Frau. Das sieht nicht gut aus!
Ist der Mann bei Bewusstsein?
Er bewegt sich nicht. Scheiße. Weitere Flüche, Knacken.
TF-LÍF, was ist los?
Die Frau hat ein Messer! Anscheinend hat sie den Mann in die Seite oder ins Herz gestochen. Das kann ich nicht richtig erkennen. Er bewegt sich immer noch nicht.
Sofort abseilen! Lass erst unseren Mann runter, danach den Polizisten.
Verstanden. Ich muss jetzt aufhören und den Männern helfen. Shit.
Was ist?
Die Frau dreht total durch. Sie schreit was, wahrscheinlich meint sie uns. Mein Gott, jetzt lacht sie hysterisch.
Sag unserem Mann, er soll vorsichtig sein. Er soll sich direkt losmachen und damit rechnen, dass die Frau ihn angreift. Und er soll das Messer im Blick behalten. Sag ihm, er darf notfalls auch Gewalt anwenden. Und schärf ihm ein, dass da nicht viel Platz ist. Nicht, dass er auch noch ins Meer stürzt. Wenn sie nicht näherkommt, soll er einfach ruhig warten und sich erst vom Landeplatz wegbewegen, wenn der Polizist unten ist.
Verstanden. Gaui geht zuerst runter. Dann der Polizist. Ich sag es ihm.
Viel Glück!
Danke. Das ist echt die Hölle hier.
Knacken, das Gespräch reißt ab.
1. Kapitel
26. Januar 2014
Der Flug ist wie eine verschwommene Wiederholung, als sei das alles schon mal passiert. Nach dem Aufwachen konnte Helgi sich nur an einzelne Passagen aus seinem Traum erinnern, doch während des Flugs fällt er ihm wieder ein. Nichts Besonderes oder Geheimnisvolles, nur einzelne Momente, die seine Phantasie letzte Nacht produziert hat: das Flattern im Magen, wenn der Hubschrauber abhebt, taube Fußsohlen vom Vibrieren des Stahlbodens und das unangenehme Gefühl, etwas Wichtiges zu Hause vergessen zu haben. Anderes passt wiederum nicht: Helgis Mitreisende sind zum Beispiel ganz anders als in seinem Traum, obwohl er sich nicht mehr richtig an ihre Gesichter erinnern kann. Er weiß auch gar nicht mehr, wie das Abenteuer ausging, kurz bevor ihn der Wecker in aller Herrgottsfrühe wachrüttelte. Im Winter ist er es nicht gewohnt, so früh aufzustehen, denn Fotografen haben meistens keinen Grund, vor dem ersten Morgenlicht das Haus zu verlassen. Aber es gibt Ausnahmen, so wie jetzt. Dabei hätte er genauso gut ausschlafen können, denn der Flug wurde mehrmals verschoben, bis sie gegen Mittag endlich grünes Licht bekamen. Trotzdem verfolgt ihn der Traum weiter, vielleicht weil er dachte, sie wären nur zu zweit, er und Ívar, der ihm von der ganzen Sache erzählt hat. Erst am Flughafen hat er erfahren, dass noch zwei weitere Passagiere mitkommen. Dieser seltsame Zufall beunruhigt ihn mehr, als er sich eingestehen will.
Helgi beugt sich zum Fenster und späht hinaus. Der Lärm des Hubschraubers ist immer noch genauso ohrenbetäubend wie beim Start in Reykjavík, als die Rotorblätter anfingen, sich zu drehen, und die Ohrenschützer in dem schweren Helm dämpfen das Dröhnen kaum. Vermutlich bringt die Sicherheitsausrüstung bei einem Unfall nicht viel, wenn man aus dieser Höhe abstürzt. Er rückt den Helm zurecht, damit das Dröhnen leiser wird, aber ohne Erfolg. Wahrscheinlich sind die Ohrenschützer gar nicht dafür da, die Geräusche zu dämpfen, sondern um bei dem ständigen Lärm im Hubschrauber eine Unterhaltung zu ermöglichen. Die bisher nicht stattgefunden hat. Die vier Passagiere hören die Piloten zwar ein paar Worte wechseln, mischen sich aber nicht in das Gespräch ein. Vielleicht werden die anderen nach der Landung ja ein bisschen lockerer, aber eigentlich ist es Helgi egal. Es ist auch ohne Smalltalk übers Wetter und dergleichen eine irre Erfahrung, auf einer winzigen Felseninsel mitten im Meer zu übernachten.
Im Helm rauscht es, dann ein Knacken und eine ferne Stimme: »Wenn Sie Luftaufnahmen machen möchten, halten Sie sich bereit!«
Helgi murmelt etwas Unverständliches. Es ist ihm unangenehm, dass alle an Bord seine Stimme über die Sprechanlage hören können. Kurz nach dem Abheben musste er dem Piloten schon einmal Antwort geben. Der hatte ihm angeboten, über den Skerjafjörður zu fliegen, damit er Fotos von dem dort stattfindenden Polizeieinsatz machen konnte. Am liebsten hätte Helgi ihn gebeten, einfach weiterzufliegen, aber das wäre unhöflich gewesen. Am Ende hat er die blinkenden Blaulichter durchs Fenster fotografiert, während der Pilot den Hubschrauber schräg gelegt hat, und jetzt sitzt er mit diesen unnützen Luftaufnahmen da, die er später unauffällig wieder löschen wird.
Helgi tastet nach der schweren Kameratasche und ärgert sich, dass er sie vorhin wieder eingeräumt hat. Jedes Mal, wenn er sich vorbeugt, bohrt sich der Sicherheitsgurt in seine Schulter, als wolle er ihm sagen, es sei sicherer, nicht auf dem Boden herumzuhantieren. Wobei ihm der Gurt im Fall eines Absturzes ebenso wenig helfen wird wie der Helm. Trotzdem wünscht sich Helgi den Gurt zurück, als der Copilot nach hinten klettert, ihn abschnallt und ihm, nachdem er ihn an einer Sicherheitsleine festgemacht hat, die Seitentür öffnet. Mit weichen Knien lehnt er am Türrahmen, hebt mit zitternden Händen die Kamera und versucht unter den wachsamen Blicken seiner Mitreisenden möglichst cool zu wirken. Zum Glück musste er aus dieser Position keine Fotos vom Festland machen. Jetzt kann er sich wenigstens einreden, dass er einen Sturz ins Meer überleben würde.
Helgi kämpft mit dem Schwindel und ringt nach Luft. Die Gewissheit, nicht aus dem Hubschrauber stürzen zu können, beruhigt ihn keineswegs. Er mustert die raue Wasseroberfläche tief unter sich und spürt den unwiderstehlichen Drang, die Sicherheitsleine zu kappen und sich einfach fallen zu lassen. Das Meer würde ihn freudig begrüßen. Doch er widersteht der Verlockung, denn der Wind bläst ihm heftig entgegen, und der Salzgeschmack erinnert ihn gnadenlos an das, was ihn da unten wirklich erwarten würde: entsetzliche Kälte und der sichere Tod. Helgi schluckt und schließt für einen Moment die Augen. Am liebsten würde er den Copiloten bitten, die Tür zuzumachen, und sich wieder auf seinen Platz setzen.
Aber da muss er jetzt durch. Wenn er Schwäche zeigt, schicken sie ihn womöglich mit dem Hubschrauber wieder zurück. Oder die Angst setzt sich in ihm fest, und er traut sich nachher nicht, sich abzuseilen. Wenn er jetzt kalte Füße bekommt, verspielt er seine Chance. Jetzt oder nie. Konzentriert nimmt er die Hand vom Türrahmen und hebt die Kamera hoch. Durch die Linse wirken die gewaltigen Gefahren harmloser, werden zu Motiven, die er einfangen möchte, sein Griff wird sicherer, und die schwere Kamera ruht fest in seinen Händen. Jetzt sieht er nur noch das, was er fotografieren will.
Der Wind weht das ungute Gefühl fort. Mit versierten Handgriffen zoomt Helgi die Felseninseln näher heran, so dass sie auf ihn zuzufliegen scheinen, als könnten sie es gar nicht erwarten, ihn zu sich zu holen. Er macht ein paar Fotos von den vier Felsen und zoomt dann weiter, bis die größte und höchste Insel die gesamte Linse einnimmt.
»Sehen Sie, dass es vier sind? Nicht drei.«
Helgi wird wieder in den Lärm und die Unberechenbarkeit gerissen, greift nach dem Türrahmen und nickt dem Piloten zu, der ihn von seinem Sitz aus anlächelt.
»Erstaunlich, dass man so falsch gezählt hat.«
Helgi lächelt verkrampft zurück und wendet sich dann wieder seinem Motiv zu. Warum hatte man die vier Inseln, die wie Krallen aus den Wellen ragten, Þrídrangar, Drei Felsen, genannt? Von den Westmännerinseln oder der Südküste Islands hatten die Leute vielleicht nur drei Inseln gesehen, aber irgendwann mussten sie das Missverständnis bemerkt haben, denn jede Insel trug einen eigenen Namen: Kúludrangur, Þúfudrangur, Klofadrangur und Stóridrangur – Kugelfels, Hügelfels, Spaltfels und Großer Fels. Es ist eindeutig, bei welcher Insel es sich um Stóridrangur handelt, aber die anderen kann Helgi nicht unterscheiden.
Stóridrangur ragt aus dem Meer wie eine schiefe Säule mit steilen Klippen ringsum. Wie die Insel wohl die immerwährende Brandung und die vielen Erdbeben überlebt hat? Sie muss aus unglaublich hartem Gestein sein – es sei denn, sie ist nur der Überrest einer wesentlich größeren Insel, von den Naturgewalten geformt.
»Wenn Sie möchten, kann ich die Inseln einmal umrunden und über den Leuchtturm fliegen. Wir haben genug Zeit.« Wieder hat sich der Pilot umgedreht und schaut Helgi fragend an. Offenbar hat er die Hoffnung aufgegeben, dass die Passagiere die Sprechanlage benutzen.
Helgi nickt und konzentriert sich dann wieder auf die Motive. Das milde Licht ist perfekt, das Meer grünblau und rund um die Felseninseln von weißer Gischt gekrönt. Die Wasseroberfläche sieht aus wie eine Samtdecke mit Rüschen an den Rändern. Der Leuchtturm wurde gebaut, damit die Inseln den Schiffen bei starker Brandung und Dunkelheit nicht zum Verhängnis werden. Unglaublich, wie man es damals geschafft hat, ganz oben auf Stóridrangur einen Leuchtturm zu errichten. Damals, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, hatte man keine Hubschrauber zur Verfügung, und das gesamte Baumaterial und die Arbeiter mussten übers Meer zu der Insel und auf die steilen Klippen gebracht werden. Ob die Leute damals aus anderem Holz geschnitzt waren? Helgi kann erkennen, wo die Kette zum Klettern am Felsen hängt. Er würde da bestimmt nicht freiwillig hochklettern.
Er hat ein paar gute Aufnahmen im Kasten, für die sich die gefahrvolle Reise bereits gelohnt hat, als die Stimme des Piloten erneut in seinem Helm ertönt: »Ist da wirklich genug Platz für euch vier? Da kann man ja kaum aufrecht stehen!«
Helgi gibt sich unbeeindruckt und konzentriert sich weiter aufs Fotografieren. Er hört seine Mitreisenden vor sich hinmurmeln. Der Hubschrauber fliegt jetzt über den Leuchtturm, und die Frage des Piloten ist durchaus berechtigt. Bis auf das kleine Haus und den viereckigen Landeplatz, der wesentlich später gebaut wurde, gibt es auf Stóridrangur nichts als steile Klippen. Neben dem Leuchtturm türmen sich Felsnadeln auf, die unbesteigbar, steil und zerklüftet sind. Die Fotos, die Helgi im Internet gesehen hat, waren nur ein schlechter Abklatsch der Wirklichkeit. Wieder einmal ist die Realität um ein Vielfaches beeindruckender als ihr zweidimensionales Abbild. Wie soll er das nur auf Zelluloid bannen? Helgi dreht die Kamera ein wenig, um die Schräglage des Hubschraubers auszugleichen, und drückt ab. Normalerweise machen ihm weniger spektakuläre Situationen schon Angst, aber er verdrängt den Gedanken und überlässt sich ganz dem Gefühl für das Bildmotiv. Die Küstenwache lässt bei solchen Flügen nur selten Fotografen an Bord, und wer kann es sich schon leisten, einen Hubschrauber zu mieten? Helgi war überrascht, als man seiner Anfrage zustimmte. Schließlich hat das Leben es nicht immer so gut mit ihm gemeint. Aber besser könnte es kaum sein, und jetzt müssen die Fotos auch gelingen.
Der Hubschrauber fliegt nun knapp über der Insel, und sie können den viereckigen Landeplatz direkt unter sich nicht mehr sehen. Das einzige Fenster in dem kleinen weißen Gebäude ist zugenagelt, sodass der Leuchtturm sie mit einem blinden Augen anzustarren scheint.
»Willkommen beim Þrídrangar-Leuchtturm!«
Die Piloten drehen sich um und grinsen verschwörerisch. Dann tauschen sie einen Blick und bedienen verschiedene Tasten am Armaturenbrett. Sie können sich das Lachen kaum verkneifen angesichts der Umstände, die den Passagieren bevorstehen. Kein Wunder – sie starren alle auf diesen unwirtlichen Ort, an dem sie die nächsten vierundzwanzig Stunden verbringen werden, und keiner hat es besonders eilig, von Bord zu kommen. Jedenfalls nicht auf dem einzig möglichen Weg. Steil nach unten. Helgi schießt ein paar Fotos von dem Leuchtturm, aber der Hubschrauber wackelt jetzt deutlich mehr, so dass er das Motiv schwer fokussieren kann.
»Wir beginnen jetzt mit dem Abseilen. Bitte hören Sie auf zu fotografieren und setzen Sie sich auf Ihren Platz«, sagt der Pilot resolut. Helgi macht noch zwei Bilder, hat aber keine Zeit mehr, sie anzuschauen. Er weiß, dass sie misslungen sind. Dann quetscht er sich auf seinen Sitz, macht die Sicherheitsleine los und schnallt sich wieder an.
Der Copilot hantiert mit Seilen, Rettungswinde und Abseilgurt. Er klopft dem Passagier, der am nächsten zur Tür sitzt, aufs Knie, lässt ihn aufstehen und hilft ihm in die Ausrüstung. Sie reden miteinander, während der Copilot kräftig an allen Leinen ruckelt, in die der Mann nun eingeschnallt ist. Dann stellen sie sich an die Tür, die der Copilot, ohne mit der Wimper zu zucken, weit aufzieht. Der Passagier tritt instinktiv einen Schritt zurück. Wieder wechseln sie ein paar Worte, und der Copilot erklärt ihm gestenreich, wie er sich verhalten soll. Dann setzt sich der Mann in die Türöffnung und baumelt mit den Beinen. Helgi und die beiden anderen vermeiden es, sich anzuschauen, und drücken sich automatisch tief in ihre Sitze. Gleich sind sie an der Reihe.
Als Nächstes wird der andere Mann von Bord gelassen und danach die einzige Frau. Helgi ist beeindruckt, wie gut sie ihre Unsicherheit überspielt, die sich nur durch das Zittern ihrer zarten Hände und ihr blasses Gesicht bemerkbar macht. Er schießt ein paar Fotos von ihren Vorbereitungen und ärgert sich, bei den Männern nicht dasselbe gemacht zu haben. Es wäre interessant gewesen, die Aufnahmen später zu vergleichen. Die Männer haben sich in die Brust geworfen, die Muskeln spielen lassen und demonstrativ tief eingeatmet. Dieses Theater haben sie bis zum Absprung mehrmals wiederholt, und das Letzte, was man von ihnen sah, waren ihre feuerroten, panischen Gesichter und ihre weitaufgerissenen Augen. Die Frau lässt sich von den Vorbereitungen nicht irritieren, ihre Gesicht zeugt von Respekt und einer stoischen Ruhe, über die Helgi auch gerne verfügt hätte. Vor allem jetzt, da er der Nächste ist.
Als der Gürtel und das Seil wieder oben sind, winkt der Copilot ihn zu sich, und Helgi steht mit weichen Knien auf. Wie ein zum Tode Verurteilter lässt er sich in den Abseilgurt schnallen, steigt in die Schlaufen und zuckt zusammen, als der Copilot die Festigkeit prüft. Als der Mann ihn berührt, überkommt Helgi die altvertraute Scham wegen seines Übergewichts, und er überlegt, ob die Ausrüstung womöglich auf eine leichtere Person eingestellt ist. Wird er abstürzen, weil er zu schwer ist? Aber er sagt nichts, möchte mit einem Fremden nicht über sein Gewicht reden, und setzt sich wie die anderen in die Türöffnung und lässt die Beine über der Felseninsel baumeln. Er reckt den Hals und blickt in die Gesichter der drei anderen Passagiere unten auf dem Landeplatz. Sie schauen zu ihm hoch und winken fröhlich, als wollten sie ihm signalisieren, dass das Abseilen gar nicht so schlimm wäre. Wie wenn man aus einer Achterbahn steigt und den Nächsten in der Warteschlange zuwinkt. Und dann hat die Achterbahn einen Defekt und fliegt in einer scharfen Kurve aus den Schienen. Weil einer der Mitfahrerenden zu schwer ist.
Helgi lässt los und stößt sich ab. Er spürt den Wind an seinem Körper, das Seil fühlt sich furchtbar dünn und schwach an. Er muss die ganze Zeit daran denken, ob er schon weit genug unten ist, um einen Sturz zu überleben, doch bevor er sich versieht, spürt er den harten Aufprall, und ein Rucken fährt durch seine Wirbelsäule. Er richtet sich auf, lächelt den anderen zu und öffnet rasch die Gurtschnallen, damit er nicht wieder hochgezogen wird. Endlich ist er frei und sieht dem leeren Gurt hinterher, der in den Hubschrauber gezogen wird.
Der Lärm der Rotorblätter ist so laut, dass man sich nicht verständigen kann, und alle starren nach oben. Keiner will den Kisten im Weg sein, die gleich runtergelassen werden. Die Sendeeinrichtung des Leuchtturms soll repariert, eine kaputte Solarbatterie ausgetauscht und die Fassade aufgefrischt werden. Außerdem soll das Gelände um den Landeplatz auf eine mögliche Vergrößerung hin vermessen werden, damit man dort wieder landen kann. Wie das vonstatten gehen soll, ohne dabei sein Leben zu riskieren, ist Helgi ein Rätsel. Der Landeplatz befindet sich auf einer Plattform aus aufgeschichteten Steinen, und wenn man die Umgebung untersuchen will, muss man von ihr runterklettern und sich fast auf die Zehenspitzen stellen, um auf den scharfen, windgepeitschten Felsvorsprüngen Platz zu finden. Helgi hofft inständig, dass ihn niemand um Hilfe bitten wird.
Gemeinsam mühen sie sich damit ab, eine Ladung nach der anderen loszumachen und zur Seite zu schieben. Als Helgi seine Arme schon nicht mehr spüren kann, seilt sich der Copilot endlich ab und signalisiert ihnen, dass jetzt alles unten sei. Dabei grinst er und winkt ihnen zu.
»Alles da!«, brüllt er, als er unten angekommen ist, und Helgi stellt sich vor, wie er seine Frau nach Feierabend versehentlich auch so anbrüllt. »Alles okay bei euch?« Helgi und die anderen nicken betreten. »Die Wettervorhersage ist gut. Wenn wir nichts mehr von euch hören, holen wir euch morgen Abend ab. Ihr habt doppelten Proviant dabei. Falls ihr noch eine Nacht länger bleiben wollt, gebt einfach Bescheid. Seid vorsichtig und bekommt mir bloß keine Platzangst!« Er grinst, so dass seine Zähne aufblitzen, die genauso weiß sind wie sein Helm. »Und morgens bitte nicht Joggen! Das könnte übel ausgehen!« Wieder grinst er und gibt dem Piloten ein Zeichen, dass er hochgezogen werden will. Kurz darauf steckt er den Kopf durch die Hubschraubertür und winkt ihnen zum Abschied. Die Tür gleitet zu, der Hubschrauber kippt leicht zur Seite, wendet und fliegt schnell davon. Während er sich entfernt, lässt der Motorenlärm allmählich nach, bis er schließlich ganz verstummt.
Die vier Leute auf der Insel tauschen verlegene Blicke und sagen nichts. Ívar, der Mann, den Helgi kennt, ergreift schließlich die Initiative, sagt, sie sollten das Gepäck verstauen, und der Jüngere pflichtet ihm bei. Dann klettern sie zwischen den kleinen Stapeln auf dem Landeplatz herum und öffnen ein paar Kisten. Die beiden Männer scheinen überhaupt keine Höhenangst zu haben, sie treten gefährlich nah an die Kante heran, obwohl sie auf dem brüchigen Asphalt leicht abrutschen könnten. Helgi überlegt, ob er einen zweiten Versuch starten soll, mit den beiden ins Gespräch zu kommen, lässt es aber bleiben. Ívar hat auf dem Flughafen nicht viel mit ihm geredet und schien sich kaum an ihn zu erinnern. Was durchaus sein kann, denn Helgi hat ihn in einer Kneipe angesprochen, in der sich nur ein paar ungesellige Eigenbrötler und vereinzelte Touristen befanden, die bei dem Gedanken, dies sei womöglich das berühmt-berüchtigte isländische Nachtleben, ziemlich geschockt waren.
Ívar war betrunken und hatte vollmundig von der bevorstehenden waghalsigen Unternehmung berichtet. Nachdem Helgi ihn lang und breit hatte erzählen lassen, fragte er, ob es möglich sei mitzukommen, zum Fotografieren. Ívar klopfte ihm so fest auf die Schulter, dass es wehtat, und meinte, das sei durchaus denkbar. Helgi sei ihm sympathisch, und er freue sich über Gesellschaft. Er solle einfach bei der Küstenwache anfragen und unbedingt erwähnen, dass Ívar dafür sei.
Die Männer legen die Werkzeuge in einer ordentlichen Reihe nebeneinander. Dabei sprechen sie nicht miteinander, was auch nicht nötig zu sein scheint. Beide wissen genau, was zu tun ist, ihre Handgriffe sind versiert und sicher. Helgi ist froh, dass er mit der Reparatur des Leuchtturms und den Vermessungen um den Landeplatz nichts zu tun hat. Er kann sich nur schwer vorstellen, wie man in dieser Enge arbeiten soll, und ihm ist klar, dass es gefährlich ist, selbst wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Am besten, er ist niemandem im Weg, was auch die einzige Bedingung dafür war, dass er mitkommen durfte. Doch jetzt stellt er fest, dass er kaum die Kamera heben kann, ohne die anderen bei der Arbeit zu stören. Falls er es überhaupt vom Landeplatz rüber zum Leuchtturm schafft.
Dorthin ist es nicht weit, aber der Weg sieht alles andere als vertrauenerweckend aus. Automatisch legt Helgi die Hand auf den Gepäckstapel, damit ihm nicht schwindelig wird. Aus dem Augenwinkel sieht er die junge Frau, die ebenfalls nach Halt sucht, und schämt sich, weil er nicht so männlich ist wie die anderen. Um diese Schmach zu kompensieren, schießt er planlos ein paar Fotos, bis die Männer fertig sind.
Dann stolpert er vorsichtig hinter ihnen her und traut sich nicht, sich zu der Frau umzudrehen. Das Knirschen der Steinchen und ihr heftiges Atmen geben ihm zu erkennen, dass sie direkt hinter ihm ist. Helgi konzentriert sich auf den Leuchtturm, der so klein wirkt, dass man meinen könnte, er sei für einen von Schneewittchens Zwergen gebaut worden. Dort angekommen, schnappt er nach Luft und lehnt sich an das schlichte Gebäude. Die Frau stellt sich neben ihn, mit geröteten Wangen und ängstlichen Augen, als hätte man sie gegen ihren Willen hergebracht. Oder gegen besseren Wissens. Sie trägt graue, profimäßige Outdoorklamotten, die gegen die Kälte schützen sollen und alles andere als sexy aussehen. Die Sachen sind nagelneu, und sie wirkt nicht gerade begeistert von der Aktion. Genauso wenig wie er.
Helgi will etwas Aufmunterndes sagen und sich damit auch selbst Mut zusprechen, findet aber nicht die richtigen Worte und schweigt. Stumm betrachten sie die Aussicht, die brodelnde, glitzernde Wasseroberfläche und den nahezu wolkenlosen Himmel. Helgi wirft der Frau, die, wenn er sich recht erinnert, Heiða heißt, einen verstohlenen Blick zu. Sie trägt rosa Nagellack und muss die Technikerin sein, die in letzter Sekunde mitgeschickt wurde, um den Leuchtturm zu warten. Tóti, der jüngere Mann, ist demnach der zweite Handwerker, der mit Ívar zusammenarbeitet.
Ívar steckt den Kopf in den Leuchtturm und wirft Helgi und Heiða, die immer noch aufs Meer starren, einen verwunderten Blick zu. Er steht auf der letzten Stufe vor dem Eingang und tritt imaginären Dreck von seinen Schuhen. Tóti ist dicht hinter ihm. Ívar stützt seufzend die Hände in die Hüften und steckt dann ein Messer in das Lederfutteral an seinem Gürtel. Helgi ärgert sich, sein Jagdmesser nicht mitgenommen zu haben.
»Also dann«, sagt Ívar. »Worauf warten wir noch? Wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir morgen Abend fertig sein wollen.«
Als Helgi sich von der Wand löst, merkt er, dass er schwankt.
»Wenn ihr wollt, kann ich euch vielleicht helfen. Ich fotografiere ja nicht die ganze Zeit.«
Die Männer gehen nicht weiter darauf ein, und Ívar murmelt nur, er werde gegebenenfalls darauf zurückkommen. Die drei anderen gehen in den Leuchtturm, aber drinnen ist es so eng, dass einer der Männer in der Türöffnung stehen bleiben muss. Helgi versucht, sein Herzrasen in den Griff zu bekommen, während er ihrer gedämpften Unterhaltung lauscht. Das ist alles so absurd. Er steht auf einer Felssäule, deren Fläche ungefähr so groß ist wie seine Wohnung. Um ihn herum ist das eiskalte Meer, das nur darauf zu warten scheint, dass einer von ihnen ausrutscht. Dieser Ort ist nicht zum Verweilen gemacht, geschweige denn zum Übernachten.
Helgi muss wieder an seinen Traum denken. Er versucht, den Hubschrauber am Horizont auszumachen, aber er ist verschwunden. Da es nicht viel mehr zu sehen gibt, tastet er sich zu den anderen und späht über Tótis Schulter in den Leuchtturm.
Drinnen beugen sich Heiða und Ívar über etwas, das er nicht erkennen kann. Doch es sind nicht die Leute, die seine Aufmerksamkeit bannen, sondern die weiß gestrichenen Wände in dem winzigen Raum. Momentaufnahmen aus seinem Traum schießen ihm durch den Kopf. Weiß gestrichener Beton, mit Blutspritzern übersät. Ein Steinboden mit schwarzen, glänzenden Pfützen. Und plötzlich fällt ihm wieder ein, wie der Traum endete.
Am Anfang waren sie zu viert.
Zwei von ihnen kehrten aufs Festland zurück.
Nur dumm, dass er nicht mehr weiß, ob er einer von ihnen war.
2. Kapitel
20. Januar 2014
Es verschlug kaum jemanden in den unbehaglichen Keller der Polizeiwache. Er hatte keine Fenster und wurde als Abstellkammer benutzt, weil die Decke so niedrig war. Allerdings nur für Unwichtiges, das aber niemand wegschmeißen wollte. Nína schaltete das Licht ein, und als sie die Treppe hinunterstieg, sprangen die Neonlampen flackernd und knackend an. Hierher kam eigentlich nur der Hausmeister, doch der abgestandene Zigarettengeruch ließ darauf schließen, dass auch einige Kollegen den Keller für ihre heimlichen Gelüste nutzten. Nína verzog das Gesicht und seufzte. An den Gestank konnte man sich gewöhnen, schließlich hatte sie bei ihrer Arbeit schon mit schlimmeren Gerüchen zu tun gehabt. Sie musterte den Krempel auf dem Fußboden und folgte dem Zickzackpfad, auf dem der Hausmeister sich einen Weg durch den Keller gebahnt hatte. Der arme Kerl musste vor dem Umzug der Polizeiwache in ein neues, moderneres Gebäude das ganze unnütze Zeug durchsehen. Irgendwo gab es auch ein vollgestopftes Archiv, das laut Anordnung der Vorgesetzten ein Polizeibeamter ausmisten sollte. Die Unterlagen waren zwar längst eingestaubt, konnten aber dennoch heikle Informationen enthalten.
Staub wirbelte hoch und legte sich nicht mehr. Es herrschte absolute Stille; der Verkehrslärm von der Hverfisgata und dem Busbahnhof Hlemmur, der Nína in den oberen Stockwerken immer nervte, war hier überhaupt nicht zu hören. Merkwürdig, dass eine einzelne Betonschicht den Keller total isolierte. Hier unten fühlte man sich wie in einer anderen Welt, weitab von Hektik und Tageslicht. Nína schüttelte das mulmige Gefühl ab und zwang sich, nicht an die jüngsten Zeitungsberichte über Schimmelpilze und Sporen in schlecht belüfteten Räumen wie diesem zu denken. Wobei sie sich im Moment wenig Sorgen über ihre Gesundheit machte. Eigentlich war ihr alles egal, in der letzten Zeit war sie wie ein Roboter zur Arbeit gegangen und hatte sich nur um das Nötigste gekümmert. Ihre Kollegen behandelten sie wie eine Porzellanfigur oder eine Handgranate, und ihr Chef war unfähig, die Sache anzugehen. Deshalb war sie jetzt wahrscheinlich auch im Keller. Er konnte sie nicht weiter auf Streife schicken nach der Aufregung über ihre Beschwerde wegen des Verhaltens eines Kollegen, das auf der Wache in aller Munde war. Dabei sollten solche Vorfälle eigentlich vertraulich behandelt werden.
Es war um eine Ruhestörung und häusliche Gewalt in einem Wohnblock in der Oststadt gegangen. Nína war mit einem Kollegen hingeschickt worden, um den Vorfall zu untersuchen und den potentiellen Gewalttäter festzunehmen. Auf dem Weg erzählte ihr der Kollege von dem Ergebnis einer Studie, Polizistinnen hätten beruflich einen schlechten Stand und mit Vorurteilen zu kämpfen. Nína kannte das ziemlich gut. Frauen waren bei der Polizei immer noch in der Minderzahl, wobei es einigen Männer anscheinend schon zu viele waren. Der Kollege wollte sie davon überzeugen, dass Männer als Polizisten einfach besser seien als Frauen, und bestätigte am Ende sämtliche Vorurteile, die bei der Studie herausgekommen waren.
Als sie die Treppe in dem Wohnblock hinaufstiefelten und an die Tür klopften, waren sie von der Diskussion noch ganz aufgewühlt. Ein Mann machte auf, und hinter ihm hörte man eine Frau schluchzen. Die Wohnung roch nach Alkohol und abgestandenem Zigarettenqualm. Der Mann ließ sie wortlos rein, als sei es in diesem Land völlig normal, Frauen zu schlagen. Nína folgte dem Schluchzen und fand die Frau zusammengekauert und weinend auf dem Sofa. Als sie aufschaute, konnte man den feuerroten Abdruck einer Ohrfeige auf ihrer Wange erkennen. Ihr Gesicht war mit Wimperntusche verschmiert, und ihr T-Shirt war zerrissen, so dass die roten Träger ihres BHs aufblitzten. Als sie die Arme von den Knien nahm, sah man, dass ihre Hose bis zum Schambein heruntergezogen war. Sie war noch zugeknöpft und hatte die Haut an den Hüftknochen aufgescheuert.
In der Zwischenzeit waren der Mann und Nínas Kollege ins Wohnzimmer gegangen. Der Typ lallte, es gäbe keinen Grund zur Aufregung, sie seien schließlich verheiratet und könnten tun und lassen, was sie wollten. Dann bot er ihnen einen Drink an und meinte, sie sollten keine Zeit an die Alte verschwenden, sie sei eine beschissene, langweilige Heulsuse. Nínas Gesichtsausdruck musste ihn wohl provoziert haben, denn bevor sie sich versah, stand er plötzlich hinter ihr, presste sich an ihren Rücken, schob seine Hand unter ihre Jacke und betatschte ihren Busen. Er flüsterte ihr ins Ohr, das würde sie doch anmachen, und zu ihrem Entsetzten spürte sie, dass er eine Erektion hatte. Dann nahm er eine Hand von ihrer Brust, drehte ihr Gesicht zu sich und leckte ihr über die Wange. Er roch nach verfaulten Zähnen. Aus dem Augenwinkel sah Nína, dass ihr Kollege keine Anstalten machte, ihr zu helfen. Ein höhnisches Grinsen umspielte seine Lippen. Vergeblich versuchte sie, sich umzudrehen und den Mann wegzutreten, was die Amüsiertheit ihres Kollegen noch anzufachen schien.
Auf einmal stand die Frau vom Sofa auf und kreischte los. Erst dachte Nína, sie wollte sich in einem Anfall aus Eifersucht auf sie stürzen, aber sie hatte es auf ihren Mann abgesehen. Als ihre Fingernägel sein Gesicht zerkratzen, ließ er Nína los. Vier rote Striemen zogen sich über seine feisten Wangen bis zu den Ohren.
Der Einsatz endete damit, dass der Mann wegen häuslicher Gewalt und Widerstand gegen die Polizei abgeführt wurde. Auf dem Rückweg fragte Nína ihren Kollegen, was er sich eigentlich dabei gedacht hätte, bekam aber nur zur Antwort, sie müsse doch auch alleine klarkommen, wenn sie gleichberechtigt sein wolle.
Auf der Wache meldete sie sein Verhalten sofort und forderte eine Verwarnung. Wie konnte er Polizist sein, wenn man sich als Kollegin nicht darauf verlassen konnte, dass er einem zu Hilfe kam? Selbst wenn man sich stritt und miteinander diskutierte, durfte das doch keinen Einfluss auf die Arbeit haben. Da musste man zusammenhalten. Dachte sie jedenfalls.
Am nächsten Tag herrschte helle Aufregung, und Nína wurde gebeten, die Beschwerde zurückzuziehen, weil sie die Karriere ihres Kollegen erheblich beeinträchtige. Stattdessen würde er inoffiziell verwarnt. Außerdem forderte man sie auf, die Schilderung des Übergriffs gegen sie aus dem Bericht zu löschen. Das sei das Beste für sie, sie wolle doch bestimmt nicht, dass der Vorfall an die Öffentlichkeit käme – als hätte sie freiwillig mitgemacht oder sei selbst schuld daran. Nína weigerte sich und sagte, sie fühle sich gezwungen, sich an eine höhere Instanz zu wenden, wenn die Sache nicht korrekt abgehandelt würde.
Und plötzlich galt es als unmöglich, mit ihr zusammenzuarbeiten, man könne ihr ja nicht trauen. Selbst ihre Kolleginnen wandten sich von ihr ab, eine sogar mit den Worten, sie hätte ihnen das Leben endgültig zur Hölle gemacht, jetzt seien sie alle als Petzen verschrien. Nína war sprachlos.
Als ihr bis auf weiteres Sonderaufgaben zugewiesen wurden und sie nicht mehr Streife fahren durfte, protestierte sie nicht. Im Grunde war sie heilfroh. Der Angriff des Betrunkenen hatte ihr mehr zugesetzt, als sie sich eingestehen wollte. Sie wollte auf gar keinen Fall noch einmal in eine solche Situation geraten und war froh über die stupiden, aber ungefährlichen Aufgaben, die man ihr übertrug. Der Schichtleiter war von ihrer besonnenen Reaktion überrascht und hatte offenbar mit mehr Widerstand gerechnet, aber sie stand einfach vor ihm und nickte, als er ihre neuen Aufgaben beschrieb.
Inzwischen hatte sich ihr Aufgabenbereich allerdings noch wesentlicher verändert. Ihr Chef hatte die geniale Idee gehabt, ihre unerwünschte Anwesenheit im Büro zu beenden, indem er sie in den Keller verbannte. Das Archiv war so umfangreich, dass Nína damit rechnete, tage-, wenn nicht gar wochenlang dort unten zubringen zu müssen. Währenddessen konnte man die Entscheidung über ihre Zukunft bei der Polizei getrost verschieben. Nínas Beschwerde hing immer noch in der Luft, und niemand bearbeitete die Anklage gegen den Gewalttäter, weil man befürchtete, dass der Disziplinarverstoß ihres Kollegen dann bekannt würde. Womöglich würde das Schwein davonkommen, weshalb Nína noch entschlossener war weiterzukämpfen, auch wenn private Gründe ihr erst einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten. Sie war wie in Trance und traute sich selbst schon nicht mehr zu, auf Streife verantwortungsbewusst zu handeln.
Nína nahm eine Rolle schwarze Mülltüten und klemmte sich möglichst viele aufgeklappte Kartons unter den Arm. Sie war schlank, aber stark, hatte allerdings in letzter Zeit noch mehr abgenommen. Ihre Wangenknochen stachen hervor, und ihre Rippen sahen aus wie ein Waschbrett. Der Keller hatte immerhin den Vorteil, dass es dort keinen Spiegel gab.
Sie wankte mit den Sachen zu den Archivräumen. Vor ewiger Zeit hatte jemand einen Zettel an die Flurtür gehängt, der schon ganz verblichen war: »Alte Sünden«. Nach einigem Hantieren gelang es Nína, die Tür aufzumachen. Sie betrat den Flur und seufzte, als sie die Sachen abgestellt hatte. Es gab sechs Türen, von denen nach Aussage des Hausmeisters jede zu einem speziellen Archiv führte. Ihr Blick fiel auf einen Feuerlöscher beim Eingang, doch bevor sie das Licht einschalten konnte, fiel die Tür zu, und sie stand plötzlich im Dunkeln. Nína fluchte, weil sie das nicht vorhergesehen hatte, doch es war, als würden ihre Worte von den Wänden verschluckt.
Sie hatte schon lange nicht mehr in völliger Dunkelheit gestanden, die Tür ließ noch nicht einmal einen kleinen Lichtschimmer durch. Nína stützte sich an der Wand ab und tastete sich zur Tür. Dabei musste sie an Þröstur, ihren Mann, denken. Ob er die Dunkelheit wahrnahm, die ihn umgab? Während sie sich vorsichtig weitertastete, hoffte sie, es wäre nicht so. Am meisten wünschte sie sich jedoch, dass er wieder sehen könnte und alles in Ordnung käme, trotz der schlechten Prognose. Trotz allem. Dabei hatte sie selbst neben dem Arzt gestanden, als er die Taschenlampe auf Þrösturs glänzende Pupille gerichtet hatte. Þrösturs Auge hatte weiter blind geradeaus gestarrt.
Der Arzt hatte ihr erklärt, wenn Þröstur noch sehen könnte, müsste sich das Auge dabei zusammenziehen, und hinzugefügt – wie um Salz in die Wunde zu streuen –, dass dasselbe wahrscheinlich auch für seine anderen Sinnesorgane galt. Der Arzt hatte es zwar nicht direkt ausgesprochen, aber es lag in der Luft, dass ihr Mann eine lebende Leiche war.
Auf Nínas Nachfrage meinte der Arzt, man könne das natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, und deshalb hegte sie die winzige Hoffnung, dass Þröstur seinen Zustand in irgendeiner Form wahrnahm. Wobei es in der Medizin wohl einfach keine Gewissheit gab. Genauso wenig wie anderswo. Falls die schreckliche Prognose der Ärzte stimmte, sollte sie eigentlich aus ganzem Herzen hoffen, dass Þröstur nichts von den Veränderungen in seinem Leben mitbekam. Es war eine gewisse Gnade, nichts mehr zu spüren, nur zu schlafen und sich schönen Träumen hinzugeben. Doch ihr angeborener Pessimismus sagte ihr, dass seine Träume wahrscheinlich genauso schwarz waren wie die Prognosen der Ärzte.
Nína griff nach der eiskalten Türklinke und öffnete die Tür, während sie sich dazu zwang, diesen Gedanken nicht weiterzuführen. Dabei drängte er sich ihr immer wieder auf. Wie konnte man verhindern, dass Þröstur jemals etwas von seinem Zustand mitbekam? Dass er eines Tages in einem unbrauchbaren Körper aufwachte? Letztendlich gab es nur eine Möglichkeit: den Rat der Ärzte zu befolgen und die Geräte abschalten zu lassen. Nína spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Warum zum Teufel musste sie diese Entscheidung treffen? Wozu gab es in Krankenhäusern speziell ausgebildete Fachleute? Konnten die ihr nicht einfach sagen, was sie tun sollte? Trübes Licht fiel in den Flur, und Nína holte tief Luft. Lieber nicht zu viel denken. Besser den Autopiloten einschalten und einfach weitermachen. Das tat am wenigsten weh.
Ungefähr jede zweite Neonlampe an der Flurdecke war kaputt. Die Wände, die früher mal schneeweiß gewesen waren, sahen jetzt gelblich und schmutzig aus, und der Türrahmen machte nicht den Eindruck, als hätte man hier immer alles vorsichtig transportiert. Nína sah, wie schmutzig ihre Hosenbeine waren, und versuchte, das Gröbste abzuwischen. Am Morgen war sie gedankenversunken durch den Schneematsch zur Arbeit gelaufen, nachdem sie die Nacht auf einem Stuhl an Þrösturs Krankenbett verbracht hatte. Die Krankenschwestern hatten es irgendwann aufgegeben, sie anzustoßen und zum Ausruhen nach Hause zu schicken. Sie wussten genau, wann man besser nichts sagte. Worte konnten Nínas Schmerz nicht lindern. Die unaufdringliche Freundlichkeit der Ärzte und Krankenschwestern war in Ordnung, und es war angenehm, nichts erklären zu müssen. Sie wussten, dass Nína nur nach Hause fahren würde, wenn sie dazu gezwungen wäre. Die Wohnung war wie ein lebloses Skelett, und die Dinge darin erinnerten sie nur an das, was einst gewesen war.
Nína blieb nachdenklich stehen, die Hand auf dem Feuerlöscher, als die Tür langsam, wie von einer unsichtbaren Hand geführt, zuging. Der Flur hatte nicht nur eine niedrige Decke, sondern auch einen schrägen Boden. Sie starrte auf das schlecht gestrichene Viereck, das auf den Türrahmen zukroch, und meinte, die Türklinke hätte sich bewegt, aber das musste Einbildung sein.
Vor ihr lagen die Türen zu den Archivräumen, drei auf jeder Seite. Es wäre normal gewesen, entweder bei der ersten oder bei der letzten anzufangen und sich dann langsam zum anderen Ende vorzuarbeiten, aber Nína ging zu einer der mittleren Türen. Sie wusste nicht, warum, hatte nur das unerklärliche Gefühl, dass sie dort anfangen sollte. Die Türklinke war warm, als wolle sie sie willkommen heißen, als fände sie dahinter den langersehnten Frieden. Komisch, die Klinke an der Tür zum Flur war ihr eher kalt vorgekommen.
Geruch von Staub und altem Papier stieg ihr in die Nase. Diesmal achtete Nína darauf, erst das Licht einzuschalten, bevor sie den Raum betrat. Wie erwartet, war er voller Aktenordner. Zwischen den Regalreihen gab es kaum Platz, und man konnte sich nur knapp dazwischen durchquetschen.
Nína wollte sich erst ein wenig umschauen, bevor sie anfing zu sortieren und wegzuschmeißen. Alles, was noch wichtig war, sollte erst eingescannt und dann entsorgt werden. Sie ging durch die Regalreihen und las die Aufschriften auf den Aktenordnern und Kisten, die in Augenhöhe standen: Verkehrsverstöße: Januar 1979. Einbrüche: Mai – September 1980. Während sie umherging, wurde Staub aufgewirbelt, und sie musste sich die Nase zuhalten, um nicht laut zu niesen. Weiter hinten zwischen den hohen Regalen wurde das Licht schwächer, und Nína nahm sich vor, das nächste Mal eine Stehlampe mitzubringen.
Sie wollte gerade umkehren, als ihr Blick auf einen Aktenordner fiel, der ganz hinten im Archiv aufgeschlagen auf den anderen lag. Sie pustete ihn an, aber der Ordner war nicht verstaubt. Ohne ihn zuzuklappen, las Nína die Aufschrift auf dem Rücken: Selbstmorde: Februar 1982 – Oktober 1985. Plötzlich erschauerte sie. Ihr Herz schlug langsam, aber schwer, als müsste es in der Stille zu hören sein. Sie brauchte einen Moment, bis sie sich wieder gefangen hatte.
Bevor Þröstur versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, hatte sie selbst bei der Untersuchung solcher Fälle mitgewirkt. Und in letzter Zeit musste sie oft an eine Witwe denken, mit der sie vor gut zwei Jahren gesprochen hatte. Die Frau hatte Nína mit großen Augen angeschaut und immer wieder gemurmelt, es sei doch alles in Ordnung gewesen, ihr Mann hätte so etwas nie getan und keinen Grund gehabt, sich umzubringen. Nína hatte Mitleid mit ihr gehabt, aber auch an ihrer Zurechnungsfähigkeit gezweifelt. Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, dass sie selbst eines Tages verheult einem Polizisten gegenübersitzen und fast dasselbe sagen würde. Der einzige Unterschied war, dass Þröstur den Suizidversuch überlebt hatte. Falls man das Leben nennen konnte.
Der Ordner wurde immer schwerer, und Nína versuchte auszumachen, wo er gestanden hatte, aber in den umliegenden Regalen gab es keinen freien Platz. Sie entdeckte ein völlig leeres Regal in der zweiten Reihe, doch der viereckige Fleck im Staub wies darauf hin, dass dort eine Kiste oder etwas viel größeres als ein Aktenordner gestanden hatte. Vielleicht war es ein guter Anfang, den Ordner in eine schwarze Mülltüte zu werfen. Berichte über Selbstmorde vor fast dreißig Jahren waren bestimmt nicht mehr wichtig. Das wusste sie aus eigener Erfahrung. Kaum jemand teilte ihr Bedürfnis herauszufinden, warum Þröstur versucht hatte, sich umzubringen. Bis auf seinen Vater und seine Schwester wollte niemand etwas davon hören. Ihren Bekannten merkte Nína an, dass sie sich wünschten, Þröstur würde bald sterben, damit sie nicht länger mit Fragen nach seinem Befinden und dem Warum herumdrucksen mussten. Nach dreißig Jahren würden sie sich kaum noch an ihn erinnern.
Doch als Nína wieder in normalem Licht stand, konnte sie sich nicht beherrschen, einen Blick in den Ordner zu werfen. Automatisch begann sie, den Text auf der aufgeschlagenen Seite zu lesen. Und dann gab es kein Zurück mehr.
Es handelte sich um die letzte Seite eines Berichts über einen Fall, der auf den 18. April 1985 datiert war. Nína blätterte vor, um den Anfang des Berichts zu lesen, doch die ersten Seiten fehlten. Davor befand sich ein anderer Bericht, vollständig und zusammengeheftet. Die einzelne Seite war ebenfalls mit anderen Seiten zusammengeheftet gewesen, aber anscheinend unabsichtlich abgerissen worden. Nína blätterte durch den Ordner, ohne den ersten Teil des Berichts zu finden. Dann starrte sie wieder auf die schwarze Schreibmaschinenschrift, als hoffte sie, sie hätte sich verändert. Doch das war nicht der Fall. Dort stand immer noch dieselbe Schlussfolgerung, dass Milla Gautadóttir mit ihrer Unterschrift dafür bürgte, dass ihr Sohn, der noch nicht schreiben konnte, die Wahrheit sagte. Es folgte noch ein kurzer Satz, die Beweisaufnahme sei um 10:39 Uhr beendet worden. Der Name des Sohnes stand unter dem der Mutter: Þröstur Magnason, geboren am 1. September 1978. Nínas Mann.
Nína schloss den Ordner und drückte ihn an ihre Brust. Das war definitiv ihr Þröstur. Der Name seiner Mutter war ziemlich selten – ausgeschlossen, dass eine Namensvetterin von ihr einen Mann namens Magni und einen gleichaltrigen Sohn namens Þröstur hatte. Ausgeschlossen. Nína machte die Augen zu und versuchte, ruhig zu atmen. Jemand musste den Ordner aufgeschlagen und liegen gelassen haben, damit sie ihn fand. Jemand, der sie schocken wollte. Ihre Freunde – falls sie bei der Polizei überhaupt welche hatte – würden so etwas nie tun. Einen Bericht, der mit der Kindheit ihres Mannes zu tun hatte, in einen Ordner für Selbstmorde stecken. Nína presste noch einmal die Lider zusammen, und Lichtstreifen, Dämonen der vorangegangenen Helligkeit, tanzten vor ihrem inneren Auge. Sie wollte nichts sehen, wollte an nichts denken. Sonst würde sie über die Geräusche nachdenken, die sie meinte, aus dem hinteren Teil des Archivraums zu hören, von den Regalen, die sie nicht angeschaut hatte. Als würde dort jemand stehen und atmen. Vielleicht derjenige, der den Ordner liegen gelassen hatte. Aus dem Keller würden keine Laute noch oben dringen, genauso wenig wie umgekehrt. Wenn sie schrie, würde niemand sie hören. Nur jemand, der sich vielleicht hinter ihr versteckte. Zwischen den alten und verstaubten Akten.
3. Kapitel
23. Januar 2014
Das Wetter konnte sich nicht entscheiden. Ein Wechsel aus Regen, Schneeregen und Schnee, und die schwarze Schnellstraße glänzte im Licht der aufblitzenden Autoscheinwerfer. Auf dem Heimweg vom Flughafen hatte die ganze Familie Zeit, über die zurückliegende Reise nachzudenken. Alle saßen schweigend im Wagen: Nói am Steuer, daneben Vala und auf dem Rücksitz ihr Sohn Tumi, der auf die endlosen Lavaflächen starrte. Neben ihm standen zwei große Reisetaschen, weil ihr Gepäck nicht komplett in den Kofferraum gepasst hatte. Obwohl das eigentlich nicht geplant gewesen war, hatte das Preisniveau in Amerika sie so nachhaltig beeindruckt, dass sie ein paar Dinge gekauft hatten, deren Nutzen sich erst noch herausstellen musste. Bereits am Flughafen in Keflavík meinte Vala, sie fände die neuen Klamotten schon nicht mehr ganz so schick wie im Urlaub, sie würden nicht zu der grauen Eintönigkeit des isländischen Wetters passen. Nói musste sich auf die Zunge beißen, um nicht laut loszubrüllen.
»Furchtbar, morgen wieder arbeiten zu müssen.« Nói schaute durch die heftig hin- und herschlagenden Scheibenwischer konzentriert auf die Straße.
»Eigentlich wolltest du doch heute schon wieder arbeiten. Sei froh, dass ich dir das ausgeredet habe«, entgegnete Vala und drehte sich zu ihrem Sohn um. »Schläfst du?«
»Nee.« Tumi starrte weiter aus dem Fenster.
Vala wollte noch etwas sagen, ließ es aber bleiben, was Nói gut nachvollziehen konnte. Tumi war von Natur aus schweigsam, und wenn er müde war, konnte man mit dem Radiosprecher ein unterhaltsameres Gespräch führen als mit ihm.
»Mann, wird das schön, wieder im eigenen Bett zu schlafen«, sagte Vala, schloss die Augen und legte ihre Hand auf Nóis Oberschenkel. Am liebsten hätte er sie gefragt, ob sie schon vergessen hätte, wie sie sich vor zwei Wochen darauf gefreut hatte, von zu Hause wegzukommen. »Ein komisches Gefühl, dass fremde Leute in unseren Betten geschlafen haben.«
Sie hatten mit einem amerikanischen Ehepaar die Häuser getauscht und sich in dessen Haus in Florida einquartiert. Das dadurch eingesparte Geld befand sich nun in den zusätzlichen Reisetaschen. Und die Kreditkartenabrechnung würde auch nicht spaßig werden, aber das hatte Nói schon geahnt, als er der Reise zugestimmt hatte. Zum Glück waren sie finanziell gutgestellt; er besaß eine kleine, florierende Softwarefirma, und Vala war eine begehrte Fitnesstrainerin und verdiente ganz ordentlich.
»Hoffentlich waren sie zufrieden, trotz des Grills«, warf er ein.
Die Amerikaner hatten auch ihr Sommerhaus benutzt und ihnen per Mail mitgeteilt, dass der Gasgrill dort nicht funktioniere. Nói hatte sofort geantwortet und sämtliche möglichen Ursachen aufgezählt, aber keine Antwort mehr erhalten. Vala war der Meinung, die Gäste hätten das Problem bestimmt behoben, aber Nói glaubte, sie seien eingeschnappt.
»Ach, der Grill kann doch nicht so wichtig gewesen sein.«
»Wenn sie Steaks dabei hatten, schon.«
»Dann haben sie die eben in der Pfanne gebraten. Und jetzt ist es sowieso egal«, versuchte Vala seine Befürchtungen zu zerstreuen, was meistens den gegenteiligen Effekt hatte.
»Na ja, ich hätte es schon gut gefunden, wenn sie uns am Ende noch mal eine Mail geschickt und sich bedankt hätten. Wir haben das immerhin gemacht.«
»Wir sind ja auch nicht sie. Vielleicht waren sie zu beschäftigt mit Sightseeing, um noch mal zu schreiben. Oder das Internet bei uns zu Hause hat nicht funktioniert.«
»Das Internet funktioniert einwandfrei«, erwiderte Nói, der es nicht ausstehen konnte, wenn man sich in sein Fachgebiet einmischte.
»Okay, schon gut.«
Die weitere Fahrt verlief erwartungsgemäß. In Hafnarfjörður kamen sie in einen Stau und fuhren die gesamte Strecke bis zur Suðurgata in Reykjavík im Schritttempo. Dort trennte sich ihr Weg von dem der arbeitenden Bevölkerung, und sie fuhren Richtung Skerjafjörður, wo sie fast am Ende der Landebahn des Inlandflughafens direkt am Meer wohnten. Dort hörte es auf zu regnen. Nói schaltete den quietschenden Scheibenwischer aus, und auf den letzten Metern bis zu ihrem Haus machte sich eine merkwürdige Leere im Wagen breit. Die vertraute Straße weckte eine seltsame Mischung aus Freude und Wehmut, sie waren zu Hause, die Reise war zu Ende. Jetzt fing für Tumi die Schule wieder an, und für Vala und ihn die Arbeit. Das schöne Wetter und die Shopping-Touren waren Vergangenheit.
Nói parkte in der Einfahrt neben Valas Wagen, den sie den Gästen zur Verfügung gestellt hatten. Sie stiegen aus und atmeten die kühle, frische Luft ein.
Tumi stand unbeholfen da, während seine Eltern erschöpft und griesgrämig das Auto entluden. Er machte keine Anstalten, ihnen zu helfen, bis Nói ihn anfuhr, so dass er zusammenzuckte. Der Junge wirkte noch geistesabwesender als sonst. Nói nahm an, dass ihn die Müdigkeit so schwerfällig machte, dabei war er der Einzige von ihnen, der während des gesamten Flugs geschlafen hatte. Er blickte ständig nach oben auf das Haus, als erwarte er, dass die Amerikaner aus dem Fenster schauen und ihnen zuwinken würden.
»Stimmt was nicht, Tumi?«, fragte Vala, die hinter ihrem Sohn, der ihr den Weg versperrte, stehen geblieben war. Tumi stand mit einem Koffer in der Hand wie angewurzelt da und glotzte zum ersten Stock.
»Äh, nee«, antwortete er und schüttelte sich leicht.
»Ist was mit dem Haus?«, fragte Nói und schaute suchend nach oben. Alle Vorhänge waren zugezogen, sogar im Wohnzimmer, wo die schmalen Gardinen eigentlich nur zur Zierde hingen. Trautes Heim, Glück allein. Nói musste lächeln, als er das zweistöckige Holzhaus betrachtete. Als sie es gekauft hatten, wollten sie es eigentlich abreißen lassen und ein modernes Betonhaus mit viel Glas bauen. Mit Türklinken und Schrankgriffen aus gebürstetem Stahl. Aber die gemütliche Atmosphäre des alten Hauses hatte Nói gefallen, und am Ende hatte er es geschafft, Vala zu überreden, ihren Plan für ein modernes Haus in Grautönen zu begraben. Stattdessen renovierten sie das alte Haus, vergrößerten die Küche und verringerten die Anzahl der Räume. Das Ergebnis war großartig, und Nóis langgehegter Kindheitstraum von einem warmen Nest war Wirklichkeit geworden. Vala schien auch zufrieden zu sein, und Tumi interessierte sich sowieso nicht für das ganze Hin und Her. Solange es eine Internetverbindung gab, war ihm alles andere egal.
»Nee, oder doch, ich weiß nicht.« Tumi senkte den Kopf und ging weiter.
»Du bist nur durcheinander von der Reise. Das ist normal.« Nói wünschte sich, Tumi hätte irgendetwas gesagt. Ihn auf eine zerbrochene Fensterscheibe oder einen Vogel auf dem Dach hingewiesen. Irgendwas. Er ließ den Blick ein letztes Mal über die Fassade schweifen, ohne etwas zu entdecken. Seine Trägheit und Müdigkeit wichen einer unerklärlichen Angst.
Gemeinsam trugen sie das Gepäck zur Haustür. Es war, als wären die Koffer während der Reise schwerer geworden. Sie enthielten unendlich viel Zeug, das nun untergebracht werden musste. Nói schüttelte den Kopf. Eigentlich brauchten sie nichts und mussten wahrscheinlich ein paar alte Sachen wegwerfen, um Platz für die neuen zu schaffen. Er stöhnte leise, dachte dann aber daran, dass er endlich wieder zu Hause war und allen Grund zur Freude hatte.
Als sie das Haus betraten, verschwand Nóis Freude im Handumdrehen. Ein unbekannter Geruch hing in der Luft, und das Haus wirkte fremd, als hätte das amerikanische Ehepaar es sich in den letzten zwei Wochen angeeignet. Vielleicht verhielt es sich mit deren Haus in Florida ja genauso. In dem Fall wäre Nói am liebsten noch mal zurückgeflogen, hätte ausgiebig gelüftet und noch gründlicher geputzt.
Er tastete nach dem Lichtschalter, in der Hoffnung, dass das Licht das ungute Gefühl vertreiben würde. Der Flur leuchtete auf, und Nói schaute auf die vertrauten Schränke und das Schuhregal, das jedoch keinesfalls so aussah wie sonst. Bevor sie losgefahren waren, hatten sie gründlich aufgeräumt, unter anderem auch das Chaos im Flur. Nun standen die Schuhpaare in Reih und Glied nebeneinander, wie um zu zeigen, dass hier eine besonders ordentliche und gut organisierte Familie wohnte. Was eigentlich auch stimmte. Abgesehen von Tumis Zimmer.
Vala hob einen Stapel Post und Zeitungen auf, hielt ihn Nói hin und gähnte. Nói schaute die Umschläge schnell durch und legte eine verspätete Weihnachtskarte nach oben. Vala beugte sich zu ihm und versuchte vergeblich, die Handschrift zu entziffern. Wegen der Reisevorbereitungen hatten sie es dieses Jahr nicht geschafft, selbst Weihnachtskarten zu schreiben. Wahrscheinlich würden sie deshalb in Zukunft von den Listen einiger Leute gestrichen.
Vor der Abreise hatten sie einen Teil der Weihnachtsdekoration hängen lassen, was Nói beunruhigt hatte, weil er befürchtete, die Leute wären vielleicht keine Christen und könnten sich beleidigt fühlen. Außerdem war Weihnachten vorbei, und es war lächerlich, die Sachen so lange hängen zu lassen. Vala hatte ihn gefragt, ob er noch ganz dicht sei, wer solle sich denn von Weihnachtsschmuck beleidigt fühlen? Sie würde sich von der Dekoration anderer Religionen auch nicht angegriffen fühlen. Es sei doch viel gemütlicher mit der Deko, die Leute würden das bestimmt genießen. In dem Haus in Florida hatten sie dann keine einzige Tannennadel gesichtet.
»Miez, miez!« Vala hängte ihre neue Jacke auf, die zwischen den dunklen Kleidungsstücken im Garderobenschrank lächerlich grell aussah. »Miez, miez!«
»Wie? Haben sie den Kater etwa draußen gelassen, als sie abgereist sind?«
Normalerweise kam der Kater sofort angelaufen, wenn die Haustür aufging, selbst wenn man nur den Müll rausbrachte. Wo war der arme Kerl? Das konnte die Erklärung dafür sein, warum die Gäste keine Mail mehr geschrieben hatten. Vielleicht standen sie unter Schock, weil ihnen das Haustier entlaufen war und sie nicht wussten, wie sie es ihnen beibringen sollten.
Da drang ein erbärmliches Miauen aus dem Haus, und kurz darauf erschien Púki und strich am Türrahmen entlang. In dem Betonklotz, den sie ursprünglich hatten bauen wollen, hätten sie sich einen Windhund anschaffen müssen – ein rotgetigerter Kater wäre ein Stilbruch gewesen.
Vala nahm den Kater auf den Arm und schmiegte ihr Gesicht an sein weiches Fell.
»Der ist ja viel dünner geworden!«
Nói war begeistert, denn es war dringend nötig gewesen, Púki auf Diät zu setzen.
»Hast du uns vermisst?«, murmelte Vala in das Fell und bekam als Dank ein paar Katzenhaare in den Mund. Trotzdem setzte sie den Kater nicht ab, sondern drückte ihn fest an ihre Brust. »Wenn ihr die Koffer reintragt, passe ich auf, dass Púki nicht im Weg ist.«
Im Handumdrehen hatten Nói und Tumi fast den gesamten Flur mit Koffern zugestellt.
»Alles da!«
Sie zogen ihre Jacken aus, und als Nói seine aufgehängt hatte, zog er einen Männermantel aus dem Schrank.
»Kennst du den?«
Vala schüttelte den Kopf. Es war ein dunkler, kurzer Mantel, der für Nói viel zu groß war. Sie ließ den Kater runter und musterte den Mantel ausgiebig, bevor sie ihn Nói zurückgab.
»Nein, nie gesehen. Ob die Leute ihn vergessen haben?«, sagte sie und rief sich das Haus des Ehepaars mit all seinen unzähligen Stellen ins Gedächtnis, an denen sie selbst etwas vergessen haben könnten. »Oder der ist noch von der Party«.
Am Wochenende vor ihrer Abreise hatten sie Nóis fünfunddreißigsten Geburtstag gefeiert und ihren gesamten Freundeskreis eingeladen, der ziemlich groß war. Einige Gäste waren lange geblieben und so betrunken gewesen, dass sie durchaus nur im Hemd in die Nacht hinausgegangen sein konnten. Doch Vala berichtigte sich sofort: »Nee, kann nicht sein, ich hab den Schrank ja noch aufgeräumt, bevor wir gefahren sind, und hätte den Mantel bestimmt gesehen.«
»Na toll«, sagte Nói und hängte ihn zurück in den Schrank. »Dann müssen wir den wohl nachschicken. Aber warten wir lieber mal, ob wir noch mehr Sachen finden.« Er schaute sich verdrossen um. »Wo sind die Schlüssel? Sollten die nicht auf der Fußmatte liegen?«
»Da lagen nur Briefe und Zeitungen«, sagte Vala und zeigte auf den Stapel, in dem sich unmöglich ein Schlüsselbund verstecken konnte. »Sie haben die Post einfach auf der Fußmatte liegen lassen. Komisch, dass sie sie nicht aufgehoben haben.«
»Verdammtes Chaos.« Nói schüttelte genervt den Kopf.
Als sie in die Küche gingen, wurde der Kater hellwach und gab keine Ruhe, bis Tumi seinen leeren Fressnapf gefüllt hatte. Die Amerikaner waren gestern abgereist, und Púki hatte offenbar schon alles verschlungen, was sie ihm vorher noch gegeben hatten. Der Wassernapf war staubtrocken, doch der Kater interessierte sich mehr fürs Fressen als fürs Trinken. Was typisch war, den er schleckte am liebsten Wasser vom Boden der Dusche.
»Hier ist schon mal einer.« Vala nahm einen Schlüsselanhänger mit einem Autoschlüssel vom Küchentisch, der neben einem ordentlich Häufchen mit Post und Zeitungen lag. Am Anfang ihres Aufenthalts schienen die Leute die Post noch aufgehoben zu haben. »Aber der andere Schlüsselbund fehlt. Der mit den Schlüsseln für hier und das Sommerhaus.«