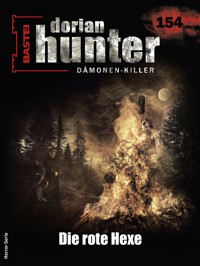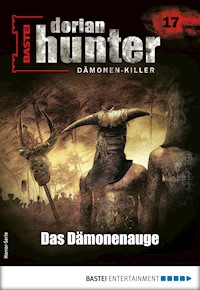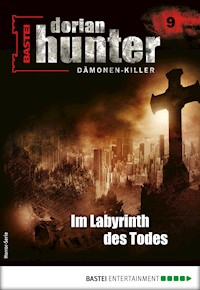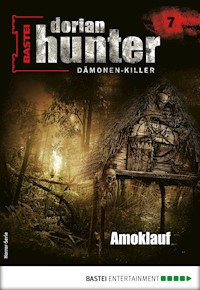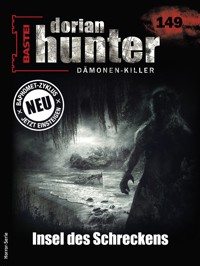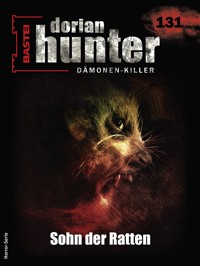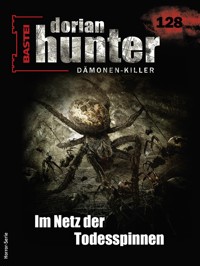1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ich hörte einen Schrei und richtete mich auf. »Hast du das auch gehört, Hernand?«, fragte ich den brutal aussehenden Mann, der neben mir hockte. Sein breites Gesicht war mit einem wild wuchernden, schwarzen Vollbart bedeckt.
»Was soll ich gehört haben?«, fragte er unwillig, ohne die Augen zu öffnen.
»Einen Schrei«, sagte ich.
Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen. Wahrscheinlich hatte ich mich getäuscht. Die lange Schiffsreise zerrte an meinen Nerven.
Ich war auf der Flucht vor der Inquisition.
Mein richtiger Name war Georg Rudolf Speyer, doch ich hatte mich als Juan Tabera ausgegeben, der ich in einem meiner früheren Leben gewesen war. Tabera war schon lange tot. Er war 1508 gestorben; jetzt schrieb man das Jahr 1532 ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
DIE WASSERLEICHE IM RIO NEGRO
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
mystery-press
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Mark Freier
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-9194-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Auf Schloss Lethian an der österreichisch-slowenischen Grenze gerät der Reporter Dorian Hunter in ein Abenteuer, das seinen Verstand übersteigt. Die acht Männer, die seine Frau Lilian und ihn begleiten, sind seine Brüder – gezeugt in einer einzigen Nacht, als die Gräfin von Lethian, selbst eine Hexe, sich mit dem Teufel Asmodi vereinigte! Dorians Brüder nehmen die Offenbarung euphorisch auf. Nur Dorian will sein Schicksal nicht akzeptieren. Er tötet seine Mutter und eröffnet die Jagd auf seine Brüder. Danach steckt er das Schloss in Brand und flieht mit seiner Frau. Aber Lilian hat bei der Begegnung mit den Dämonen den Verstand verloren. Übergangsweise bringt Dorian sie in einer Wiener Privatklinik unter, die auf die Behandlung psychischer Störungen spezialisiert ist – und begegnet kurz darauf der jungen Hexe Coco Zamis, die von ihrer Familie den Auftrag erhalten hat, Dorian zu töten. Doch Coco verliebt sich in den Dämonenkiller und wechselt die Seiten, wodurch sie nicht nur ihre magischen Fähigkeiten verliert, sondern darüber hinaus aus der Schwarzen Familie ausgestoßen wird.
Coco wie auch Dorian sind nun gleichzeitig Jäger und Gejagte, denn Dorian hat sich geschworen, seine Brüder, die das Feuer auf Schloss Lethian offenbar allesamt überlebt haben, zur Strecke zu bringen. In London tötet er Roberto Copello, nachdem dieser den Secret-Service-Agenten Donald Chapman auf Puppengröße geschrumpft hat. Mit Hilfe des Secret Service gründet Dorian die »Inquisitionsabteilung«, der nicht nur er selbst, sondern auch Coco und der Puppenmann Chapman fortan angehören. Ein weiteres »inoffizielles« Mitglied ist der geheimnisvolle Hermaphrodit Phillip, dessen Adoptiveltern von Dämonen getötet wurden. Zum Hauptquartier der Inquisitionsabteilung wird die Jugendstilvilla in der Baring Road, in der Phillip aufgewachsen ist, doch gleichzeitig stöbert Dorian Hunter weiter in der Bibliothek seines alten Reihenhauses in der Abraham Road nach Hinweisen auf dämonische Umtriebe – und stößt auf das Tagebuch des Barons Nicolas de Conde, der auf dem Eulenberg nahe Nancy im Jahr1484 seine Seele dem Teufel verkaufte. De Conde bereute, wurde zum Hexenjäger und Mitautor des »Hexenhammers« und starb als angeblicher Ketzer. Der Fluch erfüllte sich. Seither wird de Condes Seele nach jedem Tod in einem neuen Körper wiedergeboren – und tatsächlich gelingt es ihm als Dorian Hunter, nicht nur sieben seiner Brüder, sondern schließlich auch seinen Vater Asmodi zu vernichten!
Als Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, entführt wird, gelingt es Dorian zwar, den Arzt, Leonhard Goddard, der für die Entführung verantwortlich ist, auszuschalten – aber den Dämon hinter Goddard kann er nur mit Cocos Hilfe besiegen. Der Preis dafür ist hoch: Coco musste Asmodis Nachfolger Olivaro versprechen, den Dämonenkiller zu verlassen und in den Schoß der Schwarzen Familie zurückzukehren …
DIE WASSERLEICHE IM RIO NEGRO
von Neal Davenport
Ich hörte einen Schrei und richtete mich auf. »Hast du das auch gehört, Hernand?«, fragte ich den brutal aussehenden Mann, der neben mir hockte. Sein breites Gesicht war mit einem wild wuchernden, schwarzen Vollbart bedeckt.
»Was soll ich gehört haben?«, fragte er unwillig, ohne die Augen zu öffnen.
»Einen Schrei«, sagte ich.
Er hob die Schultern. »Und wenn schon. Was kümmert es mich.« Er verfiel wieder in sein dumpfes Brüten.
Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen. Wahrscheinlich hatte ich mich getäuscht. Die lange Reise zerrte an meinen Nerven. Dazu kamen die Schiffsgeräusche. Das Knacken und Ächzen war Tag und Nacht zu hören und vermischte sich mit dem Stimmengemurmel im Mannschaftsraum. Einige Männer lagen in den Hängematten und schnarchten, andere hockten in dem engen, stickigen Raum und würfelten. Das Essen, das aus Dörrgemüse und gepökeltem Fleisch bestanden hatte, lag mir noch schwer im Magen.
1. Kapitel
Dazu hatte es einen Becher brackigen Wassers und eine Schnitte Brot gegeben, mit der man vor dem Essen tüchtig auf den Boden klopfen musste, damit die Maden herauskrochen.
Ich war schmutzig, verlaust und voller Flöhe. Mein Gesicht war mit einem dichten Vollbart bedeckt, und meine Kleider waren verdreckt, zerfetzt und stanken erbärmlich.
Aber trotz all dieser unerfreulichen Nebenerscheinungen war ich froh, dass ich mich an Bord der Raja, einer kleinen Karavelle, befand. Unser Ziel war die Neue Welt, die wir in wenigen Tagen erreicht haben sollten.
Ich war auf der Flucht vor der Inquisition. Mein richtiger Name war Georg Rudolf Speyer, doch ich hatte mich als Juan Tabera ausgegeben, der ich in einem meiner früheren Leben gewesen war. Tabera war schon lange tot. Er war 1508 gestorben; jetzt schrieb man das Jahr 1532.
Wieder hörte ich den Schrei, diesmal ganz deutlich. So schrie nur ein Mensch in höchster Todesangst.
Ich stand auf. Das Schiff stampfte, schaukelte hin und her, und ich musste darauf achten, mir nicht den Kopf an der niedrigen Decke wund zu schlagen: Hernand Vivelda schlug die Augen auf und blinzelte mich an.
»Was ist los?«, fragte er brummend.
»Ich sehe mal an Deck nach.«
»Kümmere dich lieber um deine eigenen Angelegenheiten!«, knurrte er und streckte sich aus.
Ich hörte nicht auf ihn, ging zwischen den Schlafenden hindurch und passte mich den schaukelnden Bewegungen des Schiffes an. Nach wenigen Schritten hatte ich die Stufen erreicht, die zum Hauptdeck führten.
Die Mannschaft war ein wilder Haufen. Die meisten waren auf der Flucht, die anderen waren durch die Berichte über die Reichtümer der Neuen Welt animiert worden, Spanien zu verlassen.
Ich erreichte das Hauptdeck, blieb stehen und blickte über das Meer. Undeutlich sah ich zwei Karavellen vor uns. Der Himmel war dunkel, und trotz der starken Brise hatte jedes Schiff so viel Segel gesetzt, dass man um die Takelage fürchten musste. Ich stand unweit des Großmastes und blickte hoch. Über mir blähten sich ein Bonnett und das Rahsegel. Der Wind heulte. Ich drückte mich in den Schatten und sah mich aufmerksam um. Kein Mensch war zu sehen.
Da hörte ich wieder einen Schrei, langgezogen und schaurig. Ich lief einige Schritte und erreichte den Aufgang zum Quarterdeck. Das Geräusch meiner Schritte ging im Heulen des Sturms und im Toben der See unter. Ich wunderte mich, dass der Kapitän alle Segel gesetzt hatte. Der Sturm wurde von Minute zu Minute stärker. Ich streckte den Kopf vor, blieb aber noch auf den Stufen stehen. Auf dem erhöhten Halbdeck sah ich einige schemenhafte Gestalten, konnte aber keine Einzelheiten erkennen. Vorsichtig schlich ich an der Bordwand entlang.
»Lasst mich los!«, hörte ich die Stimme des Kapitäns.
Zwei riesige Gestalten hielten ihn gepackt.
Ich kam noch näher. Vor dem Kapitän stand Antonio de Aguilar, ein Edelmann, über den die verschiedensten Gerüchte im Umlauf waren. Er sollte auf seinen Anwesen Schwarze Messen gefeiert, den Teufel angerufen und die Kirche verhöhnt haben. Aguilar hob die rechte Hand, und ich sah, dass er ein gewaltiges Entermesser umklammert hatte. Er holte zum Schlag aus und spaltete dem Kapitän den Schädel.
Ich wandte den Kopf ab und atmete schwer. Nach einigen Sekunden sah ich wieder hin. Aguilar hatte sich in die Kehle des Toten verbissen und schlürfte gierig sein Blut. Schaudernd wandte ich mich ab.
Eine der dunklen Gestalten stieg vom Halbdeck herunter. Ich drückte mich eng an die Bordwand und wagte nicht zu atmen. Breitbeinig kam die Gestalt an mir vorbei. Für einen Augenblick riss die dunkle Wolkendecke auf, und ich konnte die Gestalt deutlich sehen. Der Mann war bis auf eine weite Hose nackt. Sein breiter Oberkörper war blutverschmiert. Der Schein des Mondes fiel auf sein Gesicht. Es war nicht mehr menschlich. Die Ohren liefen spitz zu, und die Augen waren groß wie Dukatenstücke und schimmerten dunkelrot. Die Nase war flach wie die eines Affen und der Mund zu einem geifernden Maul geworden. Die Lippen waren weit zurückgezogen und entblößten scharfe, blutverschmierte Reißzähne.
Das unheimliche Geschöpf stapfte weiter, ohne mich zu bemerken. Sekunden später war es auf der steil abfallenden Treppe zum Hauptdeck verschwunden.
Ich stand rasch auf und warf noch einen Blick auf das Halbdeck. Einige Tote lagen auf den Planken. Antonio de Aguilar war von drei der schaurigen, unmenschlichen Scheusale umringt. Er war eben dabei, die Leiche des Kapitäns zu zerstückeln.
Ich hatte genug gesehen. Mit klopfendem Herzen ging ich zum Quarterdeck und blieb lauschend stehen. Der Wind war noch stärker geworden und riss an den Segeln, die schon längst eingeholt gehört hätten. Ich sah mich um, bemerkte aber nichts Verdächtiges. Nach wenigen Sekunden hatte ich das Hauptdeck erreicht und betrat die Mannschaftsräume. Nach der frischen Luft kam es mir in dem engen Raum wie in einem Backofen vor. Ich setzte mich zu Hernand Vivelda, der den Kopf hob und mich musterte.
»Hör mir zu«, flüsterte ich leise. »Ich habe gesehen, wie Aguilar den Kapitän ermordete. Er hat vier furchtbare Scheusale bei sich.«
»Du phantasierst«, sagte er abweisend.
»Du musst mir glauben«, sagte ich heftig. »Aguilar ist ein Dämon. Ich sah, wie er dem Kapitän das Blut aussaugte.«
»Unsinn!«
»Ich sage die Wahrheit, Hernand. Wir müssen uns verstecken. Er wird sicherlich einige von uns töten. Er braucht Blut. Er dürfte ein vampirartiges Geschöpf sein.«
»Das hört sich ziemlich phantastisch an.«
Bevor ich noch etwas erwidern konnte, betrat Antonio de Aguilar den Mannschaftsraum und blieb breitbeinig stehen. Er war ein hochgewachsener hagerer Mann. Sein bleiches Gesicht war schmal, die dunklen Augen lagen tief in den Höhlen. Sein dunkelbrauner Spitzbart war sorgfältig gestutzt.
»Fünf Männer zu mir«, sagte Aguilar.
Niemand rührte sich.
»Wird’s bald!«, schrie er und zeigte auf drei Männer, dann auf Hernand und schließlich auf mich. »Ihr kommt mit!«
Hernand und ich wechselten einen Blick. Unwillkürlich griff ich nach meinem Dolch, der einzigen Waffe, die ich besaß.
Die anderen drei standen fluchend auf und folgten Aguilar. Hernand und ich schlossen uns ihnen an. Wir hielten uns aber einige Schritte zurück.
»Sei vorsichtig, Hernand«, sagte ich leise. »Ich weiß, wo wir uns verstecken können. Neben der Kombüse befindet sich das Lebensmittellager. Daran schließt ein Raum, in dem Waffen und allerlei anderes Zeug gelagert sind.«
Hernand gab mir keine Antwort.
Aguilar stieg zum Halbdeck hoch. Wir blieben zurück. Einer der Männer hatte das Halbdeck erreicht, da stürzte sich eines der Scheusale auf ihn, packte ihn an den Schultern und riss ihn hoch. Ich sah, wie die raubtierartigen Zähne zubissen und die Kehle des Unglücklichen zerfetzten.
»Glaubst du mir jetzt?«, fragte ich Hernand.
»Ja«, sagte er heiser.
»Wir haben keine Sekunde zu verlieren.« Ich wandte mich zur Flucht.
Ein Kampf gegen Aguilar und seine vier Helfer war sinnlos.
Eines der Scheusale verfolgte uns. Es stieß einen heiseren Schrei aus und fuchtelte wild mit den Armen herum. Ich erreichte die Tür zur Kombüse und riss sie auf. Das unheimliche Geschöpf hatte Hernand erreicht und schlug seine Pranken in seine Hüften. Hernand stieß einen entsetzlichen Schrei aus.
Blitzschnell riss ich meinen Dolch aus der Scheide und sprang auf das Monster zu. Die glutroten Augen blitzten mich böse an. Die rechte Pranke des Monsters drückte Hernands Kehle zu, der verzweifelt um sich schlug.