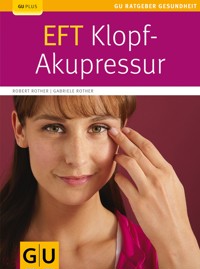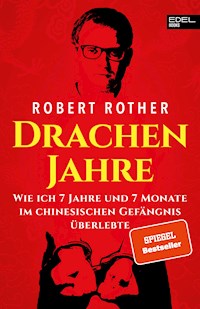
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Robert Rother im Dezember 2018 aus dem Gefängnis Dongguan im Süden Chinas entlassen wird, hat er fast acht Jahre hinter Gittern verbracht. Damit ist er einer der wenigen Deutschen, die in China eine Haftstrafe abgesessen haben – und der erste Europäer, der den Mut hat, darüber zu berichten. Dabei begann es wie im Märchen: Das Investment-Wunderkind aus Unna bleibt nach einer Reise im Land und verdient mit Finanzgeschäften schnell sehr viel Geld, steigt in die High Society auf und bewegt sich in den exklusiven Clubs der Reichen. Dann die plötzliche Wende: eine Klage bringt Rother in Untersuchungshaft, wo er unvorstellbare drei Jahre mit fünfzehn Häftlingen in einer Zelle verbringt. Irgendwann der Prozess – das Urteil: acht Jahre Gefängnis. Dort erwarten ihn Zwangsarbeit, systematische Demütigung, Folter und Isolation. Rother überlebt dank außergewöhnlicher Willenskraft und extremer Anpassungsfähigkeit. Aber auch dank des Umstandes, dass er Deutscher ist, was ihn vor den Schlimmsten Sanktionen bewahrt. Ein Glück, das nicht alle haben. Für die hat Robert Rother dieses Buch geschrieben. Das ist er ihnen schuldig, so der Autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich meiner Familie und speziell meinem verstorbenen Opa Sigismund Schuster und meinem ebenfalls verstorbenen Vater Reinhard Rother. Im Himmel werden wir wieder Schiffe bauen.
INHALT
Vorwort
Kapitel 1 – Freiheit und Brechreiz
Kapitel 2 – Kontoeröffnung
Kapitel 3 – Mein erster Ferrari
Kapitel 4 – China, ich komme!
Kapitel 5 – 1000 Frauen
Kapitel 6 – Angelina
Kapitel 7 – Geschäfte
Kapitel 8 – 2000-Dollar-Wein zum Runterspülen
Kapitel 9 – Mailin
Kapitel 10 – Festnahme
Kapitel 11 – U-Haft
Kapitel 12 – »Du bist ein Stück Scheiße, eine Schande für Deutschland«
Kapitel 13 – Hitler-Bewunderer, Sadisten und fliegende Brathühner
Kapitel 14 – »Das Ganze hier ist ein pures Geschenk Gottes«
Kapitel 15 – Familienbesuch
Kapitel 16 – Den Selbstmord vor Augen
Kapitel 17 – Krankenhaus
Kapitel 18 – Mein grenzdebiles Lächeln
Kapitel 19 – »Sehr geehrter Wärter, ich bin der Gefangene Luozi Luobote«
Kapitel 20 – »You are pig! You death! You over here!«
Kapitel 21 – Breaking Bad oder Der Kommunismus fängt beim Essen an
Kapitel 22 – Zwangsarbeit
Kapitel 23 – Der Eiserne Stuhl
Kapitel 24 – Robert, der Mensch
Kapitel 25 – Das alte neue Leben
Dank
VORWORT
Das Buch legt Zeugnis ab von meiner Zeit in der Untersuchungshaftanstalt Nummer drei in Shenzhen und anschließend im Knast in Dongguan im Südosten Chinas. Längst konnte ich nicht alles niederschreiben, was ich erlebt habe. Manches musste ich weglassen, um diejenigen, die mir halfen, den Höllentrip zu überleben, nicht zu gefährden. Die meisten Namen sind authentisch, manche musste ich aus besagtem Grund ändern.
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, werden vielleicht schlucken und fragen: Echt jetzt? Kann das so gewesen sein? Ja, so war es. Das, was ich niedergeschrieben habe, entspricht zu 100 Prozent der Wahrheit, wie ich sie erlebt habe. Ich berichte nur über eigenes Erleben, nichts beruht auf bloßem Hörensagen. Was mir im Knast von anderen Häftlingen erzählt wurde und andere Quellen habe ich kenntlich gemacht.
Ich bitte um Nachsicht, wenn ich immer wieder drastische Worte verwendet habe. Das musste mitunter sein, um jede Verniedlichung und Verharmlosung zu vermeiden.
Es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Vergessen. Wenn ich Menschen nicht vergeben kann, wie kann mir vergeben werden? Ich vergebe allen und ganz speziell meinen Peinigern und Übeltätern, aber das heißt nicht, dass ich vergessen werde. Ganz im Gegenteil. Meine Geschichte ist ein Zeugnis. Sie soll aufklären. Damit daraus gelernt und vielleicht sogar etwas geändert werden kann.
Weil sich die Welt schnell ändert und ich nicht weiß, wie es heute in den Gefängnissen aussieht, habe ich alles konsequent in der Vergangenheitsform niedergeschrieben.
KAPITEL 1
FREIHEIT UND BRECHREIZ
Freiheit verursacht also Brechreiz. Ich hatte alles gedacht, nur das nicht. Aber es war so. Sieben Jahre und sieben Monate hatte ich auf den Tag meiner Entlassung gewartet, jeden einzelnen der 2770 Tage gezählt, um dann festzustellen: Das innere Freudenfest, mit dem ich meinen ganz persönlichen Sieg über die Grenzen menschlicher Leidensfähigkeit feiern wollte, fällt aus. Ich fühlte nichts, absolut nichts. Null. Keine Freude, kein Jubeln, kein Lachen, kein stummes Triumphgeheul. Alles stumpf, wie tot und erloschen. Am allerletzten Tag meines China-Abenteuers erlebte ich mich so, wie die Regierung in Peking Menschen im Knast gerne haben will: als gefühl- und willenlose Roboter. Jeder Schritt, jede Handlung, jede Bewegung liefen wie automatisiert ab, als wäre ich der Protagonist in einem Computerspiel, der Zuschauer im eigenen Film. Robert, der Roboter, der Held aus der Playstation. Mein Gehirn glich einem Watteball. Ich tat, was man von mir verlangte. Ich war am letzten der 2770 Tage mehr Luozi Luobote als Robert Rother. Noch nicht einmal, als ich im Flieger Platz nahm, dachte ich: Yippie, es geht nach Hause. Sondern: Jetzt bloß nicht kotzen! Immerhin hatte der ständige Brechreiz auch sein Gutes. Er erinnerte mich daran, dass ich noch lebte, der Hölle von Dongguan entronnen war. Ich hatte es geschafft. Heimflug. Tschüss und auf Nimmerwiedersehen, China!
Ein paar Stunden zuvor, genauer: morgens um 05.30 Uhr. China und der Rest der Welt schrieben den 19. Dezember 2018. Der Tag begann wie jeder Tag davor im Gefängnis von Dongguan. Einer dieser grässlichen Wärter schlug mit irgendetwas Hartem gegen die Zellentür. Der Lärm weckte die letzten der 14 anderen Häftlinge in meiner Zelle, die noch nicht wach waren und gegen die Wände glotzten, ohne sich zu rühren und zu reden. Niemand wagte es, auch nur zu flüstern. Das Schweigen kannte ich zur Genüge. Es war das Beklemmendste des allmorgendlichen Rituals, bevor es zum Frühstück und hinaus in die Fabrik zur Zwangsarbeit ging.
Wie immer war ich kurz vor halb sechs aufgewacht. Für mich musste niemand Krach machen. Mein Körper hatte sich im Laufe der Jahre auf die stumpfsinnige Monotonie der Tagesabläufe eingestellt. Ich zog mich an und legte meine Nachtwäsche und mein Bettzeug in eine Box. Die Gefängniskleidung hatte ich natürlich zurückzugeben an den rechtmäßigen Besitzer, das chinesische Volk.
Dann gab es Frühstück, für mich das letzte Knastfrühstück meines Lebens. Nudeln, wie meistens. Es war das Essen, das ich anfangs gehasst hatte wie der Teufel das Weihwasser. Aber dann hatte ich mich mit der Zeit daran gewöhnt. Was in der Hölle von Dongguan bedeutete: Ich musste danach nicht mehr jedes Mal kotzen, sondern nur noch alle paar Tage.
Viertel vor sieben marschierten wir in die Fabrik. Links, zwo, drei, vier. Wie im Song von Rammstein, an den ich oft bei der Marschiererei dachte – wegen des Textes, logisch, wohl aber auch deshalb, weil er zur Brutalität des Knastlebens passte. Auf dem Weg von meiner Zelle nach draußen konnte ich mich noch von einigen Mithäftlingen verabschieden. Nur per Handzeichen, ein Gespräch war nicht mehr möglich. Manchmal meinte ich ein aufmunterndes Augenzwinkern oder ein kurzes Zunicken wahrzunehmen. Vielleicht bildete ich mir das aber auch nur ein.
Nach einer Viertelstunde waren wir in der Fabrik. Ich begab mich an meinen Platz, wo ich stupide Draht auf Rollen zu wickeln hatte. Mir gegenüber saß Watana, mein Freund aus Thailand. Wie meistens war er gut drauf. Er schien sogar beste Laune zu haben, als sollte nicht ich, sondern er heute entlassen werden. Ich bin sicher, er gönnte es mir von Herzen, dass ich gleich den Abflug machen durfte. Watana gehörte zu den Männern im Knast, die ich den Rest meines Lebens nicht vergessen und stets achten werde. Er hat dazu beigetragen, dass ich nicht durchgedreht bin. Er ist einer der Kerle, für die ich dieses Buch geschrieben habe. Watana hat es nicht verdient, in diesem Scheißgefängnis wie Bioabfall auf zwei Beinen behandelt zu werden.
Wir tauschten ein paar belanglose Sätze aus. Die Stimmung war getrübt – darüber täuschte seine gute Laune nicht hinweg. Abschied lag in der Luft, wahrscheinlich für immer.
Ich hatte keine Ahnung, weder wann genau ich entlassen werden würde noch wie meine ersten Minuten und Stunden in Freiheit ablaufen sollten. Seit über zwei Monaten hatte ich nicht mehr mit meiner Mutter oder einem anderen Familienmitglied telefoniert. Auf meine Fragen gaben mir die Wärter keine Antwort. Sie durften es wohl nicht. Sicher wusste ich nur, dass es nicht so sein würde wie im Kino: man tritt vor das Stahltor, das sich hinter einem rasch wieder schließt, zündet sich eine Zigarette an, schaut sich vielsagend in der Gegend um, da erscheint auch schon ein alter Kumpan oder gar eine schöne Frau , man fällt sich in die Arme, küsst sich (mehr oder weniger intensiv), steigt ins Auto – und schmiedet noch während der Fahrt einen Plan: für blutige Rache, den nächsten Diamantenraub oder, wer weiß, für einen Neuanfang als geläuterter Mitbürger. Rachegelüste hatte ich sehr wohl. Wenn auch keine blutigen.
Kurz vor neun kam Herr Chen, ein Polizist, den ich seit mehreren Jahren kannte, jeden Tag gesehen hatte und den ich – im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen – durchaus schätzte. Gefängniswärter in China gehören zur Polizei und sind nicht wie bei uns in Deutschland Angestellte des Justizapparats. Herr Chen war etwas jünger als ich, so Ende 20. Er hatte in Chicago studiert und gehört zu einer Generation Chinesen, die deutlich weltoffener und gebildeter ist als alle anderen davor. Er sprach – für chinesische Verhältnisse – sehr gutes Englisch. Chen rief mich zu sich und überreichte mir einige Papiere, die ich zu unterschreiben hatte, sowie meinen Pass und das Geld, das ich in den letzten zwölf Monaten vor meiner Entlassung gespart hatte: rund 2000 Yuan. Nicht gerade viel für ein Jahr üble Schufterei. Aber scheiß drauf. Hauptsache weg aus dieser Hölle.
»Scheiß drauf« hätte ich lieber nicht denken sollen. Während ich wartete und wartete und Löcher in die Luft stierte, fing es in meinem Magen an zu rumoren. Mein Darm spielte verrückt. Verdammte Scheiße, jetzt nur keinen Durchfall! Das wäre nichts Außergewöhnliches bei dem Knastfraß. Aber ausgerechnet heute, an diesem Tag? Womöglich auf dem Weg zum Flughafen? Bloß schnell raus mit der Kacke! Ich gab dem Wachpersonal Bescheid und lief, begleitet von einem Aufpasser, zum Plumpsklo. Mein Abschiedsschiss im und auf den Knast.
Kaum hatte ich mir Erleichterung verschafft und war auf meinen Platz zurückgekehrt, wurde mir vom anderen Seite der Werkhalle aus signalisiert, dass ich zum Ausgang kommen solle. Ein Mitgefangener holte mich ab, Kaweesa aus Uganda. Für solche Jobs hat die chinesische Polizei ihre Kapos. Kaweesa gehörte zur Gruppe Inhaftierter, die spezielle Aufgaben hatten und eigene Uniformen trugen, die sie von anderen Gefangenen unterschieden. Kaweesa war schon zehn Jahre im Bau und sprach Chinesisch. Er hatte damals noch weitere zehn Jahre vor sich. Ich hatte ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm – nicht, weil er Kapo, sondern weil er ein anständiger Bursche war, der andere Gefangene respektvoll behandelte.
Die 100 Meter hinüber zum anderen Ende der Fabrik waren der härteste Gang meines Lebens. Ich kam in dieser einen Minute an all meinen Freunden vorbei. Wäre ich der Held in einem Hollywoodfilm gewesen, der nach Jahren des Kampfes seine Unschuld bewiesen hatte und endlich freikam, hätte ich jeden einzelnen Meter zelebriert und meinen Triumphzug ausgekostet. Aber ein chinesischer Knast hat mit Hollywood so viel zu tun wie die Berliner mit der Chinesischen Mauer.
Wie in Trance schleppte ich mich zum Ausgang. Im Magen ein Kotzgefühl, in Hirn und Knien Watte. Ich blickte in die Augen meiner Freunde und wagte es nicht, stehenzubleiben. Zum ersten Mal an diesem Tag empfand ich eine Gefühlsregung und hatte, als meine Kumpels mir zuwinkten oder applaudierten und sogar aufstanden, was während der Arbeitszeit eigentlich verboten war, und mich mit Standing Ovations bedachten, Mühe, meine Tränen zurückzuhalten. Menschen aus Kolumbien, Nigeria, Benin, Palästina, Thailand, Vietnam und Kanada sagten in einer universellen Sprache, die jeder versteht: Auf Wiedersehen! Ich war überwältigt.
Es war eine starke Geste der Freundschaft zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft, abgestempelt als Kriminelle. Aus ihr ziehe ich die Kraft, meine Erlebnisse aus der Hölle von Dongguan aufzuschreiben. Für mich fühlte sich das damals so an, als fahre ich in den Heimaturlaub und lasse meine Kameraden am Ort der Verdammnis zurück. Man geht gerne, aber mit schlechtem Gewissen, weil man weiß, dass die Kameraden weiter im Reich des Teufels dahinvegetieren müssen.
Auch wenn es, bei Lichte betrachtet, unsinnig ist: Das Gefühl, Freunde in größter Not alleingelassen zu haben, habe ich bis heute. Es hat damals die Freude über meine Entlassung überlagert. Das mag unglaubwürdig klingen, aber verdammt noch mal: Es war so. Ich hatte mit diesen Leuten, die mir zujubelten, Jahre meines Lebens auf engstem Raum verbracht. Die meisten kannte ich besser, als manch einer seine Frau oder seinen Mann nach 20 Jahren Ehe kennt, jede Wette. In Dongguan kann man nichts verheimlichen. Man lebt rund um die Uhr gemeinsam in derselben Zelle. Man weiß, wer was gerne isst und wer was verabscheut. Man weiß, wer wovon träumt, und man weiß sogar, wie die Scheiße der Zellengenossen riecht. Alles spielt sich in einem einzigen Raum ab, ohne einen Hauch Privatsphäre. Die bis ins Intimste gehende Vertrautheit ist gezwungenermaßen enorm, obwohl alle bemüht sind, Distanz zu halten.
Kaweesa brachte mich bis vor die Tür der Fabrik. Das Gitter fiel hinter mir ins Schloss, ich würde all diese Menschen nie wiedersehen.
So ruhig hatte ich den Platz vor der Fabrik nie erlebt. Ich kannte ihn nur voller Getrampel und Befehle brüllender Stimmen. Jetzt aber herrschte absolute Stille. Ich konnte sogar hören, wie der Schlüssel im Schloss herumgedreht wurde.
Noch immer an der Seite Kaweesas wurde ich in einen kargen Raum zwischen Fabrik und Gefängnis gebracht. Herr Chen wies mich an, meine Klamotten komplett auszuziehen. Es war zwar Winter, aber mit knapp 20 Grad nicht sonderlich kalt. Ich stand splitternackt in dem Raum und wurde inspiziert, überall. Die Chinesen wollten sichergehen, dass ich nichts zwischen meinen Arschbacken rausschmuggelte, was nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Aber das hatte ich ohnehin alles im Kopf. Sie hätten mich enthaupten müssen, wenn sie gewollt hätten, dass ich nichts mit rausnehme, was sie belastet.
Man reichte mir ein Paar Schuhe und einen blauen Jolly-Jumper-Anzug, so einen Einteiler, wie ihn Kleinkinder tragen, bei dem der Reißverschluss vorne vom Bauchnabel bis zum Hals reicht. Ich fühlte mich wie ein Teletubbie.
Kaweesa durfte mich nur bis hierhin begleiten, er musste wieder zurück in die Fabrik. Wir verabschiedeten uns mit einem festen Händedruck. Von nun an begleitete mich Herr Chen. Wir gingen zum Block 2, in dem meine Zelle lag. Hier bekam ich den Rest meiner persönlichen Dinge: Fotos, Briefe meiner Familie und drei Bücher, davon zwei in spanischer Sprache, die mir ein Kolumbianer und ein Peruaner geschenkt hatten, damit ich Spanisch lernen konnte, und Fifty Shades of Grey auf Deutsch. Selbstverständlich war nicht alles dabei, was ich gerne zurückgehabt hätte. Zum Beispiel meine Tagebücher, die die Chinesen konfisziert hatten. Was mich allerdings aus zwei Gründen nicht weiter störte. Erstens: Wenn man Jahre ohne Smartphone und Laptop auskommt, lernt man, wichtige Sachen auf der Festplatte im Kopf abzuspeichern. Zweitens: Mittels Geheimcodes hatte ich mir in Fifty Shades of Grey die Telefonnummern meiner Freunde vermerkt. Soll noch einmal jemand sagen, in diesem Buch stünde nur Unsinn. Auf mein Exemplar traf das garantiert nicht zu.
Nun sollte alles ganz schnell gehen. Herr Chen hielt mich zur Eile an, weil offenbar – ich wusste nach wie vor nicht, wie ich das Land verlassen sollte – die Zeit drängte. Auf dem Weg zum Gefängnisausgang redete er die ganze Zeit auf mich ein. Ich hörte ihm nicht zu. Robert, der Roboter lief brav neben ihm her und versuchte, die Bauchschmerzen zu ignorieren.
Durch eine weitere Eisentür betrat ich den Raum, der der letzte auf dem Weg in die Freiheit sein sollte. Ein Beamter stellte mir auf Chinesisch Fragen zu meiner Person: Name, Geburtsdatum, Vergehen, Urteil, Höhe der Strafzahlung. Sie wollten absolut sicher sein, dass sie auch den Richtigen entlassen. Weil ich alle Fragen korrekt beantworten konnte, ohne einen einzigen Joker zu brauchen, erhielt ich die Entlassungspapiere zur Unterschrift. Ich unterschrieb mit »Robert Rother« und damit das Todesurteil für Luozi Luobote.
Ich ging durch die letzte stählerne Gitterdrehtür. Auf der anderen Seite empfing mich ein Militärpolizist, der mir exakt dieselben Fragen noch einmal stellte wie der Polizist wenige Minuten zuvor. Wieder alles richtig. Wieder ohne Joker ausgekommen. Die letzte schwere Eisentür öffnete sich – ich war wieder ein freier Mann. Hinter mir die Hölle von Dongguan, über mir ein paar Wolken vor blauem Himmel, vor mir das Leben. Ich starrte hinauf in das flauschige Gebilde grenzenloser Freiheit.
Ein Glücksgefühl wollte sich immer noch nicht einstellen. Aber langsam realisierte ich, dass ich auf dem Weg nach Hause war.
Gleich am Gefängnistor wartete ein Auto einer chinesischen Marke mitsamt Chauffeur. Ein weiterer Polizist gesellte sich zu Herrn Chen und mir, Herr Xi, den ich ebenfalls aus dem Knast kannte. Auch er sprach gut Englisch. Ich trug keine Handschellen, hatte aber den dämlichen Teletubbie-Anzug an. In dem Ding nach Hause? Bitte nicht. Als hätte Herr Xi meine Gedanken erraten, reichte er mir ein Paket. Es enthielt ein paar Klamotten, die das deutsche Konsulat besorgt hatte. Das Geld dafür hatte meine Mutter überwiesen. Gott sei Dank, ich musste also nicht mit dem blauen Strampler reisen. Darin wäre ich mir ziemlich bescheuert vorgekommen, auch wenn mich vermutlich einige Leute für einen exaltierten Künstler gehalten hätten. Dabei war ich nur ein ganz gewöhnlicher Überlebenskünstler.
Es folgte eine absurde Szene. Weil es gegen die Vorschriften verstoßen hätte, hatte ich die Klamotten nicht im Knast wechseln dürfen. Die Polizisten fuhren mit mir daher als Erstes in ein an den riesigen Gefängniskomplex angrenzendes Wohngebiet, wo sie mich an einer öffentlichen Toilette rausließen, in der ich mich umziehen konnte oder besser: musste. Öffentliche WCs in China, gerade die auf dem Land, gleichen Kloaken. Diese hier hätte in einem Wettbewerb um die Auszeichnung »Versiffteste Toilette Chinas« beste Chancen gehabt. Die Dreckslöcher im Gefängnis waren sauber dagegen. Aber ich war so abgestumpft und gleichgültig, dass ich nicht den geringsten Ekel empfand und mich umzog, als wäre es die Umkleidekabine im Spa-Bereich eines Fünfsternehotels.
Ich hatte mich fit gehalten, so gut es eben ging, und im Laufe meiner Jahre in Haft mindestens 20 Kilo verloren. Bis auf die Schuhgröße kannte ich meine Maße nicht mehr. Und so hatte ich dem Konsulat lediglich Schätzungen mitteilen können. Und siehe da: Die Adidas-Sneaker, das weiße T-Shirt, der Pullover und die Jacke passten perfekt. Aber die Jeans war im Bund viel zu weit. Blöderweise hatte ich keinen Gürtel – und eine Unterhose hatte ich auch nicht. An die hatte ich schlicht nicht gedacht, in der irrigen Annahme, ich könnte eine aus dem Gefängnis mitnehmen, was aber verboten war, da es sich um chinesisches Volkseigentum handelte. Was blieb mir anderes übrig, als meine Hand in die Tasche zu stecken, um die Jeans festzuhalten. Als würde ich Sackhüpfen spielen.
Um meine Habseligkeiten zu verstauen, gab man mir im Konsulat eine pinkfarbene Sporttasche. Bis heute ist es ein ungelöstes Rätsel, wer auf die Idee kam, mir eine Tasche in dieser Farbe rauszusuchen. Die Polizisten übergaben mir außerdem ein Buch meines Rechtsanwalts Qianwu Yang (Yang Qianwu), das er für mich für den Tag meiner Entlassung als Abschiedsgeschenk hinterlegt hatte, Drive: The Surprising Truth About What Motivates von Daniel H. Pink, das in Deutschland unter dem Titel Drive: Was Sie wirklich motiviert erschienen ist. Ein Wink mit dem Zaunpfahl in vielerlei Hinsicht. In dem Werk geht es darum, sich nicht von Geld und Prestige blenden und leiten zu lassen und auf das Prinzip von Bestrafung und Belohnung – also Zuckerbrot und Peitsche – zu pfeifen. Pink plädiert für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. All das passt nicht wirklich zu China, dem Land der Uniformen, der Gleichmacherei und Nivellierungen, in dem Zuckerbrot und Peitsche sowohl in der Innen- als auch Außenpolitik zum Standardrepertoire gehören und Individualismus verpönt ist. Ich verstand aber auch, was er mir persönlich damit sagen wollte: Hinterfrage dein altes Leben, hör auf, dem Geld nachzujagen und dich dabei selbst zu verlieren. In seiner Widmung schrieb Qianwu Yang: »Lieber Robert, ich war stolz, dein Anwalt und Freund zu sein. Alles Gute. Aufrichtig – Qianwu.« Das kann ich nur erwidern.
Nachdem ich fast acht Jahre weder ordentliche Schuhe noch Jeans oder Hemd angehabt hatte, fühlte ich mich seltsam. Ich musste mich erst wieder daran gewöhnen, in Straßenschuhen zu laufen.
Die Polizisten merkten davon nichts. Sie hielten mich zur Eile an. Was sie all die Jahre zuvor vermieden hatten, holten sie nun nach. Sie befragten mich zu meinem Leben in China und wollten wissen, ob ich mich auf zu Hause freue. Ich hatte keine Lust zu antworten, mit mir und meinem Kotzgefühl hatte ich genug zu tun. Also fragte ich sie meinerseits nach ihren Lebensverhältnissen und ließ sie reden. Chinesische Männer reden gerne, vor allem über Frauen. Die Polizisten beklagten sich über den Stress, den ihre Eltern ihnen machten, weil sie noch immer nicht verheiratet waren. In China muss man mit 30 einen Ehepartner gefunden haben, sonst gilt man schnell als schräger Vogel oder Loser.
Der Brechreiz war schlagartig schlimmer geworden, als sich der Wagen in Bewegung gesetzt hatte. In meinem Kopf fing sich alles an zu drehen. Das letzte Mal, dass ich in einem Auto gesessen hatte, lag rund vier Jahre zurück – damals war ich von der U-Haft ins Gefängnis gebracht worden. Weil wir unter Zeitdruck standen, gab der Fahrer ordentlich Gas. Bäume, Häuser, Zäune, Strommasten, Menschen – alles raste an mir vorbei. Dazu die Kurven. Mir war speiübel. Die Polizisten quatschten weiter munter auf mich ein und erzählten mir, wie schwierig es sei, die richtige Frau zu finden. Kinder hätten sie auch gern. Aber ohne Frau – was will man da machen? Ich versuchte, nicht zuzuhören, und sagte ab und an höflich: »Yes.«
Nach ungefähr einer Stunde waren wir endlich am Flughafen in Guangzhou. Es war fast Mittag. Ich stieg aus und musste mich mit einer Hand am Auto festhalten, um nicht umzukippen. Mein Kreislauf spielte verrückt. Die Polizisten hatten immer noch nicht bemerkt, was mit mir los war, und rannten los. Robert, der Roboter, riss sich zusammen und trabte hinterher.
Im Flughafen besorgte mir die Reizüberflutung den Rest. Der Lärm der Durchsagen, die bunten, grellen Farben der Werbeplakate und -schilder, die Gerüche aus dem Duty-free-Shop und den Restaurants … Ich hatte acht Jahre lang zwischen verschwitzten Kerlen gehaust, den Gestank von verdorbenem Essen, Plumpsklos, Durchfall und Kotze ertragen, acht Jahre lang nichts Buntes mehr gesehen. Und nun das hier. Ich hatte vergessen, dass es solche Farben und Wohlgerüche überhaupt gab. An einer riesigen Werbetafel von Louis Vuitton übermannten mich die Erinnerungen an mein einstiges luxuriöses Leben mit Angelina, die auf Louis Vuitton abgefahren war wie ich auf Ferraris.
Und just in diesem Augenblick lief eine junge Frau an mir vorbei – ich zahle gerne in die Chauvi-Kasse ein, aber ich dachte bloß: Was für ein hammergeiles Geschoss! Astralkörper, blonder Pferdeschwanz bis zur Hüfte, enganliegendes Business-Kostüm. Sie zog einen Trolley hinter sich her und eine Parfümwolke, die mir die Sinne raubte.
Im Knast hatte ich nur meine Mutter und ab und an eine Angestellte oder Praktikantin des Konsulats zu Gesicht bekommen, sonst keine einzige Frau. Und nun schickte der liebe Gott diesen Schuss, um mich zu prüfen. Der Boden unter mir fühlte sich an wie Pudding. Ich wankte, als hätte ich nach einer Flasche Wodka auf Eis eine Linie Koks gezogen. Ich wollte aufs Klo, mir den Finger in den Hals stecken oder wenigstens Wasser ins Gesicht spritzen. Aber meine Begleiter ließen mich nicht. Sie verklickerten mir, dass ich sonst meinen Flug verpassen würde.
Es war halb zwölf, als wir beim Securitycheck ankamen. Die Polizisten übergaben mich mit mehreren Kopien meines Urteilsdokuments und den Entlassungspapieren der Einwanderungsbehörde. Ich erfuhr, dass ich mit einer Aeroflot-Maschine nach Moskau fliegen sollte. Das Ticket hatte wiederum meine Mutter bezahlt. Abflug war um exakt 12.00 Uhr Mittag. High Noon in China. Wenn das nicht passte.
Ich verabschiedete mich von den Polizisten, nicht überschwänglich, aber durchaus freundlich. Gerne hätte ich sie gehasst, aber das funktionierte nicht. Sie waren auch nur Menschen. Bei der Übergabe am Securitycheck machten sie noch Fotos von mir, als Beweis, dass sie mich ordnungsgemäß am Flughafen zur Einreisebehörde gebracht hatten. Ich durfte als VIP durch die Sicherheitsschleuse. Einige Passagiere beobachteten die Szenerie. Sie müssen sich gefragt haben, wer dieser Kerl mit der Jeans, dem weißen Hemd und der auffälligen pinken Sporttasche, eskortiert von der Polizei, sein mochte. Fliegen wir mit einem Verbrecher, einer Persona non grata, einer unerwünschten Person, die des Landes verwiesen wurde? Nein, ich war’s nur: Robert, der Roboter.
Die Beamten der Einwanderungsbehörde lasen mit zunehmender Begeisterung in den Gerichtsdokumenten. Was sie darin so verzückte, begriff ich erst, als einer sagte: »Mensch, du bist ja dieser Robert!« Ich staunte nicht schlecht. Na klar wüssten sie, wer ich sei, über meinen Fall sei in den Medien ausführlich berichtet worden. »Dort hast du gewohnt?« Einer der Beamten zeigte auf das Foto meiner alten Wohnung im Reiche-Taschen-Viertel von Shenzhen. Ich nickte. Er meinte voller Respekt: »Die muss inzwischen mehr als 100 Millionen Yuan wert sein.« Ich war baff, wie gut sich dieser Mann mit den Immobilienpreisen in China auskannte – denn er dürfte mit dem Preis, umgerechnet rund 13 Millionen Euro, richtig gelegen haben.
Endlich der Securitycheck. Ich musste beide Arme hochnehmen. Es war klar, was nun passierte. Die Jeans rutschte langsam, Zentimeter für Zentimeter nach unten. Ich sah mich schon als nackter – nicht als blinder – Passagier in der Sendung Die 100 lustigsten Videos und spreizte die Beine so weit wie möglich, um die Hose am Weiterrutschen zu hindern. Meine Verrenkung dürfte kaum weniger seltsam ausgesehen haben, als wenn ich untenrum entblößt dagestanden hätte. Ich schwor mir: Nie wieder reise ich ohne Unterhose! Die Jeans hing gerade noch an ein paar Arschhaaren, bevor das erlösende Zeichen kam, ich könne weiterlaufen. Blitzschnell steckte ich meine Hand wieder in die Tasche und sorgte für Halt.
Anschließend gings zur Passkontrolle. Die Beamten erklärten mich zum VIP und führten mich – wie schon am Securitycheck – an der Schlange der wartenden Fluggäste vorbei. Sie füllten unzählige Papiere aus und machten immer wieder Fotos von mir, um jedes Detail meiner Ausreise zu dokumentieren, was die Neugier der Mitreisenden noch gesteigert haben dürfte.
Inzwischen war es fünf vor zwölf. Bis heute weiß ich nicht, ob die Maschine auf mich wartete oder ohnehin zu spät dran war. Ich tippe auf die Ersteres. Die Crew war längst dabei, den Flieger startklar zu machen. Nur die Tür zur ersten Klasse war noch offen. Der Beamte, der bis zuletzt bei mir blieb, brachte mich bis dahin und schoss ein letztes Foto aus der Serie »Robert, der Roboter verlässt China«. Dann hob er seine Hand zum Abschiedsgruß: »Good Luck!« Eine nette Geste, fand ich.
Ich, der coole VIP mit der coolen pinken Sporttasche, betrat endlich den Flieger. Die Passagiere, augenscheinlich größtenteils Russen, guckten, als wäre ich ein Außerirdischer. Was vor allem daran lag, dass ich über die VIP-Lane durch die First und die Business-Class musste, um zu meinem Platz in der Holzklasse zu gelangen. Ein VIP, der sich kein teures Ticket leisten konnte – alles klar.
Überall auf den Plätzen leuchtete es. Viele Passagiere hielten merkwürdige Dinger in der Hand: rechteckig, dünn, mit großem Display. Es waren die ersten Tablets, die ich in meinem Leben sah. Der letzte Passagier war ich jedoch nicht. Das war die Megablondine mit dem Pferdeschwanz, die Blicke auf sich zog.
Kaum hatte ich mich in den Sitz fallen lassen, hob die Maschine ab. Ich schaute hinunter auf China, dieses fantastische und zugleich verhasste Land. Robert, der Roboter, ließ seine Wahlheimat, die für ihn erst der Himmel und dann die Hölle auf Erden war, schnell immer weiter hinter sich. Nach Hause. In die Heimat. Mir war bewusst, dass ich in wenigen Stunden endlich meine Familie wiedersehen, meine Mutter und meinen Bruder in die Arme schließen würde. Aber noch war Deutschland weit weg. Mensch, nun freu dich doch mal, dachte ich, und schämte mich dafür, so stumpf und emotionslos im Flieger zu sitzen, statt die Stunden zu zählen und dem Wangenkuss meiner Mutter entgegenzufiebern.
Kurz nach dem Start kam schon das Essen. Nudeln und Huhn, halb russisch, halb asiatisch. Ich probierte davon, brachte aber nichts herunter. Nach acht Jahren Scheißreis mit Scheißsoße, die keine Soße war, sondern verdrecktes Scheißwasser mit Scheißgemüse, kamen weder meine Geschmackssensoren noch mein Magen damit klar. Es schmeckte überhaupt nicht. Mir jedenfalls nicht. Der neben mir sitzende Engländer aß mit großem Appetit. Er versuchte, mit mir ins Gespräch zu kommen. Doch ich hatte keine Lust zu plaudern und war kurz angebunden. Normalerweise ist das nicht meine Art. Aber ich wollte nicht sagen: Bitte haben Sie Verständnis, ich habe eine elende Zeit hinter mir und bin nicht zu Small Talk aufgelegt. Sich mit dem Engländer jetzt über Gott und die Welt unterhalten, das wäre voll nach hinten losgegangen.
Selbst wenn ich es gewollt hätte: Ich konnte nicht reden. Den einzigen Satz, den ich während des Fluges hervorbrachte, war die Bitte um zwei Kopfschmerztabletten, die mir der Steward denn auch brachte. Ich schloss die Augen in der Hoffnung, so meine Sinne auszuschalten. Im Kopf drehte sich alles. Ich dachte weder an die Zeit im Gefängnis, die hinter mir lag, noch an die Möglichkeiten, privat und beruflich, die ich ab morgen wieder haben würde, sondern nur: Bitte, bitte, bitte, lasst mich alle in Ruhe. Sonst fang ich an zu kotzen.
Ich wusste, ich bin frei, ich fliege nach Hause, aber es war nicht real. Wenn ich heute danach gefragt werde, versuche ich es so zu erklären: Es ist wie vor einem Urlaub. Man freut sich wochenlang darauf – und kaum ist es so weit, ist der Überraschungseffekt weg; man sitzt im Auto oder im Flieger und denkt nur noch: Bitte lass mich schnell am Urlaubsort ankommen und dann mal sehen, wie es weitergeht.
Zum Glück übermannte mich der Schlaf.
Erst acht oder neun Stunden später, die Maschine befand sich schon im Landeanflug, wachte ich wieder auf. Die Magenschmerzen und das Kotzgefühl waren weg. Wir kamen pünktlich in Moskau an. Kurz nach der Landung gab es eine Durchsage für »Mr. Robert Rother«: Ich musste sitzen bleiben, bis ich abgeholt wurde. Alle Passagiere durften raus, nur ich nicht.
Eine Dame, die zum Flughafenpersonal gehörte, erschien. »Haben Sie Ihren Pass verloren?«, fragte sie mich auf Englisch mit stark russischem Akzent. »Nein«, antwortete ich und hielt ihr meinen Reisepass vors Gesicht. Sie schien etwas verwirrt, weil sie mich und die ganze Situation nicht einordnen konnte. Dann sagte sie, sie müsse mich zur Einwanderungsbehörde bringen. »Okay«, sagte ich und bat sie, schnell zu machen, weil mein Anschlussflug nach Hamburg in einer guten Stunde gehen würde.
20 Minuten nach allen anderen verließen wir das Flugzeug. Beim Abflug waren es mehr als zwanzig Grad gewesen, in Moskau lag Schnee. Ich hatte definitiv die falschen Klamotten an. Allerdings glaube ich, dass ich selbst im T-Shirt nicht gefroren hätte. Ich hatte noch überhaupt keine Zeit, auf so etwas Banales wie die Außentemperatur zu reagieren, mein Hirn waberte weiter im Nebel, und auch wenn das Kotzgefühl zwar nicht mehr akut war, war es doch in lebhafter Erinnerung.
Die Frau führte mich zu dem Bus, mit dem die Passagiere vom Flugfeld zum Flughafengebäude gebracht wurden. Als ich einstieg, glotzten mich die Leute abermals wie einen Aussätzigen an, wahrscheinlich fragten sie sich: Was ist das nur für ein Idiot, der hier den ganzen Betrieb aufhält? Ich begriff, dass die armen Schweine wegen mir, dem Pseudo-VIP mit der pinkfarbenen Sporttasche, zwanzig Minuten bei minus zehn Grad hatten warten müssen.
Die Frau brachte mich zur Einwanderungsbehörde. Ich vermute, die Chinesen hatten die Russen gebeten, ihnen zu bestätigen, dass ich aus der Maschine ausgestiegen und in Russland eingereist war, um ganz sicher sein zu können, dass ich nicht – nun als Robert, der Rächer – in China Amok lief oder anderen Unfug anstellte.
Bei der Passkontrolle ging zum Glück alles fix. Ich hatte aber auch keine Zeit zu verlieren: Ich war in Terminal A angekommen und musste nach Terminal Z. Das waren 45 Gehminuten, die weiteste Distanz, die man in dem riesigen Moskauer Flughafen zurücklegen konnte. Ich hatte noch genau 47 Minuten Zeit. Also nahm ich meine Beine in die Hand. Die Orientierung fiel mir schwer. Zum ersten Mal nach meiner Entlassung war ich ohne Begleitung unterwegs.
Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz: Junge, du brauchst Bargeld! Ich wusste nicht, ob ich in Hamburg abgeholt werden würde, ob ich nicht Bahn oder Taxi nehmen müsste. Ich tauschte meine 2000 Yuan gegen knapp 260 Euro – wie gesagt: der Lohn für ein Jahr Arbeit. Seltsamerweise hatte es etwas Beruhigendes, Euros in der Tasche zu haben. Ich rannte weiter. Endlich, Terminal Z! Der Check-in nach Hamburg verlief reibungslos, die Maschine war nur halbvoll. Auch sie landete pünktlich. Ich betrat deutschen Boden.
Die ersten Minuten waren surreal. Innerhalb von nur 24 Stunden war ich von einer Welt in eine völlig andere gekommen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich denken sollte, selbst die pinkfarbene Sporttasche war mir jetzt völlig egal. Ich hielt meinen Reisepass unter den Scanner und erhielt das Signal: alles okay. Das hieß: Ich war noch nicht abgeschrieben und nach wie vor als deutscher Staatsbürger registriert. Dann die ersten Schritte im Hamburger Flughafen. Es fühlte sich an, als wäre ich niemals weg gewesen. Willkommen in Deutschland!
KAPITEL 2
KONTOERÖFFNUNG
Es gibt nur einen Weg, die Hölle zu überleben: Man muss abstumpfen, sich emotional abschotten, dicht machen, alle Gefühle wegdrücken, verdrängen. Nichts fühlen, nichts sehen, nichts hören. Hart zu werden, war meine einzige Chance, und das habe ich geschafft, obwohl es oft bis zur Selbstaufgabe ging. Ich lief vorbei an Folteropfern mit schmerzverzerrten Gesichtern – und registrierte ihre Qualen wie ein Buchhalter den Eingang einer Rechnung. Wenn ich noch Mitgefühl hatte, drang dies nicht bis in mein Bewusstsein vor. Ich wäre sonst auch durchgedreht. Dabei war mir glasklar, welch fundamentales Unrecht hier geschah. Folter ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Menschenrechte. Doch was hätte ich tun können? Schreien? Randalieren? Ich hätte lediglich riskiert, selbst auf dem Eisernen Stuhl zu landen und von anderen Häftlingen mit Augen wie aus Stahl angesehen zu werden. Ich hatte nur noch ein Ziel: Ich wollte überleben.
Seelischen Schmerz sollte man sich im Knast auf keinen Fall anmerken lassen. Wer Schwäche offenbart, gerät von zwei Seiten unter Druck: Die Wärter traktieren dich, gleichzeitig verachten dich die anderen Gefangenen (oder verprügeln dich), weil du ein Schlappschwanz bist und sie einen noch Schwächeren gefunden haben.
Noch in der Untersuchungshaft hatte ich Vom Winde verweht von Margaret Mitchell gelesen. Der Roman spielt zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, bei dem es um die Abschaffung der Sklaverei ging. Das Motto der Romanheldin Scarlett O’Hara lautet: »After all, tomorrow is another day!« Ihre Devise: »Morgen ist auch noch ein Tag!« wurde im Gefängnis mein Leitspruch, an dem ich mich im Stillen immer wieder aufrichtete. Für mich bedeutete er: Mit Seelenqualen muss ich mich heute nicht plagen. Ich kann sowieso nichts ändern.
Ich verbarg also meine Gefühle und erschütternden Erfahrungen wie in einer Schublade: rein damit und weg. Ich dachte: Eines Tages, wenn die Umstände andere sind und wenn ich dazu in der Lage bin, werde ich sie öffnen und mich um den Inhalt kümmern. Das war die richtige Entscheidung. Inzwischen habe ich verstanden, dass die vielen schrecklichen Erlebnisse, auch wenn ich sie verdrängt habe, einen anderen Menschen aus mir gemacht haben. Es ist so hart, wie es klingt: Gerettet hat mich der pragmatische Umgang mit Schmerz – eigenem und fremdem, körperlichem und seelischem. Ich wollte lebend raus aus der Hölle, um später davon erzählen zu können.
Ich lernte, alles, was mich bewegte, worunter ich litt, mit mir selbst auszumachen, aber auch, meiner Familie Normalität und gute Laune vorzugaukeln – und wenn es sein musste, sogar mir selbst. Bereits in der U-Haft lernte ich, zu verdrängen. Ich sagte mir: Morgen ist dieser Wahnsinn vorbei. Oder übermorgen. Allerspätestens. Meine Briefe nach Hause, die genehmigten wie die herausgeschmuggelten, sind ein beredtes Zeugnis dafür. Bis zu meiner Verurteilung redete ich mir mantraartig ein, bald wieder frei zu sein. Und tatsächlich glaubte ich auch fest daran, dass der ganze Spuk sich bald in Luft auflösen würde, wie die Gespenster, die ich als Kind im Flur sah, weshalb nachts dort das Licht brennen und die Tür zu meinem Zimmer einen Spalt offen stehen musste.
In der Hölle von Dongguan wollte ich – anders als in der Untersuchungshaft – niemanden aus der Familie sehen, nicht mal meine Mutter. Ich hätte es nicht ausgehalten. Jeder Gefangene, der sich in den Augen der chinesischen Polizei gut benahm, durfte einmal im Monat 30 Minuten einen einzigen Besucher empfangen. Damit erpressten sie einen: Wenn du brav bist, darfst du jemanden empfangen … Nicht mit mir! Für meine Mutter wäre das ein Wahnsinnsaufwand gewesen, psychisch und finanziell. Und reden konnte man sowieso nur per Telefon, getrennt durch eine dicke, versiffte Panzerglasscheibe. Eine Umarmung, ein Handschlag, eine Berührung – alles verboten, alles nicht möglich! Ich hatte immer versucht, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Gedanken an meine Familie, mein Zuhause schob ich sehr weit weg – anders ging es nicht.
In der U-Haft hatte ich noch mitbekommen, dass mein Großvater an Blutkrebs erkrankt war. Meine Mum hatte mir einen langen Brief geschrieben, in dem sie seine letzten Tage ausführlich schilderte. Sie wusste, wie sehr ich an ihm gehangen hatte, was er mir bedeutete. Erst mit einem Jahr Verspätung ist mir der Brief im Knast ausgehändigt worden. Die Chinesen hatten ihn mir vorenthalten. Den Grund dafür habe ich nie erfahren. Der Gedanke, dass ich mich von meinem Großvater nicht hatte verabschieden können, war entsetzlich. Ich unterdrückte meine Tränen, fraß die Trauer in mich hinein. Sich nur nichts anmerken lassen, nur keine Schwäche zeigen, niemand sollte mitbekommen, wie es mir ging. »After all, tomorrow is another day!«