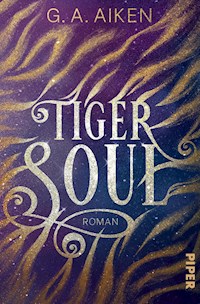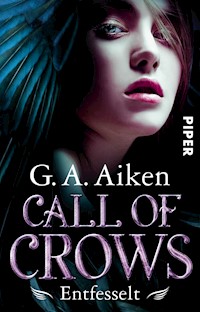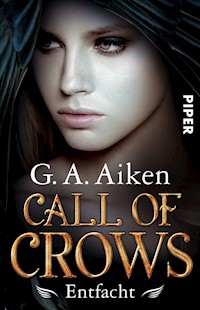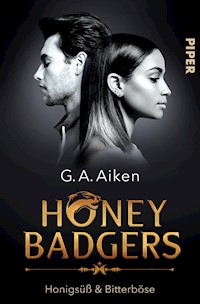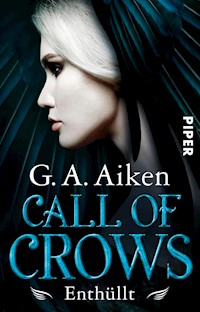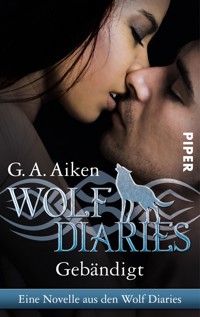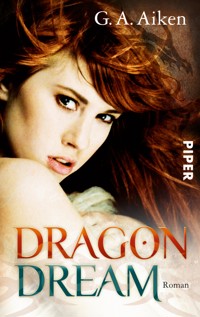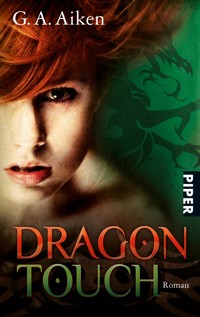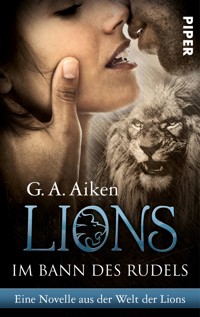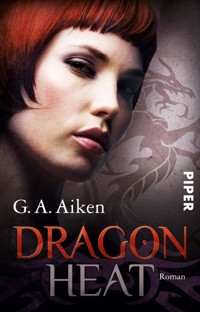
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mit prickelnder Erotik und einer gehörigen Portion Humor führt G. A. Aiken erneut in die Welt der fürchterlichen, barbarischen und unglaublich feurigen Dragons: Aidan der Göttliche ist, nun ja, göttlich. Er ist stolz auf seinen Beinamen, der ihm von der Drachenkönigin höchstpersönlich verliehen wurde. Als mächtiger Krieger verfügt er nicht nur über einen gut versteckten Goldschatz, sondern sieht auch noch extrem gut aus. Doch obwohl er von adeligem Stand ist, weist ihn die niedriggeborene Branwen ab – oder, noch schlimmer, sie ignoriert ihn. Dabei ist Branwen gar nicht entgangen, wie charmant Aidan ist, dass er oft viel zu nah an ihrer Seite sitzt und wie verführerisch seine Blicke sind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Michaela Link
ISBN 978-3-492-99083-7
© G. A. Aiken 2017 Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Bring the Heat« bei Zebra Books, New York 2017 © Piper Verlag GmbH, München 2018 Covergestaltung: Guter Punkt, München Covermotiv: Sabine Dunst, Guter Punkt, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock und Thinkstock Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Guide
Prolog
»Dein Sohn.« Der Zorn raste durch ihn hindurch. Kalt. Grausam. Der Zorn, dem er seinen Namen verdankte. Der Zorn, der es ihm erlaubte, nichts zu empfinden. Für niemanden. Für gar nichts. Knurrend wiederholte er: »Dein Sohn.«
Vateria, nicht ganz die Letzte des Hauses der Atia Flomimia, legte den Vorderfuß um ihr Kind. Zum ersten Mal überhaupt sah Gaius Lucius Domitus, der Rebellenkönig, Angst in den Augen seiner Cousine. Echte, absolute Angst. Denn ausnahmsweise einmal scherte sie sich um etwas, das nicht sie selbst war.
»Das würdest du nicht wagen«, sagte Vateria zu ihm.
Aber Gaius würde es wagen. Gaius, der sich an seine Schwester erinnerte, eingesperrt mit Vateria, gefoltert von Vateria, würde einiges wagen, um dieses Unrecht wiedergutzumachen.
Gaius hob sein Schert hoch über den Kopf und zitterte am ganzen Körper. Er sah seiner Cousine fest in die Augen und genoss den Schmerz, den er ihr gleich zufügen würde. Obwohl er wusste, dass es ein Unrecht war, würde ihn nichts aufhalten. Nichts.
Gaius riss die Vorderklauen noch ein wenig weiter zurück, um seinem Hieb so viel Kraft wie möglich zu verleihen, als er Kachka Shestakova von oben schreien hörte: »Gaius, nein!«
Er kämpfte gegen ihre Stimme an. Kämpfte dagegen an, wie richtig sie sich anhörte.
»Tu es nicht! Er ist noch ein Kind!«
»Vaterias Kind«, rief er ihr ins Gedächtnis.
»Wäre deine Schwester darauf stolz? Oder verwandelst du dich zu guter Letzt doch noch in einen Thracius? Tu das nicht.«
Gaius’ Entschlossenheit geriet ins Wanken. Kachka hatte recht. Einem Kind etwas anzutun, um es seiner Mutter heimzuzahlen? Das war etwas, das sein Onkel nicht nur tun würde, sondern tatsächlich getan hatte.
Und jetzt stand er im Begriff, das Gleiche zu tun.
Tu es nicht, Gaius.
Aggie …
Bitte, tu es nicht.
Er hatte seine Schwester in seine Gedanken gelassen und es nicht einmal gemerkt. Also, wenn er das hier tat, würde sie es ebenfalls tun. Es würde genauso ihre Erinnerung sein wie seine.
Das durfte er nicht. Sie besaß schon genug schlechte Erinnerungen für ein ganzes Leben. Er würde diesen Erinnerungen nicht noch die Last dieser Sünde hinzufügen.
Gaius ließ seine Waffe sinken und Vateria riss ihren Sohn an sich, öffnete eine mystische Tür und war innerhalb von Sekunden verschwunden.
Vateria purzelte aus der mystischen Tür, die sie geöffnet hatte, und zog ihren ältesten Sohn an ihre Brust. Er mochte aussehen wie ein Mensch – und war größtenteils auch einer –, aber er war ihr Sohn. Ihr wahrer Sohn, teils Mensch, teils Drache. Ihr Schatz.
Und für eine Zeit, die ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen war, hatte sie geglaubt, dass sie ihn an ihren Cousin, diesen Bastard, verlieren würde. Er war bereit gewesen, es zu tun, aber seine Schwester … schwach wie eh und je. Vateria konnte die Worte des Miststücks in ihrem Kopf hören, obwohl sie nur zu ihrem Zwillingsbruder sprach. »Tu es nicht, Gaius, bitte, tu es nicht.«
Erbärmlich. Wäre die Situation umgekehrt gewesen, hätte Vateria jeden Abkömmling von Gaius ohne Zögern niedergemetzelt. Und sie hätte gelacht, während sein Kind gestorben wäre.
Aber wie seine Schwester war er zu schwach.
Wie dem auch sei, Vateria hatte ihren Sohn und das war alles, was zählte.
»Mutter?«
»Tu ich dir weh?«, fragte sie etwas erschrocken. »Bist du verletzt?«
»Nein … ich … Vater.«
Scheiße.
Sie hatte nicht wieder ihre menschliche Gestalt angenommen, bevor sie durch die Tür gekommen war. Sie war nicht in die Herzogin Ageltrude Salebiri zurückverwandelt, der sehr menschlichen Gemahlin von Herzog Salebiri. Eine Täuschung, die sie seit Jahren aufrechterhielt.
Langsam hob sie den Kopf und sah, wie ihr menschlicher Ehemann und seine Elitegarde sie quer durch die riesige Haupthalle voller Entsetzen anstarrten. Sie stellte ihren Sohn vorsichtig auf den Boden, stieß ihn aber nicht weg. Er war jetzt mit seinen elf Jahren alt genug, um zu lernen, welche Rolle er eines Tages einnehmen würde und was zu dieser Rolle gehörte.
Vateria setzte sich auf die Hinterbeine. Dann rief sie im Geiste den Zauber auf, der sie wieder in einen Menschen verwandeln würde. Binnen einer Sekunde stand sie in Flammen, die auch ihren Sohn mit einschlossen, aber diese Flammen würden ihm keinen Schaden zufügen. Sie waren ein Teil von ihm. Als das Feuer erloschen war und sie ihre menschliche Gestalt angenommen hatte, lächelte sie ihren Gemahl an.
»Mein Liebster …«
»Tötet diese Kreatur!«, schrie der Anführer der Elitegarde.
Mit gezückten Schwertern stürmten die Männer heran.
Vateria hob die Hand und schleuderte sie mit der Macht Chramnesinds, des augenlosen Gottes, mit einem Fingerschnippen zurück. Die Augen immer noch auf ihren Gemahl gerichtet, sagte sie: »Ruf sie zurück, sonst werde ich sie alle töten.«
Der Herzog schaute sie an und ihre Blicke trafen sich.
Mit leiser Stimme knurrte er: »Im Namen unseres mächtigen Gottes … tötet dieses Miststück.«
Die Männer rappelten sich auf und stürmten erneut auf sie zu. Diesmal verschränkte sie die Arme vor der Brust und entfesselte eine weitere Gabe ihres treuen Gottes: Zahlreiche Tentakel schlängelten sich zwischen ihren Beinen und aus ihrem Rücken hervor, schossen durch den Raum und bohrten sich den Wachen in die Brust – nahe ihrem Herzen, aber nicht direkt hindurch. Mit einem Stoß presste sie ihre schreienden Opfer gegen die Steinwände.
Zitternd und erfüllt von Zorn und Abscheu zog Salebiri sein Schwert aus der Scheide.
Vateria beobachtete ihn und ihr Sohn trat hinter sie, versteckte sich hinter seiner Mutter. Wenn sie starb, würde ihre gesamte Nachkommenschaft sterben, und das würde sie nicht zulassen.
Aber als Salebiri sich ihr näherte, erstarrte er plötzlich mitten im Schritt. Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen, sein Kopf fiel ihm in den Nacken, er atmete stoßweise.
Sie sah es ebenfalls. Der Geist ihres Gottes durchströmte den Menschen und erfüllte ihn, verlieh ihm durch seinen Segen Kraft. Immer noch zitternd senkte Salebiri den Kopf und sah sie direkt an.
»Verstehst du jetzt, mein Gemahl?«, fragte sie. »Siehst du es jetzt?«
Er ließ sein Schwert fallen und kam zu ihr. Dann flocht er die Hände in ihr Haar und schaute ihr tief in die Augen.
»Ich verstehe alles … meine Gemahlin.«
Sie neigte den Kopf und küsste seine Hand. »Er hat uns gegenüber noch nie ein Versprechen gebrochen. Er wird uns alles geben, was wir uns je gewünscht haben. Blut. Rache. Und das unaufhörliche Leiden anderer. Wir müssen ihm gegenüber nur loyal sein. Uns vor ihm verbeugen. Ihm unsere Seelen versprechen. Kannst du das tun, mein Liebster? Kannst du mich lieben? Alles an mir?«, fragte sie und ließ einen ihrer Tentakel über Salebiris Nacken gleiten. »Mich lieben und dich an mich binden, so wie du an unseren Gott gebunden bist?«
»Ja, das kann ich. Das tue ich. Ich sehe jetzt, dass du sein Segen für mich bist. Dass unsere Kinder … ein Segen für mich sind.«
Vateria legte ihm die Hände auf die Hüften und streichelte mit einem weiteren Tentakel durch seine Kettenpanzerhose seinen Schwanz.
»Das ist alles, worum ich bitte, mein Gemahl. Alles, was ich brauche.«
Salebiri schaute seine Männer an, die immer noch an die Wand gespießt waren und immer noch schrien.
»Was ist mit ihnen?«, knurrte er. Für ihn waren sie jetzt Verräter. »Man kann ihnen nicht trauen.«
Vateria streckte die Hand nach seinem Schwertgürtel aus und zog den Dolch aus der Scheide. Hielt ihn ihrem Gemahl hin.
»Mach dir keine Sorgen, mein Liebster. Wir werden uns loyale Wachen suchen, die nur das sehen, was unser Gott ihnen zeigen will.«
Sie beugte sich vor, küsste ihn zart auf die Lippen … und reichte ihrem Sohn die Klinge.
Benedetto Salebiri nahm die Waffe von seiner Mutter entgegen und unter den ungeheuer stolzen Blicken seiner Eltern machte er sich daran, den ganzen Trupp der Elitewachen auszuweiden, weil er an ihre Kehlen noch nicht heranreichte.
Während die Männer in Todesqualen schrien und ein Kind um Barmherzigkeit anflehten, rieb Vateria die Nase am Kinn ihres Gemahls und sagte: »Wir werden dieses Miststück und ihre abscheulichen Abkömmlinge in die Knie zwingen.«
»Ich werde dir Annwyls Kopf persönlich überbringen«, versprach er und meinte damit die menschliche Königin der Südländer.
»Nicht Annwyl«, erwiderte Vateria und schüttelte schnell den Kopf. »Sie ist bedeutungslos. Eine wahnsinnige Hure, die schon bald ihr wahres Schicksal ereilen wird.«
Salebiri schaute verwirrt auf sie herunter. »Wen … dann?«
Sie küsste ihn auf die Wange und leckte ihm übers Kinn. »Ich spreche von Rhiannon, mein liebes Herz. Von der Drachenkönigin. Die Einzige, die überhaupt je eine Rolle gespielt hat.«
Sie bedachte ihn mit einem breiten Grinsen, wohl wissend, dass er jetzt wahrhaft verstand, was sie wollte, und sie sich nicht länger zu verstellen brauchte. Dass er sie genauso sah, wie sie war, und dass er ihr treu ergeben war.
»Wir bringen Rhiannon die Weiße zur Strecke – und die Welt wird uns gehören.«
1 Sieben Winter später …
Der abgebrochene Speer traf sie an der rechten Seite und riss sie von ihrem Streitross. Sie landete hart auf dem blutdurchtränkten Boden, ließ sich aber keine Zeit, wieder zu Atem zu kommen. Sie zwang sich auf die Füße und blockte schnell mit ihrem gepanzerten Unterarm den beschädigten Speer ab.
Mit ihrer freien Hand schlug sie nach ihrem Angreifer. Ihre Faust krachte gegen seine Brust und ließ ihn in die Angriffswelle der Soldaten fliegen, die auf sie zuliefen.
Sie griff über ihre Schulter und packte ihre Hellebarde, eine lange Streitaxt, die sie gern benutzte, weil der Kopf aus einer Axt, einem Speer und einer Stahlspitze bestand. Für sie waren das drei Waffen in einer.
Nachdem sie den ersten Mann, den sie sah, aufgespießt hatte, riss sie ihre Waffe zur Seite, schleuderte ihr Opfer von sich und bereitete sich auf den nächsten Angriff vor.
Ihre Gegner umzingelten sie und sie nahm sich einen kurzen Moment Zeit, um alle zu mustern. Sie duckte sich ein wenig tiefer, korrigierte ein klein wenig ihre Haltung … dann griff sie an.
Sie riss die Spitze ihrer Waffe über mehrere Kehlen, senkte sie, drehte sie leicht und stieß sie dann in die Höhlen, wo manche Fanatiker Augen hatten, aber sie drückte sie tief genug hinein, um Schädel und Hirn zu zerfetzen.
Die verbliebenen Soldaten rückten vor und sie zog ihre Waffe näher an sich, stellte die Beine weiter auseinander und verankerte das Ende des Schafts an der Innenseite ihres Schuhs. Dann drehte sie die Hellebarde, stieß den Kopf der Axt nach oben in die Lenden eines Soldaten und ließ seine Eingeweide sich auf den Boden entleeren. Sie zerrte die Waffe heraus und benutzte die Axt, um Beine an den Knien abzutrennen.
Sie spürte eine Brise, eine Veränderung der Energie um sie herum, und hob schnell den Schaft, während sie den Kopf senkte. Sie blockte den auf sie niedergehenden Schwertangriff ab und drehte ihre Hellebarde, um den Angreifer zu entwaffnen, bevor sie mit dem Ende des Schafts auf seinen Kopf einschlug und er das Bewusstsein verlor.
Dann schwang sie die Waffe seitlich nach oben und ließ sich von dem Schwung zu denen, sie sich hinter ihr befanden, schwenken.
Sie bewegte sich rechtzeitig, um einer Klinge auszuweichen, die auf ihren Kopf zielte, und stieß ihre Waffe in die Innenseite des Oberschenkels ihres Angreifers, durchdrang Fleisch und riss eine Arterie auf. Mit einem Ruck ihrer Hände hob sie die Waffe über ihren linken Unterarm, stach damit nach vorn und spießte den Mann neben sich auf, bevor er zuschlagen konnte. Dann tat sie das Gleiche in die andere Richtung und spießte einen Soldaten zu ihrer Rechten auf.
Sie blockte einen weiteren Angriff von vorn ab und schleuderte den Mann zu Boden, wo sie ihn mit einem Fuß auf der Kehle festhielt, während sie ihre Hellebarde benutzte, um sich der beiden letzten Männer zu entledigen, die sie angegriffen hatten. Sobald diese tot waren, spießte sie den Mann unter ihrem Fuß auf und gab noch zwei letzten Angreifern den Rest, die sich gerade von einem Schlag auf den Kopf erholt hatten.
Branwen die Schreckliche, Hauptmann der Ersten und Fünfzehnten Kompanie der Armeen der Drachenkönigin und Oberst des Achtundneunzigsten Regiments der Südlandarmeen, stieß den Atem aus, rammte das Ende ihrer Hellebarde in den blutgetränkten Boden und nahm sich einen Augenblick, um das Gemetzel zu betrachten, das sie auf diesem Berghang angerichtet hatte.
Ihre Truppen befanden sich unten im Tal und kämpften gegen die, die sie schlicht die Fanatiker nannten – die, die dem augenlosen Gott Chramnesind bis in den Tod treu ergeben waren.
Während sie dastand und sich umschaute, spürte sie instinktiv, dass sich ihr jemand von hinten näherte. Brannie drehte sich nur in der Hüfte, hob die Waffe und fuhr damit in den Kopf des blutüberströmten Priesters, der hinter ihr stand. Als ihre Waffe durch die Schädeldecke des Priesters drang, musste sie einen kleinen Sprung nach links machen, um dem Speer auszuweichen, der durch den Hinterkopf des Priesters kam und sie dabei beinahe mit aufspießte.
»Tut mir leid!«, rief Aidan der Göttliche. Der Golddrache zuckte leicht zusammen, als ihm klar wurde, wie nah er daran gewesen war, sie mit seinem Speer zu durchbohren. »Ich versuche nur zu helfen.«
Das sagte er immer. »Ich versuche nur zu helfen!« Er hätte sich diese Worte mit einem Brandeisen auf die verdammte Stirn schreiben lassen sollen.
»Ja, ich weiß«, antwortete Brannie. »Aber ich habe deine Hilfe gar nicht gebraucht.«
»Jeder braucht ab und zu ein wenig Hilfe.«
»Ich nicht.« Brannie riss ihre Waffe aus dem Kopf des Priesters und genoss insgeheim, wie das Blut über Aidans hübsches Gesicht spritzte und mitten hinein in die leuchtenden goldenen Augen.
Aidan sagte nichts, als er versuchte, sich das Blut wegzuwischen, aber dann schenkte er ihr wieder sein strahlendes Lächeln und zeigte Brannie seine aufreizenden Grübchen. Oder, wie ihr Onkel Addolgar sie nannte: Gesichtskuhlen.
Sie wandte sich ab, machte einen Schritt und hörte dann: »Willst du dich nicht bei mir bedanken?«
»Nein.«
»Nicht einmal mit einem Dankeschönkuss?«
Brannie drehte sich zu dem Golddrachen um. Wie sie hatte er seine menschliche Gestalt. Sein schulterlanges goldenes Haar fiel ihm in seine goldenen Augen und verdeckte beinahe die Sicht auf die markanten Wangenknochen. Brannie trat dicht vor ihn und hielt ihm die Faust unter die Nase. Sie schlug ihn nicht, sondern hielt nur ihre in einem Panzerhandschuh steckende Faust vor ihn hin und fragte: »Wie wäre es mit einem Dankeschönschlag ins Gesicht?«
»Ist das meine einzige Wahlmöglichkeit?«
Gegen ihren Willen kicherte sie. Bastard.
Branwen wusste nicht, wann es passiert war oder warum, aber irgendwie hatte sie sich mit Aidan dem Göttlichen angefreundet. Einem echten Edelmann vom Haus der Foulkes de chuid Fennah. Himmelweit entfernt von Brannies niederen Cadwaladr-Klan-Wurzeln. In den letzten langen Jahren, in denen sie gegen die Fanatiker gekämpft hatten, waren sie sich irgendwie nähergekommen, obwohl er im Gegensatz zu ihr aus einem adligen Ei geschlüpft war.
Noch mehr erstaunte sie, dass sie ihn trotz seiner Zugehörigkeit zu den Mí-runach mochte. Die Mí-runach, Drachen, die sich nur der Königin gegenüber loyal verhielten, waren nicht mehr als ein Killerkommando, das auf Befehl tötete.
Brannie konnte sich nicht den Luxus erlauben, umherzulaufen, wahllos zu töten und nur auf die Königin zu hören. Als Offizier und Drachin musste sie an alle möglichen Dinge denken, und das sowohl bevor ihre Truppen sich in die Schlacht stürzten als auch danach.
Sie respektierte die Mí-runach nicht, aber sie hatte – widerwillig – gelernt, Aidan den Göttlichen zu respektieren. Und im Laufe der Jahre hatten sie sich auf ihre eigene Weise angefreundet.
Nur deshalb verrieten der plötzliche Ausdruck auf Aidans Gesicht und seine in Panik geweiteten Augen ihr jetzt, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Sein Unterkiefer klappte herunter, als wollte er etwas sagen. All das konnte nur eines bedeuteten – Aidans idiotische Mitbrüder führten wieder irgendetwas im Schilde. Etwas, das sie zornig machen würde. Doch bevor Brannie herausfinden konnte, was das war, hörte sie ein unverkennbares Geräusch. Ein Geräusch, das sie besser nicht gehört hätte.
Mit offenem Mund wirbelte Brannie herum und funkelte den Drachentölpel böse an, der gerade ihr Pferd auffraß.
Brannie, deren menschlicher Körper zitterte, während sie mit den Zähnen knirschte, spürte, wie ihr selten losgelassener Zorn ausbrach.
»Was hast du getan?«, brüllte sie.
Caswyn der Schlächter schaute in seiner riesigen Drachengestalt auf sie herab, während er weiterkaute. Die vordere Hälfte ihres schönen, treuen Pferdes hing ihm aus dem Maul.
»Hä?«, murmelte er mit seiner Mahlzeit im Maul.
Brannies menschlichen Hände spannten sich um den Schaft ihrer Waffe. Sie hob die Hellebarde und ließ deren Ende auf den Boden krachen, sodass die Waffe zu ihrer vollen Größe wuchs, die sie brauchte, wenn Brannie ihre Drachengestalt hatte. Sie war im Moment so sauer, dass ihre menschliche Gestalt nicht einmal von der jetzt riesigen Waffe überfordert war. Sie drückte ohne Umschweife die Spitze ihrer Hellebarde auf die Hauptarterie am Hals des Drachen.
Caswyn hörte auf zu kauen und seine Augen weiteten sich. Die Vorderhufe ihres armen Pferdes hingen ihm noch immer aus der Schnauze und zuckten noch.
Sie zuckten noch!
Aber bevor sie dem Idioten ihre Waffe in den Hals rammen und ihn für einen solchen Affront töten konnte, sprang Aidan dazwischen, beschützte seinen idiotischen Freund und kam ihr in die Quere.
»Vielleicht sollten wir darüber nachdenken?«, schlug Aidan sanft vor, wie es seine Art war. Der einzige Mí-runach, den sie kannte, der versuchte, Vernunft einzusetzen statt brutaler Gewalt.
»Nein«, blaffte sie. »Geh zur Seite.«
»Du hast das nicht richtig durchdacht.«
»Geh mir aus dem Weg, bevor ich euch beide umbringe.«
»Er hat es nicht so gemeint.«
»Das ist mir egal! Ich werde mir seinen Kopf holen!«
»Das Pferd wäre sowieso gestorben«, murmelte Caswyn um die Hufe in seinem Maul herum.
»Es ist bloß ein verdammtes Pferd«, warf Uther ein, dessen blutige menschliche Gestalt sich ihr von der anderen Seite näherte.
Aber er blieb stehen, als sich die Spitze von Brannies Schwert gegen die Arterie in seinem Hals presste. Sie hatte es, ohne ein Geräusch zu machen und so schnell, dass die Männer keine Zeit hatten zu reagieren, aus der Scheide gezogen. Wie Branwen sehr gut wusste, war es ihre Schnelligkeit, die sie immer am Leben erhalten hatte.
Natürlich drohte ihr im Moment nicht wirklich Gefahr. Diese Drachen würden ihr, ganz gleich in welcher Gestalt, niemals Leid zufügen. Nicht weil sie auf derselben Seite kämpften. Nicht weil sie im Rang über ihnen stand, ganz gleich, welche Armee sie repräsentierte. Nicht einmal weil sie schneller war und eine bessere Kämpferin als jeder Einzelne von ihnen. Sondern weil sie das »Cousinchen« von Éibhear dem Verächtlichen war. Ihrem Waffenbruder. Als Bruderschaft der Mí-runach beschützten sie die Familien der anderen, so wie sie ihre eigenen beschützen würden. Daher wusste sie, dass keiner dieser Männer ihr auch nur ein Haar krümmen würde, was nur bedeutete, dass sie sie schnell töten und ihre blutenden Leichname den wilden Tieren dieser Berge überlassen konnte.
Es schien ihr fair zu sein für das, was Caswyn getan hatte, und dafür, dass Uther für den Idioten eintrat.
Natürlich wäre Éibhear nicht glücklich darüber, aber was erwartete er, wenn er seinen Mí-runach-Brüdern erlaubte, frei herumzulaufen und dumme, dumme Dinge zu tun?
»Könntet ihr beide mir einen Gefallen tun?«, fragte Aidan seine Freunde. »Und aufhören zu reden?«
Als keiner der Männer reagierte, wandte Aidan sich Brannie zu und öffnete den Mund, um zu sprechen … aber das Knirschen, das von Caswyn kam, während er langsam an den Hufen ihres geliebten Pferdes nagte, ließ ihn innehalten, und er senkte in stummer Niederlage den Kopf.
Talwyn, einzige Tochter von Fearghus dem Zerstörer und Annwyl der Blutrünstigen, versenkte ihre Axt in einer muskulösen Brust und zwang ihren Feind zu Boden. Sobald sie ihn dort hatte, riss sie ihre Waffe heraus und rammte dessen Schneide dem Mann in den Kopf, ohne die Blutspritzer zu beachten, die im nächsten Moment ihr Gesicht bedeckten.
Sie drehte sich um und schaute über die Schlacht, die um sie herum tobte, bis ihr Blick den ihres Zwillingsbruders fand.
»Was hast du gesagt?«
»Ich habe gesagt, hol Mum!«
»Warum bin ich für sie verantwortlich?«, wollte Talwyn wissen, bevor sie einem Mann, der neben ihr stand, das Bein abhackte.
»Sie ist unsere Mutter.«
»Warum machst du es dann nicht?«
Ihr Bruder, der voller Blut war, schaute von dem Leichnam auf, den er gerade wiederzuerwecken versuchte. »Ich bin beschäftigt.«
»Beschäftigt mit Versagen. Du kannst menschliche Tote nicht wiedererwecken. Akzeptier das doch endlich.«
»Es erfordert eben Übung!«
»Hey! Ihr zwei!« General Brastias – oder, wie Talwyn ihn zu nennen pflegte, als sie ein kleines Mädchen war, Onkel Bra-Bra – gab ihnen ein Zeichen. »Einer von euch zwei Idioten soll eure Mutter holen. Es gibt ihr niemand Rückendeckung!«
»Braucht sie denn Rückendeckung von irgendjemandem?«
Brastias packte einen der Feinde am Hals und beugte ihn nach vorn. Er versenkte sein Schwert in den ungeschützten Nacken des Mannes und tötete ihn auf der Stelle. Und nicht einmal dabei wandte er seinen missbilligenden Blick von Talwyn ab.
Immer sie! Warum nicht Talan? Wie kam es, dass es immer ihr zufiel, sich um ihre Mutter zu kümmern?
Sie schnitt einem weiteren Soldaten, der auf sie zukam, die Kehle durch und schaute schnell über die kämpfende Menge, versuchte, ihre ach so kostbare Mutter zu finden.
Man sollte denken, die Herrscherin der gesamten Südlandregionen könnte sich verdammt noch mal selbst helfen. Aber nach all diesen Jahren des Krieges war Talwyn irgendwie zur Aufseherin über all das geworden, was Königin Annwyl von der Insel Garbhán betraf. Oder, um sie bei dem Namen zu nennen, unter dem sie eher bekannt war, Annwyl die Blutrünstige, das verrückte Miststück der Südländer.
Talwyn nannte sie einfach nur Mum. Zumindest meistens.
Als Talwyn die Königin endlich entdeckte, sah sie, dass ihre Mutter tat, was sie immer noch am besten konnte. Alles in ihrer Nähe töten, was nicht ihre Fahne trug.
Die Königin ließ ein Schwert auf ihren Gegner niedersausen, spaltete ihn schräg von der Schulter durch den Oberkörper, bis er in zwei Hälften geteilt war. Sie drehte sich um und schlug erneut mit ihrem Schwert zu, hackte einen Kopf ab. Drehte sich abermals und schlug zu. Drehte sich und schlug zu. Wieder und wieder, während sie sich eine Schneise durch die kämpfenden Männer hieb.
Ihre Mutter war nicht wie die meisten Königinnen. Sie hatte es nicht nötig, in der Sicherheit ihrer Burg zu bleiben und sich von berittenen Boten Informationen überbringen zu lassen. Nein. Talwyns Mutter steckte immer bis zu den Knien in Dreck und Blut und Körperteilen. Sie hasste ihren Spitznamen, aber die Frau hatte ihn sich ehrlich verdient.
Talwyn grinste höhnisch. Worüber machten ihr Bruder und ihr Onkel sich eigentlich solche Sorgen? Wenn es ein Geschöpf auf dieser Welt gab, das allein zurechtkam, dann war es Annwyl die Blutrünstige.
Genau das wollte sie gerade den besorgten Männern erklären, als ihre Mutter sich plötzlich hoch aufrichtete und die Feinde zu ihren Füßen ignorierte, die darum flehten, dass sie ihnen den Garaus machte, damit sie als Märtyrer zu ihrem Gott gehen konnte.
Talwyns Mutter war normalerweise nur zu glücklich, ihren Feinden den Tod zu geben, und Talwyn konnte sich nicht erinnern, sie je mitten in einem Blutbad innehalten gesehen zu haben.
Also, was hielt sie jetzt auf?
Annwyl hob den Kopf und ließ den Blick über die vor ihr kämpfenden Soldaten wandern. Wonach suchte sie? Ein nächstes Opfer war es jedenfalls nicht. Die befanden sich ja überall um sie herum.
»Mum?«, rief Talwyn. »Mum!«
Entweder hörte ihre Mutter sie nicht oder sie ignorierte sie vollkommen, etwas, wofür sie bekannt war, wenn sie sich in den Fängen ihres Zorns befand. Aber wenn das geschah, drosch Annwyl die Blutrünstige gewöhnlich auf alles ein, das sich bewegte. Sie stand nicht einfach nur da und starrte.
Annwyl legte den Kopf schräg. Hörte sie etwas? Was konnte sie hören, das Talwyn nicht hörte?
»Talan«, rief sie ihrem Bruder zu. »Da stimmt was nicht.«
Talan ließ von seinem jetzt verwesenden Leichnam ab – waren sie erst einmal tot, schienen die Fanatiker schneller zu verfaulen als die meisten anderen Menschen, ein Ärgernis für die Königin, die es ausgesprochen genoss, die Köpfe ihrer Feinde auf ihre Burgmauern zu pflanzen – und trat neben seine Schwester.
»Was macht sie da?«, fragte er und benutzte Magie, um mit einer schnellen Drehung seiner Hände eine kleine Schar Fanatiker in die entgegengesetzte Richtung fliegen zu lassen.
»Ich habe keinen Schimmer.« Talwyn stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können.
Was Talwyn mehr beunruhigte als irgendetwas sonst, war, dass keiner der Fanatiker versuchte, ihre Mutter zu töten. Keiner griff an. Plötzlich war Annwyl die Blutrünstige für sie unsichtbar. Sie beachteten Talwyns Mutter plötzlich nicht mehr, obwohl sie die Frau war, deren Tod sie sich mehr wünschten als alles andere auf dieser Welt, weil sie hervorgebracht hatte, was sie die Gräuel nannten – insbesondere Talwyn und Talan.
»Wir sollten sie besser holen.«
Talwyn stimmte zu und folgte ihrem Bruder. Sie hielt nur ein- oder zweimal kurz inne, um mit ihrem Kurzschwert auf einige Angreifer einzuhauen. Aber als sie sich Annwyl näherten, zuckte der Kopf der Königin zur einen Seite … dann zur anderen. Wie der Kopf von Talwyns Hund. Beinahe hätte sie gelacht, doch da rannte ihre Mutter plötzlich los.
Talwyn und Talan stürmten hinter ihr her und machten sich nicht länger die Mühe, gegen die Soldaten zu kämpfen, die ihnen entgegenkamen. Sie stießen sie einfach beiseite und liefen weiter, versuchten, ihre flinkfüßige Mutter einzuholen.
Wenn es um irgendjemand anderen gegangen wäre, hätte Talwyn sich nicht solche Sorgen gemacht. Aber ihre Mutter war für ihre »Zornesanfälle« bekannt, wie ihr Vater es ausdrückte. Er versuchte aber einfach nur, nett zu sein. Wenn man sagte, ihre Mutter habe Zornesanfälle, könnte man genauso gut sagen, ein Taifun sei ein »kleiner Sturm«.
Die Zwillinge wussten außerdem, dass der Zorn ihrer Mutter von Frustration hervorgerufen werden konnte. Sie war davon ausgegangen, dass dieser Krieg längst vorbei wäre. Sie hatte mehr Legionen gehabt, mehr Proviant und mehr erfahrene Generäle und Soldaten als der Feind. Doch Talwyns Vater hatte versucht, sie zu warnen. Der Kampf gegen Fanatiker war anders als andere Kriege und sämtliche getreuen Truppen Salebiris waren Fanatiker. So loyal ihrem augenlosen Gott gegenüber, dass viele von ihnen sich während irgendeiner Zeremonie absichtlich die Augen hatten entfernen lassen. Doch selbst ohne Augen kämpften die Fanatiker immer noch erstaunlich gut und fügten Annwyls Truppen nachhaltigen Schaden zu.
Dann, im vergangenen Jahr, hatten die Fanatiker es mit einer neuen Taktik versucht: verbrannter Erde. Sie hatten Südlandterritorien zerstört, hatten Bauernhöfe niedergebrannt, Ortschaften und sogar Städte. Sie hatten noch mehr Schaden angerichtet als die Drachen, als diese vor mehreren Jahrhunderten einen umfassenden Krieg gegen die Menschen geführt hatten.
Anscheinend erzählten Salebiris Fanatiker den Menschen, deren Land und Leben sie zerstörten, dass sie sich keine Sorgen machen sollten: »Unser Gott wird euch alles ersetzen, was ihr verloren habt, sobald die Hure tot ist.« Wobei die Hure natürlich Annwyl war. Die Beschimpfung machte Annwyl nicht so viel aus wie das Leiden ihrer Untertanen. Das Wissen, dass sie ihr Heim und ihre Lebensgrundlage verloren hatten, bekümmerte die Königin mehr, als sie sagen konnte, aber trotzdem drängte sie weiter voran.
Annwyl kannte die Götter gut genug, um zu wissen, dass der augenlose Gott niemals Wort halten würde. Mit ihrem Land oder ohne, ihre Untertanen würden unter der Herrschaft Chramnesinds niemals sicher sein. Also kämpfte sie weiter.
Jetzt näherten sie sich der Stadt Levenez, dem Sitz der Macht Salebiris und seines Weibchens. Talwyn fragte sich immer noch, ob Herzog Roland Salebiri die wahre Identität seiner Gemahlin kannte. Er nannte sie Ageltrude, aber alle anderen kannten sie als Vateria Domitus. Sie war eine Cousine des Rebellenkönigs der Quintilianischen Provinzen und das meistgehasste Miststück der freien Welt.
Salebiri hatte mindestens einen Sohn von Vateria, was bedeutete, dass er seinen eigenen »Gräuel«-Sprössling hatte, ein Kind eines menschlichen Elternteils und eines Drachen. Aber trotz des Gelübdes des Herzogs, die Gräuel zu vernichten, lebte das Kind, soweit sie wussten, immer noch. Zumindest vorläufig. Wer wusste schon, was Annwyl tun würde, sobald sie die Stadt eingenommen hatten?
Dieser Tage fingen allerdings einige der Soldaten an zu sagen: »Falls wir die Stadt einnehmen.« Und ganz gleich, wie schnell Talwyn sie korrigierte … sie fing an, genau das Gleiche zu denken.
Andererseits hatte ihre Mutter vielleicht recht. Sie mussten diese Stadt einnehmen, um deren Schutz die Fanatiker so hart kämpften, dann Salebiri und Vateria töten … und das alles würde vielleicht ein Ende nehmen.
Talwyn und Talan hielten inne. Als sie ihre Mutter im Gedränge der Leiber kurz aus den Augen verloren, hatte Talwyn daran gedacht, mit ihren Gedanken nach ihrer Sippe in der Nähe zu rufen, aber vor fast einem Jahr hatten alle Drachen – sogar die Drachenkönigin – aufgehört, so zu kommunizieren. Sie hatten herausgefunden, dass die Priester der Fanatiker irgendwie gelauscht hatten, dass sie von Schlachtplänen und ihren Vorhaben erfahren hatten. Es war jedoch extrem nervig, mit der Sippe zu kommunizieren wie normale Menschen. Mit Pergament und Tinte und Boten.
Glücklicherweise entdeckte Talwyn ihre Mutter endlich … die in einen Brunnen starrte.
Talwyn schaute ihren Bruder an. »Was zum Schlachtenscheiß tut sie da?«
»Ich habe keine Ahnung. Aber wir sollten sie besser da wegholen.«
Sie trieben mühelos die wenigen Soldaten zurück, die angriffen, und waren nur noch ein Dutzend Schritte von ihrer Mutter entfernt, als Talwyn voller Entsetzen beobachtete, wie sich eine Klaue aus den Tiefen des Brunnens erhob, Annwyls Gesicht packte und sie zu sich hineinzerrte.
»Mum!«, schrien Talwyn und Talan gleichzeitig und stürzten zu ihr. Aber Sekunden, bevor Talwyn kopfüber in den Brunnen tauchen konnte, um ihrer Mutter zu folgen … waren sowohl der Brunnen als auch ihre Mutter verschwunden.
Aidan der Göttliche verbrachte den größten Teil seines Lebens damit, zu tun, was er in diesem Moment tat – seine Freunde vor dem sicheren Tod beschützen.
Nein. Nicht während der Schlachten. Sie waren mächtige Kämpfer und dort brauchten sie seine Hilfe nicht. Vielmehr schien es Aidans Job zu sein, seine Mitbrüder zu beschützen, wenn sie sich nicht in der Schlacht befanden. Wenn sie nicht vor dem Feind standen. Und wer hätte gedacht, dass eine solche Aufgabe so gottverdammt hart sein würde? Er drehte sich langsam zu Caswyn um und funkelte den Drachen böse an, während der Idiot weiter an den Hufen dieses verfluchten Pferdes nagte. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, während der sich die Spitze von Brannies Furcht einflößender Waffe gegen Caswyns Kehle drückte.
Allerdings hatte die Anspannung des Augenblicks, um ehrlich zu sein, wenig mit der Waffe zu tun und mehr mit der Drachin, die die Waffe schwang. Branwen die Schreckliche war dafür ausgebildet worden, jede Waffe zu benutzen, die Aidan kannte. Und sie benutzte sie nicht nur, sie beherrschte sie vollkommen. Schwerter, Äxte, Kriegshämmer, Speere, Piken, Bögen … die Liste war sehr lang.
Ihre Fähigkeiten hatten sogar ihre unbeeindruckbare Mutter beeindruckt, den großen Drachenarmeegeneral, Ghleanna die Dezimiererin.
Jetzt starrte Branwen die Schreckliche mit kaltem Blick zu Caswyn hoch, während er weiterkaute. Schwarzer Rauch kringelte sich aus Brannies menschlichen Nasenlöchern und Aidan befürchtete, dass er sich würde opfern müssen, um seine Freunde zu retten. Nicht dass er das wollte, aber es war vielleicht seine einzige Wahl …
Aidan wandte seinen Blick schließlich von dem unmittelbar bevorstehenden Tod vor ihm ab und richtete ihn auf den Boden. Dann hob er den Kopf und schaute über das Schlachtfeld.
Annwyl die Blutrünstige und Iseabail die Gefährliche hatten die Legionen unter ihrem direkten Kommando vereint, um es in den Territorien zwischen den Quintilianischen Provinzen und dem Annaigtal mit Herzog Salebiris Fanatikerarmee aufzunehmen. Und wenn man ihre zahlenmäßige Stärke bedachte, war es wenig überraschend, dass ihre Seite gewann. Stetig vorrückte. Mühelos an Boden gewann.
Aber von seinem Ausguck halb auf dem Berghang konnte Aidan erkennen, dass irgendetwas gerade schrecklich schieflief. Er konnte es hören.
»Brannie.«
»Vergiss es. Sie sind beide tot. Es ist das Mindeste, was mein Pferd verdient.«
»Nein, Brannie. Horch. Hörst du das?«
Sie hörte es und legte leicht den Kopf schräg. Ihre Blicke trafen sich und Brannie senkte sofort ihre Waffen.
Aidan, dem klar wurde, dass sie nicht viel Zeit hatten, hob an: »Wir sollten besser …«
Ein harter Ruck ging durch den Boden. Sie alle stolperten nach hinten und schlugen beinahe der Länge nach hin.
In diesem Moment war das Geräusch plötzlich deutlich zu hören. Es wurde über die Morgenluft herangetragen. Ein Lied. Ein Gebet. Nein. Aidan verstand schnell, was da nicht stimmte. Es war kein Gebet, sondern ein machtvoller Zauber.
Der Boden erzitterte abermals, aber diesmal war das Beben so stark, dass keiner von ihnen stehen blieb. Der Berg, auf dem sie standen, brach auseinander.
»Verwandelt euch!«, befahl Brannie, nur Sekunden, bevor sie unter der Erde verschwand. Der Rest von ihnen folgte ihr in die Schwärze.
Vollkommenes Entsetzen. Panik. Die Zwillinge liefen in das Hauptlager und suchten nach Hilfe. Die Königin war weg und wenn sie nicht Unterstützung von jemandem erhielt, der über ebenso mächtige Magie verfügte wie sie selbst, würde sie für immer fortbleiben.
Talan wusste, dass seine Schwester genau wie er selbst nicht die Möglichkeit in Erwägung zog, dass ihre Mutter bereits tot sein könnte. Sie war bereits einmal tot gewesen und sie hatten sie zurückgeholt. Also konnte eine simple Falle sie niemals töten.
Das glaubten sie. Das mussten sie glauben.
Und ausnahmsweise waren es nicht nur ihre selbstsüchtigen, königlichen Bedürfnisse, die ihre Mutter unverzichtbar machten. Das Volk der Südländer brauchte sie. Die Truppen brauchten sie. Legionen von Soldaten, die sich auf die verrückte Königin der Insel Garbhán verließen, damit sie sie in die Schlacht führte. Wenn sie bereit war, alles für ihr Volk und für ihr Land aufs Spiel zu setzen, dann waren sie ebenfalls bereit, dasselbe für Annwyl zu tun. Aber ohne Annwyl?
Natürlich würden die menschlichen Truppen immer noch kämpfen, aber würden sie bereit sein, alles zu geben? Talan wusste es nicht und er wollte jetzt auch nicht darüber nachdenken. In diesem Moment interessierten er und seine Schwester sich einzig dafür, Annwyl die Blutrünstige zurückzubekommen. Ganz gleich, wen sie dafür opfern mussten.
Als sie im Lager ankamen, gesellten sich Talwyns Streitross und ihr Schlachthund zu ihr. Sie hatte sie an diesem Morgen zurückgelassen, weil die roten Augen des Pferdes und die Hörner, die beide Tiere auf dem Kopf trugen, die menschlichen Soldaten beunruhigten. Die Tatsache, dass sie Geschenke der Kyvich waren – Kriegerhexen aus den Eisländern –, war bedeutungslos, wenn man einem rotäugigen Pferd dabei zusah, wie es Menschenfleisch fraß, nachdem es einen Soldaten in den Boden gestampft hatte.
Ohne ein Wort sagen zu müssen, steuerten die Zwillinge denselben Ort an. Das Zelt von General Iseabail der Gefährlichen. Sie würden dort beginnen, sich nach außen vorarbeiten und ihre Cousine Rhianwen und ihre Tante Morfyd mitnehmen. Starke Hexen, die ihnen helfen konnten …
Talwyn blieb als Erste stehen und Talan kam neben ihr zum Halten.
»Was?«
»Hörst du das nicht?«, fragte seine Schwester.
»Was soll ich hören?«
Dann hörte er es. Die sanften Klänge einer wunderschönen Stimme wehten durch die frische Morgenluft. Ein mächtiger, zu einem Gott gesungener Zauber. Talwyn ballte die Hände zu Fäusten und ihr Körper vibrierte auf der Stelle, auf der sie stand.
»Talwyn? Was ist das?«
Ein Kreischen explodierte aus Izzys Zelt und sie beobachteten, wie ihre Cousine Rhianwen, ein weiterer mächtiger Gräuel so wie die Zwillinge, herausgestolpert kam, die Hände über den Augen, durch deren Finger ihr Blut quoll.
Talan fing seine Cousine in den Armen auf.
»Mach, dass es aufhört!«, bettelte Rhian. »Mach, dass es aufhört!«
Talwyn drückte die Finger gegen die Stirn ihrer Cousine und Rhian wurde ohnmächtig. Gleichzeitig legte sich ein Schutzzauber um sie herum. Talan spürte, dass der Zauber Rhians Körper einhüllte wie ein dünnes, aus Eisen bestehendes Laken.
»Leg sie auf mein Pferd«, befahl Talwyn. Talan hob Rhian auf den Rücken des Tieres und ließ sie nach vorn sacken, sodass ihr Kopf sich an den Hals der Kreatur drückte.
»Beschütze sie, Aghi«, trug Talwyn ihrem Pferd auf.
»Dort«, sagte Talan und zeigte auf die Person, die den Zauber wirkte.
Eine schöne, augenlose Frau auf einem der hohen Hügel.
»Ich werde …«, hob Talwyn zu sprechen an, aber dann änderte sich alles. Der Boden unter ihren Füßen bewegte sich und brach auf, rüttelte sie durch und erschreckte die Soldaten in ihre Nähe.
Talan wusste in dem Moment, dass sie keine Zeit für ausgefeilte Pläne hatten. Sie mussten sich bewegen.
»Zieht euch zurück!«, brüllte Talwyn den Soldaten zu. »Zieht euch sofort zurück! Lauft!«
Die Zwillinge rannten auf den Hügel zu und schrien dabei den Soldaten zu, dass sie verschwinden sollten.
»Lauft! Schaut euch nicht um! Lauft einfach! Rennt!«
Glücklicherweise hatte ihre Mutter die Legionen dazu ausgebildet, Talans und Talwyns Befehlen zu gehorchen, als kämen sie direkt von Annwyl selbst.
Also rannten die Soldaten. Sie rannten, so schnell sie konnten. Viele schnappten sich auf ihrer Flucht die Zügel ihrer Pferde. Nur wenige waren bereit, ihr treues Ross zurückzulassen.
Als Talan an einer Bogenschützin vorbeilief, schnappte er sich den Bogen der Frau und riss den Köcher vom Rücken eines anderen Kämpfers. Als er nah genug dran war, kniete er sich hin, legte seinen Pfeil an und schoss.
Er zielte genau und der Pfeil flog mit großer Wucht und Schnelligkeit den Hügel hinauf und – zerbrach, bevor er die augenlose Priesterin der Fanatiker auch nur erreichte. Irgendetwas beschützte sie, so wie irgendetwas nun auch Rhian beschützte.
Doch schlimmer noch, die Frau war nicht allein. Es gab noch andere Priesterinnen auf anderen Hügeln. Sie sangen zusammen den Zauber, ihre schönen Stimmen vereinten sich.
Die Zwillinge schauten sich an und mit einem Nicken setzten sie sich in Bewegung.
Talwyn hockte sich hin und legte die Hände flach auf den Boden. Ein Zauber kam ihr über die Lippen, zu schnell, als dass Talan ihn verstanden hätte. Während seine Zwillingsschwester den Zauber sprach, entdeckte Talan zwei Ritter, die versuchten, ihre scheuenden Pferde zu besteigen. Die armen Tiere hatten Angst vor dem, was um sie herum geschah.
Talan lief zu den Soldaten, zog das Kurzschwert an seiner Seite und schnitt beiden Pferden die Kehle durch.
Die Pferde fielen sofort zu Boden und eins landete auf seinem Reiter.
»Was hast du getan?«, brüllte einer der Ritter.
Talan antwortete nicht. Stattdessen beobachtete er voller Entsetzen, wie in der Ferne zwei Berge zerbröselten wie winzige, von einem Kleinkind erbaute Erdhügel.
Er drehte sich dem Ritter zu. »Lauf!«, befahl er und ließ sich neben dem Kadaver auf die Knie fallen. Talan legte die Hände auf den Hals eines jeden Tieres, schloss die Augen und ließ das Dunkel, das unter dem Boden lag, in seinen Körper fließen, bis es seine Hände erreichte. Er ließ die Macht in die toten Pferde hineinströmen und binnen Sekunden sah er, wie sie auf die Hufe kamen. Ihre Augen waren jetzt blutrot und er konnte dort, wo er sie aufgeschlitzt hatte, das Innere ihrer Kehlen sehen.
Talan deutete auf die Priesterin und befahl den Pferden: »Tötet sie!«
Die toten Tiere rannten davon und Talan drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um zu sehen, wie die Macht des Zaubers seiner Schwester sich über dem Boden ausbreitete, den Hügel hinauf unter den Schutz der Priesterin drang und aus der grünen Erde herausfuhr.
Talans tote Pferde hatten es ebenfalls auf den Hügel geschafft. Die Magie, die die Priesterin schützte, war außerstande, die lebenden Toten aufzuhalten, als Schlingpflanzen und Äste aus dem Boden brachen und sich um die Beine der Priesterin schlangen.
Ihre Stimme brach abrupt ab, als die Schlingpflanzen sich um sie wanden, von den Zehen bis zu ihrem blinden Gesicht. Sie versuchte, dagegen anzukämpfen, und sang von Neuem. Aber die Schlingpflanzen zogen sie unerbittlich herunter, herunter in das Dunkel, während Talans tote Pferde sie mit ihren Hufen attackierten und auf ihren Kopf und ihre Schultern eintraten.
Die Zwillinge wandten sich von ihr ab, aber sie wussten, dass ihre Arbeit noch nicht getan war. Es gab jetzt mindestens fünf blinde Priesterinnen, die ihren Zauber sangen. Und immer mehr Berge fielen in sich zusammen. Berge, die schon vor den Drachen da gewesen waren.
Talwyn und ihr Bruder sahen sich an. Wieder fiel kein Wort zwischen ihnen. Sie wussten bereits, was geschehen musste. Die Truppen ihrer Mutter mussten gerettet werden. Alle mussten auf sichereren Boden gebracht werden. Rhian musste zurückgeholt und geheilt werden.
Also … was war mit ihrer Mutter?
Sie entfernten sich voneinander und keiner von ihnen war bereit, darüber zu reden. Sie wussten einfach, was sie zu tun hatten. Was Annwyl die Blutrünstige von ihnen erwarten würde. Sie mussten die Königin – falls sie noch lebte – allein lassen und sie ihre eigenen, schrecklichen Schlachten ausfechten lassen.
2 Annwyl wachte immer mal wieder kurz auf. Wurde ohnmächtig. Wachte auf. Wurde ohnmächtig. Wieder und wieder. Wenn sie wach war, wusste sie, dass sie gerade fortgeschleift wurde. Aber wohin oder warum wusste sie nicht.
Der Sturz hatte sie nicht getötet, aber sie fragte sich, warum nicht. Denn es kam ihr vor, als sei sie stundenlang gefallen. Tagelang. Als würde sie niemals aufhören zu fallen.
Aber schließlich war sie gelandet und hatte das Bewusstsein verloren. Wann immer sie kurz zu sich kam, begriff sie, dass sie fortgeschleift wurde. Von etwas, das abscheulich roch.
Endlich wachte sie auf und es gelang ihr, wach zu bleiben. Sie bemerkte schnell, dass sie sich in irgendeiner Art von Verlies oder Gefängnis befand. Irgendetwas hielt ihren rechten Fuß fest und zerrte sie immer noch über den Boden, ohne sich zu bemühen, unterwegs irgendwelchen Höckern oder Löchern auszuweichen.
Sie hob den Kopf, um einen Blick auf ihren Peiniger werfen zu können, und sah … einen Schwanz. Einen Schwanz mit grünen Schuppen und einem stachelbewehrten Ende.
Annwyl richtete sich noch ein wenig mehr auf und begriff, dass sie, jawohl, von einer Laufechse durch ein Verlies geschleift wurde. Einer großen Laufechse.
Bevor sie das wirklich analysieren konnte, blieb die Echse vor Metallgitterstäben stehen. Sie öffnete die Tür, die in der Mitte der Gitterstäbe eingelassen war, und warf Annwyl am Bein hinein. Sie flog quer durch den Raum und knallte gegen die gegenüberliegende Wand.
Es gelang ihr, ihren Kopf vor dem Aufprall zu schützen, aber als sie auf dem Boden aufschlug, entwich ihr sämtliche Luft aus den Lungen.
Sie brauchte ein wenig, um wieder zur Besinnung zu kommen, und dann war die Tür ihrer Zelle auch schon zugeschlagen und abgeschlossen worden. Sie mühte sich hoch, bis sie auf dem Hintern saß und die Kreaturen betrachten konnte, die sie durch die Gitterstäbe anstarrten.
Es waren jetzt fünf von ihnen. Alles Laufechsen. Doch sie hatten etwas Menschliches an sich. Zum Beispiel durch die Tatsache, dass sie alle Lederkilts trugen, um ihre Lenden zu verbergen, und mehrere von ihnen schmückten sich mit Ohrringen und dekorativen Halsketten.
Sie unterhielten sich mit leisen, kehligen Lauten, die Blicke aus ihren leuchtend gelben Augen auf sie gerichtet.
Annwyl beschloss, zu versuchen, mit ihnen zu sprechen.
»Wo bin ich? Und wer seid ihr?«
Einer von ihnen bellte sie an – buchstäblich – und sie wusste, dass er ihr befahl, den Mund zu halten, obwohl sie kein Wort verstanden hatte.
»Dann verpisst euch!«, blaffte Annwyl zurück.
Eine Echse mit einer Kette, die aus tierischen Fängen und Menschenzähnen gemacht war, trat vor und öffnete das Maul.
Eine gegabelte Zunge wie die einer Schlange schoss hervor. Aber anders als eine Schlangenzunge reichte diese durch den ganzen Raum und schnippte über eine nackte Stelle an Annwyls Ellbogen.
Der sengende Schmerz ließ sie aufschreien und sie hielt sich mit der anderen Hand ihren verletzten Ellbogen.
»Bastard!«
Er schnippte wieder mit der Zunge nach ihr.
»Au! Lass das!«
Die anderen Echsenmänner lachten, als ihr Freund es abermals tat – also packte Annwyl seine Zunge mit beiden Händen und ignorierte den brennenden Schmerz in ihren Fingern und Handflächen.
Und sie zog.
Die Augen in Panik geweitet, schlug der Echsenmann mit seinen krallenbewehrten Händen nach seinen Freunden. Mehrere Echsen packten ihn und hielten ihn von den Gitterstäben fern, während die anderen seine Zunge ergriffen und versuchten, sie zurückzubekommen. Einer oder zwei benutzten sogar die eigenen Zungen, um sie ins Gesicht und an den Hals zu schlagen, in dem Bemühen, sie dazu zu bringen, loszulassen.
Doch jetzt war Annwyl zornig. Sie empfand nicht wirklich Schmerz, wenn sie zornig war. Also hielt sie fest und zog weiter.
Mit vereinten Kräften zerrten die Echsenmänner Annwyl an der Zunge ihres bedauernswerten Freundes über den Boden der Zelle. Aber als Annwyl sich der Tür näherte, hob sie die Beine in die Höhe und drückte die Füße gegen die metallenen Gitterstäbe. Solchermaßen gesichert, schlang sie sich die Zunge der Eidechse wie ein langes Seil um den Arm. Sie wickelte und wickelte, bis die Echse von der anderen Seite gegen die Gitterstäbe gepresst war.
Die anderen Echsenmänner knurrten und bellten und bleckten die Zähne, während sie Annwyl ansahen. Annwyl verstand ihre Worte zwar immer noch nicht, aber sie spürte, dass die Echsen ihr befahlen, ihren Freund loszulassen.
Das tat sie nicht.
Stattdessen ließ Annwyl die Beine auf den Boden fallen, machte einen einzigen großen Schritt nach hinten, drehte sich um und zog. Sie stieß einen triumphierenden Schrei aus, als sie wusste, dass sie dem Bastard die Zunge aus der Schnauze gerissen hatte.
Langsam wandte sie sich ihren schockierten Peinigern zu und erklärte ihnen: »Ich. Sagte. Lasst. Das.« Sie warf die irrsinnig lange Zunge in eine Ecke auf der anderen Seite des Raums. »Jetzt wisst ihr, dass ich es ernst meine.«
Der zungenlose Echsenmann, aus dessen Schnauze Blut lief, packte die Gitterstäbe der Zellentür. Annwyl erwartete ihn bereits auf der anderen Seite.
Während sie schrie und er brüllte, griffen sie durch die Gitterstäbe und schlugen aufeinander ein, bis die Freunde des Eidechsenmanns ihn von der Zelle wegzerrten.
Annwyl, die immer noch in ihrem Zorn gefangen war, schrie weiter und streckte die Hände durch die Gitterstäbe nach ihrer Beute aus. Sie war so in dem versunken, was sie tat, dass sie keine Ahnung hatte, wie lange sie so weitermachte, und auch nicht wusste, wie lange die Echsenmänner schon fort waren.
Doch schließlich fiel ihr Zorn von ihr ab. Das war der Moment, in dem sie brüllte: »Und wenn ich nichts zu essen bekomme, esse ich seine Zunge!«
Niemand antwortete, daher ließ sie die Gitterstäbe los und fiel auf den Boden. Ihr war nicht einmal klar gewesen, dass sie sich einen guten Meter oder sogar einen Meter zwanzig über dem Boden befunden hatte, aber so war es nun mal, wenn ihr Zorn die Oberhand gewann. Es war nicht ihre Schuld. Es war die Schuld der Echsen, die sie so zornig gemacht hatten.
Für das Ganze hier übernahm sie keinerlei Verantwortung. So wie immer.
Sie stieß den Atem aus, stemmte die Hände in die Hüften und schaute sich schnell in ihrer Zelle um, um festzustellen, ob es einen Weg gab, hier herauszukommen. In dem Moment erst bemerkte sie die eingesperrten Männer in den Zellen ihr gegenüber.
Stumm und mit offenem Mund gafften sie sie an.
Annwyl zuckte die Achseln. »Was ist?«, bellte sie und alle Männer wandten sich schnell ab oder verschwanden in der Dunkelheit hinten in ihren Zellen.
»Ja, genau«, murmelte sie. Sie war immer noch sauer und ihr Zorn pulsierte immer noch in ihren Adern. »Das dachte ich mir.«
3 Branwen schob die Klauen durch Erde, Bäume und Gestein, bis sie endlich die Wärme der beiden Sonnen auf ihren Schuppen spürte.
In dem verzweifelten Wunsch, sich zu befreien, kämpfte sie sich weiter nach oben vor. Sie war nicht bereit, aufzugeben. Immerhin war sie eine Cadwaladr, rief sie sich immer wieder ins Gedächtnis. Wir geben niemals auf!
Also kämpfte sie weiter, bis ihre Vorderbeine und ihr Kopf aus dem Schutt auftauchten. Sie klammerte sich an alles, woran sie sich festhalten konnte, und ihre Klauen tasteten umher. Dann schüttelte sie den Kopf und versuchte, den Dreck aus den Augen zu bekommen.
Sie fand etwas Stabiles und benutzte es, um sich daran herauszuziehen.
Sobald sie frei war, senkte Brannie den Kopf auf den Vorderfuß und sog in tiefen Zügen die herrliche Luft ein.
Es gab nicht viel, was ihr Angst machte. Nicht einmal der Tod. Aber lebendig begraben zu sein? Die Folter des dunklen Erstickens vor dem Tod? Davor hatte sie ganz offiziell schreckliche Angst.
Etwas packte Brannie am Vorderfuß und sie fuhr zurück. Doch dann sah sie im Licht der beiden Sonnen Gold glitzern.
»Aidan«, stieß sie hervor und ihr wurde schnell bewusst, dass sie ihn total vergessen hatte.
Sie ergriff seine Klaue mit ihrer eigenen, sodass er wusste, dass er nicht allein war. Dass jemand für ihn da war. Dann zog sie sich ganz aus dem Dreck. Doch diesmal hielt sie nicht inne, um die frische Luft zu würdigen. Stattdessen begann sie zu graben. Sie benutzte ihre Klauen und die Spitze ihres Schwanzes und grub sich in die Tiefe, bis sie den oberen Teil von Aidans Kopf sah.
Sie grub weiter, bis sie seine Schultern zu fassen bekam. Dann zog sie ihn hoch, während Aidan sein Bestes gab, um von allein herauszukommen. Wahrscheinlich war er genauso in Panik, wie sie es gewesen war, als sie begriffen hatte, wie leicht sie hier hätte sterben können.
Aidan packte mit seinen Klauen ihre Vorderbeine und hielt sich an ihr fest, während Brannie mit zusammengebissenen Reißzähnen zerrte.
Sie zog ihn zur Hälfte heraus, bis sie beide heftig keuchend auf den Boden fielen.
»Götter«, stieß er hervor. »Ich danke dir.«
»Ich konnte dich ja nicht dortlassen.«
Er schüttelte den Kopf und Erde flog aus seinen goldenen Haaren. Dann erstarrte er abrupt.
»Caswyn und Uther.«
Gemeinsam huschten sie zu dem hinüber, was von dem Berg noch übrig war, und gruben sich durch zerborstene uralte Bäume, Felsbrocken und alles andere, das ihnen im Weg war, auf der verzweifelten Suche nach Spuren von Aidans beiden Mí-runach-Brüdern.
Brannie dachte gerade, dass sie mit den Klauenspitzen etwas spürte, als sie das Rascheln von Bäumen in der Nähe hörte.
Sie stand auf, drehte sich um und begriff schnell, dass sie keine ihrer Waffen mehr hatte.
Eine kleine Truppe von Männern kam aus dem Wald. Späher. Fanatiker.
»Aidan«, sagte sie leise.
Er wollte nach seinen Freunden suchen und hatte keine Zeit, mit diesen Männern zu verhandeln, die so willig für ihren einen Gott starben. Einige von ihnen waren im Namen ihres Gottes verstümmelt worden, sodass ihnen ein Auge oder sogar beide fehlten.
Mit einem schnellen Einatmen entfesselte Aidan seine Flamme. Aber als das Feuer sich gelegt hatte, standen die Männer immer noch dort. Lebendig und wohlauf und nicht zu Asche verwandelt.
Der an der Spitze – ihm fehlte nur ein Auge – hob die Hand und schaute gen Himmel. »Danke, mächtiger Chramnesind!« Er lachte hysterisch. »Ihr könnt uns nichts anhaben, Drachen! Unser Gott hat uns seinen Schutz gewährt. Euer Feuer bedeutet gar nichts für uns!«
Das Land erzitterte und die Bäume schwankten, als ein zerschundener, humpelnder Uther sich seinen Weg auf die Lichtung bahnte. Er hielt ein verletztes Vorderbein mit der Klaue des anderen fest und sein armes Hinterbein schleifte nutzlos hinter ihm her. Eine Seite seines Gesichts und seiner Schnauze waren blutverschmiert und sein linkes Auge war so geschwollen, dass es sich nicht mehr öffnen ließ. Aber er lebte.
»Noch einer!«, jubilierte der Fanatiker. »Es spielt keine Rolle! In ebendiesem Moment ist unsere Legion schon ganz nahe und marschiert auf diese Lichtung zu. Sie werden euch alle vernichten und eure schwache Flamme wird uns nichts anhaben! Denn wir sind die Mächtigen und kämpfen für den einen, wahren …«
Das Schwadronieren des Fanatikers endete, als Aidan seine schwarze Klaue in die Gruppe der Späher krachen ließ. Seine Flamme mochte nicht wirksam sein, aber er war immer noch ein Drache.
Die wenigen, die nicht sofort von Aidans Klaue zerquetscht worden waren, versuchten zu entkommen, aber Brannie schlug nach ihnen und ließ sie gegen die nahen Bäume krachen. Ihre Hinterköpfe zerplatzten beim Aufprall gegen die harten Stämme.
»Menschen«, murmelte Aidan voller Abscheu, während er sich Blut von der Fußsohle kratzte.
»Aber sie hatten recht«, warf Uther ein. »Nur Minuten von hier entfernt nähern sich mindestens zwei Legionen und sie haben Belagerungswaffen.«
Belagerungswaffen, mit denen sie Drachen mühelos erledigen konnten.
»Es sieht so aus, als würden wir heute doch noch auf dem Schlachtfeld sterben, meine Freunde«, verkündete Uther mit großem Stolz.
Brannie, die nicht in der Stimmung für solche lächerlichen Gefühle war, schaute zu Aidan hinüber, damit er ihre Augen deutlich sehen konnte, bevor sie sich darauf konzentrierte, den verschütteten Caswyn zu finden, der immer noch unter dem Schutt des Bergs begraben war.
Aidan, der den Ausdruck auf Brannies Gesicht richtig deutete, sammelte schnell die Überreste der gefallenen Fanatiker auf und warf sie in eine Richtung weg von den Legionen, die auf sie zukamen. Dann kümmerte er sich um Uther, wohl wissend, dass Brannie keine Geduld mit Uthers Verlangen hatte, »ehrenvoll zu sterben«.
»Nein, Uther«, sagte Aidan und schlug einen strengen Tonfall an. »Wir werden heute nicht sterben.«
»Wir haben keine Wahl.« Uther streckte eine Hand aus. »Sie sind gleich da drüben. Kommen aus dem Wald. Sie werden hier sein in …«
»Schlag es dir aus dem Kopf, Idiot. Wir haben nicht das alles hier überlebt, damit wir fünf Minuten später unter den Händen von Fanatikern sterben. Also reiß dich zusammen und verwandle dich in einen Menschen!«
»Aber …«
»Sofort! Oder ich schwöre bei allem, das unheilig ist …«
»Ich habe ihn!«, jubelte Brannie und Aidan eilte an ihre Seite. Er hockte sich hin und sah den oberen Teil von Caswyns Kopf. Sie gruben mit den Klauen tief in die Erde hinein und zusammen zogen sie Aidans bewusstlosen – aber atmenden! – Freund aus dem, was beinahe sein vorzeitiges Grab geworden wäre.
Sobald sie ihn befreit hatten, legten sie ihn auf den Boden und Aidan schlug ihn sachte auf beide Wangen, in dem Bemühen, Caswyn zu wecken.
»Beeil dich«, drängte Brannie, während sie in ihre Menschengestalt wechselte und einem sich mühsam bewegenden Uther half, sich tief in den Schatten der Bäume zu verstecken.
»Ich versuche es ja.« Wieder schlug Aidan Caswyn sanft ins Gesicht. Als das nicht wirkte, versetzte er ihm einen heftigen Boxhieb, so wie er es oft tat, wenn sein Freund betrunken war.
Caswyn öffnete kaum merklich die Augen.
»Kannst du Menschengestalt annehmen, Bruder?«
Außerstande zu sprechen, schloss Caswyn die Augen, und einen Moment später umringten ihn schwache Flammen. Es dauerte länger als gewöhnlich, aber mit einiger Mühe gelang es Caswyn, in seine menschliche Gestalt zu wechseln.
Aidan, der ein Drache blieb – und betete, dass keiner der Fanatiker ihn sah, als sie einen Hügel in der Nähe überwanden –, trug seinen Freund zum Waldrand und verwandelte sich, sobald sie dort waren, ebenfalls in einen Menschen.
Er hievte sich Caswyn auf die Schultern und lief hinter Brannie her in den Wald. Schließlich fand er sie und Uther in Sicherheit an einem riesigen Felsbrocken. Dort legte er Caswyn neben Uther.
»Sorg dafür, dass er still ist«, bat er Uther, da Caswyn für gelegentliche Albträume bekannt war, wenn er betrunken das Bewusstsein verlor. Es hatte keinen Sinn zu glauben, es würde jetzt anders sein, nur weil er aus einem anderen Grund als Alkohol ohnmächtig war.
Aidan schlich sich neben Branwen und ging in die Hocke. Gemeinsam spähten sie um den Felsbrocken herum, als die Legionen der Fanatiker in Sicht kamen. Sie marschierten auf die Lichtung, nicht weit entfernt von der Stelle, an der Aidan und Brannie sich versteckten.
Während sie marschierten, sangen mehrere der Soldaten, die meisten vollkommen blind, Lobpreisungen für ihren augenlosen Gott. Sie alle wirkten glücklich, aber Aidan verstand nicht, wie irgendjemand glücklich sein konnte, der auf diese Weise lebte.
Nicht weil sie blind waren, denn Blindheit konnte jedem widerfahren, und mehrere der Mí-runach hatten ihren legendären Status erlangt, weil sie ohne die Gabe des Sehens weiter für ihre Königin gekämpft hatten. Sie lernten lediglich, sich auf ihre anderen Sinne zu verlassen. Es war, wie einer von Aidans frühen Lehrern zu ihm gesagt hatte, »nur dann eine Tragödie, wenn man eine daraus machte«.
Also, nein. Es war nicht die Blindheit. Es war die Vorstellung, die eigene Seele einem Wesen zu schenken, das sich nur von Hass und blindem religiösen Eifer speiste. Aidans Meinung nach war das Leben viel zu kurz, um so ein gottverdammt elendes Leben zu führen.
Aber die Fanatiker suhlten sich wohlgemut in ihrem Hass und sangen Lieder über die Zerstörung von Wesen, die kein Mitspracherecht dabei gehabt hatten, in dieses Universum gesetzt zu werden. Die Gräuel.
Lieber ein Gräuel, dachte Aidan, als eine Fanatikermarionette für einen unwürdigen Gott, der in einem Sumpf aus Scheiße, Dreck und Zorn steckt.
Sobald das erste Regiment es auf die andere Seite der Lichtung geschafft hatte, fingen die Soldaten an, ihr Lager einzurichten.
»Wir müssen hier raus«, flüsterte Branwen. »Ich kümmere mich um Caswyn.«
»Er ist immer noch bewusstlos. Ich sollte ihn nehmen.«
»Dich brauche ich, um Uther ruhig zu halten, bis wir weit genug weg sind. Wenn ich bei Uther bleibe, werde ich ihm noch den Tod schenken, auf den er so wild ist.«
Sie hatte natürlich recht. Ein verletzter Mí-runach konnte gefährlich sein, weil die Mí-runach mehr als bereit waren, sich für andere zu opfern. Das war für sich genommen schön und gut, aber sie taten dergleichen selten leise. Und Verstohlenheit war der einzige Vorteil, den ihre kleine, waffenlose Gruppe im Moment besaß.
Brannie stellte sich neben Caswyn und hob den Drachen in Menschengestalt mit verblüffender Mühelosigkeit auf ihre Schultern. Aidan wusste aus weitreichender Erfahrung, dass Caswyn selbst in seiner menschlichen Gestalt nicht leicht zu tragen war, aber Brannie ließ es so erscheinen, als koste es sie nicht die geringste Anstrengung. Vielleicht stimmte das ja auch. Aidan hatte den großen General Ghleanna zwei Drachen gleichzeitig von einem Schlachtfeld tragen sehen und sie hatte nicht einmal den Eindruck erweckt, als sei sie außer Atem. Warum sollte es bei Ghleannas Tochter anders sein?
Sobald Aidan an Uthers Seite trat, begann der Drache darüber zu debattieren, dass er keine Hilfe brauche. Aidan schlug seinem Freund schnell eine Hand vor den Mund. Uthers Stimme war dafür bekannt, dass sie weit trug, wenn er betrunken oder schwer verletzt war.
»Tu mir einen Gefallen, alter Freund«, flüsterte Aidan. »Halt den Mund.«
Uther begann, hinter Aidans Hand zu protestieren.
»Wenn du nicht willst, dass Brannie die Schreckliche zurückkommt und dir persönlich den Garaus macht, wirst du jetzt aufhören zu reden und tun, was ich sage.«
Das eine Auge, das nicht zugeschwollen war, weitete sich. Eingeschläfert zu werden wie ein altes Pferd hatte für Uther keinen Reiz, daher legte er Aidan den Arm über die Schultern, und gemeinsam folgten sie stumm den anderen.
Morfyd die Weiße zwang die blutigen Hände ihrer Nichte von ihrem blutüberströmten Gesicht herunter.
»Lass mich mal sehen, Rhian«, bettelte sie.
»Es tut weh«, flüsterte Rhian.
»Ich weiß, Liebes. Ich weiß«, murmelte Morfyd besänftigend. Sie drückte die Hände ihrer Nichte auf ihren Schoß und wusch sanft das Blut von Rhians Augen, während überall um sie herum Chaos herrschte.
Uralte Berge waren an diesem Tag in sich zusammengefallen, das Land geborsten. Das alles nur, weil jemand Fanatikern Zauber beigebracht hatte, so alt und mächtig, dass ihre Benutzer nicht einmal begriffen, dass die Macht dieser Zauber, selbst wenn die Zwillinge sie nicht zerstört hätten, sie vollkommen entkräfteten. Und nichts zurückließen als ausgebrannte, leere Hüllen.
Natürlich hatten die Zwillinge das nicht zugelassen. Sie hatten Talwyns Macht über die Natur mit Talans Herrschaft über den Tod kombiniert – selbst wenn Talan noch keine Macht über den Tod eines Menschen besaß – und eine gewaltige Streitmacht geschaffen. Der Schaden, den sie angerichtet hatten, wäre noch verheerender gewesen, wäre Rhian bei ihnen gewesen. Aber Rhian war von dem Zauber der Fanatiker verletzt worden und Morfyd versuchte immer noch, herauszufinden, wie sehr.