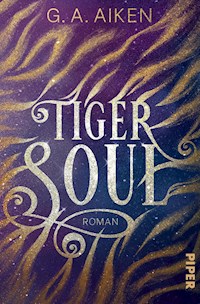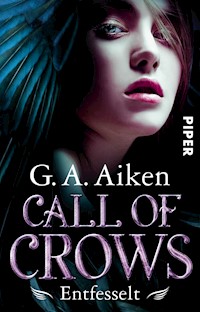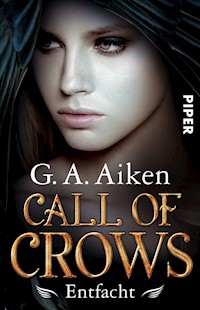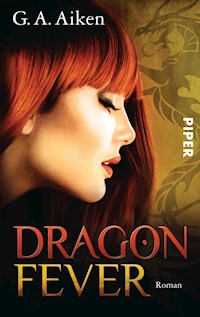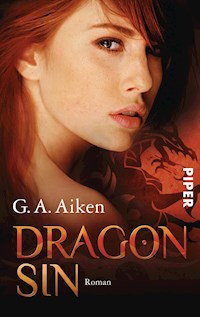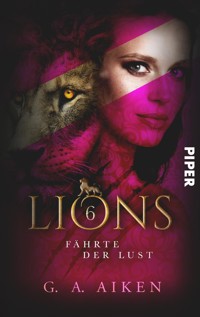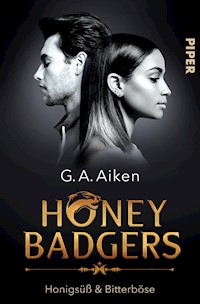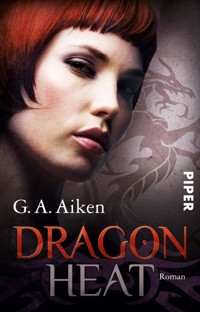9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin G. A. Aiken entfesselt erneut pure Magie und knisternde Gefühle – für Fans von Gestaltwandlern und der »Dragons«-Romane Wer Fantasy-Bücher mit prickelnder Romantik liebt, kommt an G. A. Aiken nicht vorbei. Ihre »Blacksmith Queen«-Reihe ist der ideale Einstieg in eine magische Welt aus Gefahren und Gefühlen. Eine alte Prophezeiung, eine Königin, die niemand kommen sah, ein Krieg und jede Menge Stoff für einen beschleunigten Puls: Mit »Blacksmith Queen« spinnt G. A. Aiken ihre Erfolgsgeschichte fort und zieht ihre LeserInnen in ein neues großes Abenteuer aus dem »Dragons«-Universum, in der nicht nur Gestaltwandler, sondern auch starke Frauenfiguren ihren großen Auftritt haben. Schmiedin Keeley Smythe muss ihre Kraft und ihr Geschick in völlig neue Bahnen lenken. Der König ist gestorben, doch nicht seine Söhne, sondern eine Königin soll den Thron besteigen. Ausgerechnet Keeleys Schwester Beatrix erfüllt diese uralte Prophezeiung. Im Krieg um die Thronfolge muss Keeley nicht nur ihre Familie beschützen, sondern auch ihr Herz. Denn an der Seite des Zentauren-Gestaltwandlers Caid erwachen in ihr Gefühle, die sie treffen wie ein Hammer den Amboss. Fantasy mit unbändigem Feuer – Buchserien zum Schmökern »Blacksmith Queen« ist der ideale Einstieg in G. A. Aikens fantastische Liebesromane um Shapeshifter und die Magie der Anziehungskraft. Lust auf mehr? Die »Honey Badgers«-Reihe wird Sie ebenso begeistern wie die Bestseller der »Dragons«-Serie. »Langweilig wird es mit ›Blacksmith Queen‹ auf keiner Seite. Heiße Spannung für den Sommer, lohnt sich definitiv für alle Fans dieses Genres.« – Sonic Seducer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy.www.Piper-Fantasy.de
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Michaela Link
Deutsche Erstausgabe© G.A. Aiken 2019Published in Arrangement with G.A. AikenTitel der amerikanischen Originalausgabe: »The Blacksmith Queen« bei Kensington Publishing Corp., New York, 2019© Piper Verlag GmbH, München, 2020Covergestaltung: Guter Punkt, MünchenCoverabbildung: Guter Punkt unter Verwendung von Motiven von Getty Images und Adobe Stock
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für all die wunderschönen und bewundernswerten Pferde im Los Angeles Equestrian Center, die ich kennenlernen, streicheln und an die ich meine Nase drücken durfte. Ihr alle habt mir so viel für meine Arbeit gegeben, ebenso wie die Besitzer und die Trainer, mit denen zu plaudern ich das Glück hatte. Danke euch allen.
Prolog
Der große König hatte kaum seinen letzten Atemzug getan, da schlug ein Bruder dem anderen den Kopf ab.
Es ging so schnell, dass ich, der Hüter Seines Wortes, keine Chance hatte zu fliehen. Ich versuchte wegzulaufen, doch die Flure der Burg füllten sich schnell mit kämpfenden Männern und sterbenden Frauen und Kindern. Am Ende versteckte ich mich überall dort, wo sich mir die Möglichkeit bot, doch ich musste stets in Bewegung bleiben, um nicht mein Leben zu verlieren.
Ich hörte die Schreie der Sterbenden, doch ich war nicht mutig genug, um einzugreifen. Um zu helfen. Denn ich wusste bereits zu viel. Seine Majestät hatte mich vor vielen Jahren genau hiervor gewarnt.
»Wenn ich sterbe«, hatte der König gesagt und mich von seinem Thron aus angesehen, »werden meine Söhne alles in Stücke reißen. Sie werden bei ihrem Versuch, meinen Platz einzunehmen, alles zerstören, was ich aufgebaut habe. Keiner von ihnen wird jedoch des Thrones würdig sein. Kein Einziger.«
Ich wusste nicht, ob das stimmte, denn wer war ich schon? Nur der Hüter Seines Wortes. Ich wusste nicht, ob irgendeiner von ihnen würdig war oder ob sie alle würdig waren. Es war nicht meine Aufgabe, so etwas zu entscheiden.
Ich hatte allerdings keine Ahnung gehabt, dass es sich so zutragen würde. So … schnell.
Die jüngsten Knaben wurden sofort von ihren älteren Geschwistern getötet. In ihren Betten niedergemetzelt, zusammen mit ihren Müttern, die sie zu beschützen versuchten. Es gab keine Gnade für sie.
Die älteren Söhne kämpften gegeneinander, doch nicht alle waren echte Krieger. Die Schwächsten fanden ein schnelles Ende. Alle, die kämpfen konnten, taten ihr Bestes, aber zum Schluss blieben nur fünf Prinzen übrig: Marius der Hasserfüllte, der älteste und am meisten gefürchtete Sohn des Alten Königs; Straton der Verschlinger; Cyrus der Verehrte sowie die Zwillinge – Theodorus und Theotimus –, die zu jung waren, um sich Beinamen verdient zu haben, und trotzdem bereits wegen ihrer Bösartigkeit verabscheut wurden.
Irgendwann sah ich Straton und Cyrus vom Burggelände fliehen: Cyrus nahm so viele Unschuldige wie möglich mit, um sie zu retten. Ich versuchte, nach unten zu gelangen, um mich ihm anzuschließen, doch mir wurde der Weg von kämpfenden Männern versperrt.
Es hieß, Cyrus habe die halbe Armee seines Vaters übernommen, jene Soldaten, die ihm treu ergeben waren, und plane bereits seinen nächsten Angriff auf seine Brüder, während Straton schon eine Armee von Söldnern bereitstehen hatte, die auf ihre Befehle warteten. Im Laufe des Tages waren auch die Zwillinge verschwunden, aber niemand schien zu wissen, wohin, und niemand suchte nach ihnen, außer den übrigen Brüdern vielleicht. Doch die Zwillinge waren – trotz ihrer Fähigkeit zu kämpfen – relativ dumm, und ich war mir sicher, dass niemand sich ihretwegen große Sorgen zu machen brauchte. Selbst wenn sie irgendwann wieder auftauchten, würden sie schnell ausgelöscht werden.
Das bedeutete also, dass die Burg und das Gelände ringsum gegenwärtig von Prinz Marius gehalten wurden, der die andere Hälfte der väterlichen Armee übernommen hatte. Ich konnte ihn durch die Burg ziehen hören, mit der Absicht, alle zu töten, die er nicht für loyal hielt – ihm und nur ihm gegenüber –, oder schlimmer noch, alle, die auch nur die kleinste Chance hatten, durch ihre Abstammung auf den Thron zu gelangen.
Da ich nicht wusste, wie Marius mich einschätzen würde – ich hatte seinem Vater gegenüber stets offen meine Loyalität gezeigt und war ein entfernter Cousin von Marius –, huschte ich in das Gemach des Alten Königs und versteckte mich hinter einer der riesigen Säulen.
Gerade noch rechtzeitig, den Göttern sei gedankt! Denn ein weiterer meiner Cousins kam kurz nach mir in den Raum gerannt. Er war bereits blutüberströmt, doch Marius folgte ihm herein und streckte ihn nieder, indem er dem Mann mit seinem Schwert den Rücken aufschlitzte. Unser Cousin fiel auf den Marmorboden und schluchzte. Voller Verzweiflung.
»Prinz Marius, bitte! Ich bin von Eurem Blut! Bitte!«
Marius sagte nichts zu seinem flehenden Cousin, sondern rammte ihm lediglich seine Klinge in den Rücken, bis zum Herz, ohne sich darum zu scheren, dass der Leichnam des Alten Königs noch immer auf seinem Bett lag.
Ich hielt mir den Mund zu, aus Angst davor aufzuschreien. Ich war nicht fürs Kämpfen geschaffen. Ich war nicht für Krieg geschaffen. Ich war lediglich ein Chronist. Ich hatte Aufzeichnungen über das Leben des Alten Königs gemacht. Aber jeder König wählte seinen eigenen Chronisten, und Marius würde nichts von dem behalten wollen, was einst seinem Vater gehört hatte, außer dem Thron und der Krone.
Marius beendete sein Werk und richtete sich auf. Ich schob mich weiter hinter die Säule und betete, dass er den Raum nicht durchsuchen würde. Aber er ging nicht fort, und da wusste ich, dass er kommen würde. Kommen würde, um mich zu töten.
Doch die Götter mussten meine Gebete erhört haben, denn plötzlich erscholl eine süße Stimme.
»Marius? Wo bist du?«
»Mutter?«
»Ah, da bist du ja!«
Ich spähte wieder um die Säule herum und beobachtete, wie Marius’ Mutter das Gemach des Alten Königs betrat. Maila war die ranghöchste Gefährtin des Alten Königs gewesen, da sie ihm seinen ersten Sohn geboren hatte. Der Alte König hatte nie geheiratet, daher kam Maila in den Augen der Untertanen einer Königinwitwe am nächsten. Und im Gegensatz zu den anderen Gefährtinnen hatte sie auch fast wie eine Königin gelebt, denn wenn der Alte König Gäste empfangen hatte, war immer Maila an seiner Seite gewesen. Das bedeutete auch, dass sie jede Menge Gold und Juwelen besaß und sich jederzeit alles kaufen konnte, was ihr gefiel. Ihre Gewänder waren die schönsten und prachtvollsten, ihr Haar war stets kunstvoll frisiert. Außerdem war es Maila gelungen, sich ihre Schönheit zu erhalten.
»Mutter, was tust du hier? Du solltest in Sicherheit sein, in …«
Ein weiterer Cousin kam in den Raum gerannt und schwang seinen Streitkolben. Maila duckte sich schnell und Marius fing den Schlag mit seinem Schwert ab, bevor er dem Mann einen Dolch in den Bauch rammte. Wieder und wieder, bevor er ihm obendrein die Kehle aufschlitzte.
»Mutter, du musst zu meinen Soldaten zurückkehren. Sie werden dich beschützen.«
»Ich muss mit dir sprechen, und das kann nicht warten. Außerdem sind die meisten deiner Brüder entweder tot oder geflohen. Die Burg ist unser.«
»Trotzdem wäre mir wohler, wenn …«
In diesem Moment stürzte ein schreiender Soldat in den Raum, das Schwert hoch über dem Kopf erhoben, um Prinz Marius anzugreifen. Der Soldat trug die Farben von Prinz Cyrus und war bereit, für den Mann zu sterben, von dem er hoffte, dass er König werden würde.
Marius schwang abermals seine Waffen, doch Maila hob die Hand, um ihn aufzuhalten, und einige Sekunden später blieb der Soldat wie angewurzelt stehen, sein Schwert immer noch erhoben. Er hustete, dann schoss ihm Blut über die Lippen. Maila stieß ein kleines Lachen aus und hielt sich den Mund zu, als der Soldat zu Boden stürzte – tot.
»Mutter, was hast du getan?«
»Ich habe den Brunnen der Soldaten vergiftet. Oh, sieh mich nicht so an«, beklagte sie sich. »Wir wussten beide, dass ich mich niemals aus dieser Angelegenheit würde heraushalten können. Ich warte seit deiner Geburt darauf, dass du den Thron besteigst.«
»Das hier ist meine Schlacht.«
»Falsch. Das hier ist unsere Schlacht. Denkst du wirklich, all meine anderen Söhne wären durch Unfälle gestorben? Nein. Ich habe ihnen ihr Leben genommen, weil das mein Recht als ihre Mutter war. Ich kam nicht in die Nähe deiner anderen Halbbrüder, wegen ihrer Mütter, aber ich wusste, wenn die Zeit reif war, würdest du in der Lage sein, die übrigen zu beseitigen. Und sieh nur, wie brillant du hier deine Aufgabe erfüllst. Also, gönne mir ein wenig Spaß.«
Der Lärm weiterer kämpfender Soldaten im Flur veranlasste den Prinzen, Maila näher zu sich heranzuziehen und sich vor sie zu stellen.
»Sag mir einfach, was los ist, und beeil dich bitte.«
»Vor nicht allzu langer Zeit ist ein Bote eingetroffen. Von den Hexen von Amhuinn.«
Das überraschte mich. Die Hexen von Amhuinn blieben für gewöhnlich in ihrer Bergfestung, lasen ihre Bücher und verfassten ihre Aufzeichnungen. Sie tanzten nicht nackt im Mondschein, sie opferten keine Stiere in der Morgendämmerung, sie brauten keine Liebes- oder Rachetränke. Trotzdem hatten ihre Aussagen Macht. Selbst der Alte König hatte respektiert, was sie sagten.
Und was sie sagten, musste auch Maila wichtig genug gewesen sein, um den sicheren Ort zu verlassen, an dem ihr Sohn sie untergebracht hatte.
»Was wollen sie?«, fragte der Prinz.
»Sie haben die Götter angerufen und …«
Ein Onkel des Prinzen stürmte in den Raum, doch er war schon älter und bewegte sich nicht mehr so flink, wie er das früher einmal getan hatte. Marius schlug ihm den Kopf ab und beförderte seinen Leichnam mit einem Tritt zu Boden.
»Mutter, komm einfach zur Sache!«
»Ihre Seherin hat eine Königin gesehen. Eine Königin, die an die Stelle des Alten Königs tritt.«
Ich runzelte verwirrt die Stirn. Ich konnte mich nicht erinnern, je in meinem Leben von einer Seherin bei den Amhuinn gehört zu haben. Es musste jemand sein, der sich wahrhaft bewiesen hatte, da die Hexen von Amhuinn – nach allem, was ich wusste – sich eher auf Statistiken verließen als auf jene, die in die Zukunft blicken konnten.
»Was für eine Königin?«
»Ein Mädchen. Die Tochter eines Bauern.«
»Eine Bäuerin?«
»Ich war ebenfalls Bäuerin, bevor man mich an deinen Vater verkauft hat.«
»Dann leg das Miststück in Ketten und bring sie zu mir. So oder so werde ich der nächste Herrscher dieses Landes sein.«
Maila warf einen Blick auf den Alten König in seinem Bett und ich sah in ihren Zügen weder Schmerz noch Bedauern über seinen Tod. »Dein Halbbruder Straton hat sich bereits auf die Suche nach dieser Bauerntochter gemacht.«
»Gut. Soll er sie töten. Ich habe andere Dinge zu tun …«
»Sei nicht wie deine Brüder«, fuhr Maila ihren Sohn an. »Sei nicht so kurzsichtig. Ob Bäuerin oder Edelfrau, wenn die Hexen von Amhuinn schon ein Mädchen auserwählt haben, dann wird es auch von den Herzögen und Baronen dieses Landes bereitwilliger akzeptiert.«
»Warum sollte ich die brauchen …?«
»Du brauchst ihre Armeen. Cyrus hat sich bereits die Hälfte der Männer deines Vaters genommen. Die übrigen sind dir zwar treu ergeben, aber wenn du hoffst, gegen Cyrus zu siegen und, was noch schwieriger ist, gegen Straton, der seine Söldnerarmee über Jahre hinweg aufgebaut hat, dann brauchst du mehr Männer. Männer, die bereit sind, für dich zu sterben.«
»Also … du willst, dass ich sie töte?«
»Nein! Verdammt, Sohn! Denk doch nach! Du sollst eine Königin an deiner Seite haben, die den Segen der Hexen von Amhuinn hat. Genau jener Hexen, die vor vierhundert Jahren deine Vorfahren auf den Thron gesetzt haben.«
Marius stieß einen langen Seufzer aus. »Du willst, dass ich sie vor meinem Bruder rette.«
»Dafür ist es zu spät. Man hat bereits Beschützer zu ihr geschickt.«
»Hast du sie geschickt?«
»Nein. Es sind keine Freunde von uns. Aber sie werden das Mädchen zu den Hexen von Amhuinn bringen müssen, damit es dort persönlich von seiner Bestimmung erfährt. Also wissen wir, wo die Bauerntochter zu finden ist. Nimm sie und heirate sie. Mach sie zur Königin.«
»Ich will nicht heiraten.«
»Dein Vater war der einzige Sohn seines Vaters. Du, mein Lieber, hattest dieses Glück nicht. Eine Ehefrau zu haben – eine Königin – bedeutet nicht, dass du nebenbei keine Huren haben kannst. Dein Urgroßvater hatte das auch, und deine Urgroßmutter, die Königin, wusste immer, wo ihr Platz war.«
»Ich weiß nicht …«
»Lern sie kennen. Man wird sie ergreifen und dir bringen. Ich werde das alles arrangieren. Sobald wir sie haben, kannst du immer noch entscheiden, ob du sie behalten oder ihr die Kehle aufschlitzen willst.«
Marius stieß den Atem aus und schaute kurz zur Decke. »Na gut. Ich werde sie kennenlernen. Aber zuerst muss sie sowieso Straton überleben. Ich bin noch nicht bereit, mich ihm zu stellen.«
»Wenn es ihr nicht gelingt, deinen Halbbruder zu überlisten«, sagte Maila und trat über die toten Angehörigen hinweg, »wird sie kein großer Verlust sein.«
»Du musst mir etwas versprechen«, sagte Marius, obwohl seine Mutter ihm bereits den Rücken zukehrte.
Sie drehte sich wieder zu ihm um. »Und was wäre das, mein Liebling?«
»Dass du, wer auch immer diese Bäuerin ist … sie nicht töten wirst, bis ich zu dem Schluss komme, dass ich keine Verwendung für sie habe.«
»Warum sollte ich jemals …«
»Mutter.«
Maila grinste. »Ich verspreche es. Ich werde brav sein.« Die beiden sahen einander an, bis Maila hinzufügte: »Zumindest werde ich es versuchen.«
»Danke. Ich habe es immer zu schätzen gewusst, dass du mich geleitet hast, doch jetzt, da Vater tot ist, ist es an der Zeit, meine eigenen Entscheidungen zu treffen.«
»Selbstverständlich.«
»Also, zwing mich bitte nicht, dich bis zu deinem plötzlichen und tragischen Tod in nicht allzu ferner Zukunft in ein Nonnenkloster zu sperren.«
»Das würdest du deiner eigenen Mutter antun?«, fragte Maila ihren einzigen verbliebenen Sohn.
Marius trat dicht vor seine Mutter und legte ihr sanft seine blutverschmierte Hand auf die Wange. »Noch bevor du zu deinen erwählten Göttern beten könntest, dich zu retten.«
Maila lächelte. »Du bist so sehr mein Sohn.«
Sie verließen den Raum und Marius brachte seine Mutter wieder in Sicherheit. Ich nutzte meine Chance und kroch durch die versteckte Tür unter dem riesigen Bett, die der Alte König vor allen außer mir geheim gehalten hatte.
Sobald ich hindurch war, schloss ich langsam die Tür hinter mir, damit niemand mich fliehen hörte. Als ich aufrecht stehen konnte, eilte ich durch den schmalen Geheimgang und betete, dass die Stahltür am Ende nicht von irgendeinem stämmigen Soldaten versperrt wurde, der sich fragen würde, was ich im Schilde führte.
Meine Flucht dauerte mehrere Minuten, und sobald ich die Stahltür erreichte, öffnete ich sie gerade weit genug, um herauszufinden, ob mir irgendjemand den Weg versperrte. Durch diese Tür gelangte man in die Wälder im Westen der Burg. Ich ließ meinen Blick über die Bäume schweifen, entdeckte aber nichts. Schließlich schlüpfte ich hinaus, nahm mir jedoch die Zeit, die Tür sorgfältig hinter mir zu schließen, aus Angst, auch nur das leiseste Geräusch zu verursachen. Sobald ich das letzte Klicken hörte, stieß ich den Atem aus und …
»Du willst uns schon verlassen, Hüter des Wortes?«
Ich schloss verzweifelt die Augen und kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an, als ich mich Lady Maila zuwandte.
»Nun, nun, wein doch nicht. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich bin hier, um dir Schutz vor meinem Sohn anzubieten.« Sie kam um den Baum herum, hinter dem sie gewartet hatte, und ergriff meinen Arm. »Die Lage hier wird sich drastisch verändern und ich brauche meinen eigenen Geschichtsschreiber. Du könntest der Hüter Meines Wortes sein. Wäre das nicht hübsch?«
Was konnte ich darauf erwidern? Nein? Nicht Lady Maila gegenüber. Und zwar nicht bloß wegen ihres Sohnes. Sich Maila zu widersetzen hieß, sein eigenes Todesurteil zu unterzeichnen. Und ich war noch nicht bereit zu sterben.
Also antwortete ich stattdessen: »Das wäre wunderbar, Mylady.«
»Glänzend.« Gemeinsam gingen wir zurück zur Burg. »Und du kannst mich jetzt Königinwitwe nennen. Das ist recht passend, findest du nicht auch?«
»Ja, Mylady.«
»Und warte nur, bis du die zukünftige Königin meines Sohnes kennenlernst. Sie ist anders als alle, die dir je begegnet sind.«
Ich hoffte, dass die Königinwitwe recht hatte. Denn dieses arme Mädchen, wer immer sie sein mochte, würde etwas ganz Besonderes sein müssen, wenn sie auch nur die kleinste Chance haben wollte, diese Mutter und ihren Sohn zu überleben.
Kapitel 1
Der gewaltige Kopf des Hammers schlug hart auf dem Boden auf und erschreckte die Männer, die eben den Jungen aufgehängt hatten.
Er konnte die Frau sehen – gerade noch so –, während er dort oben hing. Er versuchte, sie zu warnen. Ihr zu sagen, dass sie abhauen solle. Diese Soldaten waren käuflich. Sie waren niemandem außer sich selbst gegenüber loyal – und dem, der sie bezahlte.
Sie waren über ihn gestolpert, als er unter genau diesem Baum geschlafen hatte, und noch bevor er wusste, wie ihm geschah, hatten sie beschlossen, ihm seine magere Habe und die drei Pferde, mit denen er gereist war, abzuknöpfen. Und wäre es nicht ein großer Spaß, ihn baumeln zu sehen?
Nun … nein.
Nein, es war kein Spaß zu baumeln.
Wie dem auch sei. Er wollte nicht, dass diese überaus hochgewachsene Frau ihr Leben riskierte, um seines zu retten. Solche Männer waren Frauen gegenüber noch grausamer als zu einem einzelnen Mann, der unter Bäumen schlief.
Sie hatte ihren großen Hammer hochgerissen und über ihren Kopf geschwungen, und als der massive Hammerkopf auf dem Boden aufgeschlagen war, hatte sie für einen Augenblick reglos dagestanden. Das Kinn gesenkt. Ihre Muskeln unter ihrer ärmellosen Tunika aus schwarzem Leder angespannt.
Nach diesem kurzen Moment hob sie nur den Blick und knurrte: »Schneidet ihn los.«
Einer der Soldaten lachte. »Schaut euch an, was wir hier haben, Jungs! Eine Schlampe mit fetten Armen, auf der Suche nach …«
Der Hammer war erneut in der Luft und schwang über ihrem Kopf, und noch bevor der Soldat seinen Satz beenden konnte, katapultierte er ihn gegen einen anderen Baum in der Nähe. Knochen brachen und Blut spritzte aus dem Mund des Söldners.
Schwerter wurden gezückt und die Männer umstellten sie.
»Schlechte Entscheidung, Weib«, bemerkte ein anderer Soldat.
»Nein«, erwiderte sie. »Schlechte Entscheidung, in meine Stadt zu kommen und einen Jungen zu töten.«
Moment mal. Er war noch nicht tot! Natürlich lag das größtenteils daran, dass die Soldaten sich dabei Zeit gelassen hatten, ihn vom Boden hochzuhieven, damit er möglichst langsam starb. Sie hatten wörtlich gesagt: »Lasst uns zuschauen, wie er ganz langsam stirbt, Jungs!«
Einer der Soldaten hieb mit seiner Klinge nach der Frau, doch sie parierte mühelos mit diesem erstaunlich großen Hammer, bevor sie dem Mann den Hammerkopf gegen die Brust rammte. Er fiel um, sein Brustkorb zerschmettert, und sein Ringen nach Luft war geradezu schmerzhaft anzuhören.
Er wollte weiter zusehen und flehte die Götter an, diese mutige, aber törichte Frau zu beschützen, doch seine Sicht trübte sich langsam. Er erstickte.
Nein! Er würde nicht sterben. Er würde kämpfen!
Nachdem er diese Entscheidung getroffen hatte, gab er sich noch größere Mühe, die Finger zwischen das Seil und seine Kehle zu bekommen, in der Hoffnung, den Strick zu lockern. Während er sich abmühte, schaute er zu einem nahen Hügel und sah die Herde wilder Pferde, die er am Abend zuvor bereits entdeckt hatte. Da hatte er noch gedacht, dass die drei Pferde, um die er sich kümmerte, in der Herde nicht weiter auffallen würden. Er hatte ihnen extra Sattel und Zaumzeug abgenommen und sie direkt am Waldrand versteckt. Aber das hatte nicht so gut funktioniert wie erhofft.
Jetzt stürmten diese Wildpferde wie panisch über den Hügel, direkt auf die Soldaten und ihn zu. Doch als sie diesen Hügel hinuntergaloppierten, glaubte Samuel für einen Sekundenbruchteil, er sähe … Menschen? Die zwischen den Pferden rannten? Über die Pferde hinweg?
Oder er litt bereits an Wahnvorstellungen. Auch das war möglich.
Denn er starb. Er würde sterben, wenn er die Schlinge nicht endlich losbekam.
Da er wusste, dass ihm die Zeit davonlief, kämpfte Samuel noch heftiger. Mühte sich ab, das Seil um seinen Hals loszuwerden.
Die meisten der Männer machten Platz, um der herannahenden Herde auszuweichen. Einer jedoch griff die Frau an. In diesem Moment galoppierte ein grauer Hengst zwischen ihnen hindurch. Als der Hengst an den beiden vorbei war, schlug er mit den Hinterbeinen aus, traf den Mann am Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel.
Die Frau nutzte ihre Chance. Sie zog eine Klinge aus ihrem Gürtel und durchtrennte Samuels Seil dort, wo es festgebunden worden war.
Samuel schlug auf dem Boden auf, würgend und keuchend, aber jetzt war er endlich in der Lage, die Finger unter das Seil zu schieben und es sich über den Kopf zu ziehen.
Eine Hand in einem Lederhandschuh erschien vor seinen tränenden Augen.
»Steh auf, Junge!«, befahl die Frau. »Auf, auf, auf!«
Samuel griff nach ihrer Hand und ließ sich von ihr auf die Füße ziehen. Dabei wurde ihm klar, dass die Pferde an ihnen vorbeiliefen. Keines hatte sie umgerannt. Es schien, als würden sie bewusst einen Bogen um Samuel und die Frau machen, während sie die anderen Männer niedertrampelten.
Die Frau sah Samuel an, den Blick auf seine Kehle gerichtet, als sich plötzlich ihr Gesichtsausdruck veränderte und sie wieder diesen Hammer hob, dessen Kopf größer war als Samuels Schädel. Er machte einen schnellen Schritt zurück, gerade als sie sich umdrehte und gleichzeitig ihre Waffe schwang.
Der Metallkopf krachte gegen ein Schwert, und der hochgewachsene, kräftig gebaute Mann, der es hielt, starrte durch eine dichte, dunkle Haarmähne auf sie herab.
»Dieser Hammer ist lächerlich«, bemerkte der Mann.
»Ich liebe meinen Hammer«, entgegnete die Frau. »Ich habe ihn selbst geschmiedet.« Sie zog ihre Waffe von seinem Schwert weg. »Du bist ein Amichai. Nicht wahr?«
Was Samuel die mächtige Mähne und den ledernen Kilt erklärte.
»Vielleicht machen wir uns später miteinander bekannt«, antwortete der Amichai. »Zunächst solltest du dein Augenmerk lieber auf das richten, was hinter dir ist.« Er sah Samuel an. »Runter, Junge.«
Es war kaum ein Befehl, bloß zwei leise gemurmelte Worte, aber Samuel gehorchte sofort und ließ sich auf die Knie fallen. Genau in dem Moment peitschte etwas an seinem Kopf vorbei. Er hörte ein Grunzen, hörte etwas brechen. Ein Mensch fiel neben ihm zu Boden und Samuel wand sich. Er konnte nicht anders, denn der Hammer der Frau war dem Soldaten ins Gesicht gekracht und hatte es zerschmettert. Blut, Haut, Knochen und Gehirnmasse explodierten und machten Samuel vorübergehend blind.
Eine Hand packte ihn am Oberarm und zerrte ihn abermals auf die Füße.
»Hinter mich, Junge«, sagte seine Retterin und schob ihn nach hinten, bis er gegen einen Baumstamm prallte.
Samuel wischte sich das Blut aus den Augen, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie einer der Soldaten mit dem Schwert nach dem Kopf der Frau hieb. Sie sprang zur Seite und parierte den Schlag mit ihrem Hammer, dann setzte sie mit einem Boxhieb gegen den Kopf nach und zwang den Mann damit in die Knie. Nicht dass Samuel überrascht gewesen wäre. Die Schultern dieser Frau … Bei den Göttern!
Der Amichai, der helfend eingegriffen hatte, kämpfte jetzt gegen andere Soldaten. Er war jedoch nicht allein. Wie die meisten aus diesem Teil der Welt reiste er mit anderen zusammen. Mit zwei Männern und einer Frau. Ebenfalls hochgewachsen, ebenfalls kräftig gebaut und alle schwer bewaffnet. Allein nach dieser Beschreibung hätten sie von überallher kommen können, doch die ledernen Kilts, die Stammestätowierungen und etwas, das sein Vater immer als »ihre monströsen Mähnen« bezeichnet hatte, machten klar, dass sie aus den Amichai-Bergen kamen. Jenem ausgedehnten Gebirgsterritorium, das von mächtigen, unfreundlichen Stämmen beherrscht wurde. Das Herrschaftsgebiet des Alten Königs grenzte direkt an die Ausläufer des Amichai-Gebirges, aber er hatte es nie gewagt, die Stämme direkt herauszufordern. Niemand hatte das je getan. Sie galten als brutale Barbaren. Tollwütige Mörder, die ihresgleichen fraßen und ihren Toten und ihren Dämonengöttern Säuglinge opferten.
Samuel wusste nicht, ob das alles der Wahrheit entsprach, aber im Moment hoffte er von Herzen, dass dem nicht so war. Denn die Amichai und die Frau mit den breiten Schultern waren seine einzige Hoffnung, am Leben zu bleiben.
Als er nach seinem eigenen Schwert greifen wollte, fiel Samuel wieder ein, dass die Soldaten es ihm entrissen hatten, bevor sie ihn aufgehängt hatten.
»Wie heißt du?«, fragte die Frau, während sie einen Soldaten auf dem Boden mit ihrem Hammer attackierte. Sein Gesicht wurde zerschmettert, seine Brust eingeschlagen.
»Ssss … Sssss …« Er schüttelte den Kopf und versuchte es noch einmal. »Samuel.«
»Ich bin Keeley«, antwortete sie und hielt inne, um ihm ein kleines Lächeln zu schenken, bevor ein weiterer Soldat auf sie zugerannt kam. Sie wirbelte den Hammer herum, stieß ihn nach vorn und rammte ihn dem Soldaten in den Bauch. Schnell hob sie die Waffe wieder an und riss den Soldaten gleich mit hoch.
Samuel beobachtete, wie sie den Mann in die Höhe hievte und ihn sich über den Kopf hielt. Die Muskeln ihrer Arme und Schultern traten bei der Anstrengung hervor, bevor sie ihn wieder zu Boden schmetterte. Der Kopf ihres Hammers steckte nun tief im Leib des Soldaten.
Als sie den Hammer herausriss, wurde Samuel erneut mit Blut und Eingeweiden bespritzt, doch diesmal hob er rechtzeitig den Arm, um seine Augen zu schützen.
Samuel musste zugeben … er war es leid, die Innereien irgendwelcher Männer abzukriegen.
Nachdem er seinen mittlerweile blutbesudelten Arm gesenkt hatte, beobachtete Samuel weiter, wie die Menschen, die es auf sich genommen hatten, ihn zu retten, gegen die brutalen Soldaten kämpften. Zum Glück – mehr um ihrer selbst willen als um seinetwillen – waren sie alle geübte Nahkämpfer und hatten die Soldaten schon nach kurzer Zeit mühelos überwältigt.
Samuel stieß gerade einen erleichterten Atemzug aus, als Keeley den Kopf hochriss und zu der nahe gelegenen Straße hinüberschaute. Im selben Moment ging die Amichai-Frau in die Hocke und legte die Hand auf den Boden.
»Es kommen noch mehr!«, rief sie.
»Wir sollten den Jungen in Sicherheit bringen«, sagte einer der Stammesmänner.
»Keine Zeit.« Keeley schritt durch den Wald auf die Straße zu. »Ich brauche eine Axt«, befahl sie. »Sofort!«
Ein anderer Amichai zückte eine wunderschöne Waffe. Eine Axt, die aus einem einzigen langen Stück Stahl zu bestehen schien. Keeley streckte im Gehen die Hand aus und er warf sie ihr zu. Sie fing sie mit Leichtigkeit auf, ohne stehen zu bleiben.
»Was hast du vor?«, fragte einer von ihnen.
»Die Straße sperren.« Sie benutzte die Axt, um hinter sich zu deuten. »Da rüber. Los. Bewegung.«
Samuel befolgte ihre Befehle sofort und zu seiner Überraschung machten es die Amichai genauso. Das war seltsam, da er in dem Glauben erzogen worden war, dass sie Barbaren seien, die sich keinem Befehl unterwarfen.
Keeley umklammerte den Axtgriff, hob die Waffe und spannte alle Muskeln an. Dann ließ sie die Axt heruntersausen, ganz unten hinein in den Stamm eines großen Baums. Sie schlug einmal zu … zweimal … und der Baum fiel krachend über die Straße.
»Götter, ist die stark«, murmelte einer der Amichai hinter Samuel.
Keeley ging über die Straße und attackierte den nächsten Baum. Jetzt versperrten zwei große Bäume die Straße, und Samuel konnte endlich sehen, was die anderen bereits gespürt hatten: weitere berittene Söldner, die auf sie zugaloppierten.
»Beeindruckend«, sagte der dunkelhaarige Mann, »aber ich weiß nicht, was das bewirken soll. Wir hätten besser wegrennen sollen.«
Der Amichai hatte wahrscheinlich recht, obwohl Keeley es tatsächlich geschafft hatte, die Reiter vorübergehend aufzuhalten. Die an der Spitze zügelten ihre Pferde und hielten vor den Bäumen an. Der Erste lachte, als er die Straßensperre sah.
»Was soll das sein?«
Keeley antwortete nicht. Sie war zu sehr damit beschäftigt, den Leichnam von einem ihrer Landsleute zu ihnen hinüberzutragen.
»Du Miststück!«, blaffte einer der Männer. »Was hast du …«
Ihm wurde das Wort abgeschnitten, als dieser Leichnam und seine Innereien ihn und einige der anderen Soldaten trafen. Dann legte Keeley sich zwei blutverschmierte Finger an die Lippen und stieß einen langen, lauten Pfiff aus.
»Du verrückte Kuh«, rief der gegnerische Anführer, zog sein Schwert und …
Samuel stolperte rückwärts gegen die Stammesfrau. Er konnte nicht anders, da wie aus dem Nichts ein Wolf erschien, der über das Pferd des Soldaten hinwegsprang, die Reißzähne in die Kehle des Anführers schlug und ihn aus dem Sattel riss.
Weitere Wölfe sprangen von den Bäumen herunter … oder aus dem Boden heraus … da war Samuel sich nicht sicher. Er wusste es wirklich nicht genau. Denn sie schienen von überallher zu kommen. Sie waren nicht größer als die Waldwölfe, die er auf seinen Reisen gesehen hatte, aber ihm waren noch nie welche begegnet, die so kühn, so blutrünstig oder so bösartig gewesen waren.
Dann drehte einer der Wölfe sich zu ihm um und Samuel wandte sofort den Blick ab und sang gleichzeitig verzweifelt einen Schutzzauber. Er musste es tun.
Diese Augen. Liebe Götter … diese Augen!
Bevor Samuel jedoch richtig in Panik geraten konnte, kam Keeley auf ihn zugelaufen, und sie trug die Axt und ihren Hammer, als hätten sie kein Gewicht. Sie warf die Axt deren eigentlichen Besitzerin zu und rief im Vorbeirennen: »Jetzt laufen wir weg. Lauft!«, drängte sie alle wohlgelaunt. »Alle weglaufen. Schnell wie die Häschen!«
Schockiert, verwirrt und erschüttert von den Todesschreien der Soldaten liefen Samuel und die anderen hinter Keeley her.
Samuel stieß einen Pfiff aus, und die drei Pferde, mit denen er unterwegs gewesen war, erschienen am Waldrand und folgten der Gruppe, wofür Samuel sehr dankbar war. Er wollte nicht in diesen Wald zurück, um nach ihnen zu suchen, und er wollte auch seinem Herrn nicht sagen müssen, dass er die Pferde verloren hatte.
Das würde ihn mit Sicherheit seinen Kopf kosten. Und dabei hatte er so viel durchgemacht, um ihn zu behalten …
Kapitel 2
Keeley Smythe musste es zugeben: Sie hatte nicht damit gerechnet, dass ihr Tag so verlaufen würde. Sie war am Morgen aufgewacht und hatte ihre Geschwister aus dem Bett gescheucht, damit sie ihren Pflichten nachkamen, während ihre Mum noch schlief, bis das neue Baby sie mit seinem entzückenden Geschrei aufwecken würde. Sie hatte ihrem Vater geholfen, die Pferde zu füttern, ihrem jüngeren Bruder, diese Pferde auf die östlichen Weiden zu bringen, und sie hatte einen Faustkampf zwischen zwei ihrer Geschwister beendet.
Für sie ein ganz normaler früher Morgen auf der Farm ihres Vaters. Dann, nachdem die beiden Sonnen am Himmel aufgestiegen waren, hatte sie sich ihren Lieblingshammer gegriffen, ihre Mum und ihren Dad zum Abschied geküsst und war an ihren Lieblingsort gegangen, in die Iorwerth-Wälder. Eine riesige, dicht mit Bäumen bestandene Fläche, die Keeley schon erkundete, seit sie ein kleines Mädchen war. Im Iorwerth-Wald hatte sie ihre ersten Wildpferde gesehen. Mehrere Herden, die im Wald heimisch geworden waren. Sie war jeden Tag dorthin gegangen und hatte ihre Zeit damit verbracht, sie zu beobachten. Immer und immer wieder, ohne die Tiere zu stören, sodass diese schließlich zu ihr gekommen waren. Die Fohlen waren als Erste auf wackeligen Beinen zu Keeleys Platz neben einem Baum gestakst. Dann die Jährlinge. Zu guter Letzt war die wunderschöne graue Leitstute herbeigeschlendert, hatte Keeley ein Weilchen betrachtet und sich dann um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert. Danach hatten auch alle anderen Pferde Keeley in ihrer Nähe geduldet und ihr erlaubt, ihnen Leckereien zu geben oder ihnen zu helfen, wenn sie verletzt waren. Aber ihr bester Freund, ihr absoluter Liebling, war der Sohn der grauen Stute. Ein grauer Hengst, der immer nach ihr Ausschau hielt, der sie zum Lachen brachte und sie warnte, wenn ihre jüngeren Geschwister im Begriff waren, etwas zu tun, das sie alle bereuen würden.
Sie hätte gleich wissen müssen, dass mit diesem Tag etwas nicht stimmte, als sie wie jeden Morgen nach der Herde schauen wollte und keines der Tiere in Sicht gewesen war, bis auf drei gezähmte Pferde, die sie nicht kannte. Dann hatte sie das raue Gelächter von Männern gehört. Keeley wusste, dass dieser Laut mitten im Wald selten etwas Gutes bedeutete. Und sie hatte recht gehabt – eine kleine Einheit von Soldaten knüpfte zur eigenen Belustigung einen Jungen an einem Baum auf.
Keeley war sehr froh darüber, dass sie genau in diesem Moment eingegriffen hatte. Und sie war noch froher, dass die Amichai vorbeigekommen waren. Hätte sie es mit der ganzen Einheit allein aufnehmen können? Wahrscheinlich. Hätte sie alle Soldaten überlebt? Höchstwahrscheinlich. Hätte sie dabei auch ihre wichtigsten Körperteile behalten können? Ihre Arme, Beine und Augen? Wahrscheinlich nicht.
Also würde sie den Außenseitern, die ihr zu Hilfe gekommen waren, ewig dankbar sein. Nicht zuletzt deshalb führte sie sie nun eilig durch den Wald.
Sie hatten es gerade ins Tal geschafft, als Schreie hinter ihnen erklangen, die Keeley herumwirbeln ließen. Einer der Soldaten kam aus dem Wald gerannt, doch er kippte plötzlich der Länge nach auf den Boden, einen Wolf auf seinem Rücken.
»Scheiße«, murmelte sie vor sich hin.
Zwei weitere Wölfe kamen aus dem Wald. Einer packte den Soldaten an der Wade und zerrte ihn zurück, langsam, Meter für Meter. Der Wolf, der bereits auf seinem Rücken stand, schnappte nach seiner Wirbelsäule, zerfetzte das Fleisch und ließ Knochenstückchen durch die Luft fliegen.
Der Soldat schrie und streckte die Hand nach Keeley aus.
»Hilf mir! Bitte!«
Keeley ließ sich auf die Knie nieder und breitete die Arme aus. Der schwarze Wolf, den sie kannte, seit sie ihn im Wald gefunden hatte – allein, wimmernd und im Begriff, von drei religiösen Fanatikern im Gewand von Friedensmönchen getötet zu werden –, lief auf sie zu. Er sprang an ihr hoch und leckte ihr das Gesicht ab, und Keeley grub ihm die Finger in sein dickes Fell und rang ihn zu Boden.
Sie lachte, bis sie hörte, wie ein Schwert gezückt wurde. Keeley griff nach ihrem Hammer und drehte sich auf den Knien in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Der schwarze Wolf stand neben ihr, bleckte die Zähne und blutiger Sabber tropfte von seinen Lefzen.
Es war die Amichai-Frau, die jetzt ihr Schwert schwang, den Blick fest auf die Wölfe gerichtet.
»Ich weiß es zu schätzen, dass du im Wald geholfen hast«, sagte Keeley zu der Frau, während sie sich hochrappelte und ihren Hammer mit beiden Händen umfasste. »Aber es wird mir nicht gefallen, wenn du weiter darauf bestehst, meine Freunde zu bedrohen.«
»Deine Freunde? Diese Kreaturen sind deine Freunde?«
»Diese Kreaturen haben uns das Leben gerettet.«
»Diese Kreaturen hatten eine Mahlzeit.«
Keeley grinste. »Und zwar eine herzhafte.«
»Sie sind aus irgendeiner Höllengrube hergerufen worden. Dämonen. Du hast Dämonen gerufen, damit sie dir helfen. Macht dir das nichts aus? Dass sie böse sind?«
»Böse? Wie kommst du auf die Idee, sie wären böse?«, fragte Keeley aufrichtig verwirrt.
Die Amichai deutete mit ihrem Schwert in Richtung des Wolfes. »Flammen. Sie haben alle Flammen anstelle von Augen! Stört dich das nicht?«
»Solange ich ihnen die Hände nicht direkt aufs Gesicht lege, ist es …«
»Das meine ich nicht!«
Der dunkelhaarige Amichai näherte sich der Frau. »Entschuldige uns kurz«, sagte er zu Keeley, bevor er die Amichai beiseitezog.
Keeley zuckte die Achseln und schaute den schwarzen Wolf an, der mit seinen Flammenaugen zu ihr aufblickte.
»Launisches Miststück, hm?«, fragte sie, und ihr Freund gab zustimmend ein verhaltenes »Wuff« von sich.
Caid vom Clan der Vernarbten Erde sah seine Schwester an und fragte: »Was zum Teufel soll das?«
»Flammenaugen!«
»Ich weiß. Ich sehe sie auch.« Wirklich, es war schwer, sie nicht zu sehen, da diese Augen so hell brannten wie die beiden Sonnen über seinem Kopf. »Aber du scheinst vergessen zu haben, weshalb wir hier sind.«
»Ich vergesse gar nichts, Bruder. Allerdings frage ich mich, mit welcher Art von Mensch wir es hier zu tun haben.«
»Spielt keine Rolle. Diese Frau ist nicht unser Ziel. Sondern ihre Schwester. Und wir kommen an die eine nicht ohne die andere heran.« Das hatte man ihnen schon vorab erzählt, als man sie ausschickte, die zukünftige Königin dieses Landes zu beschützen. Und nachdem er die Familie beobachtet hatte, wusste Caid, dass es stimmte. Denn Keeley Smythe mochte zwar nicht die Mutter oder der Vater ihrer Familie sein, aber sie war die Matriarchin. Und nachdem er Zeuge geworden war, wie sie sich eben im Wald bewährt hatte, wusste Caid auch, dass mit ihr nicht zu spaßen war. Also verstand er das plötzliche Verlangen seiner Schwester nicht, Keeley wegen ihrer Zuneigung zu den Dämonenwölfen zur Rede zu stellen. Es schien kein Tier zu geben, das diese Frau nicht ins Herz geschlossen hatte, und sie würde sich bestimmt nicht von ein paar Flammen, die aus Augenhöhlen schossen, davon abhalten lassen.
Bei den mächtigen Pferdegöttern des Ostens, jemanden wie Keeley Smythe hätte er sich nie träumen lassen.
»Ihr werdet die Schwester überzeugen müssen, bevor ihr an das Mädchen herankommt«, hatte man sie gewarnt. »Die Schwester des Stahls und des Steins.«
Es gab in den Hügelländern nicht viele Frauen, die Schmiedinnen waren, doch manche versuchten, in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten, bevor sie einen Gefährten fanden und sich niederließen, um Kinder zu bekommen und die harten Zeiten zu überstehen. Aber von den überaus wenigen, denen er im Laufe seines Lebens begegnet war, war keine – keine Einzige – so gewesen wie sie.
Sie trug diesen Kampfhammer mit dem absurd riesigen Kopf herum, als wöge er überhaupt nichts. Doch er hatte den Schaden gesehen, den dieser Hammer – und sie – angerichtet hatten. Dieses Ding war genauso schwer, wie es aussah, und doch handhabte sie es mühelos. Mit ihren breiten Schultern, ihren muskulösen Armen und Oberschenkeln und der Tätowierung einer der Schmiedegilden war sie eine Frau, die es zu fürchten galt. Sie konnten sie nicht einfach als etwas abtun, das ihnen in die Quere kam.
Die Hexen hätten ihre Warnung deutlicher formulieren sollen. Denn wenn diese Frau beschloss, dass ihre Schwester nirgendwo hinging … dann ging ihre Schwester nirgendwo hin.
Doch trotz ihrer offensichtlichen körperlichen Kraft und ihrer Bereitwilligkeit, Soldaten einfach in den Boden zu stampfen – nur um einem Jungen zu helfen, den sie nicht zu kennen schien, und vielleicht um der frühmorgendlichen Unterhaltung willen –, bewies das Lächeln, das sie der Kreatur neben ihren langen Beinen schenkte, dass sie dieses Tier mochte. Dass sie es mochte und beschützte, so wie sie die Wildpferde im Tal und die Schafe auf der nahe gelegenen Farm ihres Nachbarn mochte und beschützte.
Mit anderen Worten, sie war nicht böse. Denn wer böse war, scherte sich um niemand anderen als um sich selbst. Jedenfalls riskierte so jemand nicht sein eigenes Leben, um Dämonenwölfe zu beschützen, deren Augen man tunlichst nicht berühren sollte.
»Wollt ihr mit mir in die Stadt kommen?«
Caid blickte die Schmiedin über seine Schulter hinweg an. Die Wölfe waren fort, ebenso der Soldat, obwohl sie noch immer seine Schreie aus dem Wald hörten, wo er hysterisch um den Tod bettelte.
Sie lächelte ihn an. »Ich nehme euch zu meinem Laden mit. Ihr könntet etwas essen und trinken. Euch ein Weilchen ausruhen, bevor ihr weiterreist. Wäre das nicht nett?«
Mit einem Nicken stimmte Caid zu. »Das würden wir sehr zu schätzen wissen.«
»Nun, ich schulde euch eine Menge. Ihr habt mich und meinen jungen Freund hier beschützt …« Sie sah den Jungen an. »Samuel? Richtig?«
»Ja. Samuel«, antwortete er.
»Lass uns gehen, Junge. Wir müssen uns um deinen Hals kümmern.«
Sie hievte sich den Kopf ihres Hammers auf die Schulter, hielt den stählernen Griff fest, setzte sich in Bewegung und richtete nach hinten gewandt das Wort an sie.
»Ich denke, es wird euch allen in meiner Stadt gefallen. Es ist ein wunderbarer Ort.«
»Kommt mit«, sagte Caid zu seiner Schwester und nickte auch Farlan und Cadell zu. »Wir gehen mit ihr.«
»Und wir werden die Dämonenhunde, mit denen sie befreundet ist, einfach ignorieren?«
»Dämonenwölfe, und ja.« Er drehte seine Schwester an den Schultern um und schob sie sanft an.
»Ich habe das Kommando«, rief sie ihm ins Gedächtnis.
»Und unser Vater sagt immer, sobald du deine Truppe daran erinnern musst …«
»Ich bin übrigens Keeley«, stellte Keeley sich ihren neuen Freunden vor. Sie ging jetzt rückwärts, damit sie besser mit ihnen sprechen konnte.
»Ich bin Laila.« Die Amichai zeigte auf den dunkelhaarigen Amichai. »Das ist Caid, mein Bruder.« Sie deutete auf einen etwas kleineren, aber breiteren blonden Mann. »Das ist Farlan.« Zuletzt wies sie auf den Mann mit dem hellbraunen Haar und dem extrem vernarbten Kinn. »Und das ist Cadell.«
Keeley drehte sich wieder nach vorn um und fügte hinzu: »Seid uns alle herzlich willkommen.«
»Also werden wir einfach so tun, als gäbe es diese Wölfe nicht?«, fragte Laila.
»Genau das werden wir tun!«, erwiderte Keeley fröhlich. Sie hatte gerade einen Kampf überlebt und war recht zufrieden mit sich. Warum das alles ruinieren, indem sie mit einer Frau stritt, die sie kaum kannte?
»Bist du eine Hexe der dunklen Götter?«
»Ich? Eine Hexe?« Keeley musste lachen. »Außer meiner Familie bin ich nur einer einzigen anderen Sache ergeben, und zwar dem Stahl. Mit meinem ganzen Herzen und all meiner Liebe.«
Die Amichai trat plötzlich vor Keeley hin und hinderte sie am Weitergehen.
»Wie hast du diese Kreaturen dann zu dir gerufen?«
»Laila«, murmelte ihr Bruder warnend, aber sie hob lediglich die Hand in seine Richtung.
»Ich habe einmal ein Junges gefunden und ihm geholfen.«
»Ich frage dich noch mal. Diese Augen stören dich nicht?«
»Deine stören mich doch auch nicht. Warum sollten mich seine stören?« Als die Frau sie mit schmalen Augen und schief gelegtem Kopf musterte, fügte Keeley – weil sie immer noch nicht streiten wollte – hinzu: »Auf der Welt gibt es alle möglichen Arten. Ich kann nicht herumlaufen und das Leiden anderer ignorieren, nur weil jemand anders aussieht als alles, was mir bis dahin begegnet ist. Ich weiß nur, dass er mich nicht gebissen hat. Er hat nicht versucht, mir Arme oder Beine abzureißen oder nach meiner Kehle zu schnappen. Also habe ich ihm geholfen. Genau wie ich Samuel geholfen habe. Genau wie ich euch zu helfen versuche.«
»Das weiß ich wirklich zu schätzen«, gab Laila zu, »aber trotzdem …«
»Das Leben ist zu kurz, um Dinge zu hassen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Meine Unwissenheit darf nicht dazu führen, dass andere leiden. Jetzt gehe ich in meinen Laden. Ihr könnt Samuel und mich dorthin begleiten, oder ihr könnt hierbleiben und euch Gedanken um Tiere machen, die ihr nicht wiedersehen werdet.« Keeley trat dicht an sie heran und senkte die Stimme, sodass nur Laila sie hören konnte. »Oder ihr könnt mir auch weiter auf Schritt und Tritt folgen, wie ihr es während der letzten paar Tage getan habt, und ich tue weiterhin so, als würde ich euch nicht sehen. Was ich bis jetzt gemacht habe, weil nichts von dem, was ihr tut, mich zu der Annahme bringt, ihr wolltet meiner Familie etwas Böses. Also liegt es bei dir, da es scheint, als hättest du das Kommando über deine kleine Herde hier.« Keeley zog eine Braue hoch. »Verstanden, Amichai?«
Die Frau brauchte einen Moment, um zu antworten. Sie war zu sehr damit beschäftigt gewesen, Keeley mit offenem Mund anzugaffen. Schließlich warf sie mit einem Ruck ihr Haar zurück und sagte: »Ich verstehe. Vollkommen.«
»Gut. Das freut mich. Komm mit, Samuel!«, rief Keeley.
Dann ging Keeley mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln – welches ihre Mutter immer maßlos ärgerte – weiter. Und diesmal … hielt niemand sie auf.
Laila starrte Keeley Smythe hinterher, als sie mit Samuel und den drei Pferden des Jungen voranging. Schließlich trat ihr Bruder neben sie.
»Was war das denn gerade?«, fragte er.
»Sie weiß, wer wir sind.«
»Warum schockiert dich das so? Jeder weiß, wer wir sind. Die Kilts verraten es für gewöhnlich.«
»Lass es mich anders ausdrücken. Sie weiß, was wir sind.«
Das ließ ihren Bruder stutzen. »Wie kommst du darauf?«
Sie sah Caid an. »Sie hat uns eine Herde genannt.«
»Ach.«
Cadell und Farlan gesellten sich zu ihnen.
»Stimmt irgendetwas nicht?«, fragte Cadell.
»Die Schwester weiß, was wir sind«, antwortete Caid.
»Sollten wir sie töten?«, fragte Farlan. Als Laila frustriert die Augen schloss und ein leises Knurren ausstieß, fügte er hinzu: »Was? Das ist eine berechtigte Frage.«
»Nein, ist es nicht!«, blaffte sie. »Wir können die Schwester nicht töten. Und wir töten sie definitiv nicht, nur weil sie Bescheid weiß. Bevor diese Sache unter Dach und Fach ist, bin ich mir sicher, dass eine Menge Menschen davon wissen werden. Sollen wir sie alle töten, Farlan?«
»Wenn sie uns Probleme machen …«
Laila schnaubte empört und folgte der Schmiedin. »Rede mit ihm, Caid!«
»Worüber soll er mit mir reden?«
»Darüber, dass du dich wie ein Esel benimmst.«
»Dir zufolge bin ich immer ein Esel.«
»Das ist wahr.« Caid legte Farlan einen Arm um seine breiten Schultern. »Und wenn du der Schmiedin irgendetwas antust, werde ich dir deinen Schwanz abschneiden und ihn meiner Cousine geben, damit sie daraus Schmuck macht. Verstanden?«
Farlan verdrehte die Augen, nickte jedoch. »Schön. Ich verstehe.«
»Großartig!« Caid schob seinen Kameraden vor sich her. Der weniger redselige Cadell ging an seiner Seite, und sein Lächeln ärgerte seinen Freund.
Caid spürte, dass er beobachtet wurde, und musterte den Wald. Er war tief und dunkel, obwohl es später Vormittag war, doch er sah all diese brennenden Augen, die ihn anstarrten. Ihn musterten. Plötzlich hatte er das Gefühl, dass die Schmiedin sich vielleicht irrte. Sie würden diese Wölfe wiedersehen und Caid freute sich nicht im Mindesten darauf.
Kapitel 3
Caid stand mitten in Keeley Smythes »Laden«, wie sie ihn nannte, und ausnahmsweise staunte er über das, was er sah.
Sie waren ihr etwa fünf Tage lang gefolgt, bevor sie ihr während dieses unbedeutenden Kampfes zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden hatten, doch sie hatten nie ihre Schmiede gesehen. Sie hatten sich nur ein Bild davon machen wollen, wer sie war und wie ihre Familie war.
Ihr »Laden« war nicht bloß eine Schmiede. Sie hatte offenbar die beiden Händlerstände hinter ihrem gekauft und Maurer angeheuert, die ihr ein ordentliches Gebäude errichtet hatten.
Der erste Teil war eine typische Schmiede mit einem großen Loch in der Decke, damit der Rauch abziehen konnte. Dahinter war jedoch der eigentliche »Laden«, in dem sie alle möglichen stählernen Waffen verkaufte, und hinter diesem Laden kam der Bereich, in den sie die Pferde brachte, um ihnen neue Hufeisen zu machen.
Es warteten bereits zwei Pferde auf sie, als sie eintraf, und sie waren offensichtlich glücklich darüber, sie zu sehen, denn sie stupsten sie liebevoll mit ihren massigen Körpern an und legten ihre riesigen Köpfe an ihre Schulter.
Doch das hier war kein Betrieb für eine einzelne Frau. Keeley Smythe hatte Arbeiter. Männer und ein paar Jungen, die an der Esse arbeiteten. Die Jungen befanden sich alle in der Ausbildung, die älteren Männer waren selbst richtige Schmiede. Vielleicht war es ihnen zu teuer gewesen, auf eigene Rechnung zu arbeiten, und zu gefährlich, für den Alten König tätig zu sein. Mehr als ein Schmied war Opfer der Wutanfälle des Alten Königs geworden. Oder der Wutanfälle seiner Söhne.
Nachdem sie geholfen hatte, die beiden Pferde zu versorgen, kehrte Keeley zu Caid und den anderen zurück. »Besorgen wir euch etwas zu essen und Wasser. Samuel, hinter dem Haus kannst du dich sauber machen. Wasch dir den Hals«, sagte sie und schob ihn zur Hintertür. »Ich werde dir danach eine heilende Salbe auftragen.«
Sobald Samuel durch die Tür war, tauchte eine ältere Frau aus einem anderen Raum auf. Sie kratzte sich gähnend am Kopf und war lediglich mit einem schlichten Hemd bekleidet. Als sie aus der Tür trat, streckte sie sich lang und genüsslich mit über den Kopf gereckten Armen und stellte sich dabei auf die Zehenspitzen. Tragischerweise trug sie keine Unterwäsche, und beim Strecken rutschte ihr das Hemd so hoch, dass ihnen allen eine hübsche Aussicht auf ihren Unterleib gewährt wurde.
»Gütige Götter, Weib!«, beschwerte sich einer der Schmiede. »Zieh dir verdammt noch mal etwas an!«
Caid hatte noch nie gehört, dass ein Mann einer Frau sagte, sie solle Kleider anziehen, daher ahnte er, dass sie so etwas häufiger tat.
Grinsend zeigte Keeley auf die Frau. »Das ist Keran, meine Cousine. Sie wohnt hier.«
»Es ist nur vorübergehend.«
»Es ist seit einigen Jahren vorübergehend.«
Keran öffnete endlich die Augen und betrachtete die Gruppe mit kaltem Blick. Jetzt bemerkte Caid plötzlich all die Narben: in ihrem Gesicht, an ihrem Hals, an ihren Armen und Beinen und erschreckend viele an ihrem Rumpf, den er teilweise zu sehen bekam, als sie sich ein weiteres Mal kurz streckte – zum großen Ärger der Arbeiter. Unter all diesen Narben waren jedoch Muskeln. Harte, durchtrainierte Muskeln.
Die Tätowierung, die sie seitlich an ihrem Hals trug, erklärte alles. Wie bei ihrer Cousine war es die Tätowierung einer Gilde. Doch anders als bei Keeley war es keine Arbeitergilde, sondern eine Kämpfergilde. Und das hieß, dass sie in jüngeren Jahren in eine Grube gestiegen war und gegen andere gekämpft hatte. Manchmal mit Waffen. Manchmal mit bloßen Händen. Und immer waren es Kämpfe auf Leben und Tod gewesen.
Er war noch nie einem Kämpfer oder einer Kämpferin mit ergrauten Schläfen begegnet. Sie schafften es nie, so lange am Leben zu bleiben.
»Vielleicht wärest du so freundlich, dir etwas anzuziehen, bevor meine Arbeiter von deinem wunderschönen Körper überwältigt werden«, neckte Keeley ihre Cousine kichernd.
Keran tätschelte Keeleys Schulter. »Ich weiß, wie schwer es für sie sein muss.« Sie drehte sich um, aber dann hielt sie inne und stieß einen sehr tiefen Atemzug aus. »Da ist etwas, das ich vergessen habe, Cousine. In meinem Zimmer …«
»Igitt. Ich will nichts davon wissen.«
Für einen Moment wirkte die Kämpferin verwirrt, schüttelte dann allerdings den Kopf. »Nein, du Idiotin. Da ist eine Besucherin. Sie ist ein paar Minuten vor dir hier eingetroffen.«
Stirnrunzelnd ging Keeley um ihre Cousine herum, und nachdem sie in den Raum gespäht hatte, lag auf ihrem sonst stets lächelnden Gesicht plötzlich ein gewittriger Ausdruck. Einer, der selbst Caid davon abhalten würde, sich mit ihr anzulegen.
»Was machst du hier?«, fragte Keeley scharf und trat zurück.
Eine Frau kam aus dem Hinterzimmer. Vom Hals bis zu den Füßen sittsam und anständig bedeckt von dicken weißen Roben, die sie eine Spur … unförmig aussehen ließen. Weiße Handschuhe. Eine kleine weiße Kappe prangte auf ihrem Hinterkopf und bedeckte kaum ihr kurz geschorenes dunkelblondes Haar. Sie war eine Nonne. Caid wusste jedoch nicht, welcher Glaubensgemeinschaft sie angehörte. Sie trug keinerlei Hinweise auf ihren Kleidern.
Sie hob die Hände, die Innenflächen nach außen gekehrt. »Bevor du irgendetwas sagst«, begann die Nonne, »lass mich einfach erklären …«
Laila gähnte und da bemerkte die Nonne sie zum ersten Mal … und dann den Rest von ihnen. Ihr Blick wanderte über ihre Einheit und sie ließ langsam die Hände sinken. Caid blinzelte überrascht. Das waren nicht die Augen einer frommen Nonne. Nicht so, wie sie sie gerade eben gemustert hatte.
»Wer sind deine Freunde?«, fragte die Nonne und versuchte zu lächeln.
Keeley stieß einen höhnischen Laut aus. »Verdammt, nimmst du mich auf den Arm?«
Verblüfft sah die Nonne wieder zu Keeley hinüber. »Was?«
»Du kommst hierher, stellst Fragen nach meinen Freunden, und denkst, ich schuldete dir eine Erklärung?«
»Es war eine harmlose Frage.«
»An dir ist gar nichts harmlos … Schwester.«
»Nach all diesen Jahren«, sagte die Nonne leise und kopfschüttelnd, »bist du immer noch eine nervige Kuh!«
Caid blinzelte überrascht, als ihr sanftes Gemurmel in Gebrüll mündete.
Keran schob sich zwischen die beiden und stieß sie auseinander. »Hört auf damit.« Beide Frauen öffneten den Mund, um zu widersprechen, doch Keran fügte schnell hinzu: »Ich werde mich hier gleich splitternackt ausziehen! Titten und Busch, für alle Welt sichtbar!«
Sie schlossen beide den Mund wieder und wandten sich voneinander ab.
»Gut«, sagte Keran. »Jetzt werde ich mir etwas anziehen. Und ihr zwei seid nett zueinander, bis ich wieder da bin, sonst fange ich an zu boxen. Verstanden?«
Sie wartete klugerweise nicht auf eine Antwort, doch sobald sie in ihr Zimmer verschwunden war und die Tür hinter sich geschlossen hatte, bemerkte die Nonne: »Ich kann nicht fassen, dass du dich immer noch nicht verändert hast.«
»Warum sollte ich mich verändern? Ich habe meine Familie nicht im Stich gelassen. Das warst du. Und wozu? Um irgendeinen Gott anzuflehen, damit du dich um alle kümmern kannst, bloß nicht um deine Familie?«
»Für dich ist es immer so einfach, nicht wahr?«
»Das ist es. Familie ist alles. Etwas, was du immer noch nicht gelernt hast und was dir immer noch nichts bedeutet.«
Schwestern. Sie waren Schwestern. Das wusste Caid jetzt. Sie sahen sich nicht im Mindesten ähnlich, aber nur Geschwister konnten auf diese Art das Schlimmste im anderen zutage fördern.
»Erzähl mir nicht, was mir etwas bedeutet, Keeley«, knurrte die Nonne. »Du hast keine Ahnung, was mir wichtig ist! Was für mich zählt!«
»Es ist mir egal, was für dich zählt! Mach, dass du verdammt noch mal aus meiner Schmiede kommst!«
»Ich werde gehen, wenn ich verdammt noch mal dazu bereit bin. Du hast mir nichts zu befehlen! Nicht mehr!«
Die Tür zum Hinterzimmer wurde geöffnet und eine inzwischen bekleidete Keran trat heraus. »Wie geht es uns?«, fragte sie grinsend. »Haben alle Spaß?« Als niemand antwortete, schlug sie vor: »Wie wär’s, wenn ich etwas zu essen für uns besorge. Ihr seht hungrig aus. Frisches Brot. Vielleicht etwas von Marcys Verkaufsstand? Klingt das nicht verlockend?«
»Ich habe zu arbeiten«, blaffte Keeley, bevor sie davonstürmte.
»Ich werte das mal als ein Ja«, erklärte Keran und ging zum Vordereingang.
Die Nonne rührte sich nicht vom Fleck. Sie war zu sehr damit beschäftigt, ihre Schwester mit schmalen Augen zu beobachten … bis Samuel durch die Tür hereinkam, die hinter den Laden führte. Er war frisch gewaschen. Bei seinem Anblick erstarrte die Nonne und ihre Augen weiteten sich. Der Junge hingegen geriet total in Panik, wirbelte herum und versuchte, durch die Tür zu fliehen, durch die er gerade erst hereingekommen war. Dabei lief er zuerst gegen den Türrahmen, prallte zurück, schüttelte seinen Schwindel ab, lief dann hinaus und schlug die Tür hinter sich zu.
Die Nonne stieß einen tiefen, gequälten Seufzer aus und schloss für einen Moment die Augen, bevor sie in Kerans Zimmer zurückging.
»Hast du das gesehen?«, fragte Laila Caid.
»Wie denn nicht?«, fragte Caid zurück. »Ich stehe doch hier.«
»Denkst du, die Nonne hat mit dem Jungen gevögelt?«, flüsterte sie kichernd.
»Dieser Junge«, eröffnete Caid ihr voller Überzeugung, »hat mit niemandem gevögelt. Außer vielleicht mit sich selbst.«
Keeley konzentrierte sich auf die Arbeit an einigen Eisenknäufen, weil sie das Bedürfnis hatte, drauflos zu hämmern, und Stahl erheblich mehr Sorgfalt erforderte. Zum Glück brauchten all die Söldner, die heutzutage den Weg in ihre Werkstatt fanden, Schwerter für ihre Schlachten. Keeley hatte sich ein kleines Vermögen mit dem bevorstehenden Krieg zwischen den königlichen Brüdern verdient, und in Zeiten wie diesen half ihr die Arbeit, mit ihren – wenn auch seltenen – Wutanfällen fertig zu werden. Sie konzentrierte sich ganz auf das Schmieden, verlor sich in ihrer Tätigkeit, sodass sie ihre Gedanken von der Tatsache ablenken konnte, dass ihre jüngere Schwester, die nur wenige Jahre nach ihr zur Welt gekommen war, den verdammten Nerv hatte, in dieser lächerlichen Aufmachung vor sie hinzutreten und sich aufzuführen, als wäre sie total fromm und vom göttlichen Geist durchdrungen. Das Miststück konnte sich glücklich schätzen, dass Keeley ihr nicht sofort eins auf die Nase gegeben hatte! Und die Tatsache, dass sie sie nicht darauf hingewiesen hatte, wie unförmig das Leben als götterverdammte Nonne ihre Schwester gemacht hatte, zeigte Keeleys Willenskraft. Denn diese weißen Roben verbargen gar nichts. Außer ihre Füße. Warum musste sie ihre verfluchten Füße verstecken? Musste sie, um Nonne zu sein, nicht bloß auf Sex verzichten, sondern auch auf ihre Füße?
Welche Religion bestand darauf, ihre Gläubigen in diesem Ausmaß zu verhüllen? Warum war das notwendig?
Warum hatte ihre Schwester alles aufgegeben, um sich diesen religiösen Fanatikern anzuschließen? So dachte Keeley über sämtliche Glaubensgemeinschaften, die überall im Land zu finden waren. Sie beherrschten das gesamte Leben ihrer Mitglieder und das gefiel Keeley ganz und gar nicht. Die Götter, denen sie aus freien Stücken huldigte, zwangen sie nicht dazu, sich auf irgendeine spezielle Weise zu kleiden. Sie verlangten nicht von ihr, ihr Leben für sie aufzugeben. Ein paar Opfer, für die sie nicht zu töten brauchte, zu Beginn der Pflanzsaison und um ihre wichtigsten Waffen zu segnen, und ihre Götter schienen mehr als glücklich zu sein.
Sie musste nicht ihre ganze Familie aufgeben! Das hatten ihre Götter nie von ihr verlangt.
Und Gemma war genauso erzogen worden wie sie. Ihre Mutter hatte gehofft, dass die Schwestern zusammen die Schmiede betreiben würden. Ein richtiges Familienunternehmen. Es war ein hübscher Traum gewesen, aber Keeley hatte nie damit gerechnet, dass ihre Schwester ihn verwirklichen würde, da sie das Schmieden niemals so geliebt hatte wie sie selbst. Keeley glaubte, dass die Menschen – so weit es möglich war – stets das tun sollten, was sie liebten. Sie liebte es, mit Stahl zu arbeiten, genauso wie ihr Vater es liebte, auf seiner Farm zu arbeiten. Warum sollte sie Gemma bitten, etwas – egal was – zu tun, was sie nicht liebte?
Sich jedoch in einem Nonnenkloster einzusperren und ihre Freiheit aufzugeben, um irgendeinem x-beliebigen Gott zu gefallen? Das war etwas, was Keeley niemals verstehen würde. Ihre Schwester verdiente etwas Besseres.
Doch nach ihrem sechzehnten Geburtstag war Gemma eines Nachts vor Einbruch des Winterfrostes plötzlich verschwunden und hatte nichts weiter hinterlassen als einen Brief, den ihre Eltern später fanden.
Das lag über ein Jahrzehnt zurück und keiner von ihnen hatte sie seither gesehen. Zwar hatten ihre Eltern im Laufe der Jahre hier und da ein paar Briefe bekommen, aus denen hervorging, dass Gemma in Sicherheit und aus freien Stücken fortgegangen war. Keine Nachrichten jedoch für Keeley oder ihre anderen Geschwister. Als hätte Gemma erwartet, sie würden vergessen, dass sie ein Teil der Familie war. Als wären sie nicht vom selben Blut.
Keeley verstand einfach nicht, was Gemma diese lange Zeit über von ihrer Familie ferngehalten hatte. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass das Zusammensein mit der eigenen Familie ausgerechnet dadurch ersetzt wurde, den ganzen Tag dazusitzen – oder zu knien –, um zu einem Gott zu beten, der vielleicht antwortete oder vielleicht auch nicht.
Und jetzt war Gemma zurück! War mit ihren makellos weißen Roben und behandschuhten Händen in Keeleys Schmiede geschneit gekommen und benahm sich, als wären sie eher alte Bekannte als Schwestern.
Keeley war so beschäftigt damit, vor Wut zu schäumen, dass sie keine Ahnung hatte, wie lange sie eigentlich schon an diesem letzten Knauf arbeitete und dabei ihren ganzen Zorn über die gegenwärtige Situation mit einfließen ließ. Normalerweise war Arbeiten einfach ihre Art, den Tag zu genießen, doch im Moment … hielt sie ihre Tätigkeit davon ab, ihre Schwester in den Schwitzkasten zu nehmen, um wieder ein wenig Vernunft in sie hineinzuquetschen.
Als sie endlich eine Pause machte, das Haar durchnässt, Arme und Hände schmutzig, trat sie von der Esse zurück und stieß mit einem der Amichai zusammen.
Ende der Leseprobe