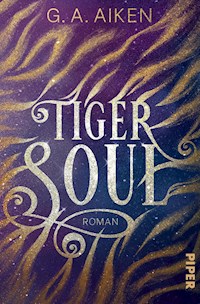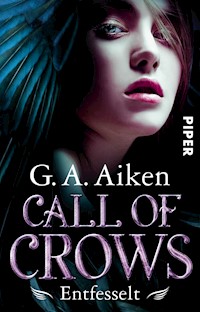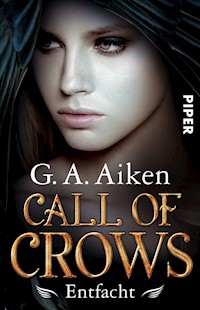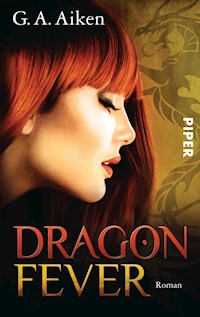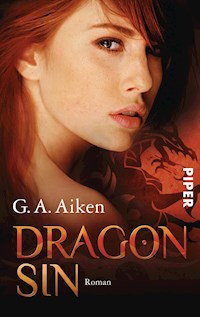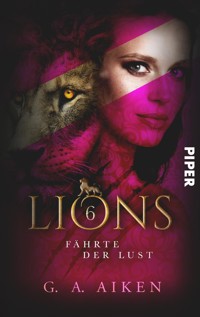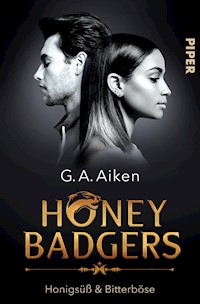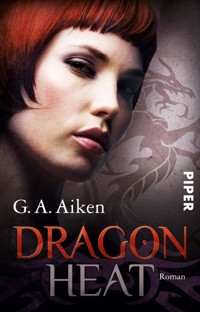9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. So heißt es zumindest. Gaius Domitus der Einäugige hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass es genau andersherum ist. Erst recht, wenn man als Drachenkönig über die Provinzen herrscht. Um Recht und Ordnung zu wahren und sich seine blutrünstige Verwandtschaft vom Hals zu halten, muss er sich mit einer waschechten Barbarin zusammentun. Die will jedoch nichts von ihm wissen. Kachka ist nicht nur wild, sondern auch gnadenlos – und genau so stellt sie sich ihren Partner vor. Mit einem verzogenen Drachen wie Gaius kann eine stolze Tochter der Steppen wie sie nichts anfangen. Zugegebenermaßen ist dessen Augenklappe irgendwie verwegen. Fragt sich nur, ob auch Gaius selbst verwegen genug ist, um Kachkas Leidenschaft zu entfachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Michaela Link
ISBN 978-3-492-96560-6
Juli 2017 © G.A. Aiken 2015 Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Feel the Burn« bei Zebra Books, New York 2015 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2017 Covergestaltung: Guter Punkt, München Covermotiv: Alex Malikov/shutterstock Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Prolog
Der Wutschrei der Verrückten Königin der Insel Garbhán hallte durch das stille Tal, scheuchte Vögel von den Bäumen und trieb kleine Tiere tiefer in ihren Bau.
Es war immer schrecklich, ihren Zornesausbrüchen beizuwohnen – sie waren so ungezähmt, so unmissverständlich bösartig. Wahrlich, es gab nichts Beängstigenderes, als wenn sich dieser Zorn gegen einen Einzelnen oder gegen eine ganze Armee richtete. Aber im Moment konnte die Königin ihren Zorn nicht gegen einen Einzelnen oder eine ganze Armee richten. Die waren alle längst fort.
Glücklicherweise ließ die Königin ihren Ärger nicht an denen aus, die ihr am nächsten standen. Das war auch der Grund, warum sie alle gerne an ihrer Seite kämpften. Denn so verrückt die Königin auch sein mochte, sie war nicht unnötig grausam.
Eins der wenigen Geschöpfe, die mit der Königin vernünftig zu reden wagten, wenn sie zornig war, lenkte ihre Stute näher heran. Die Frau war kein Mensch, auch wenn sie sich gegenwärtig in ihrer exquisiten menschlichen Gestalt befand. Nein, sie war eine Drachin. Ihr langes weißes Haar fiel in Wellen über den ganzen Rücken ihres Pferdes, und ihren scharfen blauen Augen entging nichts um sie herum. Wenn man die Wahrheit über sie nicht kannte, hätte man nicht vermutet, dass diese schlanke menschliche Figur eine große weiße Drachin verbarg, die einen Mann mit einem einzigen Klauenhieb in Stücke reißen konnte.
»Annwyl?«, rief sie. »Annwyl?«, versuchte sie es noch einmal. Aber die Königin hörte weder sie noch sonst jemanden. Sie war zu beschäftigt damit, mit einem ihrer Schwerter auf einen Baumstamm einzuschlagen. Es half jedoch nicht, davon wurde sie nicht müde. Wenn überhaupt, wurde sie davon nur noch zorniger.
Die Drachin drehte sich zu der Gruppe Soldaten hinter sich um. Sie wirkten verlegen, ihre bleichen Wangen röteten sich. Aber sie waren die Leibwache der Königin. Sie verstanden Annwyl die Blutrünstige besser als irgendjemand sonst. Sie sahen sie in der Schlacht. Sie sahen sie in ruhigen Zeiten. Sie sahen sie in ihrer schlimmsten Verfassung und in ihrer besten. Der Einzige, der sie besser kannte als ihre Leibwache? Ihr Gefährte, der schwarze Drache, Fearghus der Zerstörer.
»Annwyl, das bringt nichts.«
Die Königin rammte ihr Schwert in den Boden und stemmte die Hände in die Hüften, den Kopf gesenkt, während sie in heftigen Stößen atmete.
»Das weiß ich«, blaffte die Königin die weiße Drachin schließlich an. »Glaubst du, ich wüsste das nicht?«
»Ich denke, sie haben nach etwas gesucht«, verkündete ihr General, der gerade von der Ruine des Tempels zurückkehrte.
General Brastias war ein Held vieler Kriege und führte das Kommando über Annwyls Armeen. Er hätte, wie viele Generäle vor ihm, Männer ausschicken können, die solche Sachen erledigten, während er den Luxus und die Sicherheit der Insel Garbhán, des Machtzentrums der Südländer, genoss. Aber seine unerschütterliche Treue zu Annwyl und der Drachin Morfyd der Weißen war so groß, dass er bei Missionen wie dieser noch immer mit ihnen ritt.
Morfyd – eine Tochter der Drachenkönigin und damit eigentlich eine Prinzessin – schaute auf ihren Gefährten herab und streichelte dabei über den Hals ihres Pferdes, um dessen Anspannung zu lösen. »Wonach haben sie gesucht?«, fragte sie Brastias.
»Ich habe keine Ahnung, aber das Innere des Tempels ist völlig verwüstet.«
»Vielleicht wollten sie nur eine Botschaft hinterlassen.«
»Nein.« Annwyl schüttelte den Kopf. »Sie suchen etwas Bestimmtes.«
»Annwyl, sie zerstören jetzt seit Monaten Tempel. Lass uns daraus nicht irgendeine irre Verschwörung machen, wenn sie lediglich versuchen, deinem Ruf bei deinem Volk zu schaden.«
»Es steckt mehr dahinter. Das weiß ich.« Annwyl riss ihr Schwert aus dem Boden und rammte es wieder in die leere Schwertscheide, die sie über den Rücken geschnallt trug. »Das hier funktioniert einfach nicht«, beklagte sie sich und stapfte zu Blutvergießen, ihrem Streitross. »Sie sind uns immer einen Schritt voraus, weil wir keine Ahnung haben, was sie als Nächstes planen.«
»Also, was schlägst du vor? Wir haben bereits Spione …«
Annwyl schnaubte. Nicht weil sie gerade auf ihren wilden Hengst stieg, sondern weil sie von niemandem mehr auch nur einen Ton hören wollte.
»Ich will nichts über Dagmars und Keitas Legionen von Spionen wissen. Hier geht es nicht um Politik, Morfyd. Hier geht es auch nicht um Propaganda. Das hier ist etwas anderes.«
Sie schaute zu der Ruine des niedergebrannten Tempels hinüber, und ihre grüngrauen Augen funkelten unter ihrem dichten hellbraunen Haar hervor. »Ich habe es satt, Morfyd.«
»Annwyl …«
»Ich habe es satt.«
»Mach jetzt keine Dummheiten.«
Unter neuerlichem Schnauben wendete Annwyl ihr Pferd. »Lasst ihnen die angemessenen Todesriten zuteil werden«, befahl sie und deutete auf die Tempelpriester, die gefoltert worden waren, bevor man sie getötet hatte. Der Kult, der für die Folter und Ermordung der Priester verantwortlich war, bezeichnete es als »Reinigung«. Man reservierte sie für jene, die sich weigerten, ebenfalls den Gott Chramnesind, genannt der Blinde, anzubeten. »Dann verbrennt die Leichen.«
»Was wirst du …?«
Aber Annwyl war mit ihrem Pferd bereits davongeprescht. Brastias nickte einigen von den Männern zu, die am längsten mit Annwyl geritten und mit ihren Wutanfällen vertraut waren, und gab ihnen den stummen Befehl, ihrer Königin zu folgen. Nicht um ihre Sicherheit zu gewährleisten … sondern um die zu beschützen, die das Pech hatten, ihr über den Weg zu laufen. Vor allem, da die Königin nicht aussah wie jemand von königlichem Geblüt und sich auch nicht so benahm. In diesem Zustand konnte sie eine kleine Auseinandersetzung zwischen Bauern durchaus als eine Art Rebellenangriff missdeuten.
»Was ist, wenn sie recht hat?«, fragte Brastias seine Gefährtin, während die restlichen Männer absaßen und sich an die Arbeit machten. »Was, wenn es hierbei nicht nur darum geht, sie schlecht dastehen zu lassen?«
Die Drachin zuckte mit ihren trügerisch schmalen Schultern. »Dann mögen die Götter uns helfen, wenn sie, was immer sie suchen, vor uns finden.«
TEIL 1
1 Kachka Shestakova, ehemals von den Schwarzbärenreitern der Mitternachtsberge der Verzweiflung in den fernen Weiten der Steppen der Außenebenen, ließ den Blick über das wunderschöne Land schweifen, in dem sie jetzt seit fast sechs Monaten lebte. Jede Menge Gras, Bäume und Süßwasserseen. Reichlich Nahrung und glückliche Leute, die von einer gütigen Herrscherin regiert wurden.
Bei den Pferdegöttern von Ramsfor! Es war die Hölle auf Erden!
Und Kachka hatte das keinem anderen als sich selbst zu verdanken. Sie hatte ihr schmerzvolles, hartes Leben als Tochter der Steppen aufgegeben, als sie ihre Schwester vor ihrer Mutter gerettet hatte. Es war trotzdem eine Entscheidung, die sie wieder treffen würde, wenn sie musste, aber sie hätte nie gedacht, dass ihr Leben einmal so enden würde. Sie hatte angenommen, ihre Mutter würde sie beide zur Strecke bringen und töten. Kachka hatte sich geirrt. Ihre Mutter hatte nie die Chance dazu bekommen, weil sie Annwyl der Blutrünstigen, der Königin der Südländer, ins Auge gesehen hatte.
Die Königin hatte Glebovicha Shestakova getötet, ihr den Kopf abgeschlagen und ihr die Augen aus dem Schädel gerissen. Und das alles vor der Anne Atli, der Anführerin der Stämme der Außenebenen. Es war ein kühner Schritt der Königin gewesen. Oder, wie jene, die der Königin am nächsten standen, mehr als nur einmal gesagt hatten: »Ein vollkommen wahnsinniger Schritt.« Kachka wusste nicht, welches von beidem richtig war. Sie redete nicht mit der Königin. Und auch mit niemandem sonst, es sei denn, es ließ sich absolut nicht vermeiden.
Die Insel Garbhán wimmelte vor Drachen in Menschengestalt. Ohne die Hilfe ihrer Schwester konnte sie sie nicht voneinander unterscheiden. Kachka hasste die Drachen nicht. Sie verstand nur nicht, warum ein Mensch sich mit einem von ihnen paaren sollte. Nun gut, Männer waren sowieso größtenteils nutzlos, aber sie erfüllten ihren Zweck: Sie trugen den Müll raus, zogen die Kinder groß und dienten zur Fortpflanzung. Die Sache mit der Fortpflanzung hatte sich allerdings in den vergangenen Jahrzehnten verändert, soweit es Drachen und Menschen betraf. Die Königin selbst hatte Zwillinge, die halb Mensch und halb Drache waren. Ihretwegen – und wegen der anderen gemischten Nachkommen, die danach geboren worden waren – hatten sich die Götter der Menschen von ihren Schützlingen abgewandt. Und es den Gläubigen überlassen, die Anhänger Chramnesinds allein zu bekämpfen.
Das Ganze entwickelte sich zu einem ziemlich ausufernden Krieg, soweit Kachka das erkennen konnte. Die Südländer und die Bewohner des quintilianischen Reiches der Sovereigns waren nicht bereit, ihre vielen Götter aufzugeben. Und jene, die sich doch dafür entschieden, Chramnesind nachzufolgen, wollten niemandem erlauben, einen anderen Gott anzubeten. Man war dabei, Armeen aufzustellen und Schlachtpläne zu schmieden.
Und Kachka war nicht daran beteiligt. Das überraschte sie jedoch nicht besonders. Sie stammte nicht aus diesen Landen. Sie war eine Reiterin, und der Kampfstil ihres Volkes und dessen Gründe zu kämpfen waren völlig andere. Die Anne Atli und die Töchter der Steppen hatten zwar ein Bündnis mit Königin Annwyl und den Südländern – aber das hieß nicht unbedingt, an der Seite der Südländer zu kämpfen, sondern vor allem, die Südländer und ihre anderen Verbündeten nicht daran zu hindern, das Territorium der Außenebenen zu passieren.
Was sich jedoch mehr als irgendetwas sonst in Kachkas Seele bohrte, war dies: Bevor ihre Schwester mit der Bitte nach Hause zurückgekehrt war, in Königin Annwyls Namen mit der Anne Atli zu sprechen – der Titel wurde all ihren Anführerinnen verliehen, seit die erste Anne Atli den nutzlosen Männern die Macht abgerungen hatte –, hatte Kachka sich in stetigem Tempo in den Rängen hochgearbeitet. Sie wäre nie die Anne Atli geworden, aber sie hätte ihre eigenen Truppen in die Schlacht führen können. Vielleicht den Zusammenkünften aller Stämme beiwohnen können, wenn große Entscheidungen getroffen wurden.
Mit anderen Worten … sie hätte eine Aufgabe gehabt.
Kachka brauchte eine Aufgabe. Sie brauchte ein Ziel. Sie musste sich einen Namen machen. Ihre Mutter hatte zwar weder Kachka noch deren Schwester je gemocht, aber Kachkas Fähigkeiten und ihre Bereitschaft, sich in eine Schlacht zu stürzen, auch nicht geleugnet.
Und was blieb ihr hier?
Natürlich konnte sie der Armee der Königin beitreten, aber in Formation zu marschieren und Befehle von Personen entgegenzunehmen, bei denen es sich größtenteils um Männer handelte … nein. Niemals!
Sie war eine Tochter der Steppen, kein Schaf, das die Augen vor dem dekadenten Leben in diesen südländischen Territorien verschloss.
Was also blieb Kachka hier? Was?
»Ähm … Entschuldigung? Mylady?«
Kachka wand sich innerlich angesichts des lächerlichen Titels, auf den diese Südländer bestanden. Sie war es müde geworden, sie zu korrigieren, daher schnaufte sie nur und blaffte: »Was?«
»Margo« – die Leiterin des Küchenpersonals – »hat sich gefragt, ob du, wenn du nicht zu beschäftigt bist, etwas Fleisch für uns auftreiben könntest? Ein paar von den Cadwaladrs kommen heute Abend zum Essen, und die Metzger haben nicht genug, um sie alle mit ausreichend Fleisch zu versorgen. Du weißt ja, was für gute Esser Drachen sind. Also hat sie einfach …«
Während das Schaf weitersprach – und bettelte – und Kachka ihr ins Gesicht schaute, hob sie ihren Bogen, an dessen Sehne bereits ein Pfeil lag, und schoss auf das Erste, was sie aus dem Augenwinkel wahrnahm. Der Bison schrie einmal kurz auf, bevor er aus einer Halswunde blutend auf die Knie fiel.
»Sonst noch etwas?«, fragte Kachka.
Die Frau war jetzt sehr blass und schüttelte zur Antwort nur den Kopf.
Angewidert – die Jagd war für eine Tochter der Steppen keine Herausforderung, sondern wie Atmen – wandte Kachka sich ab und setzte sich in Bewegung.
»Kachka?« Sie hielt inne und schaute über ihre Schulter. Ihre Schwester stand hinter ihr.
»Scheiße«, murmelte Kachka, als ihre Schwester jetzt auf sie zukam.
»Kannst du nicht mal nett sein?«, fragte Elina in ihrer Muttersprache.
Kachkas Schwester trug dort, wo ihr zweites Auge hätte sein sollen, eine leuchtend violette Augenklappe. Das Auge war das Letzte gewesen, was ihre Mutter Elina genommen hatte. Im Laufe der Zeit hatte sie sich an den Verlust gewöhnt, und ihre Fähigkeiten beim Bogenschießen verbesserten sich von Tag zu Tag. Aber die Augenklappen … die lächerliche violette hier konnte nur von dieser idiotischen Drachin Keita kommen. Deren Interesse an Elinas Kleidung grenzte an Besessenheit. War es nicht schlimm genug, dass die Shestakova-Schwestern bereits dekadent und faul geworden waren? Mussten sie außerdem noch jämmerlich sein?
»Ich war nett«, antwortete Kachka, aber als Elina die Lippen schürzte, warf Kachka die Hände in die Luft. »Was willst du denn noch von mir, Schwester?«
»Wie wäre es damit, dass du das Personal nicht immer in Angst und Schrecken versetzt?«
»Du meinst die Schafe?«
»Und hör auf, sie so zu nennen! Du weißt, dass sie das hassen!«
Gaius Lucius Domitus, Eisendrache und einäugiger Rebellenkönig aus dem Westen, verdrehte sein verbliebenes Auge und setzte seinen Weg von den hinteren Hallen des Senats zum königlichen Palast fort. Er hatte wichtige Pläne zu schmieden und keine Zeit für ein weiteres Gespräch über seine mangelhaften königlichen Fertigkeiten.
»Ich finde, es ist dumm von dir, das zu tun.«
»Vielen Dank, Tantchen. Ich weiß dein Vertrauen in mich zu schätzen.«
»Sprich nicht in diesem Ton mit mir.«
»In welchem Ton?«
Lætitia Clydia Domitus packte Gaius am Arm und riss ihn herum. Sie war eine kleine Drachin und in ihrer Menschengestalt lächerlich winzig, aber sie hatte Macht. Diese Macht musste sie auch besitzen, sonst hätte sie nicht so lange überlebt. Es gab nur wenige, die die Herrschaft des Oberherrn Thracius überlebt hatten, obwohl sie ihn offensichtlich verabscheuten, doch Lætitia hatte es geschafft. Irgendwie.
»Erstens …«, hob sie an.
»Götter«, stöhnte Gaius. »Es gibt ein ›Erstens‹.«
»… solltest du nicht allein durch diese Straßen laufen. Du bist jetzt König. Das macht dich zu einer leichten Zielscheibe. Zweitens, du bist jetzt König. Du kannst nicht jedes Mal, wenn du Hummeln im Hintern hast, davonlaufen und Dummheiten anstellen. Du hast ein Reich zu regieren.«
»Ein Reich, das nicht länger existieren wird, wenn ich meine Cousins und Cousinen nicht in ihre Schranken weise und, was noch wichtiger ist, das Erstarken des Chramnesind-Kults nicht im Keim ersticke.«
»Da widerspreche ich dir nicht, aber ich verstehe nicht, warum du dafür selbst losziehen musst. Du hast Drachen und Männer zu deiner Verfügung. Warum setzt du sie nicht ein?«
»Warum? Weil ich niemandem traue. Außer meiner Schwester.« Als seine Tante bei der Erwähnung Agrippinas stöhnte und die Augen verdrehte, entzog Gaius ihr seinen Arm und ging davon.
»Warte! So habe ich es nicht gemeint.«
»Doch, hast du.«
»Nein. Habe ich nicht. Ich liebe deine Schwester …« Diese Worte entlockten Gaius ein Schnauben, und Lætitia griff erneut seinen Arm und zerrte ihn herum, mit noch mehr Kraft, als er ihr ohnehin zugetraut hätte. »Wage es nie, Junge, meine Loyalität dir und deiner Schwester gegenüber in Zweifel zu ziehen. Ihr beide seid das Einzige, was mir von den wenigen Verwandten, die ich geliebt habe, geblieben ist, und das soll schon etwas heißen. Aber deine Schwester ist durch die Hölle gegangen. Die absolute Hölle. Und sie hat sich noch nicht davon erholt – ganz gleich, wie sehr ihr beide vorgebt, es sei anders. Daher scheint es mir, gelinde gesagt, eine riskante Entscheidung zu sein, den Thron in ihre Klauen zu legen, während du davonspazierst, um den Heldenkönig zu spielen.«
»Nun, dann … schätze ich …« Gaius schaute weg und tat so, als denke er einen Moment lang nach. »Dann wirst du ihr einfach mit leitender Hand zur Seite stehen müssen, während ich weg bin.«
Aus dem Augenwinkel sah er, wie seine Tante verzweifelt versuchte, ein Lächeln zu verbergen. Es war kein boshaftes Lächeln. Im Gegensatz zu den meisten seiner Sippe war sie nicht boshaft. Aber zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, es würde ihr gestattet sein, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten direkt einzusetzen, statt – wie sonst üblich – nur hinter den Kulissen. Ihre Machenschaften waren legendär, aber sie wurden häufig einem ihrer anderen Geschwister zugeschrieben. Natürlich war es ihr Bestreben, nicht offen mitzumischen, was sie so lange am Leben gehalten hatte.
»Das«, sagte Lætitia schließlich, »wird deiner Schwester gar nicht gefallen.«
»Natürlich wird es ihr gefallen«, log Gaius. »Sie hat Respekt vor dir, Tantchen.«
»Gütige Götter, Gaius Lucius Domitus!«, rief sie aus. »Du bist genau wie dein Vater – so ein Lügner!«
Zankend machten sich die Schwestern auf den Weg zurück in das Schloss der Königin, aber Kachka wurde bewusst, wie sehr die Frau vom Küchenpersonal sich damit abmühte, den Bison hinter sich herzuziehen. Wütend – auf alles und jeden! – packte Kachka das tote Tier an einem Bein, und ihre Schwester an einem zweiten. Zusammen zerrten sie den Bison zum Palast, und den ganzen Weg über stritten sie miteinander, während das Mädchen rennen musste, um mit ihnen Schritt zu halten.
»Ich verstehe einfach nicht, warum du so unglücklich bist«, sagte Elina und wuchtete den Bison über eine Bodenwelle. »Wir haben reichlich zu essen und zu trinken und weiche Betten, in denen wir schlafen können.«
»Du brauchst mir nicht ins Gedächtnis zu rufen, wie jämmerlich ich geworden bin, Schwester.«
»Wieso ist es jämmerlich, einige Annehmlichkeiten zu genießen?«
»Die Tatsache, dass du das fragen musst, erschüttert mich mehr, als du ahnst.«
»Dann such dir eine Aufgabe, Kachka, statt herumzusitzen und alle zornig anzufunkeln.«
»Was kann ich hier schon machen?«, fragte Kachka. »Was gibt es für mich zu tun? Landwirtschaft?« Sie hielt inne und sah ihre Schwester zornig an. »Willst du, dass ich das werde? Eine Bäuerin? Wie ein … Mann? Denkst du so von mir? Dass ich ein wertloser Mann bin?«
»Natürlich nicht! So etwas würde ich niemals denken. Aber vielleicht kannst du mit Dagmar Reinholdt, der Nordländerin, reden. Sie führt doch immer irgendetwas im Schilde.«
»Sie hasst mich«, rief Kachka ihrer Schwester in Erinnerung.
»Nun, wenn du nicht ihren Neffen gefickt hättest …«
»Er war gerade da!«
Sie machten sich wieder daran, den Bison-Kadaver weiterzuschleppen.
»Es muss doch irgendetwas Konstruktives geben, das du tun kannst«, fuhr ihre Schwester fort. »Ich bin mir sicher, General Brastias wäre überglücklich, dich bei sich zu haben …«
Kachka blieb wieder stehen, nur wenige Schritte von dem Heim der Königin entfernt. »Befehle von einem Mann entgegennehmen? Hast du den Verstand verloren?«, brüllte sie. »Haben denn alle den Verstand verloren?«
Wie zur Antwort auf ihre Frage ritt die Königin selbst die Stufen ihres Schlosses hinauf, saß von ihrem riesigen schwarzen Ross ab – ehrlich, wer brauchte so viel Pferd? –, ging einige Stufen hinauf und blieb dann wie angewurzelt stehen.
Und in dem Augenblick schrie die Königin plötzlich. Und schrie. Und schrie noch ein wenig mehr.
Alle, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert hatten, rannten, als sie den Schrei hörten. Soldaten. Kaufleute. Stillende Mütter. Alle. Sie rannten und versteckten sich.
»Das beantwortet meine Frage«, murmelte Kachka.
»Sei still.«
Die Königin verschwand in ihrem Zuhause, und Kachka und Elina zerrten den Bison bis ganz hinüber zu den Küchen. Sobald sie den Kadaver dort fallen gelassen hatten, gingen sie in die verlassene Haupthalle.
Kachka stand einen Moment lang da, bevor sie verkündete: »Siehst du? Hier gibt es nichts zu tun!«
Gaius trat in den Palast, der jetzt ihm und seiner Zwillingsschwester gehörte. Der ursprüngliche Palast, von dem aus seine Cousine Vateria und deren Vater, Oberherr Thracius, geherrscht hatten, war während der Rettung von Gaius’ Schwester Aggie zum Teil zerstört worden; danach hatten Gaius und einige ausgewählte Drachenfreunde den Rest davon dem Erdboden gleichgemacht. Er hätte diesen Palast niemals stehen lassen, ganz gleich, wie viele der Seinen dort gelebt und geherrscht hatten. Nicht, nachdem Vateria, dieses Miststück, seine Schwester in dem Palast gefangen gehalten hatte. Sie waren mit ihrer Cousine Vateria aufgewachsen, hatten ihr aber von Anfang an nicht nahegestanden. Ihr nie getraut. Sie definitiv nie gemocht. Und als ihr Vater dann von seinem eigenen Bruder ermordet worden war, hatte Gaius sich vorgenommen, eines Tages mit Thracius um den Thron zu kämpfen. Aber als er endlich alt und stark genug gewesen war, um Thracius herauszufordern, hatte Vateria – die schon immer überaus gerissen war – Aggie gefangen genommen und in dem alten Palast als Geisel gehalten. Sie hatte gewusst, dass es die einzige Möglichkeit war, Gaius in Zaum zu halten. Ihn »auf seinen Platz zu verweisen«, wie sie es gern ausdrückte. Und es hatte funktioniert. Aggie war in einer erträglichen Situation gewesen, da sie nach wie vor von königlicher Geburt und eine Nichte von Thracius war. Aber dann hatte sich Thracius zum Krieg gegen die Südländer aufgemacht, war gegen die Drachenkönigin angetreten und hatte sein Miststück von Tochter mit Aggie allein gelassen. Fünf lange, qualvolle Jahre.
Aggie weigerte sich, über das, was geschehen war, zu sprechen, aber in manchen Nächten wachte sie schreiend auf. In anderen Nächten schlief sie überhaupt nicht.
Und ja, Gaius gab sich die Schuld daran, obwohl er wusste, dass Aggie es nicht tat. Aber wie konnte er sich nicht die Schuld daran geben? Seine arme, schwache, schutzlose Schwester, gefangen im Netz dieser bösartigen …
»Du!« Aggie packte Gaius an der Kehle, sodass er würgen musste, und zerrte ihn in einen anderen Raum. »Entschuldige uns bitte, Lætitia«, sagte sie zu ihrer Tante, bevor sie direkt vor deren verblüfftem Gesicht die Tür zuknallte.
»Was hast du getan?«, fragte seine Schwester.
»Kannst du etwas genauer sein?«
»In unserem Thronsaal befinden sich Mì-runach. Warum?«
»Mì-runach?« Krieger, die absolut niemandem außer der Drachenkönigin selbst unterstanden? »Bist du dir sicher?«
»Natürlich bin ich mir sicher. Also, warum sind sie hier?«
»Ich habe keine … oh.« Gaius wand sich. »Oh.«
»Was hast du getan?«
»Ich hatte nur dein Bestes im Sinn.«
»Du Idiot«, seufzte Aggie, gerade als Lætitia an die Tür klopfte und schnell eintrat.
Sie schloss die Tür, wandte sich ihrer Nichte und ihrem Neffen zu und verkündete: »In deinem Thronsaal sind Bauern. Südländische Bauern!«
»Das sind Mì-runach«, erklärte Aggie ihr und deutete auf Gaius. »Die dieser Idiot angefordert hat.«
»Gaius!«
»Ich habe sie nicht angefordert.«
»Was hast du dann getan?«, fragte seine Schwester.
»Ich habe die Drachenkönigin um Hilfe gebeten, aber …«
»Aber?«
»Ich dachte, sie würde Cadwaladrs schicken.« Die Cadwaladrs waren ein südländischer Clan von niedriggeborenen Drachen, die schon als Schlüpflinge in den Gepflogenheiten des Krieges und der Verteidigung der Territorien der Drachenkönigin ausgebildet wurden. Sie mochten nicht besonders angesehen sein, aber sie waren sehr gefürchtet. Und das nicht ohne Grund.
»Warum willst du lieber diese Kampfhunde hier haben als die Mì-runach?«
»Du brauchst Schutz.«
Aggie richtete sich plötzlich kerzengerade auf, das Rückgrat durchgedrückt. Ihr langes stahlfarbenes Haar fiel ihr in kunstvollen Zöpfen und Locken über den Rücken. Sie sah erstaunlich majestätisch aus, wie immer, wenn sie in der Defensive war. »Warum sollte ich Schutz brauchen?«
»Weil er sich wieder auf eine dumme, vergebliche Reise begibt, deshalb.«
Gaius schloss kurz die Augen. »Lætitia«, seufzte er.
»Was ist? Ich lüge nicht. Sag mir, dass ich lüge«, befahl sie. »Sag es mir.«
Wenn Lætitia gehofft hatte, Aggie auf ihre Seite ziehen zu können, war sie gerade gescheitert, denn jetzt kicherten die Zwillinge. Wie sie es immer taten, seit sie Schlüpflinge waren.
»Ihr zwei! Ich schwöre es bei den Göttern …«
Aggie räusperte sich. »Tante Lætitia, würdest du uns bitte entschuldigen?«
»Ihr schickt mich wieder da raus? Zu diesen Plebejern?«
»Du könntest auch einfach auf dein Zimmer gehen. Aber du musst gehen … du weißt schon … woandershin.«
Lætitia riss die Tür auf und schaute sich noch einmal nach ihrer Nichte und ihrem Neffen um. »Pah!«, blaffte sie, bevor sie den Raum verließ und darauf achtete, dass sie die Tür hinter sich zuknallte.
»Hast du etwas dagegen, mir zu verraten, was hier los ist?«, fragte Aggie. »Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn Lætitia mehr weiß als ich. Es bereitet ihr viel zu viel Vergnügen. Und wir wissen beide, dass ich das nicht zulassen kann.«
Dagmar Reinholdt hatte sich völlig in ihre Papiere, Schriftrollen und Pergamente vertieft, die ihren Schreibtisch übersäten. Ihre Hände waren voller Tinte. Und sechs ihrer am besten abgerichteten Hunde umringten sie. Seit dem letzten Anschlag auf ihr Leben vor fast sieben Monaten war das immer so. Ihr Gefährte Gwenvael der Schöne bestand darauf. Sie hatte auch noch einen Assistenten, aber der war von Morfyd ausgewählt worden, die mit ihrer Magie sicherstellte, dass der Nordländer, den ihre Brüder geschickt und den Dagmars Vater für gut befunden hatte, außer seinem Verstand nichts und niemandem verpflichtet war.
Das einzige Problem allerdings war … er verabscheute Hunde. Und ihre Hunde verabscheuten ihn.
Daher hatte er seinen eigenen Bereich im Turm, zusammen mit Bram dem Gnädigen, Dagmars Neffen Frederik Reinholdt – der gegenwärtig in den Nordländern mit den dortigen Kriegsherrn zusammenarbeitete, um zu gewährleisten, dass sie gegen mögliche Angriffe von Herzog Salebiri und den Chramnesind-Kult gerüstet waren – und Unnvar, Dagmars einzigem Sohn.
Dieser Turm. Dieser lächerliche Turm, den die Königin erbaut hatte, war zum Knotenpunkt umsichtiger Vernunft und entschiedener Kriegsplanung geworden. Schwer zu glauben, denn Dagmar hatte monatelang gedacht, die Königin sei dabei, eine Tötungsmaschinerie für ihre Feinde zu erschaffen.
Dagmars Hunde knurrten Sekunden, bevor die Tür aufging. Drei von ihnen sprangen den Eindringling an, bereit, ihm das Fleisch vom Gesicht zu reißen, aber Dagmars ruhiges »Nein« stoppte sie. Sie zogen sich widerstrebend und immer noch knurrend zurück, während die Königin in den Raum schritt. Nichtsahnend wie immer.
»Sie haben es schon wieder getan«, knurrte die Königin und tätschelte die Hunde, die nur Augenblicke zuvor bereit gewesen waren, sie in Stücke zu reißen. Im Gegensatz zu Dagmars Assistenten liebte Annwyl Hunde. Hunde jeder Art. Selbst die nutzlosen.
»Wer hat was wieder getan?«, fragte Dagmar, ohne von ihrer Arbeit aufzuschauen.
»Dieser blöde Kult hat schon wieder einen meiner Tempel zerstört.«
»Das ist nicht dein Tempel. Du magst die Götter nicht einmal. Und du weigerst dich, sie anzubeten.«
»Es war mein Tempel, weil er auf meinem Land gestanden hat.«
Dagmar lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, legte ihre Feder auf den Schreibtisch und massierte sich ihre müden Finger. »Also, was willst du tun, meine Königin?«
»Was?« Annwyl funkelte sie an. »Das frage ich dich!«
Dagmar zuckte die Achseln. »Dazu habe ich keine Meinung. Ich würde sehr ungern dazwischengeraten, wenn du deine wichtigen Entscheidungen triffst.«
Annwyl runzelte verwirrt die Stirn. »Was zum Schlachtenscheiß redest du da? In letzter Zeit verstehe ich dich einfach nicht. Du benimmst dich seit Monaten wie ein totales Arschloch!«
»Ich kenne meinen Platz, Annwyl. Ich würde nur ungern jemandem auf die Füße treten.«
Annwyl beugte sich vor und schaute Dagmar ins Gesicht, hinter all dieses Haar, das sie sich weigerte aus dem Gesicht zu kämmen. »Was ist los mit dir?«, fragte sie.
»Nichts, meine Lehnsherrin. Findest du, dass etwas mit mir los ist?« Dagmar blinzelte einige Male. »Vielleicht mit meinen Augen?«
Annwyl fuhr zurück. »Was? Was ist los mit deinen …? Wovon redest du?«
Dagmar hob zu sprechen an, aber Annwyl schnitt ihr das Wort ab. »Vergiss es! Ich finde es schon allein heraus!« Sie drehte sich auf dem Absatz um, stürmte aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.
»Warum quälst du sie so, Mum?«
Dagmar schaute hinter sich. Die fünf jüngsten ihrer sieben Kinder saßen hinter ihr auf dem Boden. Nein. Dagmar hatte keineswegs übersehen, dass sie sich im Raum befanden. Ihre Töchter waren vielmehr durch die Wand gekommen. Dagmar hatte entdeckt, dass sie dazu mühelos in der Lage waren.
In der einen Sekunde waren sie nicht da … und in der nächsten Sekunde waren sie es.
Etwas, das sich immer schwerer vor dem Rest der Familie verbergen ließ.
»Ich quäle eure Tante Annwyl nicht.«
»Doch, tust du«, beharrte die Älteste von Gwenvaels Fünf, wie sie jetzt sogar ihr eigener lächerlicher Vater nannte. »Seit sie gedroht hat, dir die Augen auszukratzen. Aber sie hat es nicht so gemeint, wie du glaubst.«
»Das sind Erwachsenen-Themen, die ich nicht mit euch besprechen werde.«
»Nur dass Grandmum sagen würde, dass du dich nicht wie eine Erwachsene benimmst.«
»Nun, eure Grandmum kann mich … Moment.« Bei der Erwähnung ihrer Großmutter, der Drachenkönigin Rhiannon der Weißen, drehte Dagmar sich auf dem Stuhl herum, sodass sie ihre Töchter richtig ansehen konnte. »Wie oft redet ihr mit eurer Grandmum, wenn ich nicht dabei bin?«
Die Jüngste der Fünf wollte gerade etwas erwidern, aber drei verschiedene Hände hielten ihr den Mund zu, um sie zum Schweigen zu bringen, und ohne ein weiteres Wort waren die Mädchen verschwunden.
Dagmar drehte sich wieder nach vorn, legte die Hände auf ihren Schreibtisch und murmelte: »Das kann einfach nichts Gutes heißen, nicht wahr?«
Elinas Vorschlag, ein Spiel zu spielen, änderte nichts an Kachkas Gemütsverfassung. Wenn überhaupt, fühlte sie sich dadurch nur noch nutzloser.
Elina musterte mit ihrem gesunden Auge das Spielbrett und dachte über ihren nächsten Zug nach.
So sah jetzt das Leben der Shestakova-Schwestern aus.
Dekadent. Faul. Verwöhnt. Sie saßen herum. Spielten Brettspiele wie Kinder.
Dass Erwachsene Spiele spielten, erstaunte Kachka. Bei den Töchtern der Steppen ließ man die Dreijährigen solche Spiele spielen, um ihnen zu helfen, das Konzept von »Spalten, erobern und vernichten, damit einem das nächste Dorf oder die nächste Stadt einfach gibt, was man verlangt« zu verstehen.
Dass jetzt die beiden Schwestern wieder solche Spiele spielten, traf Kachka deshalb bis ins Mark.
Wie tief sie gesunken war! Würde es denn nie besser werden?
Endlich, nach langem Nachdenken setzte Elina zu ihrem Zug an … und verfehlte ihren Spielstein um etliche Zentimeter. Obwohl es Elinas Reaktion nach zu urteilen genauso gut eine Meile hätte gewesen sein können.
Kachkas Schwester knurrte, dann fuhr sie mit der Hand über das Brett … das sie ebenfalls verfehlte.
Im selben Moment flog das ganze Brett durch die Luft und das Wutgebrüll ihrer Schwester schreckte die schwachen, voller Wahnideen steckenden Diener auf, die für diese reichen, dekadenten Adeligen arbeiteten.
Kachka seufzte. »Du warst am Gewinnen.«
»Halt den Mund!«
Kachka lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »So ein Gejammer. Du flennst wie Baby!«
»Ich bin immer noch schwach!«
»Letzte Woche hast du Bären erlegt.«
»Ich habe drei Schüsse dafür gebraucht!«
»Es ist nicht Auge. Es ist Leben, das wir jetzt leben.« Sie zeigte auf einen der Drachen, der gerade vorbeiging. »Dekadent! Wie dieser Drache.«
Der Drache blieb stehen und fasste sich an die Brust. »Ich? Kachka, du liebst mich!«
»Ich liebe deine Schönheit. Für deinen Charakter habe ich nichts übrig. Du stehst für alles, was wir hassen.«
»Warum redest du so mit ihm?«, fragte Elina. »Er kann nichts dafür, dass er schön, aber wertlos ist.«
»Ich bin nicht wertlos! Ich bin Gwenvael der …«
»Das interessiert uns nicht, Echse!«, blaffte Kachka.
»Schrei ihn nicht an!«
»Verhalte dich nicht so jämmerlich! Dir fehlt also Auge! Komm drüber weg!«
Das war der Moment, in dem Elina Kachka unter dem Tisch einen Tritt versetzte. Also trat Kachka zurück.
»Au!«
»Heul doch!«
Elina packte Kachka an ihrem Wildlederhemd. Das bekam sie problemlos zu fassen.
Kachka schlug ihrer Schwester auf den Arm, aber das führte nur dazu, dass Elina Kachka vom Stuhl zerrte.
Kachka fasste Elina an den Schultern und stieß sie wieder gegen den Tisch.
»Hört auf damit! Alle beide!«, rief der Drache. »Ich bin schön genug, um meine Schönheit mit allen zu teilen!«
Kachka ignorierte den schönen, aber nutzlosen Drachen und holte aus, um ihrer Schwester einen Schlag zu versetzen, aber jemand packte ihren Arm und hielt ihn fest.
Sie nahm an, dass es der Drache war, aber als sie hinschaute, war es die Königin, die sie festhielt.
Doch was ihr Sorgen machte, war der Ausdruck auf dem Gesicht der Königin. Sie starrte Kachka an, als hätte sie sie noch nie zuvor gesehen.
»Du«, sagte die Königin.
»Was ist mit mir?«
Zuerst antwortete sie nicht, sondern gaffte nur. Dann riss sie Kachka plötzlich von ihrer Schwester weg. »Komm mit«, befahl sie.
»Nein!«, rief Elina und packte Kachkas anderen Arm. »Töte sie nicht!«
Die Königin blinzelte. »Was?«
»Es ist alles in Ordnung, Schwester«, murmelte Kachka besänftigend. »Ich bin bereit für Tod.«
»Wovon redet ihr zwei …?«
»Keine Sorge«, warf der schöne Drache ein. »Ich werde dafür sorgen, dass du ein bezauberndes Begräbnis bekommst.«
»Gwenvael!«, brüllte Annwyl.
»Warum schreist du mich an? Ich habe nichts getan. Das war die Außenseiterin!«
Annwyl riss Kachka aus dem Griff ihrer Schwester. »Ihr wird schon nichts passieren«, fauchte sie, bevor Elina sich weiter beschweren konnte.
»Mach dir keine Sorgen, Schwester«, sagte Kachka, als die Königin sie wegzerrte. »Ich werde tapfer in Tod gehen!«
»Es könnte eine Falle sein«, warnte Aggie.
»Ich weiß. Aber ich muss das Risiko eingehen.«
Aggie nickte und lief dann wieder auf und ab. Sie wirkte beunruhigt, und er war sich bis zu einem gewissen Grad sicher, dass sie sich wirklich Sorgen machte. Aber Gaius wusste überdies, dass seine Schwester immer besorgt schien, wenn sie nachdachte. Analysierte. Sie war sehr gut im Analysieren.
»Wirst du unseren Cousin herholen?«
»Das habe ich nicht vor, Schwester.«
Sie blieb stehen und sah ihn mit ihren grauen Augen fest an. »Gut.« Sie begann wieder auf und ab zu gehen. »Und was ist mit Vateria?«
»Nichts Neues über sie. Gar nichts. Sie könnte tot sein.«
»Dieses Miststück ist nicht tot, und das wissen wir beide.«
»Was ich weiß, ist, dass sie verletzt wurde.«
Aggie blieb wieder stehen und wandte sich zu ihrem Bruder um. »Verletzt?«
Er zuckte die Achseln. »Behauptet General Iseabail. Sie wurde an der Wirbelsäule verletzt. Sie kann angeblich gehen, aber sie wird nie wieder fliegen.«
Aggie schüttelte den Kopf. »Wie lange ist das jetzt her?«
»Ein paar Jahre.«
»Und du hast es mir nie erzählt?«
»Ich spreche mit dir nicht über sie. Es regt dich zu sehr auf.«
»Nein, Bruder. Es regt dich zu sehr auf.«
»Ich habe es zugelassen, dass sie dich geschnappt hat.«
Aggie lachte. »Das hast nicht du zugelassen, sondern, wenn überhaupt, habe ich mich von ihr schnappen lassen.«
»Nein …«
»Sie wollte mich haben. Und sie hätte keine Ruhe gegeben, bis sie mich in die Finger bekommen hätte. Aber das ist lange her, Gaius. Ich weigere mich, noch länger in diesem Albtraum zu leben. Ich weigere mich, mich von der Vergangenheit beherrschen zu lassen, wie es früher der Fall war.«
»Ich werde nicht ruhen, bis Vateria tot ist«, versprach Gaius seiner Schwester. Wieder einmal. »Aber bis dahin … muss es reichen, den Rest unserer Cousins und Cousinen zu töten, die ihr treu ergeben sind.«
»Nimmst du eine Armee mit?«
»Nein. Nur einige meiner treuen Soldaten. Und ich gehe als Zenturio, nicht als König.«
»Gut.«
»Ich werde ihn finden. Ich werde ihn töten. Und ich werde seinen Kopf auf einen Pfahl draußen vor unseren Palastmauern spießen.«
Aggie verzog angewidert den Mund. »Was sind wir jetzt? Südländer?«
Sie fanden sich in den Stallungen mit den riesigen Pferden der Königin wieder. Elina nannte sie »Reisekühe«, womit sie Kachka immer zum Lachen brachte.
Die Königin schickte ihre Stallburschen weg und fing an, die Mähne des schwarzen Hengsts, den sie »Blutvergießen« nannte, zu bürsten. Ein ziemlich beunruhigender Name, selbst in den Ohren einer Reiterin.
Kaum dass die Königin die lange Mähne, die über den großen Kopf des Pferdes fiel, zur Seite bürstete, schien sie sich völlig zu beruhigen. Der Wahnsinn, der die Königin immer umgab, schien sich aufzulösen.
Die Tatsache, dass das Pferd in Gegenwart der Königin so ruhig war, ihr so sehr vertraute, verriet Kachka mehr als alle Worte oder Taten von Menschen und Drachen. Pferde waren immer ehrlich.
»Du schleppst mich also hierher, Südländerkönigin. Warum?«
Annwyl sah Kachka an und lächelte kaum merklich. Soweit Kachka sich erinnerte, war dies das erste Lächeln, das sie von der Frau zu sehen bekam. »Du langweilst dich, nicht wahr, Kachka?«
»Ob ich mich langweile? Nein. Ob ich schwach und jämmerlich werde? Eindeutig.«
»Schwach und jämmerlich? Du? Wirklich?« Annwyl rieb ihre Nase am Maul des Pferdes, und das Pferd erwiderte die Zärtlichkeit. Es würde für sie sterben, das wusste Kachka nur aus ihrer Beobachtung der beiden. Allerdings war Kachka sich sicher, dass Annwyl genauso empfand. In der Gegenwart von Tieren schien es ihr besser zu gehen. Bei Pferden. Hunden. Drachen.
»Du hast eine Menge aufgegeben, als du mit deiner Schwester hergekommen bist, nicht wahr?«
Kachka hatte alles aufgegeben, aber sie wollte nicht, dass ihre Schwester das je erfuhr. Also sagte sie stattdessen: »Wir alle treffen Entscheidungen. Und dann müssen wir damit leben.«
»Du weißt, dass deine Schwester hier bei uns in Sicherheit ist. Die Drachen lieben sie. Sogar Rhiannon, und sie hat früher Menschen als Leckerbissen verzehrt.«
»Sie beschnuppert manchmal mein Haar. Fühlt sich nicht gut an.«
»Ja, lass sie das nicht zu lange tun.« Annwyl ging zur Stalltür, stellte den Fuß auf eine Latte und legte die Arme oben auf dem Gatter ab, die Bürste immer noch in der Hand. »Wie würde dir eine Arbeit gefallen, Kachka Shestakova?«
»Ich erjage bereits euer Essen.«
»Nein, nein. Ich meine eine richtige Arbeit.«
»Ich werde mich nicht deiner Armee anschließen, Annwyl die Blutrünstige. Ich werde keine Befehle von Männern entgegennehmen.«
»Ja, das habe ich schon geahnt, als du dem Hauptmann meiner Wache gesagt hast, dass du ihm, wenn er dich nicht in Ruhe lässt, den Penis abreißen und ihn damit ficken würdest.«
»Er kann sich glücklich schätzen, dass ich das nicht durchgezogen habe.«
»Du brauchst eine Aufgabe. Ich habe eine für dich gefunden.«
»Was für eine Aufgabe, wenn nicht die einer Jägerin, die Drachen mit täglicher Fleischration versorgt?«
»Der Chramnesind-Kult hat überall in meinen Gebieten Tempel angegriffen. Hat die Priester und Priesterinnen getötet. Oder sie, wie sie das nennen, gereinigt. Sie scheinen in kleinen Gruppen zu arbeiten, denn kaum haben sie einen Tempel betreten, sind sie auch schon wieder weg und hinterlassen nichts als Tod. Bis meine Truppen eintreffen, ist schon alles vorüber.«
»In Gruppen?«
»Es ist mehr als eine Gruppe, denn sie haben schon in einer einzigen Nacht Tempel angegriffen, die etliche Stunden voneinander entfernt liegen.«
»Und was soll ich gegen deinen Kult unternehmen?«
»Finde sie. Töte sie alle. Sorg dafür, eine hübsche, blutige Nachricht zu hinterlassen, damit Herzog Salebiri und sein Chramnesind-Kult wissen, dass sie von mir kommt. Nach allem, was ich von dir gesehen habe … ich glaube, das ist etwas, das du kannst.«
»Du glaubst, ich sei so, wie alle Welt sagt? Barbarische Reiterin, die viel lieber tötet als redet?«
»Ja«, antwortete die Königin ohne Zögern.
Kachka nickte. »Du hast recht. Das tue ich tatsächlich. Jetzt erzähl mir mehr über Chramnesind-Kult, Südländerkönigin.«
»Ich verstehe alles, bis auf eines, Bruder.«
»Was denn?«
»Warum sind die Mì-runach hier?«
»Nun …«
»Nein, Gaius. Keine Politik. Keine Zentauren-Scheiße. Erzähl es mir einfach.«
Gaius stieß einen Seufzer aus. »Ich wollte, dass du von jemandem außerhalb des Reiches beschützt wirst. Also habe ich Rhiannon eine Nachricht geschickt. Und sie gebeten, jemanden herzuschicken, der dich beschützt. Ich dachte, sie würde einen Cadwaladr schicken. Die sind vielleicht nicht klug, aber sie sind effektiv.«
»Und dieses verrückte Miststück hat stattdessen ihre Mì-runach geschickt? Entzückend.«
»Nun, zumindest kann man sich auf sie verlassen. Ihre Loyalität gilt ihrer Königin, und unser Bündnis mit den südländischen Drachen und der Menschenkönigin ist unerschütterlich.«
»Das behauptest du.«
»Die eine Königin ist wahnsinnig und davon besessen, ihre Ehre unter Beweis zu stellen. Die andere Königin mag mich. Du darfst raten, welche welche ist. Die Quintessenz ist … ich vertraue ihnen beiden, und sie würden niemanden schicken, dem sie nicht selbst vertrauen. Das würde sie in Verlegenheit stürzen. Sie hassen nichts mehr, als sich zu blamieren.« Er legte seiner Schwester die Arme um die Schultern, zog sie an seine Brust und drückte sie fest an sich. »Aber wenn du nicht willst, dass ich losziehe …«
»Beende diesen Satz nicht einmal«, warnte ihn seine Schwester, deren Stimme beinahe zornig klang. »Ich bin schließlich kein Schlüpfling mehr, Gaius. Ich bin genauso stark wie du, nur anders.«
»Und wir herrschen gemeinsam über dieses Reich.«
»Tante Lætitia wird das nicht gefallen. Sie findet, du solltest allein herrschen.«
»Lætitia ist nur eine neugierige alte Schachtel.« Gaius schaute zur Tür hinüber und rief: »Die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollte!«
»Ich versuche nur zu helfen!«, brüllte Lætitia zurück. »Und hört auf zu kichern! Ihr seid keine Schlüpflinge mehr! Ihr seid Herrscher!«
Kachka verzurrte ihr Reisebündel und warf es sich zusammen mit ihrem Bogen und einem Köcher Pfeile über die Schulter, dann trat sie hinaus in den Korridor. Sie ging in die Große Halle, wo sie ihre Schwester tief im Gespräch mit deren Gefährten, dem schwarzen Drachen Celyn, sitzen sah. Als sie Kachka bemerkte, stieß sie einen erleichterten Seufzer aus.
»Tod hat dich heute wohlauf gefunden«, jubelte sie beinahe.
»Ja. Jetzt muss ich gehen.«
»Gehen? Wohin?«
»Ehre finden oder Tod.«
»Morfyd hat gesagt, Königin sei außer sich wegen Tempel in ihrem Land. Also schickt sie dich aus, damit du diejenigen aufhältst, die Tempel überfallen«, vermutete Elina.
»Ja.«
Der Drache setzte sich gerader hin. »Moment mal … was? Was sollst du?«
Kachka ignorierte ihn, weil er ein Mann und weil dies ein wichtiges Gespräch über Schlachtpläne war. Ein Gespräch, dem nur Frauen wirklich folgen konnten.
»Wirst du ein paar von ihren schwachen Soldaten mitnehmen?«
»Nein, nein. Sie hat sie mir angeboten. Aber was könnten sie anderes tun, als umherzustampfen, viel Lärm zu machen und alle Feinde wissen zu lassen, dass wir kommen. Sie wären nutzlos. Stattdessen kehre ich in Heimat zurück. Finde starke Frau, die an meiner Seite kämpft.«
»Gut.«
»Aber es wird gefährlich. Also, wenn ich in nächsten ein oder zwei Jahren nicht zurückkomme und du keine Nachricht erhältst, geh davon aus, dass ich tot bin«, verkündete Kachka rundheraus, »und sorg dafür, heilige Riten zu vollziehen, damit ich in nächster Welt auf unsere Vorfahrinnen treffe.«
»Das werde ich«, versprach Elina. »Und ich werde mir zu Ehren deines Todes tief ins Gesicht schneiden.«
»Danke, Schwester.«
Sie fassten einander an den Unterarmen und nickten, wohl wissend, dass dies vielleicht das letzte Mal war, dass sie einander lebend sahen.
Da es sonst nichts mehr zu sagen gab, ging Kachka auf die großen Türen zu.
Aber sie war nur wenige Schritte weit gekommen, bevor Celyn blaffte: »Ist das alles?«
»Ist was alles?«, fragte Elina.
»Ein Versprechen auf Selbstverstümmelung und ein Nicken? Ist das alles, was ihr zu sagen habt, wenn ihr euch vielleicht nie wiederseht?«
Elina runzelte die Stirn. »Was denn sonst, Dummkopf?«
»Keine Ahnung. Eine Umarmung? Ein Abschiedskuss? Irgendetwas!«
Kopfschüttelnd stieß Elina einen langen, gequälten Seufzer aus. »Geh, Schwester. Du hast wichtige Arbeit zu tun und keine Zeit für …« Sie wedelte mit der Hand in Richtung des entsetzten Drachen an ihrer Seite, dessen Mund vor Verwirrung weit offen stand. »… Was immer das ist.«
»Pass gut auf deinen Drachen auf«, sagte Kachka, als sie sich in Bewegung setzte. »Er wird deinen Schutz brauchen, so schwach und jämmerlich, wie er ist.«
»Schwach? Ich bin ein mächtiger Drache der Südländ…«
Das vereinte Gelächter der Schwestern übertönte den Rest dieser lächerlichen Behauptung und ließ Kachka ihre Reise munterer beginnen, als sie sich hätte vorstellen können.
2 Egnatius Domitus konnte nicht schlafen. Er hatte zu viel zu tun. So viel war ihm versprochen worden, und er hatte vor, auch alles zu bekommen, was ihm versprochen worden war. Selbst wenn das bedeutete, einen Gott anzubeten, auf den er keinen Pfifferling gab.
Diese religiösen Typen mit ihren blödsinnigen Regeln und Vorstellungen. Egnatius sagte das nichts. Wirklich nicht. Götter hätten ihm nicht gleichgültiger sein können. Das einzig Wichtige war, Oberherr über die quintilianischen Sovereigns zu werden. Der Thron gehörte von Rechts wegen ihm. Vom Schlüpfen an. Und, was das Allerwichtigste war, weil er es einfach verdammt noch mal so gerne wollte.
Jetzt herrschte sein idiotischer Cousin. Doch nicht als Oberherr. Nein, nein. Er war zu »gut«, um ein Oberherr zu sein. Er war König Gaius. Wer wollte König sein, wenn er Oberherr sein konnte? Wenn er die ganze Welt beherrschen konnte, statt nur einen kleinen Teil davon?
Aber sein Cousin hatte sich immer viel zu sehr darum bemüht, unparteiisch zu bleiben. Und was hatte ihm das eingetragen? Einen vorübergehenden Platz auf dem Königsthron.
Komisch allerdings war, dass Egnatius’ Cousin meilenweit davon entfernt war, wirklich unparteiisch zu sein. Er erinnerte sich ganz deutlich an die finsteren Tage, die folgten, als Vateria sich Gaius’ Zwillingsschwester geholt hatte. Der Schaden, der dabei angerichtet worden war. Das Blut, das über große Teile des Reiches vergossen worden war. Gaius hatte sich Vateria nicht direkt vornehmen können. Nein. Das hätte nur garantiert, dass seine Schwester schneller getötet würde. Also hatte er seinen Zorn an allen anderen ausgelassen.
Es war vielleicht das erste und einzige Mal, dass Egnatius Respekt vor seinem Cousin gehabt hatte. Als er den Schaden sah, den dieser verursacht hatte. Wie Gaius die Leichen angrinste, die er aus Frustration aufgetürmt hatte.
Es hatte ihm den Titel Rebellenkönig eingetragen.
Viele Leute dachten, Gaius habe während jener dunklen Zeiten sein Auge verloren, aber das stimmte nicht. Es war Thracius gewesen, der Gaius das Auge aus dem Kopf gerissen hatte, als der noch ein Schlüpfling war. Thracius hatte nicht einmal geblinzelt, als Gaius vor Schmerz geschrien hatte, und seine Zwillingsschwester hatte versucht, ihren Bruder mit dem eigenen Körper und ihren Flügeln zu schützen. Aber es war zu spät gewesen. Während sie zugeschaut hatten, hatte Thracius das Auge mit seiner Flamme geröstet und es dann lächelnd heruntergeschluckt. Dann hatte er sich wieder seinem Tagwerk zugewandt.
Das war damals Thracius’ Stil, und es würde auch Egnatius’ Stil sein, wenn er erst Oberherr war. Er würde herrschen, wie sein Vater es getan hatte. Mit Angst und Hass und einem Hauch Zorn.
Aber zuerst musste er etwas erledigen. Zuerst musste er …
Das Schwert ging nicht ganz hindurch … Es bohrte sich nur in sein Rückgrat und durchtrennte Nerven, sodass seine Beine unter ihm wegknickten, als er jedes Gefühl darin verlor. Aber Egnatius schlug nicht auf dem Boden auf; der menschliche Arm seines Cousins hielt ihn aufrecht.
»Hallo, Cousin«, flüsterte Gaius ihm ins Ohr, als seine Prätorianergarde die von Egnatius angriff. »Wir haben uns ja furchtbar lange nicht gesehen.«
Kachka starrte die vier Reiter an, die die Anne Atli ihr zugebilligt hatte.
Nach mehreren Minuten und unter den Augen anderer Stammesmitglieder sagte sie endlich zu der Stellvertreterin der Anne Atli: »Das soll wohl ein Witz sein.«
»Ich weiß nicht, was du meinst«, antwortete Magdalina Fyodorov.
Kachka achtete darauf, dass sie besonders enttäuscht klang – sie musste in einer sehr kurzen Zeitspanne viel erreichen. Diese Sache musste sie genau richtig angehen. »Das sind die Besten, die du erübrigen kannst?«, fragte sie.
»Pass auf, was du sagst, Kachka Shestakova«, murmelte jemand. »Zumindest wurde meine Schwester nicht von ihrer eigenen Mutter von hier vertrieben.«
Kachka schaute nicht einmal hin, um festzustellen, wer sprach. Stattdessen konzentrierte sie sich weiter auf Magdalina. Sie tat das aus vielen Gründen, aber vor allem, weil es gefährlich war, Magdalina den Rücken zuzukehren.
»Auf meiner Liste habe ich unmissverständlich darum gebeten …«
»Auf deiner Liste?«, unterbrach Magdalina sie. »Die Liste, in der du verlangt hast, dass dich einige unserer besten Kriegerinnen im Namen irgendeiner imperialistischen Königin auf ein Himmelfahrtskommando begleiten? Hast du wirklich gedacht, die Anne Atli würde ihre besten Leute für etwas so Lächerliches hergeben? Nein. Stattdessen geben wir dir die hier. Du wirst zufrieden mit ihnen sein … für die kurze Zeit, die ihr alle noch zu leben habt.«
»Du weißt aber schon, dass wir auch da sind?«, erklang eine Männerstimme. »Wir können euch hören.«
»Nimm, was dir gegeben wurde, Kachka Shestakova, und sei dankbar dafür.«
Kachka stieß einen tiefen, dramatischen Seufzer aus. »Na schön. Wenn es sonst nichts anderes gibt.«
»Es gibt nichts anderes.«
Kachka wandte sich schon zum Gehen, als eine weitere Stammesführerin aus dem Zelt der Anne Atli kam und Magdalina etwas ins Ohr flüsterte.
Kachka beobachtete, wie Magdalinas Augen sich weiteten. Bei Südländern wäre es ein »Ausdruck der Sorge« gewesen. Aber bei einer Tochter der Steppen war es schon eher ein Ausdruck des Entsetzens.
»Warte … warte hier«, befahl Magdalina Kachka, bevor sie im Zelt der Anne Atli verschwand.
Kachka wartete tatsächlich, außerstande, viel mehr zu hören als den Klang von Magdalinas Stimme, die mit einer viel leiseren Anne Atli debattierte. Denn wenn man über die Steppen herrschte, hatte man es nicht nötig zu brüllen.
Während sie wartete, betrachtete Kachka die vier Krieger, die man ihr zur Seite gestellt hatte.
Marina Aleksandrovna. Eine wahrhaft verlässliche Kämpferin, die einen schweren Fehler hatte. Sie hinterfragte die Lebensweise der Reiter. Ohne jeden Komfort in der rauen Steppe zu leben, damit hatte sie kein Problem. Aber mit der Art, wie sie die Männer behandelten, die sie gefangen nahmen, und die ruppige Art, mit der sie mit Dörfern und Städten außerhalb der Steppen verfuhren. Dieser spezielle Charakterfehler machte sie zu einer echten Nervensäge, wenn man mit ihr zusammenarbeiten musste.
Dann gab es da noch die Geschwister Khoruzhaya. Beide exzellente Fährtensucher und Jäger. Sogar bessere als Kachka, was einiges besagte. Aber sie waren keine Schwestern. Sie waren Bruder und Schwester, nur ein Jahr nacheinander geboren, und der Junge … er dachte, seine Zugehörigkeit zum Stamm mache ihn den Frauen ebenbürtig. Das traf keineswegs zu. Schlimmer noch, seine törichte Schwester folgte ihm in dieser Denkweise und erlaubte ihrem Bruder, bei Stammesveranstaltungen zu sprechen, statt ihm auf den Mund zu schlagen, damit er still war, wie Kachka es bekanntermaßen bei ihren eigenen Brüdern und Cousins gemacht hatte. Sie wollte ihnen nur helfen. Sie schützen, bis sie als Ehemänner auserwählt wurden. Aber Yelena Khoruzhayas Nachsicht gab Ivan erst recht das Gefühl, Macht zu haben. Schlimmer noch, sie beschützte ihn vor ihren Schwestern und Cousinen. Am Ende konnten sich Yelena und Ivan nur noch aufeinander verlassen.
Und schließlich – und nicht überraschend – eine aus Kachkas eigener Familie: Tatyana Shestakova. Eine Cousine, die wegen ihrer Vorliebe für südländische Gepflogenheiten verabscheut wurde. Sie hatte sich die Umgangssprache der Südländer so gut angeeignet und beherrschte sogar den Akzent, dass niemand aus diesen Territorien merkte, dass sie keine Einheimische war. Sie ging sogar so weit, die Kleidung der Südländer und den dekadenten Lebensstil zu bevorzugen und wünschte sich oft – sprach das sogar laut aus –, sie hätte ein »richtiges Bett zum Schlafen«.
»Was steht an?«, erklang eine Donnerstimme. »Was habe ich verpasst?«
Ivan Khoruzhaya stieß einen Seufzer aus tiefster Seele aus. »Bei den Pferdegöttern Ramsfors, nicht sie.«
Kachka musste ihm zustimmen. Sie hatte gehofft, längst fort zu sein, bevor … bevor das hier.
»Was ist denn hier los?«, fragte die Stimme weiter, während sich ein sehr massiger Leib durch die Menge drängte. Es dauerte nur Sekunden, dann stand Zoya Kolesova vor Kachka. Erheblich größer als sie, schaute Zoya von ihrer erhabenen Höhe auf sie herab. »Kachka Shestakova von den Schwarzbärenreitern der Mitternachtsberge der Verzweiflung in den fernen Weiten der Steppen der Außenebenen?«, fragte sie. »Was um alles in der Welt machst du hier? Ich dachte, du seist tragischerweise in die dekadente Welt der Südländer verbannt worden, und man würde dich nie wieder zu Gesicht bekommen!«
Kachka betrachtete die erheblich größere Frau. Größer sogar, als ihre Mutter Glebovicha es gewesen war. Riesig und wie alle Kolesovas stark. Nicht so stark wie die meisten Reiter, die in den rauen Außenebenen leben mussten, aber … stark.
Es ging das Gerücht, dass eine der frühesten Kolesovas, entschlossen, an der Seite der ersten Anne Atli zu kämpfen, ihren Lieblingsehemann den Pferdegöttern geopfert hätte, in der Hoffnung, »so stark zu sein wie der Mann, den ich gerade getötet habe«.
Den Göttern musste das Opfer gefallen haben, denn sie taten noch mehr als das. Sie hatten diese Kolesova nicht nur größer und stärker gemacht als jeden Mann, sie hatten das Gleiche auch mit den weiblichen Nachkommen getan, die sie später in die Welt setzen sollte. Jetzt wurde diese Stärke und Größe von Mutter an Tochter weitergegeben, wieder und wieder.
Leuten von außerhalb erschien es seltsam, dass keine der Kolesovas bei all ihrer körperlichen Stärke auch nur ein einziges Mal die Anne Atli geworden war. Aber das lag daran, dass sie alle einen wirklich fatalen Makel hatten …
Zoya riss die Arme auseinander und presste Kachka stürmisch an ihre Brust, hob sie von den Füßen und zerquetschte ihr dabei beinahe die Rippen.
»Ich bin so froh, dich zu sehen, alte Freundin!« Auch wenn sie niemals Freundinnen gewesen waren. Weder alte noch sonstige. »Ich war mir sicher, du seist tot! Ich bin so froh, dass du es nicht bist! Ich bin so ungeheuer froh!«
Ja. Das war das Problem. Die götterverdammte Gutmütigkeit der Kolesovas. Es gab in ihrem Stamm niemanden, der nicht irgendetwas fand, das ihm ein Lächeln entlockte. Ein Lachen. Ein Frohlocken. Jeden Tag. Ständig.
Aber, so meinten Leute von außerhalb oft, es hätte doch trotz ihrer Gutmütigkeit und wegen ihrer Stärke und Größe und der Anzahl von Frauen in ihrem Stamm wenigstens eine von ihnen die Anne Atli werden können. Also, warum war das nie passiert?
Einfach ausgedrückt … weil ihnen nicht der Sinn danach stand. Sie waren schlicht zufrieden damit, hin und wieder in den Krieg zu ziehen. Viel zu trinken. Und ihre zahlreichen Ehemänner zu ficken. Auf einem Schlachtfeld waren sie ein Segen. Zu jeder anderen Zeit … viel zu fröhliche Nervensägen.
Kachka kämpfte sich aus Zoyas erstickender Umarmung und log: »Ich freue mich auch, dich zu sehen, alte Freundin.«
Noch einmal, sie waren nie Freundinnen gewesen. Aber Kachka wollte nicht, dass Zoya das Gefühl hatte, sie müsse beweisen, wie nah sie sich einst gestanden hatten. Das konnte schmerzhaft werden. Sehr, sehr schmerzhaft.
»Warum bist du hier?«, fragte Zoya mit immer noch donnernder Stimme. »Du kehrst zu den Stämmen zurück, nicht wahr?«
»Nein, nein. Ich brauche nur eine kleine Gruppe, die mir hilft …«
»Ich komme mit!«, bot Zoya an.
»Nein!«, brüllten alle fünf.
»Haha! Ihr bringt mich alle so zum Lachen! Das wird ein Spaß!«
Das war noch so etwas an den Kolesovas. Sie waren nie beleidigt. In mehr als tausend Jahren hatten sie nie eine Blutfehde mit irgendjemandem gehabt. Kachka verstand nicht, wie das möglich war. Selbst Glebovicha, die Blutfehden mit so ziemlich jedem hatte, hatte nie eine mit den Kolesovas geführt. Denn sie hatten über jede Beleidigung, die sie ihnen an den Kopf geworfen hatte, nur gelacht, ihr auf den Rücken geschlagen – und ihr dabei beinahe die Wirbelsäule zerschmettert – und waren fröhlich ihrer Wege gezogen.
»Was ist mit deinen Kindern, Zoya?«, fragte Kachka, verzweifelt darauf bedacht, sie irgendwie hier festzuhalten.
»Alle einhundertsiebenundvierzig«, verkündete Tatyana leise und sah Kachka mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Ja«, sagte Kachka, die versuchte, sich ihren Schreck über diese Zahl nicht anmerken zu lassen. Selbst für eine Tochter der Steppen, die mühelos über tausend Jahre alt werden konnte … war das verdammt unverhältnismäßig! »Was ist mit ihnen allen?«
»Dafür sind meine Ehemänner da! Sie erziehen die Mädchen, während ich fort bin, und die älteren Mädchen werden sie beschützen!«
»Was wir vorhaben, ist ein ganz schönes Himmelfahrtskommando«, warf Ivan ein.
»Still, Junge«, blaffte Zoya Ivan kalt an. »Niemand spricht mit dir.«
Und das war der Grund, warum die Kolesovas bei den anderen Stämmen recht angesehen waren, trotz ihrer Gutmütigkeit: Ihr absoluter und vollkommener Mangel an Respekt vor irgendetwas mit einem Penis.
Magdalina kam schließlich zurück, und ihr Gesicht war jetzt aschfahl. Außerdem weigerte sie sich plötzlich, Kachka in die Augen zu sehen.
»Wenn du haben willst, was wir dir hier angeboten haben, gibt es noch … eine Person, die du mitnehmen musst.«
Ein Muss? Götter, was für einen unfähigen Verlierer versuchten sie ihr aufzudrängen?
»Wirklich?«, fragte Kachka. »Wen denn?«
Gaius zwang seinen Cousin zuzusehen, wie dessen Soldaten niedergemetzelt wurden. Es war kein kurzer Kampf – Egnatius’ Soldaten waren gut –, aber es war trotzdem eine Schlacht, die sie nicht gewinnen konnten.
Während seine Soldaten die Letzten erledigten, schob Gaius das Schwert, das immer noch in Egnatius’ Rücken steckte, tiefer hinein und sagte dicht am Ohr seines Cousins: »Wenn du willst, dass ich dies schnell zu Ende bringe, Cousin, musst du mir verraten, was ich wissen will.«
»Wissen?«
»Wo ist Vateria? Ich will Vateria haben. Deine Schwester wird niemals der Strafe entgehen, die sie sich mit dem verdient hat, was sie Agrippina angetan hat.«
»Ich werde dir gar nichts sagen«, schoss Egnatius zurück.
Gaius schockierte das nicht weiter. Egnatius war einer der stärkeren von Thracius’ Nachfahren. Er würde nicht so ohne Weiteres zu Boden gehen.
Etwas, das er schnell bewies, als er Gaius den Ellbogen ins Gesicht rammte und ihn zwang zurückzuweichen. Für einen Moment befreit, fiel Egnatius zu Boden, wechselte aber schnell von seiner menschlichen in seine Drachengestalt. Seine Beine mochten gelähmt sein, aber nicht seine Flügel.
Er erhob sich in die Luft, schwebte vom Boden weg und riss sein Schwert aus der Scheide.
»Los, Cousin!«, rief er Gaius zu. »Zeig uns, wie ein guter König kämpft.«
Gaius nickte. »Wie du wünschst.«
Kachka fand die Person, die man ihr aufzwingen wollte, in einer der wenigen Holzhütten auf Stammesterritorium.
Holzhütten wurden normalerweise nicht gebaut, weil es zusätzliche Zeit kostete, sie einzureißen, wenn die Stämme weiterzogen. Wichtiger noch, sie waren nicht annähernd so warm wie die Jurten.
Aber ab und zu einmal war eine Holzhütte notwendig. Denn in diese Behausungen schickte man diejenigen, die ihren eigenen Leuten ein Leid angetan hatten. Die Südländer nannten so etwas Gefängnis. Die Reiter nannten es: »Den Ort für jene, die nicht getötet werden können.«
Diese Hütte war nicht voll mit Verbrechern wie die Gefängnisse der Südländer. Stattdessen gab es hier nur eine einzige Bewohnerin. Auf den Knien, die Arme mit Ketten gefesselt. Die Ketten waren so an der Decke befestigt, dass die Arme der Frau weit auseinander über ihren Kopf gezogen wurden. Das sollte sie daran hindern, die Hände für irgendetwas zu benutzen.
Weitere Ketten schlangen sich um ihre Knöchel, und diese Ketten führten über den Boden und waren dort mit dicken Metallpfählen befestigt.
Es gab kein Licht in der Hütte. Kein Feuer, das Wärme spendete. Nur die Gefangene.
Nina Chechneva, die Ausgestoßene.
Ausgestoßen, weil kein Stamm sie haben wollte. Der Stamm, in den sie hineingeboren worden war, hatte sie vor fast zweihundert Jahren verstoßen. Und niemand sonst wollte sie aufnehmen. Also war sie nur noch Nina Chechneva.
Sobald Kachka die Hütte betrat, wusste sie, dass Nina sie wahrnahm.
Ohne ihren Kopf zu heben, sagte sie: »Kachka Shestakova. Ich wusste, dass du kommen würdest.«
»Haben deine dunklen Götter dir das verraten, Nina Chechneva?«, fragte Kachka, während sie vorsichtig näher kam.
»Nein. Nur die verdammten Seelen, die durch diese Lande schweifen. Verloren und verzweifelt und damit reif für meine Zwecke.«
Letzteres brachte sie in einem zischelnden Flüstern hervor. Im Laufe ihrer dreihundertsechsunddreißig Jahre hatte Nina viele mit diesem zischelden Flüstern in Angst und Schrecken versetzt. Sie hatte es schon zu ihrem Vorteil genutzt, bevor sie laufen konnte, und sogar ihre leibliche Mutter das Fürchten gelehrt, die sie nicht lange danach den Schamanen des Stammes übergeben hatte. Aber nach einer Weile hatten selbst ihre Schamanen nichts mehr mit Nina Chechneva zu tun haben wollen. Niemand wollte etwas mit ihr zu tun haben.
Inhaltsverzeichnis
Cover & Impressum
Prolog
TEIL 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
TEIL 2
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Epilog
Orte und Bewohner der Welt der Drachensippe