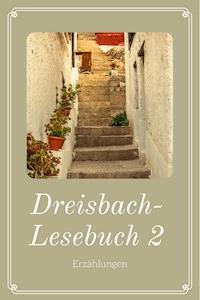
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Elisabeth Dreisbach-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Elisabeth Dreisbach ist eine der bekanntesten und herausragendsten christlichen Erzählerinnen unserer Zeit. Seit vielen Jahren schreibt sie Geschichten für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Viele Leser und Leserinnen haben durch ihre Bücher Lebenshilfe und Glaubensstärkung erfahren. Aufgrund des großen Erfolgs des Dreisbach-Lesebuchs 1 legt der Verlag ein weiteres vor, das ebenfalls gehaltvolle Erzählungen aus älterer und jüngerer Zeit vereinigt. Elisabeth Dreisbach (1904 - 1996) zählt zu den beliebtesten christlichen Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre zahlreichen Romane und Erzählungen erreichten ein Millionenpublikum. Sie schrieb spannende, glaubensfördernde und ermutigende Geschichten für alle Altersstufen. Unzählig Leserinnen und Leser bezeugen wie sehr sie die Bücher bewegt und im Glauben gestärkt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dreisbach-Lesebuch 2
Elisabeth Dreisbach
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Elisabeth Dreisbach
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-156-5
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Vorwort
Und so was nennt sich Ferien!
Das Reiseandenken
Annegret kommt in die Fremde
Brigitte und das Kind
Die Schuldkiste
Alles geht schief!
Einer Liebe Opferweg
Unsere Empfehlungen
Vorwort
Elisabeth Dreisbach, 1904 in Hamburg geboren, ist durch ein gläubiges Elternhaus entscheidend geprägt worden. Hier wurden auch die Grundlagen für ihren schriftstellerisch-missionarischen Auftrag gelegt. Die Autorin eröff- nete nach dem Krieg ein Heim für heimatlose Kinder. Mit ihrem Mann lebte sie bis zu ihrem Tode im Jahr 1996 im Berghaus St. Michael in Oberböhringen, einem christlichen Gästehaus und Kinderheim.
Aufgrund des großen und anhaltenden Erfolgs des Dreisbach-Lesebuchs zum neunzigsten Geburtstag der Autorin hat der Verlag sich entschieden, ein weiteres Dreisbach- Lesebuch 2 mit älteren, gehaltvollen christlichen Erzählungen zusammenzustellen. Der Band ist beste Lektüre für einen stillen Abend oder für die Ferienzeit. Er will unterhalten, geht aber auch geschickt auf Fragen und Probleme des Lebens ein.
Die Gestalten der Erzählungen sind in dichterischer Freiheit entstanden, wiewohl manche tatsächlich gelebt haben: Menschen, die stolz und unbeugsam nur auf ihren eigenen Vorteil versessen waren und ihre Augen vor der Not der anderen verschlossen haben. Und auf der anderen Seite die Armen, die Mittellosen am Rande der Gesellschaft, deren Leid niemand unberührt lässt.
Elisabeth Dreisbach will in ihren Erzählungen zeigen, dass jede und jeder zu Gott kommen und seine Barmherzigkeit erfahren kann. Ihnen wird auf eine Weise Hilfe zuteil, die oftmals überrascht, weil sie unerwartet kommt.
Dem christlichen Leser, der Leserin eröffnen sich Lebens-Schicksale, die sie selber erlebt haben könnten. Viele werden sagen: Ja, so war es auch bei mir oder in meiner Verwandtschaft! Gott hat uns geholfen und aus einer schwierigen Situation herausgeführt.
Elisabeth Dreisbachs Gestalten sind meist einfache Menschen: auf der einen Seite solche, die durch eigenes oder fremdes Handeln schuldig geworden sind; auf der anderen Seite ist es die aufopfernde Liebe anderer, die zur Umkehr treibt. Immer wird die helfende Hand Gottes – wenn auch zunächst verborgen – als zupackende, glaubensstärkende Hand erfahren. Sie vermag menschliches Elend in Hoffnung und Freude zu verwandeln. Das ist ihre bleibende Botschaft.
Der Verlag
Und so was nennt sich Ferien!
»Endlich!« sagte Herr Burgholz und warf die Aktentasche auf den Schreibtisch. »Noch nie habe ich den Urlaub so nötig gehabt wie diesmal. Keinen Tag länger hätte ich arbeiten mögen. Sind die Koffer gepackt?«
»Alles ist fertig, Vati. Ich glaube, Mutti ist nicht weniger erholungsbedürftig als du, schon allein nach all den notwendigen Reise Vorbereitungen, die sie treffen musste.« Maritta, die einzige Tochter des Bankdirektors Burgholz, war zu dem Sessel getreten, in den der Vater erschöpft gesunken war, und legte ihm, sich auf die Lehne setzend, den Arm um die Schultern. »Ich bin wirklich froh, dass es morgen früh losgeht. Du siehst in letzter Zeit so angegriffen aus.«
»Das ist auch kein Wunder. Ich sage dir, Maritta, heirate nie im Leben einen Bankmann! Lieber bleib ledig!«
»Du erwartest doch hoffentlich kein diesbezügliches Versprechen von mir?«
Herr Burgholz schüttelte lachend den Kopf. »Nein, nein, das gewiss nicht, ich fürchte, es wird ohnehin viel zu früh sein, dass einer kommt und dich uns wegschnappt.«
»Soll das eine Anspielung auf Peter sein, Vati?«
»Nein, an ihn dachte ich nicht direkt –«
»Deine Sorge wäre da auch unberechtigt, Peter ist …«
In diesem Augenblick betrat Frau Burgholz das Zimmer. Sie hatte aus dem Nebenraum durch die offenstehende Türe das Gespräch mit angehört.
»Was redet ihr denn da? Arno, Maritta ist knapp siebzehn Jahre alt. Sie ist doch noch ein Kind.«
»Na, Mutti«, wehrte sich die Tochter, die die Mutter um Kopfeslänge überragte, »das ist nun auch wieder leicht übertrieben. Aber euch beiden zur Beruhigung, ich denke noch lange nicht ans Heiraten. Ich will doch zuerst einmal etwas von meinem Leben haben –«
»Und vor allem zuerst etwas Rechtes lernen«, ergänzte die Mutter.
»Auch das nebenbei«, lachte Maritta. »Aber du wolltest uns doch gewiss zum Abendessen rufen, nicht wahr? Hat Suse heute Nachmittag wieder frei?«
»Ich habe sie bereits nach Hause geschickt. Sie kommt zwei Tage vor unserer Rückkehr wieder, um die Wohnung in Ordnung zu bringen. Aber du hast recht, das Essen steht bereit.«
Da die Reisevorbereitungen alle getroffen waren – Frau Burgholz war eine praktisch veranlagte, tüchtige Hausfrau und hatte frühzeitig damit begonnen –, konnte man nach der Mahlzeit noch in Ruhe beisammensitzen. Die Vorfreude auf die morgige Abreise und die vor ihnen liegenden Ferien gaben dem Abend eine beschwingte Atmosphäre.
»Ich freu' mich schrecklich, dass es wieder an den Bodensee geht«, sagte Maritta. »Hoffentlich haben wir gutes Wetter, so dass wir oft baden können!«
»Aber dieses Mal lasse ich dich nicht in den See, bevor du nicht versprichst, nie mehr so weit hinauszuschwimmen wie das letzte Mal, wo es aussah, als seist du von einem vorüberfahrenden Dampfer in die Tiefe gerissen worden.«
»Ach, so schlimm war es ja gar nicht. Wie ist es, Vati, fahren wir dieses Jahr wieder in die Schweiz? Unsere Pässe sind doch in Ordnung.«
»Ich habe es nicht vor. Dieses ungeheure Menschengewimmel überall geht mir auf die Nerven. Es ist zwar wunderschön, dass die Schweiz uns Deutschen jetzt auch wieder offensteht. Jahrelang, während des Krieges und auch nachher, haben wir es ja entbehren müssen, – aber jetzt scheint es geradezu eine Modekrankheit zu werden. Wer in seinen Ferien nicht Italien oder die Schweiz bereist hat, bekommt Minderwertigkeitskomplexe. Als ob wir in unserem Land nicht ebenfalls herrliche Ferien-, Wander- und Ausflugsmöglichkeiten hätten! Meine Güte, wenn ich daran denke, was für Schulausflüge wir in meiner Kinderzeit machten! – Immer schön zu Fuß, Proviant im Rucksack. Fünfzig Pfennige im Höchstfall gab mir meine Mutter mit, und wir waren bestimmt ebenso glücklich oder noch glücklicher als die heutigen Kinder, die mit gummibereiften, teuren Rollern umhersausen und die Gegend unsicher machen.«
Maritta lachte. »Vati, lass an unserer Zeit auch noch einen guten Faden! Sie hat ihr eigenes Gesicht und ihre eigenen Rechte.«
Nun schaltete sich auch Frau Burgholz in das Gespräch ein. »Es stimmt schon, was Vater sagt. Viele reisen auch nicht aus Freude am Reisen, oder um sich an der Schönheit der Natur zu erfreuen, sondern einfach, weil es jetzt üblich ist, seinen eigenen Wagen zu haben und für ein paar Wochen an den Bodensee, in die Schweiz oder nach Bayern zu fahren. Erinnert ihr euch noch, wie wir letztes Jahr von Friedrichshafen nach Konstanz und am Abend auf dem Schiff wieder zurückfuhren? Wir saßen hinten auf dem Deck. Es war an diesem Abend ein unbeschreiblich schöner Sonnenuntergang. Die Türme von Konstanz hoben sich wie Silhouetten in den abendlichen Himmel, der im Westen ein dauernd wechselndes prachtvolles Bild bot.
Rot, orangefarben, leuchtend gold war er ein märchenhaft wirkender Hintergrund, während der spiegelglatte See ebenfalls prächtigste Farben aufwies und schließlich wie eine einzige Perlmuttfläche schimmerte. – Wisst ihr noch, dass wir, wie gebannt, die Augen nicht abwenden konnten? In Meersburg stieg dann eine Reisegesellschaft zu. Die Leute schienen ausgiebig in einem Weinlokal gezecht zu haben. Laut und aufdringlich unterhielten sie sich über ihre Erlebnisse, besprachen die Speisekarte des Abendessens, das sie in Friedrichshafen einzunehmen gedachten, begannen Schlager zu singen und schließlich zu tanzen. Einer von ihnen hatte ein Kofferradio mit.« »Ja, ich erinnere mich noch gut«, stimmte Herr Burgholz zu. »Wir waren so empört, dass wir den Platz wechselten, um aus der Nähe dieser angetrunkenen Fahrgäste zu kommen.«
»Ich glaube nicht einmal, dass sie angetrunken waren«, meinte Maritta. »Sie freuten sich eben auf andere Art als wir.«
»Komm, hör mir auf!« sagte Frau Burgholz. »Ganz ungebildete, unerzogene Menschen waren es, sonst hätten sie selbst empfunden, wie unpassend und störend sie sich benahmen.«
»Und du, Mutti, du hättest am liebsten bei diesem herrlichen, leuchtenden Himmel gesungen: Goldne Abendsonne, wie bist du so schön! Stimmt's nicht?«
Frau Burgholz wandte sich ihrer Tochter zu, nachdem sie ihre feine Handarbeit, an der sie stichelte, für einen Augenblick vor sich auf den Tisch gelegt hatte. »Wenn ich nicht wüsste, wie sehr auch dein Herz und Gemüt für alles Schöne offen ist und wie du vor einer Frühlingsblume auf dem Waldboden, vor der Kraft der Schneeberge oder auch eben vor einem solch wunderschönen Sonnenuntergang still werden kannst, würde ich mich jetzt über dich ärgern, denn das, was du soeben gesagt hast, klingt reichlich ironisch. Warum sollte ich an jenem Abend beim Anblick der sinkenden Sonne nicht gerne gesungen haben: Goldne Abendsonne, wie bist du so schön! – Glaube mir, diese Lieder haben ihre volle Berechtigung! Unsere heutige Zeit ist viel gemütsärmer als die meiner Jugend. Ihr nennt das natürlich sentimental und schmalzig.«
Maritta rückte ihren Sessel näher an den der Mutter heran. »Wie gut, dass du deine Tochter kennst! Ich wollte dich nicht kränken, Mutter, – aber ihr müsst auch Verständnis haben für uns Junge, die wir in eine raue und herbe Zeit hineingeboren sind. Glaube mir, Gemüt haben wir auch. Es ist nur manches völlig überholt. Wenn ich daran denke, wie du mir erzähltest, dass du es als Mädel in meinem Alter nicht wagen durftest, am Abend ohne Begleitung das Haus zu verlassen, nicht etwa, weil die Straßen oder Zeiten unsicherer gewesen wären, sondern einfach, weil es sich nicht schickte, oder dass ihr nie ohne Schürze daheim umhergehen durftet und ständig irgendeine Stickerei, Häkelei oder einen Strickstrumpf in Arbeit hattet! Brrrrr, grauenhaft, wenn ich mir das vor stelle! Du kannst es ja heute noch nicht, Muttchen: dasitzen und die Hände in den Schoß legen. Ich möchte dich auch gar nicht anders haben, aber ich selbst? – Nein, ich bin wirklich froh, dass du so etwas nicht von mir verlangst.« Maritta zog die Mutter zu sich heran und gab ihr einen Kuss. »Du bist ja doch die Allerbeste!«
»Ja, ja«, schaltete sich der Vater jetzt wieder ein. »Ihr meint, ihr Jungen, ihr seid uns Alten turmhoch überlegen mit euren verrückten Frisuren, dem Zigarettenstummel im Mundwinkel und den lächerlichen, modischen Hosen, die ihr Mädels anstelle eines anständigen Rocks jetzt tragt.«
Maritta richtete sich auf und blitzte den Vater kampfeslustig an. »Du, – wenn du zum Angriff übergehst! Immer sprichst du von ›ihr‹. Wen meinst du eigentlich damit? Lächerliche Frisur? Für mich hast du noch keinen Pfennig für Dauerwellen ausgeben müssen.«
»Weil du zufällig echte Locken hast.«
»Und was das Zigarettenrauchen anbetrifft, so gehöre ich zu den drei oder vier meiner Klasse, die nicht rauchen, obgleich es mich auch hin und wieder reizen würde mitzumachen. Aber ich tue es nicht, weil ich weiß, ihr könnt es nicht leiden.«
»Brave Tochter!« lobte der Vater und kniff ein Auge zu.
»Fragst du nun noch Mutti, von wem ich meine Ironie geerbt habe? – Und was die dir so verabscheuungswürdig scheinenden Hosen anbelangt, so kommt es doch wohl darauf an, warum und bei welcher Gelegenheit man sie trägt. Beim Radfahren zum Beispiel –«
Ein Pfiff von der Straße her unterbrach Marittas Satz und ließ diese aufhorchen. »Das ist Peter! Ich spring' schnell hinunter.« Herr Burgholz zog die Stirne kraus. Maritta, schon im Begriff, das Zimmer zu verlassen, wandte sich an der Türe noch einmal zurück. »Ihr erlaubt doch?«
»Bleib aber nicht zu lange«, antwortete die Mutter. »Wir wollen zeitig zu Bett gehen. Du weißt, morgen geht es in aller Frühe los.«
Herr Burgholz zündete sich in nervöser Hast eine Zigarre an. Er begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Ein Zeichen, dass ihm etwas nicht behagte. Und wirklich polterte er auch gleich los.
»Also die Sache mit dem Peter gefällt mir schon längst nicht mehr. Es vergeht doch kein Tag, an dem man die beiden nicht zusammen sieht. Herrschaft nochmal, die tun ja gerade, als seien sie ein Liebespaar!«
»Nein, Vater, das tun sie nicht. Da muss ich sie ganz bewusst verteidigen. Sie sind seit Jahren Freunde, besuchten dieselbe Schule, und dass sie nun beginnen, aus den Kinderschuhen herauszuwachsen, das ist doch schließlich etwas ganz Natürliches. Man kann ihnen aber doch deswegen nicht verbieten zusammenzukommen.«
»Du wirst es erleben, dass es gar nicht lange dauert, dann kommt unser Fräulein Tochter an und stellt sich uns als Peters Braut vor. Sie hat es uns ja vorhin unumwunden klargemacht, dass die Jugend von heute andere Ansichten hat als wir einmal. Früher war es üblich …«
Wieder legte Frau Burgholz die Arbeit aus der Hand. Sie trat zu ihrem Gatten und legte diesem die Hände auf die Schultern. Dabei musste sie sich aber beinahe auf die Zehen stellen. »Ja, ja, unser Vati hat es dringend nötig, Ferien zu machen. Er ist wieder mal ein richtiger Schwarzseher. Warte nur, wenn du morgen Nachmittag im Liegestuhl am Strand liegst, den Möwen Brotbrocken zuwirfst, den vorbeifahrenden Dampfern nachwinkst und deine Tochter mit kräftigen Stößen hinausschwimmen und sich im Wasser tummeln siehst, – wenn du für ein paar Wochen deinen ganzen Bankkram hinter dir lassen kannst, dann sieht das Leben schon wieder anders aus. – Im Grunde genommen haben wir mit unserem Mädel bisher doch nur Freude erlebt. Und dein Groll auf den armen Peter entspringt doch nur der Angst, du könntest deine Tochter eines Tages hergeben müssen.«
»Ach was, dummes Zeug«, wehrte sich Herr Burgholz, lächelte aber bereits wieder. »Ich gäb' sie dem Lausebengel auch nicht so ohne weiteres, das kannst du mir glauben. Und übrigens kann ich ihn mit seinem »Kiss die Hand« und »Habe die Ehreee« nicht ausstehen.«
»Du weißt doch ganz genau, dass er das nur sagt, weil ich so großen Spaß daran habe. Es erinnert mich an meine Zeit in Wien. Und Peters Mutter ist doch eine Wienerin.«
»Ja, ja, verteidige ihn nur! Aber deswegen wird er doch nicht dein Schwiegersohn. Das sag' ich dir jetzt schon. – Nun etwas anderes. Du sagst, es sei alles vorbereitet zur morgigen Abreise?«
»Ja, du kannst dich darauf verlassen. Ich habe gleich gestern früh angefangen, die Koffer zu packen, nachdem wir am Abend vorher aufgeschrieben hatten, was alles mitgenommen wird.«
»Gut, dann gehe ich jetzt noch für eine halbe Stunde an meinen Schreibtisch, um einiges Notwendige zu ordnen.«
Herr Burgholz war noch nicht in seinem Zimmer verschwunden, als Maritta die Treppen heraufgestürmt kam: »Vati! Mutti! Ein Eilbrief! Wenn ich recht sehe, von Onkel Benno aus dem Schwarzwald!«
»Nanu? – Zeig her!« Frau Burgholz griff nach dem Brief. »Es wird doch hoffentlich nichts passiert sein!«
»Wieso soll was passiert sein?« Ihr Mann war herzugetreten. »Als ob ein Eilbrief immer nur eine Trauerbotschaft bringen könnte!«
»Du weißt doch, Veronika erwartet ihr sechstes Kindchen.«
»Ja, leider!«
»Aber Arno, was redest du da?«
»Na, wäre es etwa nicht genug an den Fünfen gewesen? So ein armer Dorfschulmeister ist bestimmt nicht mit irdischen Gütern gesegnet. Du weißt ja, wie sparsam es immer bei ihnen zugeht. Willst du vielleicht noch ein paarmal Patenschaft übernehmen?«
»Ich habe es auch diesmal Veronika versprochen, das heißt, Maritta und ich waren uns eins, dass sie …«
»Ach, schau mal an, und das ganz hinter meinem Rücken. Aber davon reden wir nachher. Wenn du jetzt endlich den Brief geöffnet hast, können wir vielleicht doch mit der Zeit erfahren, was sein Inhalt ist.«
Frau Burgholz wechselte mit ihrer Tochter einen Blick. Dann las die Mutter vor:
»18. Juli –
Liebe Marieluise! Lieber Arno!
In großer Sorge um Veronika wende ich mich an Euch. Ihr wisst, dass sie in Kürze unser Sechstes erwartet. Nun hat sie gestern eine große Wäsche waschen wollen, ist gestürzt und scheint sich Schaden getan zu haben. Der Arzt ist sehr besorgt um sie und wollte sie sofort ins Krankenhaus nach Karlsruhe schicken. Aber sie weigerte sich. Sie ist ja immer so heiter und tapfer. ›Hier kann ich wenigstens vom Bett aus meine Anordnungen treffen, sagte sie. Aber wem, um alles in der Welt, soll sie ihre Anordnungen geben? Guido mit seinen neun Jahren kann doch noch keinen Haushalt führen, Bianca hilft für ihr Alter schon erstaunlich. Guiseppe und Alfons haben nichts als dumme Streiche im Kopf, Sabinchen ist noch ein kleines dummes Schaf. Einmal in der Woche kommt wohl eine Frau und hilft Veronika, aber sie kann sich auch nicht öfters frei machen. Wenn ich auch zwischen den Schulstunden hinauflaufe und nach dem Rechten sehe, so ist das doch nicht ausreichend. Ihr wisst ja, dass wir auf dem Lande zu anderen Zeiten Ferien haben. Das richtet sich bei uns nach der Heu- und Fruchternte, nach den Kartoffeln usw. – In meiner Not wende ich mich an Euch. Wäre es nicht möglich, dass Du, liebe Marieluise, für ein paar Wochen zu uns kämest?«
Nur zögernd wagte Frau Burgholz weiterzulesen. Sie ahnte bereits, dass ihr Mann lospoltern würde.
»In der Stadt beginnen doch gerade jetzt die Ferien. Ihr könntet diese doch bei uns verbringen. –«
»Der ist total verrückt!« fuhr Herr Burgholz jetzt wie eine losgegangene Rakete hoch. »Bei sechs Kindern!«
»Wir haben doch ein Gastzimmer unter dem Dach«, las Frau Burgholz stockend weiter, und wurde im nächsten Moment von ihrem Mann angefaucht: »Du hast auch schon besser gestottert als jetzt. Gib mal den Wisch her, nicht, dass du mir noch einige der geistvollen Vorschläge meines Herrn Schwager unterschlägst. Ich will genau wissen, was für hirnverrückte Ideen er hat. Also weiter!« Er murmelte, mit dem Zeigefinger die Zeilen nachfahrend, vor sich hin. »Ah so, hier waren wir stehengeblieben, – unterm Dach, – richtig, – unterm Dach, – gar nicht schlecht.«
»Wenn es Dir, lieber Arno, aber nicht Zusagen sollte« – »du hast's erfasst, mein Teurer, das sagt mir nicht im geringsten zu, – also Zusagen sollte«, – »dann ist nicht weit von uns entfernt das große, modern eingerichtete Schwarzwaldhotel. Vielleicht könntest Du mit Maritta dort wohnen, oder meinetwegen auch Marieluise des Nachts, und tagsüber würde sie gewiss gerne nach ihrer Schwester schauen. – Ich weiß doch, wie die beiden, Marieluise und meine Frau, aneinander hängen. Am Abend bin ich ja frei und kann mich um Veronika kümmern. – Ich bitte Euch, lasst Euch die Sache durch den Kopf gehen, aber kommt so schnell wie möglich! Ich habe Angst um unsere Mutti.
Herzliche Grüße, Euer Schwager Benno!«
Herr Burgholz warf den Brief auf den Tisch und ließ sich in seinen Sessel fallen.
»Schön, was?« fauchte er Frau und Tochter an. »Er ist noch immer derselbe Phantast wie früher. Das sieht man schon an den blödsinnigen Namen, die er seinen Kindern gegeben hat, nur, weil seine Mutter eine Italienerin war. – Aber diesmal hat er sich in den Finger geschnitten. –
Marieluise, mach ja kein so nachdenkliches Gesicht! Es kommt nicht in Frage, dass wir tanzen, wie unser geliebter Schwager pfeift. Es langt, wenn seine Frau das tut. Wozu gibt es Diakonissen, Gemeindeschwestern, Krankenpflegevereine und derartiges? Du fährst mit Maritta und mir morgen an den Bodensee und nicht in den Schwarzwald. Meinetwegen kann er von mir einen Hundertmarkschein haben, um so eine Krankenschwester für ein paar Tage zu mieten, aber du fährst mir nicht. Das wär' gelacht!«
»Du weißt, dass sie kein Geld von uns annehmen«, wagte Frau Burgholz zu erwidern.
»Das ist mir egal, was sie dann damit machen. Dann sehen sie wenigstens unseren guten Willen. Wir fahren jedenfalls zusammen an den Bodensee. Glaubt der gute Mann etwa, weil ich Bankdirektor bin, ich könne meine Ferien ganz nach Belieben von einem Tag oder einer Woche zur anderen verlegen? Der Kerl hat doch in Wirklichkeit keine Ahnung von dem, was unsereins zu leisten hat. – Und ist meine Gallensache vielleicht nichts? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich keinen Tag länger warten kann. Ich muss jetzt auf Urlaub, und zwar an den Bodensee, wo ich mich immer am besten erhole. Im Grunde genommen ist es einfach eine Unverschämtheit, einfach …«
»Aber Arno, warum regst du dich denn so auf? Ich hab' doch noch mit keinem Ton gesagt, dass ich fahren will.«
»Als ob ich das deinen Augen nicht längst angesehen hätte! Die laufen ja bereits über vor lauter Mitgefühl mit deiner Zwillingsschwester. Hätte die Veronika nur nie diesen Schwärmer geheiratet! Sie war mal ein so vernünftiges Mädel. – Haben die Telefon? – Natürlich nicht. So'n armer Dorfschulmeister! Also werden wir ein Telegramm senden: ›Kommen gänzlich ausgeschlossen. Selbst erholungsbedürftige«
»Arno!« – »Bitte?« –
»So geht das nicht! Kann ich nicht wenigstens …«
»Siehst du, was habe ich gesagt? Au!« Herr Burgholz hielt die Hand auf die Magengegend. »Jetzt geht es wieder los. Diese verflixten Gallenschmerzen!«
»Vati, bitte, reg dich jetzt nicht unnötig auf! Ich fahre natürlich mit dir. Wir – wir werden einen Weg finden.«
Herr Burgholz wankte stöhnend in sein Schlafzimmer. Der Gallenanfall, von der ganzen Familie gefürchtet, war da. »Keine Aufregung!« befahl der Arzt immer wieder. »Keine Aufregung!« Aber wer konnte eine solche immer verhüten?
Frau Burgholz ging, um ihrem Mann beizustehen. »Schnell ganz heißes Wasser für die Umschläge!« rief sie ihrer Tochter zu. Dass sie auch Suse weggeschickt hatte! – Als der heftigste Schmerzsturm abgeebbt war und Herr Burgholz erschöpft in seinen Kissen lag, nahm Maritta die Mutter beiseite. »Ich werde zu Tante Veronika fahren. Wir können sie unmöglich im Stich lassen.«
»Das wird Vati nie und nimmer erlauben.«
»Lass mich nur machen!«
»Und du kannst das auch nicht leisten, was dort von dir gefordert wird.«
»Das lass nur meine Sorge sein! Kann ich auch nicht alles, so doch etwas. Kartoffeln braten und Brei kochen wird schon klappen. Und dann hast du ja gehört, dass Tante Veronika vom Bett aus Anordnungen trifft. Glaube nur nicht, dass es mir leicht fällt zu verzichten, Mutti! Du weißt, wie sehr ich mich auf die Ferien mit euch, auf das Schwimmen und Bootfahren gefreut habe. Aber eine von uns beiden muss doch schließlich gehen. Sie haben doch außer uns keine Verwandten. Wenn sie vielleicht schon ein paar Jahre im Schwarzwald wären, aber in den wenigen Monaten ihres Dortseins sind sie doch noch nicht heimisch geworden.« –
Und so kam es, dass Maritta Burgholz am nächsten Vormittag, anstatt mit den Eltern an den Bodensee zu fahren, von Peter auf den Bahnhof begleitet wurde und mit dem Schnellzug Stuttgart-Karlsruhe und von dort mit der Albtalbahn in den Schwarzwald fuhr.
Der Vater war keineswegs damit einverstanden gewesen, aber einmal hatte er durch seine Gallenschmerzen genug mit sich selbst zu tun – zumal der Arzt, der in der Nacht noch gerufen wurde, die Abreise erst für den übernächsten Tag erlaubte –, und dann hatte Maritta es verstanden, ihm klarzumachen, dass man Tante Veronika nicht im Stich lassen könne. »Ich muss wenigstens nach ihr sehen«, hatte sie gesagt. »Selbstverständlich bleibt Mutti bei dir, und ich komme in ein paar Tagen nach.«
Sie glaubte fest daran. Vier, fünf Tage, höchstens eine Woche würde sie schließlich bei den Verwandten bleiben. Es blieben ihr immerhin dann noch drei ganze Wochen Ferien. Die Eltern trauten ihr zwar nicht zu, dass sie bei Tante Veronika viel leisten könnte, aber sie würde schon den Beweis liefern, dass man sie gebrauchen konnte. Es war vielleicht ganz gut so, dann würden Vater und Mutter erkennen, dass sie doch nicht mehr das kleine Mädchen war, für das sie gehalten wurde. Zu Hause hatte sie ja so gut wie gar keine Gelegenheit, zu beweisen, dass sie in praktischen Dingen Fähigkeiten besaß. Die meiste Zeit beanspruchten Schule und Hausaufgaben. Dann war Mutti sehr tüchtig im Haushalt, und außerdem waren Suse, die Hausgehilfin, und die Aufwarte- und Waschfrau da. – Es wäre ja noch schöner, wenn sie nicht beweisen könnte, dass sie Tante Veronika eine Hilfe sein würde. Ein bisschen komisch war es ihr zwar zumute, denn sie kannte die Verwandten nur wenig. Die Tante war Mutters Zwillingsschwester. Beide waren in Süddeutschland aufgewachsen. Der Großvater war Architekt gewesen. Mutti hatte sehr früh geheiratet. Vater war damals auf der Bank der Kreisstadt, in der die Großeltern lebten, angestellt gewesen. Als Mutter einundzwanzig Jahre alt war, wurde Maritta geboren. Tante Veronika war noch einige Jahre im Elternhaus gewesen. Dann starben Vater und Mutter rasch hintereinander. Maritta erinnerte sich noch gut daran, wie schmerzlich ihr der Tod der Großeltern, an denen sie sehr hing, gewesen war. Tante Veronika hatte, ebenso wie Mutti, eine sehr gute Ausbildung genossen. Sie war nach dem Tode ihrer Eltern einige Jahre in Ostpreußen auf dem Gut einer Gräfin als Hausdame tätig gewesen. Der Neffe der alten Dame hätte sie gerne geheiratet, obgleich sie nicht adelig war. Aber sie hatte ja in jener Zeit bereits ihren jetzigen Mann kennengelernt, der als einfacher Dorfschulmeister am Ort war. Der Krieg trennte die beiden. Die Gräfin musste, wie alle übrigen des Dorfes, ihr Hab und Gut verlassen und flüchten. Veronika teilte ihr Los und blieb durch alle Schrecknisse der Flucht an ihrer Seite. Monatelang lebten die beiden zusammen in einem Flüchtlingslager. Niemand hätte in jener Zeit in der alten, weißhaarigen Frau, die wie alle anderen auf einer Pritsche schlief und in geschenktem Kleid und Kopftuch herumlief, eine Gräfin vermutet. Veronika verließ sie auch nicht, als sie sterbenskrank wurde.
»Sie sind mir lieb geworden wie eine Tochter«, sagte die Gräfin damals. »Wenn ich jetzt nicht ebenso arm wäre wie alle anderen Flüchtlinge auch, würde ich Ihnen einen Teil meines Vermögens vermachen, damit Sie sich eine neue Existenz aufbauen könnten. Sie sind noch jung, das Leben liegt vor Ihnen. Aber ich bin, wie Sie wissen, arm und völlig mittellos. Jedoch will ich Gottes Segen auf Sie herabflehen bis zu meinem letzten Atemzug. Er möge es Ihnen lohnen, dass Sie in solcher Treue bis zuletzt bei mir ausgehalten haben!«
Nach dem Tode der Gräfin zog Veronika allein weiter, versuchte da und dort Arbeit zu bekommen und gab die Hoffnung nicht auf, eines Tages doch ihren Dorfschulmeister Benno Fröhlich wieder zu finden. Lange Zeit wusste ihre Schwester, Frau Burgholz, nichts von ihr. Endlich kam ein Brief, in dem Veronika berichtete, dass sie sich mit Benno verheiratet habe, nachdem dieser aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sei. Durch den Suchdienst des Roten Kreuzes hatten sie sich gefunden. An verschiedenen Plätzen hatte ihr Mann aushilfsweise Beschäftigung bekommen. Endlich wurde er auch wieder als Lehrer eingesetzt. Kümmerlich mussten sie sich einrichten. Die Kinder wurden geboren. Sie hatten kaum genügend Platz, um die Betten für sie zu stellen. Vor einem halben Jahr hatte Benno endlich eine Stelle als Lehrer in Hochdorf im Schwarzwald bekommen. Kurz vor ihrer Übersiedlung dorthin hatten sie einen Besuch im Hause des Bankdirektors Burgholz gemacht. Damals hatte Maritta zum ersten Mal ihre kleinen Vettern und die Base gesehen, ebenso den Onkel. An die Tante, die sie als kleines Mädchen natürlich gekannt hatte, vermochte sie sich kaum noch zu erinnern. Frau Burgholz hatte sich damals sehr über den Besuch ihrer Schwester und deren Familie gefreut. Ihrem Manne jedoch war die Unruhe bald zu viel gewesen, und er war froh, als der Lehrer mit den Seinen wieder abzog. Geärgert hatte es ihn jedoch mächtig, dass dieser den schönen Geldbetrag, den er ihm zum Neuanfang im Schwarzwald geben wollte, höflich dankend ablehnte. »Es ist freundlich von dir, Arno, aber ich glaube, wir kommen auch ohne dein Geschenk zurecht. Veronika und ich haben vom ersten Tag unserer Ehe sehr sparen müssen und finden, dass es unseren Kindern ebenfalls nichts schadet, wenn sie von klein auf bescheiden leben müssen. Sie sollen erst gar keinen Luxus kennenlernen.«
»Eingebildeter Pinsel!« hatte Herr Burgholz gemurmelt und den Geldbetrag wieder in seine Brieftasche geschoben. Laut und betont aber hatte er gesagt: »Gut, dann eben nicht. Man soll niemals seine Hilfe einem Menschen mit Gewalt auf zwingen.«
»Ich weiß nicht, ob nicht einmal eine Situation kommt, in der ich dir von Herzen dankbar bin, wenn du einspringst«, hatte Benno Fröhlich damals geantwortet. »Man kann nie wissen, was man noch durchmachen muss, aber im Augenblick wäre es unrecht, etwas von dir anzunehmen. Ich bin gesund, kann arbeiten, habe, wenn auch kein Riesengehalt, so doch mein regelmäßiges Einkommen. Zu unserem Schulhaus im Schwarzwald gehört ein Garten, den Veronika freudig bepflanzen wird. Das Holz zur Feuerung werden die Kinder und ich gemeinsam aus dem Wald holen, der gleich hinter dem Schulhaus beginnt. Also vielen Dank, lieber Schwager!«
Herr Burgholz hatte aufgeatmet, als sie wieder abgereist waren, die unruhigen Verwandten, und gab sich genießerisch der Ruhe und dem Frieden seines Familienlebens hin, die er ehrlich verdiente, wie er meinte, nachdem er auf der Bank manches an Ärger und Verdruss einzustecken hatte.
Und nun war also seine Tochter auf dem Weg ins Schwarzwälder Schulhaus. Nachdem sie den Schnellzug verlassen hatte, fuhr sie mit einer Kleinbahn durch ein idyllisches Tal, das sie immer wieder in seiner malerischen Schönheit an Bilder von Hans Thoma erinnerte, dessen Sommerhaus ja ebenfalls in einem Schwarzwaldtal gelegen hatte. Hier war nichts zu merken von der Unruhe, wie die Stadt sie bot. Weitere Strecken fuhr man, ohne dass ein Mensch zu sehen war. An zwei Stellen traten Rehe aus dem Wald auf die sattgrünen Wiesen und setzten, das Bimmelbähnchen gewahrend, mit großen Sprüngen zurück in sein schützendes Dunkel. Dann wieder tauchten Gehöfte auf, Schwarzwaldhäuser mit ihren tief herabhängenden, weit ausladenden Dächern. Spielende Kinder winkten, schwerbeladene Holzfuhrwerke wurden von stämmigen Pferden vorbeigezogen, zu den Fenstern strömte köstliche Tannenwaldluft in den fahrenden Zug herein. Maritta atmete tief auf. Es war ihr, als öffne sich ein Tor, hinter dem allerlei Neues, vielleicht sogar Schweres, aber dennoch beglückendes Erleben auf sie wartete.
Obgleich sie die Enttäuschung, nicht gleich mit den Eltern an den Bodensee fahren zu können, noch nicht ganz verwunden hatte, empfand sie doch etwas wie freudige Erwartung, als sie, nachdem sie nach dem Weg gefragt hatte, den Bahnhof verließ. Eilig durchquerte sie den Kurpark der kleinen Schwarzwaldstadt, um dann links abzubiegen und hinauf in den Nebenort zu gelangen, wo das Schulhaus stand, in dem ihr Onkel etwa vierzig bis fünfzig Kinder unterrichtete. Zum großen Teil gehörten sie Holzarbeitern, etliche waren auch Kinder von kleinen Landwirten, einige gehörten dem Bäckermeister, der den einzigen Laden dort oben besaß, in dem es nicht nur Brot und Gebäck, sondern ebenso Kolonialwaren, Wurst, Speck und Strickwolle sowie Küchenmesser, Rasierklingen und vieles andere gab. Auch der Gastwirt hatte zwei Kinder, die die Schule besuchten. – Aber von all dem wusste Maritta bis dahin noch nichts. Sie war voller Erwartung, was sie im Schulhaus antreffen würde, und voller Tatendrang, dort zu helfen. Man gelangte auf zwei verschiedenen Wegen ins Hochdorf. Einmal war da die breite Fahrstraße, daneben aber führte ein schmaler Wiesenpfad durch das Tal. Dieser kletterte über eine etwas steinige Halde und verschwand dann im Tannenwald, den er später wieder verließ. Dann ging es über ein Brücklein, unter dem ein munteres Bergbächlein hinein in die Wiesen hüpfte, die sich zwischen den dunklen Tannenwäldern wie leuchtende Teppiche ausbreiteten.
Maritta hatte den schmalen Weg gewählt und stand nach etwa dreiviertel Stunden vor dem Schulhaus, dessen Wände mit ungezählten, braunen Holztäfelchen, die wie Schuppen wirkten, bedeckt waren. Grüne Fensterläden und ebensolche Blumenkästen, die mit Geranien gefüllt waren, deren sattes Rot weit ins Tal hinableuchtete, gaben dem Ganzen ein freundliches Aussehen. Auf dem Schulhaus war ein kleines Türmchen, in dem eine Glocke hing. Im Untergeschoß befand sich der einzige Schulraum, während darüber die Lehrerwohnung zu sein schien.
Maritta stand im Treppenhaus, als sie lebhaftes Sprechen im Keller hörte. Sie ging diesem nach und befand sich plötzlich vor der Waschküche, aus der ihr eine Wolke Waschdampf entgegenkam. Wie erstaunte sie aber, als sie, nachdem sie den Raum betreten hatte und ihre Augen den Dunst zu durchblicken versuchten, ihren Onkel, den Lehrer, hinter einer großen Wanne stehen sah, damit beschäftigt, die Wäsche zu waschen! Neben ihm auf der einen Seite stand sein ältester Sohn und auf der anderen Guiseppe und Alfons, von denen man wusste, dass sie nichts als Dummheiten im Kopf hatten. Im Augenblick aber schienen sie eifrig in Tätigkeit zu sein. Der Vater, ebenfalls ein Wäschestück bearbeitend, hatte die Kinder gerade aufgefordert, mit ihm ein Lied zu singen, alldieweil jede Arbeit, oder besser gesagt, solche wie die, an der sie augenblicklich standen, mit Gesang viel leichter vorwärtsgehe. Soeben wollten sie beginnen, als sie den eintretenden Besuch entdeckten. »Oh, es kommt jemand zu uns!« sagte der Lehrer, trat hinter dem Waschzuber hervor, um besser sehen zu können, wer es sei. »Eine junge Dame?«
Schon wollte er ihr die Hand reichen, als er sich daran erinnerte, dass diese nass und voller Seifenschaum war. Er nahm von einem in der Ecke liegenden, noch nicht eingeweichten Berg Wäsche ein Kinderhemd, trocknete sich daran die Hände und streckte die Rechte Maritta entgegen.
»Seien Sie willkommen, was führt Sie zu uns?« Maritta brach in helles Lachen aus. Der Onkel wirkte aber auch zu komisch. Er hatte eine Gummischürze umgebunden, und seine Haare waren mit einer weißen Zipfelmütze aus Seifenschaum bedeckt, die hatten seine beiden kleinen Buben ihm soeben aufgesetzt.
»Was reizt Sie so zum Lachen?« fragte der Lehrer, lachte aber bereits ebenfalls mit dem ganzen Gesicht.
›Mit Augen, Nase, Mund und Ohren lacht er‹, dachte Maritta, und antwortete:
»Dein Aussehen, lieber Onkel, aber du scheinst mich nicht mehr zu kennen. Ich bin Maritta Burgholz, deine Nichte. Du hast doch um Hilfe gebeten. Mutti kann nicht kommen, Vati ist selbst krank und muss zur Erholung fort, aber ich bin hier, um euch zu helfen.«
»Juchhu!« schrie der Onkel, machte einen Luftsprung, dass ihm der Seifenschaum vom Kopf nach allen Seiten fortspritzte, fasste seine Nichte an den Händen und wollte mit der sich nun aber doch Sträubenden mitten in der Waschküche sofort einen Walzer tanzen.
Die zwei kleinen Jungen lachten vor Vergnügen hell auf, während der Älteste, über und über errötend, leise rief: »Aber Papa, lass sie doch! Du erschreckst sie nur.«
»Tu ich das?« fragte der Vater harmlos. »Das will ich natürlich nicht. Aber ich freu' mich ganz toll, dass Hilfe in der Not kommt, und zwar eine so prächtige. Ich hätte dich wahrhaftig nicht mehr erkannt. Aber nun komm, willst du gleich an die Wäsche gehen oder zuerst Veronika, ich meine, deine Tante begrüßen?«
»Ich möchte schon gerne zuerst ablegen«, erwiderte Maritta und warf einen etwas ängstlichen Blick auf den Wäscheberg in der Ecke und den im Waschzuber. »Auch hätte ich mir gerne die Hände gewaschen.«
»Das kannst du doch hier in der Waschwanne«, sagte Guiseppe, und schwupp, hatte Maritta eine Handvoll Seifenschaum im Gesicht.
»Guiseppe!« Ganz entsetzt rief es der große Bruder aus. Aber Maritta war mit einem Satz bei dem kleinen Knirps. »Warte, du Frechdachs!« Mit einem Ruck hob sie ihn hoch, drehte ihn um und tat, als wolle sie ihn mit dem Kopf in die Seifenbrühe stecken. Da gab es ein großes Geschrei, ein Strampeln und Lachen. Guiseppe wehrte sich mit Händen und Füßen. Zuletzt aber umarmte er Maritta und sagte: »Du gefällst mir!«
Dann führte Herr Fröhlich, von allen Kindern begleitet, seine Nichte zu seiner Frau. In einem denkbar einfachen Bett – Suse hatte daheim ein besseres – lag Tante Veronika, wohl sehr bleich, aber ebenfalls mit fröhlichem Lächeln.
»Ja, ist es möglich, Maritta, du kommst zu uns und willst uns helfen? Das ist ja wundervoll! Ich danke dir! Weißt du, mein Mann und die Kinder tun ja, was sie können, aber manchmal geht es doch drunter und drüber.«
»Ich weiß zwar nicht, ob ich dir solch eine große Hilfe bin, wie du erwartest.«
»Wenn du nur guten Willens bist, dann wird alles andere ganz von selber recht. Leider können wir dir kein eigenes Zimmer anbieten. Du siehst ja, alles ist bei uns sehr einfach. Wenn es dir nichts ausmacht, kannst du bei unseren Zwillingen schlafen. In ihrem Zimmer steht noch ein Bett. Im Wohnzimmer könnte man schließlich die Möbel zusammenrücken, viel stehen ohnehin nicht drin. Dann könnten wir das Bett dort hineinstellen, und du wärst wenigstens für dich allein.«
»Danke, Tante Veronika, ihr braucht euch keine Umstände zu machen für die acht Tage. Ich schlafe schon bei den beiden Jungen.«
»Acht Tage?«
»Nur eine Woche?«
»Warum nur acht Tage? Deine Ferien dauern doch länger?« Geradezu entsetzt fragten sie alle durcheinander. Nur die Tante und der älteste Junge schwiegen, aber auch ihre Augen fragten: »Nur acht Tage?«
»Vati wollte mich am liebsten überhaupt nicht gehen lassen«, erklärte Maritta jetzt in ihrer ehrlichen Art. Das ganze Jahr freut er sich, mit Mutti und mir in die Sommerferien zu fahren. Es war schon eine große Enttäuschung für ihn. Mutti, die natürlich brennend gern selbst gekommen wäre, ließ er schon gar nicht gehen. Dann habe ich erklärt, fahren zu wollen, und konnte ihn erst beruhigen, als ich versprach, nach einer Woche zu kommen.«
»Acht Tage!« Herr Fröhlich konnte sich noch gar nicht beruhigen. »Acht Tage! Wenn aber unser Schwesterchen bis dahin noch gar nicht da ist?«
»Ein Brüderchen!« protestierten die Buben.
Beinahe hilflos blickte Maritta von einem zum andern. Ja, du liebe Zeit, dann war es natürlich erst recht nötig, dass Tante Veronika Hilfe hatte, aber sie konnte doch unmöglich warten, bis das Kleine kam. Das wurde normalerweise doch erst in einigen Wochen erwartet.
Die Ruhigste blieb auch jetzt wieder Tante Veronika. »Nun wollen wir uns vor allem freuen, dass Maritta überhaupt gekommen ist«, sagte sie. »Alles andere wird sich finden. Es ist sinnlos, dass wir uns jetzt schon den Kopf darüber zerbrechen. Wie hat doch dein Vater immer gesagt, Benno?«
»Ungelegte Eier brütet man noch nicht aus«, erwiderte der Lehrer. »Du hast recht, Veronika, es wird sich alles geben. Jedenfalls freuen wir uns, dass du da bist, Maritta.«
Seine Frau aber fügte hinzu, als sie sah, wie Marittas Stirne sich sorgenvoll in Falten gelegt hatte: »Schöner als der Vers von den ungelegten Eiern ist doch der, den du Guido gestern im Religionsunterricht gelehrt hast: ›Sorget nicht für den anderen Morgen, es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage hat.‹ – So, und für heute haben wir Verstärkung bekommen. Ich dank' dir, Maritta! Kinder, nun geht und zeigt eurer Base, wo sie ihre Sachen unterbringen kann! Im Schrank im Zwillingszimmer ist genügend Platz.«
Mit großem Hallo und einer Überschüttung von guten Ratschlägen führten die Kinder Maritta in das genannte Zimmer.
»Am besten ist es, du kommst gleich mit uns hinunter in die Waschküche«, meinten die Zwillinge.
Die siebenjährige Bianca war anderer Meinung. »Komm, hilf mir in der Küche! Ich soll Salat waschen und Kartoffeln auf setzen.«
»Lasst sie sich doch zuerst einmal umziehen!« ermahnte der vernünftige Guido. »In dem Kleid kann sie doch weder in die Waschküche noch Salat putzen und Kartoffeln aufsetzen.«
»Mensch, bist du dumm, das ist doch kein Kleid, das ist doch ein Kostüm!«
»Und so lang die Mutti im Bett liegt, essen wir die Kartoffeln in der Schale. Das ist weniger Arbeit.«
»Ja, und nachts ziehen wir auch kein Nachthemd mehr an. Dann gibt es weniger Wäsche. Du kannst dir deins auch gleich sparen.«
»Und waschen tun wir uns auch nicht mehr so oft«, erklärte Alfons, »dann sparen wir Seife.«
»Alfons, du bist nicht ganz gescheit!« tadelte Bianca. »Was denkst du, was der Papa sagt, wo doch alle in der Schule die Hände zeigen müssen, ob sie auch sauber gewaschen sind!«
»Na ja, du und Guido, ihr könnt euch von mir aus jeden Tag waschen. Wir anderen gehen ja noch gar nicht zur Schule.«
»Quatsch, Papa merkt es trotzdem.«
»Und Mama ist traurig, und das darf sie jetzt schon gar nicht sein. Das schadet ihr.«
»So, jetzt geht ihr ein Weilchen hinaus«, sagte Maritta, die sich nicht unbedingt vor der ganzen Gesellschaft umziehen wollte.
»Raus!« befahl Guido. Und die übrigen gehorchten. Als letzter ging er. Bevor er die Türe hinter sich zuzog, sagte er zu Maritta:
»Ich werde dafür sorgen, dass du jetzt ungestört bleibst. Schlüssel stecken bei uns nicht in den Türen. Die Zwillinge schließen nämlich sich und andere dauernd ein. Kürzlich war der Herr Pfarrer hier zu Besuch. Als er im Wohnzimmer auf Papa wartete, haben sie ihn eingeschlossen und sind mit dem Schlüssel davongelaufen. Wir haben sie dann mindestens eine halbe Stunde gesucht, bis wir sie fanden. Zum Glück hatten sie den Schlüssel nicht weggeworfen.
Zuzutrauen ist es ihnen. Nun hat Papa alle Schlüssel abgezogen.«
»Danke, Guido. Es ist mir recht, wenn du deine Geschwister jetzt ein wenig fernhältst.«
Maritta sah sich in dem Stübchen um, das sie mit den Zwillingen während ihres Hierseins nachtsüber teilen sollte. Wahrlich, man konnte es beinahe ärmlich nennen! Ein großes Bett, die beiden Gitterbettchen der Kinder, ein Schrank und vor jedem der Betten ein Hocker. Von wegen Nachttisch und Leselampe! Sie dachte an ihr reizendes Zimmer daheim, in dem eine Schlafcouch, ein hübscher kleiner Schreibtisch, ein Bücherregal, Tisch und zwei Sessel standen, ein handgewebter Teppich lag auf dem Boden, Blumen waren am Fenster, einige wenige, aber wertvolle Bilder schmückten die Wände. Wie liebevoll und schön hatten die Eltern ihr das Zimmer eingerichtet, und immer wieder brachte die Mutter etwas aus der Stadt mit, was sie erfreuen konnte, eine Wandvase, eine Ampel mit einer Hängepflanze, eine hübsche Schreibgarnitur, und zu ihrem siebzehnten Geburtstag hatte der Vater ihr sogar einen eigenen Radioapparat geschenkt. Etwas derartig Einfaches, wie es hier war, hatte Maritta überhaupt noch nicht erlebt. Und doch sah Tante Veronika so froh aus.
»Dauert das immer so lang, bis du fertig bist?« schrien die Zwillinge draußen.
»Kommst du jetzt zu mir in die Küche?« Bianca konnte es nicht erwarten, bis Maritta ihr half. Aus einem anderen Zimmer tönte das Rufen eines kleinen Kindes.
»Das ist Sabinchen!« erklärte Guiseppe und riss die Türe auf.
»Nun komm schon!«
Im Nebenraum lag die zweijährige Jüngste der Familie, das heißt, sie versuchte soeben aus ihrem Bettchen herauszuklettern.
»Was bist du für ein süßes Ding!« sagte Maritta und hob die Kleine auf ihre Arme. Immer, so lange sie sich erinnern konnte, hatte sie sich ein Schwesterchen gewünscht, und so, wie dieses blondlockige herzige Ding mit den großen Frageaugen hatte sie es sich vorgestellt. Fest drückte sie Sabinchen an sich. Und plötzlich wusste sie: Der Reichtum von Onkel und Tante waren nicht kostbare Möbel, ein schönes Haus oder ein Vermögen, sondern ihre fünf Kinder, und sie begriff in diesem Augenblick, dass sie sich auf das sechste herzlich freuten. Am liebsten wäre sie bei der Kleinen geblieben, aber sie dachte mit Entsetzen daran, dass der Onkel gewiss wieder in die Waschküche gegangen war. Das konnte sie doch nicht zulassen. So übergab sie Sabinchen der Schwester. »Du kannst sie gewiss anziehen, Bianca. Ich will hinunter in die Waschküche gehen.«
»Mama sagt, du sollst zuerst bei ihr eine Tasse Kaffee trinken. Ich hab' dir alles an ihr Bett gestellt.«
Gleich darauf saß Maritta bei Tante Veronika. »Ich möchte nichts essen, vielen Dank! Ich denke, es ist am besten, wenn ich gleich hinunter in die Waschküche gehe«, hatte sie gesagt. Aber die Tante bestand darauf, dass sie zuerst etwas zu sich nahm. »Dein Eifer ist erfreulich«, sagte sie, »aber du darfst nicht vergessen, dass du einen solchen Umtrieb und so viel Arbeit und Unruhe, wie es bei uns gibt, nicht gewöhnt bist. Das alles strengt an. Ich hoffe aber trotzdem, dass du gerne bei uns bist und dass wir uns ein wenig näherkommen. Allein dich hier zu haben, die Tochter meiner einzigen Schwester, ist mir eine große Freude, du weißt ja, wie deine Mutti und ich aneinander hängen. Es ist mir eine Beruhigung, dich in den nächsten Tagen bei mir zu wissen. Ich glaube nicht, dass es noch lange dauert, bis unser Kindchen ankommt. Wir alle freuen uns sehr darauf. Aber ich will es dir trotzdem anvertrauen, dass ich ein wenig Sorge habe. Es ist diesmal anders, als es sonst war. Mein Mann will ja unbedingt, dass ich ins Krankenhaus gehe, aber ich kann mich nicht entschließen. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, so bin ich schnell mit dem Auto in der Klinik, wenn aber irgend möglich, will ich hierbleiben. Onkel Benno kann nicht die Kinder und den Haushalt noch neben seiner Lehrertätigkeit haben. Er muss ja sämtliche Klassen in einem Raum unterrichten. Wir sind hier eben Dorfschule. Beinahe wünschte ich, unser Kleines käme noch heute oder in dieser Nacht. Wenn du nur acht Tage dableiben kannst, dann bin ich in einer Woche vielleicht doch schon wieder so weit, dass ich aufstehen kann.«
»Aber das ist doch gewiss nicht möglich, Tante Veronika«, sagte Maritta ängstlich und überlegte, ob sie es wirklich fertigbrächte, bereits nach acht Tagen wieder abzufahren, wenn das Kleine nun tatsächlich in den nächsten Tagen kommen würde. Eigentlich war es doch undenkbar, die Tante dann im Stich zu lassen. Aber was würde Vati dazu sagen?
»Nun will ich in die Waschküche gehen«, sagte sie nach einer Weile und stand auf. »Ich muss dir zwar sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie man wäscht. Die große Wäsche gibt Mutti aus, die kleinen Sachen wäscht Suse. Und die hat eine Waschmaschine und eine Wäschetrommel. Beides scheint ihr ja nicht zu besitzen.«
»Nein, das haben wir alles nicht. Aber mein Mann hat mir schon so oft geholfen, dass er genau den Wasch Vorgang kennt und dich anleiten kann. Du brauchst dich nicht zu schämen, dass du es nicht kannst, du hast eben bisher deine Zeit mit Lernen ausgefüllt. Das ist ja auch wichtig.«
»Oh, ich habe längst nicht nur gelernt«, erwiderte Maritta ehrlich. »Im Grunde genommen bin ich ein sehr verwöhntes Mädchen und habe ein bequemes Leben geführt.«
Als Maritta sich am Abend dieses ersten Tages in ihr Bett legte, vermochte sie nicht lange nachzudenken über das, was sie erlebt hatte. Sie war derartig übermüdet, dass ihr die Augen bereits zufielen, noch bevor sie sich richtig zugedeckt hätte. Stundenlang war sie in der Waschküche gewesen. Schon nach einer Viertelstunde hatte sie die Finger aufgerieben gehabt. Der Onkel, der tatsächlich neben ihr weitergewaschen hatte, sah plötzlich, dass ihre Hände bluteten. »Um alles in der Welt. Maritta!« rief er erschrocken aus. »Das fängt ja gut an. Das kommt daher, dass du deine Hände, aber nicht die Wäsche wäschst.«
»Nicht die Wäsche?«
Maritta blickte auf den Kopfkissenbezug, den sie gerade bearbeitete. »Du machst es falsch«, sagte der Onkel und zeigte ihr, wie sie das Wäschestück halten und reiben musste.
»Dass du als Mann so etwas kannst!«
»Ich war doch im Krieg lange genug in der Gefangenschaft. Da lernt sich so etwas von selber. Und außerdem fällt keinem Mann ein Stein aus der Krone, wenn er sich bemüht, seine Frau zu entlasten, indem er ihr von ihrer Arbeit abnimmt, was er nur kann. Aber du darfst jetzt nicht weiter waschen, Maritta. Die Seifenlauge frisst dir die wunden Stellen an deinen Fingern nur noch mehr auf, und das tut scheußlich weh. Geh nur hinauf! Oben wirst du genug andere Arbeit finden.« Aber Maritta wollte nicht.
»Nein, ich werde dich hier nicht im Stich lassen.«
»Dann nimm den Wäschestampfer und stampfe die Bettwäsche dort in dem großen Zuber!«
Als sie endlich fertig waren, hatte Guido bereits Abendessen gekocht, Bianca hatte Sabinchen gewaschen und gefüttert, und die beiden Buben, Guiseppe und Alfons, waren gerade dabei, den Tisch im Wohnzimmer zu decken, und stritten sich, wer von ihnen neben Maritta sitzen dürfe. »Schafsköpfe seid ihr«, mischte sich nun der große Bruder in den Streit. »Setzt sie doch zwischen euch! Aber darauf seid ihr natürlich nicht von selbst gekommen.«
»Selber Schafkopf«, gab Guiseppe prompt zurück, stellte aber doch den schönsten Teller, den mit dem Goldrand, zwischen den seinen und den seines Bruders.
Maritta wunderte sich, wie manierlich die Kinder bei Tisch waren. Da gab es kein Schmatzen und Schlurfen, kein Manschen und Kleckern. Natürlich blieben kleine Zwischenfälle nicht aus. So warf Alfons seine Tasse um. Zum Glück war eine Wachstuchdecke auf dem Tisch. Bianca stand sofort auf und holte ein Tuch aus der Küche, um den See aufzutrocknen. Was Maritta besonders wunderte, war, dass der Onkel auch jetzt nicht heftig wurde, sondern in aller Ruhe sagte: »Alfons, du musst besser aufpassen! Wenn du nun noch einmal etwas umwirfst, dann musst du in der Küche weiteressen.« Als Bianca, mit der Würde des kleinen Hausmütterchens, ihm Vorwürfe machen wollte: »Ja, gestern hast du auch deinen Suppenteller unter den Tisch geworfen, immer machst du irgendeinen Blödsinn«, da legte ihr der Vater ruhig die Hand auf die Schulter und sagte: »Bianca, es genügt, dass ich darüber mit Alfons gesprochen habe.«
Nach dem Essen begann Guido sofort in der Küche abzuwaschen. Die Zwillinge trockneten das Geschirr ab, und Bianca brachte den Tisch und das Wohnzimmer in Ordnung. Indessen nahm der Vater sich Zeit, einen Augenblick bei seiner Frau zu sitzen. Maritta schaute noch einmal nach Sabinchen. Die schlief aber bereits. Dann bat sie die Tante, ihr zu sagen, was sie morgens als erstes zu tun habe: wann aufgestanden würde, wann der Onkel vor dem Schulunterricht sein Frühstück haben müsse, welche Vorbereitungen für die Mahlzeiten getroffen würden und so weiter.
»Eins nach dem anderen«, sagte Tante Veronika freundlich. Und dann besprach sie ruhig mit Maritta, die eine gewisse Erregung nicht verbergen konnte, die notwendigen Aufgaben bis zum Frühstück des anderen Morgens, aber nicht mehr. »Die Fülle der Arbeit darf dich nicht erdrücken«, sagte sie.
Als die Kinder aus der Küche kamen, stellten sie sich ans Klavier, vor dem der Vater bereits Platz genommen hatte, und nun wunderte sich Maritta nicht wenig über das harmonische Singen der Kinder. Die waren ja alle hochmusikalisch! Drei, vier Kinder- und Abendlieder sang der Vater mit ihnen, die er alle mit dem Klavier begleitete, und zwar ganz ohne Noten. Maritta hörte, dass die Tante im Nebenzimmer mitsang. So froh und friedlich klang der Tag aus, dass über Maritta ein großes Staunen kam. Hier merkte man nichts von dem Gehetztsein und rasenden Tempo, über das alle Menschen in der Stadt klagten. Das war wirklich noch Feierabendstille, wie man sie eigentlich nur aus Erzählungen früherer Zeiten kannte. Dabei war aber nichts Sentimentales oder Schmalziges. Man musste sich unbedingt wohlfühlen im Kreise dieser Menschen. Maritta freute sich, dass sie hergekommen war. Sie würde nach den acht Tagen viel zu erzählen haben. –
Mitten im tiefen Schlaf hörte sie sich plötzlich beim Namen gerufen. Sie öffnete zuerst gar nicht die Augen, drehte sich auf die andere Seite und wollte, todmüde, wie sie war, weiterschlafen. Wieder hörte sie es: »Maritta, bitte, steh auf!« Aber das war doch nicht Mutti, die sie, wie sonst, weckte! Wie kam Vater dazu? –
»Maritta, ich wäre dir dankbar, wenn du aufstehen würdest, Tante Veronika …« Mit einem Satz richtete sich Maritta auf. Sie war ja im Schulhaus bei Onkel Benno. Sollte das Kleine ankommen? – Sie sah den Onkel fragend an. Er nickte. »Es ist soweit. Mach dich bitte gleich fertig und gehe zu meiner Frau hinüber! Ich will indessen Frau Schmidthauer, die Hebamme, anrufen.«
»Ist es weit bis zum Telefon?« fragte Maritta ängstlich. Er würde sie doch um alles in der Welt nicht mit der Tante allein lassen! Sie wusste sich nicht zu helfen.
»Nur hier nebenan in der Wirtschaft«, gab der Onkel zur Antwort und eilte davon. Rasch kleidete Maritta sich an. Als sie leise die Türe hinter sich schloss, stand Guido bereits angezogen vor ihr. Fragend schaute er sie an. »Kann ich etwas helfen?« Angst stand in seinen Augen. »Geht es Mama nicht gut?« Sie strich dem Jungen beruhigend über das Haar und spürte, wie im gleichen Augenblick eine große Ruhe über sie selbst kam. Sie musste zumindest jetzt für die Kinder da sein. Die Gewissheit, gebraucht zu werden, gab ihr selbst ein Gefühl der Sicherheit. »Willst du nicht lieber zu Bett gehen, Guido?« fragte sie. »Sollte ich dich wirklich brauchen, dann rufe ich dich.« Er schüttelte den Kopf. »Ich gehe schon mal in die Küche und mache Feuer.«
Tante Veronika lag in ihrem Bett, zwar schon von Schmerzen gezeichnet, jedoch freundlich der Nichte zulächelnd. »Nun scheint doch unser Kleines zu kommen. Bitte
lege alles, was ich dir sage, zurecht.« Und nun gab sie tatsächlich vom Bett aus ihre Anordnungen.
»Dort in der Schublade findest du die Windeln, Jäckchen und Hemdchen. Da drüben ist frische Bettwäsche. So, leg alles herüber auf die Wickelkommode! Hol jetzt bitte die kleine Wanne aus der Küche herein und stelle sie da drüben auf die beiden Hocker! Wir werden heißes Wasser brauchen. So, wenn du nun die Fenster weit öffnen möchtest. Mir ist, als sei die Luft hier verbraucht.« – Zwischen ihren Anordnungen hielt sie immer wieder inne und presste die Hände zusammen. Maritta sah, dass sie litt. Wenn doch nur der Onkel käme! –
»Und mahle bitte in der Küche Bohnenkaffee! Frau Schmidthauer wird froh über einen starken Kaffee sein, wenn alles vorbei ist.« Ein frohes Lächeln huschte wieder über ihr Gesicht. »Was werden die Kinder sagen, wenn morgen früh vielleicht schon das Kleine da ist! Ach, Maritta, solch ein Geschöpfchen, das Gott einem unter das Herz legt, ist ein unsagbar großes Geschenk und das höchste Glück einer Mutter!«
Onkel Benno kam zurück. »Gott sei Dank!« dachte Maritta, und es fiel ihr ein Stein vom Herzen. Sie ging in die Küche zu Guido, gewillt, unter allen Umständen wach zu bleiben, um bereit zu sein, wenn sie gebraucht würde.
Sie mochten etwa eine halbe Stunde gesessen haben, als Frau Schmidthauer kam. »Ist Feuer gemacht? Wasser aufgesetzt?« – Fragend sah sie Maritta an.
»Ich bin Frau Fröhlichs Nichte, Maritta Burgholz«, stellte diese sich vor. Die Frau nickte ihr kurz, aber nicht unfreundlich zu. »Wollen Sie aufbleiben?«
»Vielleicht kann ich doch etwas helfen.«
Ein fast belustigtes Lächeln, das Maritta kränkte, war die stumme Antwort.
Wieder warten! Eine Stunde, zwei Stunden! Einige Male war es Maritta, als höre sie leise, unterdrückte Wehlaute. Guido war am Küchentisch eingeschlafen. Als sein Vater für einen Augenblick hereinkam, nahm er ihn kurzerhand auf die Arme und trug ihn in sein Kämmerchen. Er legte ihn aufs Bett. »Zieh ihn aus, Maritta«, bat er, »und deck ihn zu!« Schon wieder im Gehen begriffen, blieb er noch einmal stehen, blickte das junge Mädchen aus sorgenvollen Augen an und sagte: »Ich bin sehr beunruhigt. Tante Veronika hätte doch auf mich hören und ins Krankenhaus gehen sollen.«
»Ist es – ist es – geht es ihr nicht gut?«
Da rief bereits Frau Schmidthauer nach ihm, und Maritta hörte etwas von »Arzt rufen«. Der Onkel rannte die Treppe hinunter.
Maritta überfiel eine heiße Angst. »Es wird doch nichts passieren!« Ohne es eigentlich bewusst zu tun, faltete sie die Hände. »Lieber Gott, lass der Tante nichts zustoßen! Erhalte sie ihrem Mann und ihren Kindern!« Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie so nah bei einem solchen Ereignis dabei. Zweifellos, man betrachtete sie hier als völlig erwachsenes Mädchen. Ach, wie gerne wollte sie helfen, soviel sie konnte, – wenn auch – sie blickte ein wenig wehmütig auf ihre rauen, sonst so sorgsam gepflegten Hände, – wenn es auch schade um jeden Ferientag war, den sie nicht am Bodensee – aber nein, solche Gedanken waren jetzt wirklich nicht am Platze.
Der Arzt war bald zur Stelle. Unruhig ging Maritta in der Küche auf und ab, sah inzwischen nach den friedlich schlafenden Kindern, deckte Sabinchen, die sich aufgestrampelt hatte, behutsam zu, legte Alfons, der quer im Bett lag, wieder zurecht, ging zurück in die Küche, sah nach dem Feuer – Da! – Rief nicht jemand? – Im nächsten Augenblick riss Onkel Benno die Türe auf, packte Maritta an beiden Schultern, schüttelte sie hin und her, gab ihr einen Kuss und schrie ihr in die Ohren, als sei sie taub: »Zwillinge haben wir, ein Pärchen, Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen – wieder Zwillinge!« Und schon war er wieder draußen, steckte noch einmal den Kopf durch die Türe und flüsterte mit an die Lippen gelegtem Zeigefinger: »Aber bitte sei ganz stille, sie braucht natürlich jetzt völlige Ruhe und Schonung!« Dann rannte er wieder davon. Maritta schüttelte den Kopf. »Dabei macht keiner Lärm außer ihm.«
Unbeschreiblich war die Freude. Die Kinder, denen der Vater gleich beim Wecken die Nachricht brachte, wollten alle mit lautem Hallo und Geschrei zur Mutter und den neuen Geschwisterchen. Aber das ließ der Vater nun doch nicht zu. »Was denkt ihr? Das kann Mama noch nicht brauchen. Sie muss heute völlige Ruhe haben und viel schlafen.«
»Aber die Kinder, dürfen wir die sehen?«
»Frau Schmidthauer hat mir verboten, sie anzufassen. Sie fürchtete wohl, dass ich gleich mit ihnen in die Nachbarschaft rennen würde, um sie zu zeigen. – Aber wenn sie nachher kommt, um Mutti und die Babys zurechtzumachen, bringt sie die beiden gewiss für einen Augenblick zu euch heraus. Und wenn Mama ausgeschlafen hat, dürft ihr auch schnell mal an die Schlafzimmertüre kommen, um ihr guten Tag zu sagen.«
»Geht es ihr gut?« fragte Guido leise und voller Besorgnis.
»Doch, Guido, – wir waren zuerst alle sehr in Sorge um sie, aber es ist alles gutgegangen.«
»Wie heißen die Kinder?« schrien Guiseppe und Alfons.
»Ihr wisst doch, wir hatten uns vorgenommen, wenn es wieder ein Mädchen sein würde, sollte es Fernanda heißen, und ein Junge Benito. Nun haben wir ja beides, und alles ist in Ordnung.«
Maritta dachte an ihren Vater. Der würde wieder über die »verrückten Namen«, wie er sagte, den Kopf schütteln. Aber schließlich konnte er dem Onkel keine Vorhaltungen machen, denn sie, Maritta, hatte auch nicht gerade einen alltäglichen Namen. Allerdings erinnerte sie sich, dass ihre Mutter ihr erzählt hatte, sie habe sich mächtig anstrengen müssen, um diesen Namen bei ihrem Vater durchzusetzen. Maritta habe ihre beste, früh verstorbene Freundin geheißen, und in Erinnerung an diese habe sie ihre Tochter so genannt. – Aber nun war nicht Zeit, über solche Probleme nachzudenken. Sie hatte die Hausfrau zu vertreten und musste sogar kochen. Um alles in der Welt, bis vor kurzem hatte sie kaum gewusst, wann das Kaffeewasser kochte! – Als erstes musste sie jetzt für alle das Frühstück bereiten und dann auf jeden Fall mal einen großen Topf Pellkartoffeln aufsetzen. Es war nur gut, dass Guido und Bianca so verständige und tüchtige Kinder waren.
»Maritta, ist der Kaffee fertig? Um sieben Uhr kommen die Schüler der fünften, sechsten, siebten und achten Klasse. Da fängt mein Unterricht an. Guido, du gehst schon einmal hinunter, stellst dich an den Eingang und sagst allen, dass wir heute Nacht wieder Zwillinge bekommen haben. Sie sollen leise sein, wegen Mutti. Kaffeetrinken kannst du nachher.«
Maritta kochte, putzte, wusch das Geschirr, hing Wäsche auf und nahm die trockene wieder ab, wurde von Frau Schmidthauer beansprucht, machte die Betten der Kinder und kochte der Tante eine Hühnerbrühe. Sie kam überhaupt nicht zu sich selbst und wunderte sich nur, dass ihr nicht mehr missriet. Prächtig waren die beiden ältesten Kinder. Guido hatte den Vater gebeten: »Lass Bianca und mich heute doch aus der Schule bleiben! Maritta kennt sich doch noch nicht genügend aus. Wir müssen ihr helfen.« Und der Vater hatte es erlaubt. Schließlich bekam man ja auch nicht jeden Tag Zwillinge.
Tante Veronika hatte der großen Nichte mit strahlendem Lächeln ihre Hand entgegengestreckt. »Wie bin ich froh, Maritta, dass du da bist! Dich hat der liebe Gott zur rechten Zeit geschickt. Sicher bin ich in einigen Tagen wieder so weit, dass ich aufstehen und mithelfen kann. Ich habe mich immer sehr bald wieder erholt.«
Maritta aber hatte die Tante besorgt angesehen. »Du siehst sehr elend aus und darfst gewiss nicht zu früh auf stehen.« Sie beugte sich über den Waschkorb, in dem das Zwillingspärchen, die rosigen Fäustchen an den Kopf gedrückt, lag.
»Sind sie nicht herzig?« fragte die Tante. »Ich glaube, es sind die schönsten meiner Kinder.« Über ihr bleiches Gesicht huschte ein verlegenes Lächeln, und sie errötete wie ein junges Mädchen. »Aber das habe ich bei jedem Kind gesagt.«
»Sie sind aber wirklich besonders hübsch«, stellte Maritta bewundernd fest. »Diese seidenweichen Härchen, die kleinen Stupsnäschen und die herzigen Fingerlein!«
»O Maritta«, fügte die Tante hinzu, »es gibt nichts Beglückenderes, als wenn Gott einer Mutter ein Kindlein in den Arm legt, und da ich diesmal wieder zwei habe, bin ich doppelt glücklich.«





























