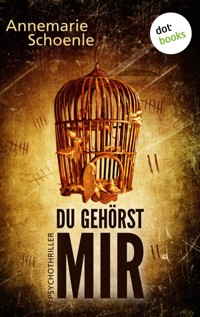Der Teufel steckt im Stöckelschuh, Die Luft ist wie Champagner & Die Rache kommt im Minirock E-Book
Annemarie Schoenle
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Frauen lassen sich nichts gefallen! DER TEUFEL STECKT IM STÖCKELSCHUH: Maren hat sich verliebt. Ausgerechnet in einen Völkerkundler! Das kann nicht gut gehen – schließlich ist sein Spezialgebiet das menschliche Paarungsverhalten … Währenddessen hat Günter ganz andere Probleme: Erst wird er von seiner Freundin verlassen und dann stellt sich heraus, dass sie noch mehr als eine Rechnung mit ihm begleichen will … DIE LUFT IST WIE CHAMPAGNER: Nachdem Christian von seinem zukünftigen Schwiegersohn zuerst wenig begeistert war, hat er ihn doch noch ins Herz geschlossen – und wird bei der Hochzeit seiner Tochter ziemlich überrascht … Stine ist glückliche Hausfrau und Mutter. Als sie Besuch von ihrer alten Freundin Bea bekommt, beginnt sie, diese um ihr Jet-Set-Leben zu beneiden. Außerdem muss sie sich fragen, ob die alte Zuneigung zwischen ihrem Mann und Bea noch immer besteht DIE RACHE KOMMT IM MINIROCK: Betti hat gerade erst ihren Job verloren, da erwischt sie ihren Freund Bert auch noch mit einer Laufstegschönheit! Sie sinnt auf Rache und fasst einen Plan. Als Bert sie schließlich für die andere verlässt, ahnt er noch nicht, dass er damit in Bettis Falle tappt … Ein unterhaltsamer Romantik-Sammelband für alle Fans von Alexandra Potter und Petra Hülsmann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
DER TEUFEL STECKT IM STÖCKELSCHUH: Maren hat sich verliebt. Ausgerechnet in einen Völkerkundler! Das kann nicht gut gehen – schließlich ist sein Spezialgebiet das menschliche Paarungsverhalten … Währenddessen hat Günter ganz andere Probleme: Erst wird er von seiner Freundin verlassen und dann stellt sich heraus, dass sie noch mehr als eine Rechnung mit ihm begleichen will …
DIE LUFT IST WIE CHAMPAGNER: Nachdem Christian von seinem zukünftigen Schwiegersohn zuerst wenig begeistert war, hat er ihn doch noch ins Herz geschlossen – und wird bei der Hochzeit seiner Tochter ziemlich überrascht … Stine ist glückliche Hausfrau und Mutter. Als sie Besuch von ihrer alten Freundin Bea bekommt, beginnt sie, diese um ihr Jet-Set-Leben zu beneiden. Außerdem muss sie sich fragen, ob die alte Zuneigung zwischen ihrem Mann und Bea noch immer besteht
DIE RACHE KOMMT IM MINIROCK: Betti hat gerade erst ihren Job verloren, da erwischt sie ihren Freund Bert auch noch mit einer Laufstegschönheit! Sie sinnt auf Rache und fasst einen Plan. Als Bert sie schließlich für die andere verlässt, ahnt er noch nicht, dass er damit in Bettis Falle tappt …
Über die Autorin:
Die Romane Annemarie Schoenles werden millionenfach gelesen, zudem ist sie eine der begehrtesten Drehautorinnen Deutschlands (u. a. Grimme-Preis). Sie ist Mutter einer erwachsenen Tochter und lebt mit ihrem Mann in der Nähe von München.
Bei dotbooks erschienen bereits Annemarie Schoenles Romane »Frauen lügen besser«, »Frühstück zu viert«, »Verdammt, er liebt mich«, »Nur eine kleine Affäre«, »Du gehörst mir«, »Eine ungehorsame Frau«, »Ringelblume sucht Löwenzahn«, »Ich habe nein gesagt«, »Familie ist was Wunderbares«, »Abends nur noch Mondschein« und die Sammelbände »Frauen lügen besser & Nur eine kleine Affäre«, »Ringelblume sucht Löwenzahn & Abends nur noch Mondschein« sowie die Erzählbände »Das Leben ist ein Blumenstrauß«, »Dreitagebart trifft Minirock«, »Tanz im Regen« und »Zuckerherz und Liebesapfel«.
Die Website der Autorin: www.annemarieschoenle.de
***
Sammelband-Originalausgabe April 2025
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane, die im Sammelband enthalten sind, finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ma)
ISBN 978-3-98952-538-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Annemarie Schoenle
Der Teufel steckt im Stöckelschuh, Die Luft ist wie Champagner & Die Rache kommt im Minirock
Drei Romane in einem eBook
dotbooks.
Der Teufel steckt im Stöckelschuh
Die Aufziehpuppe
Paarung
Viel zu jung für eine Witwe
Ein langer Tag
Mandelsplitter
Die gläserne Frau
Die gerechte Strafe
Der Flug des Falters
Ganz in Weiß
Es war Sommer
Das Schlachtross
Die Luft ist wie Champagner
Ein prachtvoller Bursche
Wiedersehen mit Bea
Der Duft von Veilchen
Der kleine Kümmerling macht Politik
Vorbei ist nicht vorüber
Eine total harmonische Trennung
Ski-Heil für Maximilian
Das Kuckucksei
Nimm's nicht tragisch, Annabell
Der Mann, der alles links machte
Lieben Sie Langusten?
Ein Mann, ein Huhn und sehr viel Liebe
Die geborene Ehefrau
Ein kleines Stückchen heile Welt
Eine ganz normale Frau
Herzklopfen
Mariechen macht eine Eroberung
Blumen für Johannes
Die Rache kommt im Minirock
Verlieben Sie sich nie in Ihren Psychiater
Rache und was sonst noch zählt
Keine Dummheiten!
Das italienische Abenteuer
Das Cover–Girl
Gelbe Margeriten
Der Park
Veilchen zum Abschied
Verwandlung
Die Rache des Produzenten
Eine gute Partie
Bettelarmband
Rechtenachweis
Lesetipps
Der Teufel steckt im Stöckelschuh
Maren hat sich verliebt. Ausgerechnet in einen Völkerkundler! Das kann nicht gut gehen – schließlich ist sein Spezialgebiet das menschliche Paarungsverhalten … Währenddessen hat Günter ganz andere Probleme: Erst wird er von seiner Freundin verlassen und dann stellt sich heraus, dass sie noch mehr als eine Rechnung mit ihm begleichen will … Wenn von der großen Liebe nur ein gebrochenes Herz bleibt, wird es spannend – denn dann beginnen starke Frauen mit Liebreiz, Humor und scharfen Waffen zurückzuschlagen!
Die Aufziehpuppe
Manchmal, wenn sie ihrer Mutter oder Tante Amy gegenübersaß, erinnerte sie sich an die Puppe, die Vater ihr zum achten oder neunten Geburtstag geschenkt hatte. Sie erinnerte sich daran, wie sie die Schachtel aufriss und auf die hässliche Zelluloidpuppe starrte und wie Mutter rief: »Sieh nur, Erica, man kann sie aufziehen, Gott, was für ein kitschiges Ding!«
Sie hatten die Puppe aufgezogen und auf ein schräg liegendes Brett gestellt, und die Puppe lief auf steifen Beinen das Brett hinunter bis zum Boden, tak-tak-tak, der Schlüssel, der wie ein kleines Messer in ihrem Rücken stak, drehte sich langsam, und als sie den Boden erreichte, fiel sie um, die porzellanblauen dummen Augen nach oben gerichtet.
»Typisch«, sagte Ericas Mutter und warf Amy einen bedeutsamen Blick zu, »das ganze Jahr lässt er nichts von sich hören, und dann das! Eine Zelluloidpuppe von Woolworth!«
Sie hatte die Schachtel mit der Puppe in ihrem Spielschrank versteckt und hatte sich geschämt, dass Vater so wenig Geld besaß und bei Woolworth kaufte, doch nachts, wenn sie sich einsam fühlte und die leisen Stimmen von Amy und Mutter aus dem Wohnzimmer drangen, holte sie die Puppe hervor, zog sie auf und ließ sie über den Teppich stolpern. Dann stellte sie sich vor, dass Vater zurückkehrte und Tante Amy aus dem Haus jagte und die Jungs verprügelte, die sich über sie in der Schule lustig machten und hinter ihrem Rücken erzählten, im Haus am Glockenbach spuke es und Mutter und Amy würden leben wie ein Ehepaar.
Das Haus am Glockenbach ... Es schauderte sie, wenn sie es sich, an ihrem Schreibtisch sitzend, vorstellte: rechteckig wie ein Sarg, ein großer dunkler Klotz, in dessen bemoosten Mauern Efeu und Immergrün zähe Wurzeln schlugen und Dutzende von Spinnen und kleine Fliegen in die Zimmer lockten. Wie oft schon hatte sie das Haus verlassen wollen, doch es hatte sie umgarnt und festgehalten, als hätte sich die im Mondlicht blinkende Fensterfront mit den im Wind singenden Blättern zu einem undurchdringlichen Netz verknüpft, als nähmen es die Spinnen und Fliegen endgültig in ihren Besitz und lähmten sie, Mutter und Amy mit dem Gift einer alles überwuchernden Trägheit. Ihre Freundinnen hatten geheiratet, Kinder geboren, sie hatten sich scheiden lassen, hatten sich Liebhaber genommen, hatten wieder geheiratet. Sie hatten gelebt, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, während es sich für sie nicht lohnte, ihre Tage in Stunden und die Jahre in Monate aufzuteilen, weil sie sich im Geflecht ihrer Resignation und ihres Hasses immer mehr verstrickte. Manchmal malte sie sich aus, wie sie Vaters Puppe nahm und am Schlüssel drehte, bis die Feder im Inneren zerbrach, wie sie die Treppen zu Amys Zimmer hinaufstieg und die Bremsen des Rollstuhls löste, wie sie dem Stuhl einen Tritt gab, einen kräftigen, hasserfüllten, befreienden Tritt, und wie sie Mutter an Amys Grab allein zurückließ, ihre Koffer packte und zu Tony ging. Immer, wenn sie sich mit diesen Koffern das Haus verlassen sah, bäumten sich ihre Träume auf, und Mutters Gesicht schwebte wie ein zarter Mond im Zimmer, mit einer pergamentdünnen, rosafarbenen Haut, schmalen, sanft geschwungenen Lippen und mit Augenbrauen, die wie erschrockene Schmetterlingsflügel in die Stirn fuhren. Grauenvolle Leere erfüllte sie dann, die ihr die Brust abschnürte und alles Leben in ihr versickern ließ. Und sie schlich sich in die Küche und schnitt dicke Scheiben vom frischen Brotlaib ab, bestrich sie mit Butter und Marmelade, rot wie Blut, und stopfte sich das Brot so gierig in den Mund, als hätte sie seit Stunden gehungert. Dann lief sie zum Spiegel und betrachtete diesen Mund mit seiner rissigen Haut, die matten Augen, die haarfeinen Linien auf ihrer Stirn, und sie schwor sich, ein neues Leben zu beginnen, ihr Leben, gleich, sofort. Am nächsten Morgen holte sie den enganliegenden Pullover, den Mutter nicht leiden konnte, aus dem Schrank, aß ein Schüsselchen Vollkornmus und trank dazu Orangensaft. Ihre Mutter stand am Fenster oder am Tisch, die Augen wachsam, sie nahm ihren Stock, suchte sich mühsam den Weg zum Flur, Erica hörte das Klicken des Telefons und Mutters zarte Stimme, die voll Wärme mit Elli oder Berte oder Amanda telefonierte. Ja, ja, ich sag' es doch! Sie ist eine Mustertochter. Seit Amy im Rollstuhl sitzt und ich diese scheußlichen Gichtanfälle habe, tut sie alles, um uns das Leben zu erleichtern. Denkt nie an sich. Nicht wie ihr verrückter Vater ...
Die Flocken in Ericas Mund schmeckten wie Gummi, es wurde ihr unmöglich, ihre Gedanken an ein neues Leben weiterzuspinnen. Sie hastete ins Badezimmer, ihr Gesicht im Spiegel quoll auf, sie biss auf die rissige, welke Haut ihrer Lippen, bis sie bluteten, und ging zurück in die Küche, strich sich ein Marmeladenbrot und bestreute es mit Schokoladensplittern.
In der Nacht, als Tony ihr das Ultimatum stellte, »entweder die beiden oder ich«, hatte sie in ihrem Zimmer auf dem Teppich gesessen, Vaters Aufziehpuppe vor sich. Sie hatte am Schlüssel gedreht, die Schuhe der Puppe verfingen sich, sie fiel um und lag auf dem Rücken, der Schlüssel schnurrte, die Puppe drehte sich im Kreis, während die Beine, steif und ungelenk, in die Luft stießen. Die Tür öffnete sich, und Erica sagte, ohne aufzublicken: »Ich werde Tony heiraten, tut mir leid, Mutter, aber ich kann nicht mein ganzes Leben im Haus am Glockenbach verbringen. Ich hasse dieses Haus, es frisst mich auf, und Amy hasse ich auch!«
»Ruhig, mein Liebling, ganz ruhig. Du liebst Amy, ich weiß es. Aber wenn Tony dich tatsächlich ... also, wenn er dich wirklich zur Frau will ... Schließlich ist er der einzige, der dich gefragt hat, mein armes Kleines ...«
»Er ist nicht der einzige. Auch Martin und Richard ...«
»Martin und Richard! Windhunde! Sie hatten nie die Absicht, dich zu heiraten. Sie hatten nur eines im Sinn ... dich rumzukriegen. Sie waren, wie alle Männer waren ...«
»Sie waren nett, aber plötzlich ließen sie nichts mehr von sich hören. Das ist eigenartig, findest du nicht?« fragte Erica. Und sie setzte, fast leidenschaftlich, hinzu: »Dabei hatten sie mich wirklich gern.«
»Tja, so sind sie, die Männer, wankelmütig und feige. Sie haben sich anderswo umgesehen. Und Tony, meinst du ... Er ist jünger als du ...«
»Zwei Jahre.«
»Die Männer wollen's gern knusprig und frisch.«
»Tony liebt mich.«
»Bist du sicher?« fragte Mutter, und es lag so viel Skepsis in der kleinen Frage, dass Erica mutlos die Schultern sinken ließ und sich ihrer Reizlosigkeit schämte.
Auch Tony war fortgegangen. Ohne Gruß. Geblieben war ihr nur sein Bild. Sein Gesicht. Lachend. Die haselnussbraunen Augen schienen ihr überallhin zu folgen. Oh, wie gern hatte Tony gelacht! Und wie sehr hatte sein Lachen angesteckt!
Mit Amy sprach Erica nur das Nötigste. Als sie noch ein Kind war, hatten sie im Religionsunterricht von dem absolut Bösen, der zerstörerischen Kraft, gehört, die die Welt zum Jammertale machte, und Erica hatte sofort gewusst, dass sie das absolut Böse kannte, denn sie kannte Amy, und Amy war böse. Sie war eine große, breite Frau mit honiggelben Augen unter schweren Lidern, sie trug Männeroveralls, Gummistiefel, sie harkte im Garten die Beete, sie aß ihre Steaks fast roh und rauchte Zigarren wie ein Mann. Zuerst schien es, als könne es ihr nicht schnell genug gehen, bis Erica aus dem Haus war, als aber dieser Schlaganfall kam – Amy war damals erst fünfzig –, musste sie es sich wohl anders überlegt haben. Nun war es ihr recht, dass Erica das Haus nicht verließ, sie hielt sie immer in Trab, verlangte nach Tee, nach Keksen, nach der Wodkaflasche, nach frisch gehackter Minze, die sie in das Wodkaglas warf, und ihre tiefe Stimme dröhnte durchs Haus und verfolgte Erica bis in den Schlaf.
Eines Tages, die Geschichte mit Tony lag schon gut zehn Jahre zurück, traf sie ihn wieder. Sie hatte für Mutter Spitze besorgt, trat aus einem Laden und lief direkt in ihn hinein.
»Pardon«, sagte er und blieb überrascht stehen. Und sie hatte, instinktiv, fast neckisch, die linke Hand gespreizt und über Mund und Nase gelegt. Sie wollte verhindern, dass er sie erkannte, zehn Jahre älter, zehn Jahre enttäuschter. Nachdem sie beide sich höflich erkundigt hatten, wie es denn ginge, gab Erica sich einen Ruck; sie sah Tony in die Augen und fragte: »Warum hast du damals so plötzlich nichts mehr von dir hören lassen?« Er wurde rot. »Aber ich bitte dich. Es ist so lange her, und deine Mutter ...«
»Was ist mit meiner Mutter?«
»Oh ... Du weißt schon. Deine Familienverhältnisse ...«
Nun war sie es, die errötete. »Was ist mit meinen Familienverhältnissen?« fragte sie steif.
Er zuckte die Achseln. »Bitte, Erica ...«
»Hast du inzwischen geheiratet? Ich erinnere mich, dass du so gern geheiratet hättest.« Ihre Stimme zitterte.
»Nein. Ich habe sogar noch meine alte Adresse.«
Sie sagte: Wollen wir essen gehen heute Abend? »Was hältst du davon? Um unserer alten ... Freundschaft willen?«
Sie spürte, wie er sich zurückzog, sie musterte ihn genau, er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, es war dünner geworden. Das rührte sie und machte ihr Hoffnung, doch die Abwehr in seinen Augen war unübersehbar.
»Ich will wirklich nur mit dir essen gehen«, sagte sie und stieß ein kleines Lachen aus, denn ihre Einsamkeit war größer als ihr Stolz.
»Es hat keinen Zweck, Erica.«
Sie nickte. »Ja, das scheint mir auch. Aber ich will es wissen ... Warum bist du damals verschwunden, ohne noch mit mir zu reden?«
»Nach dem Gespräch mit deiner Mutter wäre jedes Wort peinlich gewesen ... überflüssig.«
»Nach dem Gespräch mit meiner Mutter«, wiederholte sie. Und da er nichts mehr sagte, presste sie die Lippen zusammen und ging wie blind die Straße entlang.
Zu Hause saß sie lange in ihrem Zimmer und starrte aus dem Fenster. Es wurde Frühling, der Efeu trieb aus, und im Garten roch es nach feuchter Erde. Nach dem Gespräch mit deiner Mutter ... Sie erhob sich, machte Licht und ging ins Badezimmer. Duschte. Zog ihr neues Kostüm an. Schminkte sich. Zuletzt steckte sie eine Seidenblume an das Revers ihrer Jacke und stieg langsam die Treppe hinunter.
Mutter und Amy saßen am Esstisch. Amys Atem ging schwer. Seit sie im Rollstuhl lebte, wurde sie dickleibig. Die honiggelben Augen versanken hinter Fleischwülsten, die Finger waren braun von Nikotin.
»Ich esse nicht mit euch«, sagte Erica, »ich bin verabredet.«
»Du? Aber um Himmels willen, mit wem denn, mein Liebling?«
»Mit Tony. Erinnerst du dich an Tony, Mutter? Er ließ eines Tages nichts mehr von sich hören. Und heute bin ich ihm wieder begegnet.«
»Tony?« sagte Mutter gedehnt. »Und er will mit dir ausgehen?«
»Wundert dich das?«
»Nein, nein ...«
»Er will mir über euer Gespräch berichten. Du weißt schon – das Gespräch, das du mit ihm hattest, bevor er mich verließ.« Erica sah, wie Mutter einen Blick mit Amy wechselte. »Ich hatte kein Gespräch mit Tony.«
Amy verzog die Lippen. »Du hattest eines. Mit ihm und auch mit den anderen.«
»Weshalb?« flüsterte Erica.
»Siehst du ...« Mutter wurde verlegen. »Wir wollten dich nicht verlieren. Männer sind ja so grässlich. Wir haben doch schön miteinander gelebt ...«
»Ach was! Wir haben sie gebraucht«, sagte Amy kalt und sah Erica durch den Rauch ihrer Zigarre an. »Deine Mutter hätte mich nicht pflegen können, sie ist zu schwach.«
»Mutter, was hast du Tony gesagt? Und Martin? Und Richard?«
»Sie hat gesagt, dass dein Vater in der Heilanstalt Selbstmord verübt hat. Was übrigens stimmte. Zumindest der Selbstmord. Und dass die Krankheit erbbedingt sei.« Amy lachte. Ihre Augen glitzerten, es machte ihr Spaß, Erica zu verletzen. »Wir haben deinen Vater, damals, als ich ins Haus wollte, in die Anstalt geschafft. Er war von jeher exzentrisch und gewalttätig. Wollte sich nicht damit abfinden, dass deine Mutter und ich ... Starr mich nicht so an. Sie hat sich das alles ganz allein ausgedacht Raffinierte Frau, deine Mutter.«
Erica sank auf einen Stuhl. Ihr Herz hämmerte. Sie erinnerte sich all der Sonntage, die sie, am Fenster stehend, in ihrem Zimmer verbracht und auf Vater gewartet hatte; sie hörte Autotüren knallen, hörte das Gekicher glücklicher Mädchen, sie sah ihre Freundinnen im weißen Kleid vorm Pfarrer stehen, sie sah Babys, die nach dem Haar der Mutter grabschten, sah eine endlose Reihe von Picknicks, bei denen junge Familien auf den Wiesen um den Glockenbach lagerten – und sah sich. Sah sich Verbände erneuern, Schüsseln leeren, treppauf, treppab laufen, sie beriet sich mit den Ärzten, der Gemeindeschwester, feilschte mit Handwerkern, sie sparte und ließ den Lift für Amys Rollstuhl einbauen, sie badete Mutters Füße, sie hastete ins Büro, sie hastete nach Hause, und draußen wurde es Frühling, und die Samenkränze bogen die Blumen zur Erde, es wurde Sommer, es wurde Herbst, Winter, und im Dunkeln leuchtete der Schnee, und es klingelten die Schellen der großen Schlitten, Silvesterpartys wurden gefeiert, Kinder zur Taufe getragen, Schulranzen gepackt, Urlaubsreisen geplant. Während ihre Haut alle Frische verlor, ihr Fleisch verdorrte und ihr Haar zu Asche wurde.
Sie stand auf, ihre Lippen spannten sich über den Zähnen, sie ging zurück in ihr Zimmer, holte den alten Karton aus dem Schrank, nahm Vaters Puppe und zog sie auf, immer wieder. Die Puppe lief über den Teppich. Fiel hin. Lief weiter. Fiel hin. Blieb liegen. Blieb endlich, endlich liegen. Hatte endlich ihren Frieden. Wie Vater. Wie sie.
Sie öffnete eine Schublade und entnahm den kleinen Revolver, den Mutter gekauft hatte, um sich vor Dieben zu schützen. Sie stolperte die Treppen hinunter und betrat das Wohnzimmer. Mutter und Amy saßen noch am Tisch.
Sie schoss sechsmal.
Dann rief sie Tony an.
Als die Polizei eintraf, stand sie in der Küche und stopfte sich große Brotstücke in den Mund.
»Seien Sie vorsichtig, sie ist verrückt«, flüsterte ein Polizist dem Amtsarzt zu. »Auch ihr Vater ist in der hiesigen Heilanstalt gestorben. Der Mann, der uns alarmierte, dieser Tony Wirth ... er erzählte es mir.«
»Meine Liebe« – der Arzt trat einen Schritt auf Erica zu – »würde es Ihnen etwas ausmachen, mich zum Wagen zu begleiten? Ich möchte Sie ins Krankenhaus bringen ... Sie sind krank. Sehr krank.«
Erica kicherte. »Sie meinen, ich bin verrückt? Ich bin nicht verrückt. Es ist nur der Schlüssel, hinten am Rücken, verstehen Sie? Mutter und Amy ... sie haben ihn überdreht. Die Feder ist kaputtgegangen. Pling – und kaputt war sie, die Feder.«
»Natürlich, meine Liebe, natürlich«, sagte der Arzt beschwichtigend, und der Polizist fügte voller Mitleid hinzu:
»Ist ein Graus mit diesen Schlüsseln hinten am Rücken. Und den überdrehten Federn. Wirklich, ein Graus.«
Paarung
Seit Philipp sein Buch über anthropologische Forschungen in Bezug auf menschliche Gefühlsregungen veröffentlicht hat, wird er von einer Talk-Show zur anderen gereicht. Natürlich gibt es massenhaft anthropologische Bücher, aber keines dieser Werke befasst sich so konträr und zugleich allgemein verständlich mit menschlichem Paarungsverhalten und der durch Evolution beeinflussten Psyche wie Philipps Buch. Philipp ist nahezu besessen von diesem Thema, seine ganze Weltanschauung basiert auf der These, alle menschlichen Verhaltensmuster seien biologisch-genetischen Ursprungs.
Heute ist er Gast einer TV-Sendung, die den Titel »Kultur und Menschen« trägt. Er spricht über Liebe, über Sex, über Partnerschaft und Trennung und stellt Verbindungen zum Tierreich her. Mit lässig übereinandergeschlagenen Beinen sitzt er der hübschen Moderatorin gegenüber. Er trägt Jeans und ein Sportjackett, er wirkt ausgeglichen und souverän.
Edith weiß, wie er vorgehen wird. Er berät sich oft mit ihr über seine Auftritte und betont immer wieder, wie viel es ihm bedeute, sich mit einem vernunftbegabten Menschen unterhalten zu können. Mit seiner Frau sind solche Gespräche nicht möglich. Sie interessiert sich nicht für anthropologische Themen. Sie interessiert sich für das große Haus, den Garten, die beide Söhne, die Nachbarinnen. Edith hat ein Foto von ihr gesehen, das Philipp in der Brieftasche mit sich trägt. Eine kleine, rothaarige Frau mit lebhaften Augen. Ein Spaniel liegt neben ihr auf der dunkel marmorierten Terrasse. Sie gleichen sich. Das rötlich-goldene Fell, die braunen Augen, der lethargische Ausdruck des Gesichts. Die Schatten des Hundes und der Frau vereinigen sich und wachsen bedrohlich die weiß verputzte Hauswand empor. Das Bild jagt Edith Angst ein. Es vermittelt eine Realität, die sie degradiert, schmutzig macht, überflüssig.
Sie können mit den Augen zweierlei signalisieren, sagt Philipp gerade zur Moderatorin. Sympathie oder Ablehnung ... Dies ist seine Einleitung, um zum »Kopulationsblick« zu gelangen, ein unerschöpfliches und sehr beliebtes Thema, weil es die Leute zum Lachen reizt und die wissenschaftliche Strenge der Interviews mildert.
Als sie selbst Philipp zum ersten Mal begegnete, auf einer Party vor sechs Jahren, sahen sie sich quer durchs Zimmer an. Sie war damals erst ein Jahr mit Tom verheiratet und unempfindlich gegen eindeutige Blickkontakte – so glaubte sie jedenfalls. Außerdem verabscheute sie männliches Imponiergehabe. Philipp hatte sein Balzrevier abgesteckt, von hier bis zur Tür. Wenn eine gutaussehende Frau den Raum betrat, blähten sich seine Nasenflügel. Später, als er mit ihr tanzte und sie, schon etwas champagnerselig, zwei Wollfussel aus seinem Haar entfernte, erklärte er ihr, Affen lausten sich gegenseitig, wünschten sie mehr als nur Rudelfreundschaft. Und was sie über ihn und das Balzrevier gesagt habe, erwärme sein Herz außerordentlich. Er sei Anthropologe und begierig darauf, Frauen kennenzulernen, die sich für seine Wissenschaft interessierten. Edith erinnert sich daran, laut aufgelacht und sich für einen Moment an ihn gedrückt zu haben, nicht ohne Berechnung, auch daran erinnert sie sich. Sie spürt noch heute seinen Körper an dem ihren, die Muskeln seiner Schenkel, viel härter, als sie vermutet hatte.
Sie verloren sich aus den Augen. Erst einige Jahre später trafen sie sich wieder. Sie schrieb Artikel für eine Frauenzeitschrift und stieß in einer der Redaktionen auf ihn. Er schien ihr kleiner geworden zu sein, vielleicht, weil er zugenommen hatte. Er war jetzt ebenfalls verheiratet und baute gerade ein Haus, fünfzig Kilometer von der Stadt entfernt, in der Edith und Tom lebten. Sie gingen miteinander zum Essen, und sie erzählte ihm, dass Tom in seiner Firma Karriere mache und wenig Zeit für sie habe. Signale habe sie ihm gesandt, wie ein Leuchtturm in der Nacht, behauptete er später, obwohl das ihrer Meinung nach übertrieben war. Zu jener Zeit sehnte sie sich nicht nach einem Liebhaber, sondern nach einem Freund, einem tröstlichen, gutgelaunten Kerl, der mit ihr durch die Kneipen zog, Zigarillos rauchte und sie vergessen ließ, dass Einsamkeit umso weher tat, je näher man mit einem Menschen zusammenlebte. Er musste das gespürt und in seine Taktik einbezogen haben, denn obwohl er keinen Zweifel daran ließ, wie sehr sie ihm gefiel, versuchte er nicht, sie zu verführen. Er telefonierte mit ihr, er schrieb ihr und warf die Zettel in ihren Briefkasten, lustige kleine Mitteilungen, die er mit Zeichnungen versah und mit anthropologischen Witzchen würzte. Sie wusste um seine Flirtereien mit anderen Frauen und tat, als würde sie das kaltlassen. Sie spielte sich auf als Ratgeberin, als geschlechtslose Kameradin, aber das war sie nicht, dazu gefiel er ihr zu gut. Sie mochte seine Art, sich zu kleiden, sie mochte den Duft seiner Haut als sie ihm das einmal eingestand, sprach er von Duftködern –, sie mochte auch die Art, wie er beim Gehen die Schultern nach vorne schob und wie seine weiche Stimme umkippte, wenn er lachte. Je öfter sie ihn sah, desto mehr wuchs ihre Erregung.
Edith holt sich aus der Küche ein Glas Wein und Chips. Philipps Stimme verfolgt sie, er ist jetzt beim Geschlechtstrieb, der seiner Meinung nach bei Frauen stärker ausgebildet ist als bei Männern. Er verweist auf Hündinnen und Äffinnen, überhaupt auf die eindeutige Paarungsaufforderung brünstiger weiblicher Säugetiere. Darüber hat er schon früher Artikel geschrieben; im Grunde ist sein Buch, das jetzt so Furore macht, nichts anderes als eine Zusammenfassung dieser seiner Artikel, die er im Laufe der letzten Jahre veröffentlicht hat. Edith geht ins Wohnzimmer zurück und sieht, wie Philipp sein Gewicht auf dem unbequemen Stuhl im Studio verlagert und sorgsam darauf bedacht ist, seine lässige Haltung nicht zu verlieren. Jetzt kam sicherlich gleich das Bonmot über weibliche Verführerinnen, die, einmal entschlossen, schnurstracks auf das Männchen losgehen und es zum Beischlaf auffordern. Sehr oft geht die Initiative von den Frauen aus, sagt Philipp tatsächlich in diesem Moment und lächelt die Moderatorin an, die dieses Lächeln amüsiert erwidert.
Eines Tages traf Edith sich mit ihm in einem Hotelzimmer. Es geschah übergangslos, sie rief ihn an, er schlug es vor, und es spielte auch keine Rolle, dass sowohl er als auch sie verheiratet waren. Ihre Ehepartner waren nur Details, über die man in nüchternem Ton sprach. Tom hat eine Vorstandssitzung ... Iris ist heute mit den Kindern im Schwimmbad ... Sie wusste, warum sie ihren Mann betrog: Sie fühlte sich allein gelassen. Warum Philipp die Regeln verletzte, konnte sie nur ahnen. Eine Art Jagdinstinkt, den eine eroberte, legitim erworbene Beute auf Dauer nicht auszulöschen vermochte. Vielleicht auch das uneingestandene Gefühl von Verlassenheit, wie bei ihr. Er brauchte Gespräche, Diskussionen, den Austausch politischer Meinungen. Er erklärte ihr, er sei es müde, diesen Austausch nur mit vielen grundsätzlichen Erklärungen in Gang setzen zu können, weil seine Frau sich nicht für Dinge interessierte, die außerhalb des Clans stattfanden. Mit Edith konnte er reden. Sie fand die Balance, sich einerseits selbst mitzuteilen und andererseits ihm zuzuhören. Sie ergänzten sich, auch in ihren schlechten Eigenschaften. Seine Ungeduld, seine Gereiztheit, das Gefühl der Langeweile banalen alltäglichen Dingen gegenüber, wohnten auch in ihr. Auch die Eitelkeit und der Hunger nach Erfolg. Sie mochte es auch, wie er mit ihrem Körper umging, wenngleich ihnen beiden nicht immer Erfolg beschieden war. Das unterschied sie von seinen Affen- und Elefantenpaaren, da war immer nur die Rede von der begonnenen und beendeten Kopulation, Erfolg inbegriffen, sagte Edith einmal scherzend; aber in diesen Dingen verstand Philipp keinen Spaß. Er konnte tagelang darüber grübeln, warum das letzte Paarungsverhalten im Hilton-Hotel nicht so erfolgreich gewesen war, wie es, laut seiner anthropologischen Einschätzung, hätte sein müssen.
Edith stopft sich den Mund mit Chips voll und überlegt, ob Philipps Frau in diesem Moment ebenfalls auf ihrer Wohnzimmercouch sitzt und orale, paprikabestreute Ersatzbefriedigung praktiziert. Sie hat nie mit Philipp über den Geschlechtstrieb seiner Frau oder seinen eigenen Geschlechtstrieb gesprochen, wenn er zu Hause ist. Es gibt Dinge, über die man nicht spricht. Anfangs, so erinnert sie sich, quälten solche Fragen sie. Die beiden haben getrennte Schlafzimmer, das weiß sie. Aber was ist mit den vielen Wochenenden, die sie zusammen verreisen, was mit den Urlauben? Da sieht sie die rotfellige Iris mit dem länglichen Spanielgesicht neben Philipp im Doppelbett liegen, sie sieht Iris' halbgeschlossene Augen, sieht, wie sie sich herumdreht mit dem animalischen Reiz einer Frau, die kein Hehl daraus macht, dass ihr Denken und Fühlen stets um die Familie kreist. Alles schiebt sich stückchenweise zusammen, wie ein Film, den man cutten und der, wenn die Gedanken am Ende angekommen sind, die Phantasiebilder ihre endgültige Fassung erhalten haben, in grausamer Schärfe abläuft. Vielleicht hat Philipp mit Iris keine Paarungsschwierigkeiten, weil er sich ihr überlegen fühlt – oder weil sie eine viel weiblichere Ausstrahlung hat als Edith, die so gern feministische Artikel schreibt und irgendetwas tun möchte, das die Welt verbessert. Sie ist sich nicht sicher, wo er Iris und sie einreiht. Manchmal hat sie ihn im Verdacht, dass er es als angenehm empfindet, mit zwei ganz verschiedenartigen Frauen zu leben. Dann wieder kommt es ihr so vor, als leide er, wie sie, unter der Schmach der Heimlichkeiten und der gestohlenen Stunden und auch unter dem Gefühl des Verlusts, wenn sie getrennt sind.
Das ist auch die Zeit, da sie sich wünscht, Tom möge auf immer und ewig verschwinden. Sie malt sich aus, dass er sich in eine andere Frau verliebt und es ihr errötend und schuldbewusst gesteht. Sie sieht sich ihn tröstend umarmen, sie hört ihre beruhigende Stimme, die ihm versichert, dass kein Mensch des anderen Besitz sei, sie packt in Gedanken Toms Koffer und wünscht ihm Glück für die Zukunft. Dann wieder klingelt es an ihrer Tür, ein Polizist teilt ihr mit, ihr Mann sei verunglückt, er läge im Koma, oder er sei querschnittgelähmt. Sie eilt ins Krankenhaus, sie tut alles, um Toms Lage zu erleichtern, sie lässt die Wohnung umbauen, sie umsorgt Tom, sie wird von allen bewundert ob ihres selbstlosen Tuns; aber im Grunde ist sie unendlich erleichtert, weil Toms Krankheit sie frei macht. Manchmal nimmt ihre Phantasie sogar Toms Tod in Kauf, dann, wenn sie sich mit Tom gestritten hat. Wenn ihr bewusst wird, dass er nur das von ihr fordert, was sie, wie ein Schutzschild, an der Oberfläche trägt. Oder wenn er nur – um mit Philipp zu sprechen – während des Balzrituals zärtlich ist und außerhalb ihres Schlafzimmers sofort wieder zum nüchternen Geschäftsmann wird.
Nun ist er unweigerlich bei der Hirnrinde und beim PEA-Molekül angelangt. Edith erinnert sich lebhaft an jenen Nachmittag, als er ihr die Zusammenhänge erklärt hat. Sie hatten sich in einem Appartement getroffen, das einem von Philipps Freunden gehörte, der für ein halbes Jahr nach New York gegangen war. Sie saßen mit untergeschlagenen Beinen auf dem Bett und tranken Rotwein. Im Radio spielten sie Lieder von Theodorakis. Es war eine jener Stunden, in denen Edith trunken ist von dem, was sie Leben nennt. Philipp zeichnete mit dem Finger den Sitz des Reptiliengehirns, des limbischen Systems und der Hirnrinde auf die Bettdecke. Der kleine Finger seiner rechten Hand tupfte Milliarden von Nervenzellen zwischen das lila Rosettenmuster. Danach hüpfte der Zeigefinger von Zelle zu Zelle, Reize, sagte Philipp. Er ließ seinen Finger auf ihrer Brust nieder und kam nicht mehr dazu, die Gehirnstimulation aufgrund PEA-gesättigter Neuronen zu erklären. Auch die Versuchsreihen bei Mäusen vernachlässigte er.
Das war ihre glücklichste Zeit, da er ihrer beider Verliebtheit zum Anlass nahm, ihr seine Theorien zu erklären. Und doch ahnte sie schon damals, dass ihr limbisches System – um bei seinen Erklärungen zu bleiben – ihr Dinge vorgaukelte, die nicht real waren. Sonst hätte sie schon zu jenem Zeitpunkt erkannt, wie ausgewogen Philipp ihrer aller Leben regelte. Das kam wahrscheinlich daher, dass er aufgrund seiner Studien wusste, dass Verliebtheit nach einiger Zeit nachließ. In der Regel nach fünfzehn Monaten, sagte er. Wenn's lange dauert, vielleicht drei Jahre. Aber nur, wenn man sich nicht zu oft sieht.
Sie sahen sich nicht oft. Das lag einerseits an den vielen Reisen, die Philipp unternahm, andererseits auch an der Entfernung ihrer beider Wohnorte. Philipp hatte seine Dozententätigkeit wesentlich eingeschränkt und arbeitete als freier Autor zu Hause. Seine Frau hatte ihm, zusammen mit einem Innenarchitekten, ein Arbeitszimmer eingerichtet. Er liebte es von Anfang an. Sie ist ein echtes Talent in allem, was mit dem Haus zusammenhängt, sagte er zu Edith. Das war auch ein Teil seiner Ausgewogenheit, dass er seine Frau Edith gegenüber lobte. Manchmal ärgerte sie sich darüber, denn das zeigte ihr, dass er mit der Situation viel besser fertig wurde als sie. In seinem Inneren musste sich ein Schalter befinden, den, er nach Bedarf ein- und ausknipsen konnte, wenn er von seiner Frau zu ihr und wieder zurückging. Vielleicht hing es mit seinem Verständnis von Lebensgenuss zusammen. Nimm, was du kriegen kannst, du lebst nur einmal ...
Er war überzeugt davon, dass er sich auch mit dieser These im Recht befand, und vielleicht war er auch im Recht. Zerrissenheit kannte er nicht, zumindest sprach er nicht davon. Manchmal schloss Edith mit sich selbst Wetten ab. Wenn sie sich am Freitag sahen, würde er mittwochs wieder anrufen. Wenn er mit ihr einen ganzen Tag und einen Abend verbrachte, fuhr er mit seiner Frau in einen Wochenendurlaub. Meist gewann sie ihre Wetten gegen sich selbst. Dann weinte sie und schrieb einen Artikel für ein feministisches Blatt, in dem sie sich über die absolute Bindungsunfähigkeit der Männer ausließ. Diese Artikel erfreuten sich großer Beliebtheit, und sie kam in den Ruf, eine scharfe Verfechterin radikal-feministischen Gedankenguts zu sein.
Ja. Das Schlimme war wohl, dass sie sich nicht so gut kontrollieren konnte wie er. Wenn sie sich verabschiedeten, drängte es sie eine Stunde später schon, mit ihm zu telefonieren. Natürlich tat sie es nicht – sie tat nie etwas, das ihn in Schwierigkeiten hätte bringen können. Aber ihr wurde klar, dass seine Empfindungen und die ihren sich nicht glichen, bei aller Harmonie ihrer anderen Eigenschaften. Natürlich hatte er auch dafür eine Erklärung. Uralte Muster prägten sich da aus, meinte er, Frauen hätten aufgrund ihrer vor Jahrmillionen erworbenen Verhaltensstrukturen den Drang und das sprachliche Talent, sich mitzuteilen. Die Männer seien Einzelgänger, Späher, schweigsame Späher, er lächelte bei diesem Argument. Natürlich lächelte Edith zurück. Trotzdem verstärkte, ja, verdoppelte sich in ihr das Gefühl der Einsamkeit. Ihr genügte es vollauf, ihren Ehemann der Sparte der schweigsamen Späher zuordnen zu müssen. Von ihrem Liebhaber erwartete sie Wärme und Mitteilungsbedürfnis.
Sie dreht den Ton lauter. Philipp spricht nun seine Thesen über Monogamie und Ehe an. Monogamie sei etwas Natürliches, proklamiert er, die Menschen bilden Paare, das sei eines ihrer Hauptmerkmale. So weit, so gut. Er richtet sich auf, strafft sich. Woran er aber nicht glaube, fährt er fort, sei die Treue in der Ehe. Monogamie bedeute ja lediglich, dass man gleichzeitig nur mit einer Person in ehelicher Gemeinschaft lebe. Von sexueller Treue sei nirgends die Rede. Und er führt Beispiele einiger indianischer und afrikanischer Stämme an und kommt nun unweigerlich zur sexuellen Doppelmoral. Dieses Thema stellt eines der erfolgreichsten Kapitel seines Buches dar. Er hat es ausgesprochen witzig verfasst, populärwissenschaftlich, wie er einmal grinsend meinte, und er wird deswegen vor allen Dingen von den Frauen heiß geliebt, obwohl er natürlich nichts Neues sagt, wenn er Männer als Samenträger bezeichnet, die sich seit Jahrhunderten das patriarchalische Recht anmaßen, die Frauen ausschließlich als Nährboden dieses Samens zu betrachten und ihnen keinerlei gleichberechtigte sexuelle Vielfalt zugestehen. Edith schenkt nochmals Wein nach. Sie denkt an Iris. Sie sieht die beiden vor sich, in zwei voneinander getrennten Bildchen, wie in einer Comic-Serie. Zwei Frauen, auf zwei Sofas, in zwei Wohnzimmern. Sie starren auf den Fernsehapparat. Die Ehefrau überrascht, weil ihr Mann Monogamie nicht mit sexueller Treue gleichsetzt, die Geliebte verächtlich schnaubend ob der Lippenbekenntnisse vor laufender Kamera. Denn sie glaubt, inzwischen besser Bescheid darüber zu wissen, was sich in Philipps Inneren abspielt.
Einmal verreisten sie zwei Tage. Es hatte viel Mühe bereitet, dieses Zusammensein zu arrangieren. Philipp nahm eine Vortragsreise zum Anlass und erregte so bei Iris keinen Verdacht. Edith musste dagegen eine Freundin bemühen, was sie nicht gern tat, weil sie, gleich einer kriminell Geschulten, der Ansicht war, dass Mitwisser immer eine Gefahr darstellten. Als Philipp und sie endlich im Hotel dieser anderen Stadt zusammentrafen, waren sie befangen. Zwei Tage lagen vor ihnen, und in ihren Gesprächen hatten sie diese Tage so mit Erleben und Erlieben vollgepackt, dass sie im ersten Moment nicht wussten, womit sie beginnen sollten. Sie besichtigten die Altstadt, sie gingen essen und kauften Champagner, den sie mit aufs Hotelzimmer nahmen. Doch leider war dies eine jener Nächte, da ihre Körper nicht im Gleichklang lebten. Philipp war, wie immer, deprimiert über ihrer beider Unzulänglichkeit, obwohl Edith ihm versicherte, es zähle nur die Tatsache, dass sie zusammen seien. Sie öffneten den Champagner und hörten ein Klavierkonzert im Radio. Von der Straße fiel ein Streifen Licht ins Zimmer. Edith legte ihren Kopf auf Philipps nackte Schulter. Was würdest du tun, wenn deine Frau auch ein Verhältnis hat? fragte sie plötzlich. Nie, ihr ganzes Leben nicht, würde sie den leisen Ruck vergessen, der durch seinen Körper lief. Er sah sie an, misstrauisch, ablehnend. Ihr fiel eine Textstelle seines Buches ein, in der von Ehebruch die Rede war und die darauf hinwies, dass in vielen Kulturen niemals von männlichem, sondern nur von weiblichem Ehebruch gesprochen wurde. Auch geahndet wurde in diesen Kulturen nur der weibliche Ehebruch. Für einen winzigen Moment flackerte in Philipps Augen ein wildes Licht auf. Die Lippenhaut spannte sich über den Zähnen. Das Verhalten des Primaten, schoss es Edith durch den Kopf. Dazu die dumpfe Schwüle im Zimmer, die schweißgefleckten Laken ... Etwas Ursprüngliches, Grundsätzliches spielte sich ab, und nichts sollte mehr so werden, wie es war.
Philipp kommt jetzt zum Ende. Er hält sein Buch hoch und verabschiedet sich. Edith sieht, wie er und die Moderatorin sich ein herzliches Lächeln schenken, Musik erklingt, ein Werbeblock wird eingespielt. Edith steht auf und geht ins Badezimmer. Sie putzt sich die Zähne und frisiert sich. Tom ist verreist. Seine Firma gründet in Italien eine Tochtergesellschaft. Deshalb nutzen sie und Philipp die Gelegenheit, sich in Ediths Wohnung zu treffen.
Dann sitzt er ihr gegenüber. Er trinkt Wein. Sein Gesicht ist gerötet, er freut sich über den Erfolg; denn ein Erfolg ist das Interview gewesen, das hat man ihm bestätigt. Er lehnt sich zurück, dehnt die Arme. Er kann nicht lange bleiben, auch seine Frau hat die Sendung gesehen, auch sie wartet mit einem Glas Wein auf ihn. Er zieht seinen Terminkalender aus der Tasche, eine fast obszöne Geste in diesem Moment, und fährt mit dem Finger die Tage des Monats entlang. Er schlägt ein Treffen in der kommenden Woche vor. Edith fühlt sich wie eine Geschäftspartnerin, fast ist sie versucht, auch ihren Terminkalender zu Rate zu ziehen. Tut mir leid ... Aber wie wär's mit einem kleinen Mittagessen und anschließender Kopulation am Tag darauf?
Sie steht auf und holt das braune Kuvert, in dem die Fotos sind. Sie legt ihm das Kuvert auf den Schoß. Sie habe viel über seine Thesen nachgedacht, sagt sie, auch über das Thema der außerehelichen Beziehungen. In seinem Buch stehe, das Verlangen nach Seitensprüngen sei gleichermaßen bei Mann und Frau vorhanden. Das stimme. Schließlich sei er verheiratet und habe mit ihr ein Verhältnis, auch sie sei gebunden und schlafe mit ihm. Und dann setzt sie hinzu, auch seine Frau habe eins, ein Verhältnis nämlich, soviel nur zur Untermauerung seiner Thesen. Sie deutet auf das Kuvert, in dem sich die Bilder befinden. Sie hat sie selbst geknipst. Es war purer Zufall, dass sie Iris' Vorliebe für einen anderen Mann entdeckte. Sie sah sie einmal in der Stadt, in einem Weinlokal, an einem Abend, an dem Philipp eine Lesung hatte. Die Situation war eindeutig. Der Mann hielt Iris' Hand und lächelte sie zärtlich an. Iris' Gesicht verwandelte sich. Auch ihr Körper schien sich mit Leben zu füllen, beweglicher zu werden, nichts erinnerte mehr an die rothaarige, müde wirkende Frau auf Philipps Foto. Natürlich hat sie damals Philipp nichts von ihrer Entdeckung erzählt. Eine fast kumpelhafte Freude wuchs in ihr, wenn sie an die erlebte Szene dachte. Dann aber, als durch Philipps Körper jener bedeutsame Ruck ging, als seine Augen wild aufflackerten, festigte sich in ihr der Wunsch, herauszufinden, was er, der große Menschenkenner und Anthropologe, wirklich dachte, wie er wirklich empfand und reagierte. Wie es mit seiner Wahrheitsliebe sich selbst gegenüber stand. Da sie die Abende kannte, an denen er nicht in der Stadt weilte, war es für sie ein leichtes, getarnt in einem Auto Iris' Tür zu beobachten. Sie hatte früher als Reporterin gearbeitet, sie kannte sich aus in dem Geschäft.
Philipp blickt auf die Fotos, er sitzt wie erstarrt. Sie könnte jetzt natürlich sagen, dass sie nur sein Gewissen habe erleichtern wollen. Oder dass etwas Unbekanntes in ihr sie zur Aufklärung getrieben habe. Eifersucht auf seine makellose Frau vielleicht, das würde er als psychisch geschulter Wissenschaftler sicherlich verstehen. Aber sie tut es nicht, weil es nicht der Wahrheit entspräche. Sie steht nur da und sieht ihn an. Sie kann ihr Verhalten nicht erklären. Sie will ihm im Grunde nicht schaden, sie will nur, dass er Farbe bekennt. Sie ist wütend auf ihn, weil er zum besten Beispiel seiner eigenen Theorien mutiert. Sogar bestimmte Affenarten treiben jeden männlichen Artgenossen sofort aus dem eigenen Revier ... Seine Worte während einer Talk-Show. Wie in einem Schnelldurchlauf tauchen die Themen seines Buches vor ihr auf. Werbung, Verliebtheit, Eroberung, Paarung, Bindung. Am Ende, als Nachwort sozusagen, müsste bei einem Verfasser seines Ranges die Akzeptanz jeglichen menschlichen Verhaltens stehen, auch des Verhaltens seiner Frau.
Als er sich mit wütend vorgestrecktem Kopf erhebt, gekränkt, mit einem Gesicht, das sich schon nicht mehr mit ihr, sondern mit Iris befasst, als er die Fotos an sich nimmt und geht, weiß sie, dass es für immer ist.
Viel zu jung für eine Witwe
Das Hotel lag am Meer. Es hieß »Napoleone«. Ein kleiner weißer Kasten, in dem junge Leute und Hochzeitspärchen abstiegen. Der maurische Bungalow daneben versteckte sich hinter süß duftenden Hecken. Violette Blüten und wilder Wein rankten sich um seine weißen Säulen. Und Geschichten. Traurige Geschichten.
»Gehört angeblich einem deutschen Ehepaar, das Haus«, sagten die jungen Leute zu David. David wohnte seit ein paar Tagen im »Napoleone«. Er war neunzehn. Schmaler Rücken, eckige Schultern, braunes Haar. Mit trotzigem Gesicht hatte er bei seiner Ankunft die schweren Bergschuhe ins Hotel geschleppt, auch ein Seil und einen kleinen Kocher. Alle fragten ihn, warum er am Strand wohne, wenn er doch ins Gebirge wolle? Er hatte die Achseln gezuckt. Bereit sein sei alles, meinte er, und was es denn nun mit dem Haus und dem Ehepaar auf sich habe?
»Die beiden kamen immer zum Bergsteigen und Klettern nach Korsika. Letztes Jahr hat's den Mann erwischt.«
»Beim Klettern?«
»Nein. Auf dem Weg zum Monte Cinto. Er wurde von einem Schneesturm überrascht, mitten im Mai.«
»Und seine Frau?«
»Die war nicht dabei an jenem Tag. Ist schon ein Schicksal, nicht?«
David sah zur Villa hinüber. Die Läden waren geschlossen. Auf dem Mosaikboden der Terrasse lag Sand. Der Monte Cinto, dachte David. Das wär' ne Wucht.
Und dann sah er sie eines Tages, die Witwe. Sie mochte um die dreißig sein. Sie war mittelgroß und hatte einen fast knabenhaft schmalen Körper. Ihre Haut war von einem olivfarbenen Braun. Sie trug einen roten Badeanzug.
»Sie sieht nicht aus wie eine Witwe«, sagte David.
Die jungen Leute lachten. »Wie sieht denn deiner Meinung nach eine Witwe aus?«
»Irgendwie ... düsterer«, sagte David.
Eines Morgens sprang sein Tennisball auf die mosaikverzierte Terrasse. Ein gelber kleiner Ball, der unter einen Sonnenstuhl rollte. Auf dem Stuhl saß die Witwe.
»'tschuldigung«, sagte David und bückte sich nach dem Ball. Die Witwe richtete sich auf und musterte ihn. Sie schien erstaunt, sie hielt sogar für einen Moment den Atem an. Dann fasste sie sich. »Sie wohnen im Hotel?«
»Ja.«
Sie deutete auf einen Krug mit Limonade. Kleine Eisstückchen schwammen an der Oberfläche. »Möchten Sie ein Glas?« David nickte.
»Setzen Sie sich«, sagte die Witwe. Sie schlüpfte in eine langärmelige, weiße Bluse. Die olivfarbene Haut ihrer Arme schimmerte durch den weißen Stoff.
»Gefällt es Ihnen hier?«
David setzte sich auf den Rand eines Korbstuhls.
»Ich wollte eigentlich nicht ans Meer, sondern ins Binnenland. Ins Gebirge. Aber meine Eltern waren dagegen.«
»Warum?«
David verdrehte die Augen. »Sie machen sich andauernd Sorgen. Dass mir etwas zustößt in den Bergen ...« Er unterbrach sich. Mein Gott, was faselte er denn! War er denn von allen guten Geistern verlassen?
In ihrem Gesicht regte sich gar nichts. Es blieb glatt und unbeteiligt. »Ja. Kann viel passieren im Gebirge.« Sie starrte in die Ferne.
Er versuchte abzulenken. »Ist aber auch am Strand herrlich, so viel Wasser und ... Sand.« Er drehte das Glas in seiner Hand. Etwas in ihm wollte sich schleunigst aus dem Staub machen, doch etwas anderes hielt ihn fest.
Sie lehnte sich zurück und setzte ihre Sonnenbrille auf. In den Gläsern der Brille spiegelten sich Olivenbäume.
»So, so. Sie wollten also ins Gebirge«, murmelte sie. David spuckte einen Eiswürfel ins Gras. »Der Monte Cinto verstehen Sie? Oder ... darf ich nicht reden über den Monte Cinto?«
Ihre Augen waren immer noch aus dunklem Glas und mausetot. »Doch. Reden Sie nur.« Sie tat so, als ob sie lächele. Die Winkel ihrer Lippen bogen sich nach oben, zwei Falten bildeten sich. Wie eingeritzt, dachte David.
»Seit Jahren löchere ich meinen Vater, mit mir nach Korsika zu fahren und den Cinto zu besteigen. Gibt ja eine Route, die gar nicht gefährlich ist. Nur anstrengend. Aber er wollte nicht.«
»Warum nicht?«
»Gäbe so viele Berge daheim in Deutschland, sagt er. So ist er halt, mein Vater. Ziemlich altmodisch.«
»Und Sie wollen unbedingt auf den Cinto?«
»Ja. Das will ich. Ich habe darüber gelesen. Über das Asco-Tal, wo sich damals die allerersten Siedler einnisteten. Über die Hirten. Die Grotten. Die Wasserfälle. Die Felsen. Und über den herrlichen Ausblick bis hinunter zur Küste.« David hatte sich in Hitze geredet, wie immer, wenn es um den Monte Cinto ging.
»Ich gehe mit Ihnen auf den Cinto«, sagte die Witwe und setzte die Sonnenbrille ab. Ihre Augen blieben ernst, doch der Mund lächelte. Jetzt lächelte er wirklich. »Ich heiße übrigens Cora.« Sie gab ihm die Hand.
Cora. Der Name passte zur ihr.
Am nächsten Morgen besprachen sie alles. Cora meinte, am ersten Tag würden sie nur bis zu einem Biwakplatz gehen. Ein bisschen über zweitausend Meter. Dort würden sie übernachten. Am nächsten Tag dann zum Gipfel. Und zurück.
»Schaffst du das?«
»Mit Leichtigkeit.«
»Es wird heiß werden. Und wir haben einiges zu schleppen. Rucksäcke, Schlafsäcke, Kochgeschirr ...«
David blickte aufs Meer hinaus. Ein Sonnenuntergang in der Einsamkeit der korsischen Berge. Mit dieser Frau. Der Witwe. Die Cora hieß und eine olivfarbene Haut besaß. Jetzt war er froh, dass sein Vater ihn nicht begleitet hatte.
»Du bist so ruhig? Hast du Bedenken? Du musst es sagen, wenn du Bedenken hast.«
»Ich war schon auf der Zugspitze. Nicht mit der Gondel. Zu Fuß.«
»Aha. Er war schon auf der Zugspitze, der junge Mann«, meinte Cora. Den »jungen Mann« betonte sie extra. Hätte sie sich ruhig sparen können, dachte David.
Die Freunde im Hotel staunten. »Mit der Witwe?« sagten sie. »Du gehst mit der Witwe auf den Cinto? Dass die das macht?«
»Warum sollte sie es nicht machen?«
»Aus Pietätsgründen. Wo doch ihr Mann auf dem Cinto umgekommen ist. Dass sie das überhaupt aushält ...«
»Über manche Sachen kommt man eben nur mit einer Radikalkur hinweg.«
»Und du bist die Radikalkur?« Sie lachten.
David lachte auch, obwohl ihm gar nicht zum Lachen war. Er dachte nämlich ein Stückchen weiter als bis zum Berg Cinto, er dachte um zehn Ecken. Was da wohl lag? Ein aufregendes Abenteuer? Aber was für ein Abenteuer? Warum nahm sie ihn überhaupt mit? Zugegeben, es war wirklich nicht normal. Vielleicht zog es sie tatsächlich zu der Stelle, an der man ihren Mann gefunden hatte? Vielleicht heulte sie sich die Augen aus und kehrte wieder um und kam mit ihm gar nicht bis zum Gipfel des Cinto? Aber nein. Sie sah nicht aus wie eine Frau, die heulend im Gebirge herumstand. Eher wie eine Frau, die genau das tat, wozu sie Lust hatte. Und jetzt hatte sie eben Lust, mit ihm eine Bergtour zu machen.
Sie fuhren durch die Schluchten des Ascos, kahl, wild, fast unheimlich türmten die Felsen sich auf. Dann durch Weideland, mit Kiefern und Wacholderbüschen bewachsen. Schaf- und Ziegenherden grasten, graue Gehöfte lagen in der Ferne. In San Michele, der kleinen Kirche des Ortes Asco, entzündeten sie eine Kerze. Auf dem Stagno-Plateau parkten sie das Auto. Der Aufstieg begann.
Cora schien langsam zu gehen, und trotzdem hatte David Mühe, mit ihr Schritt zu halten.
»Sag mir, wenn ich zu schnell bin«, sagte Cora.
»Ist schon okay«, schnaufte David.
Kiefern und Wacholdersträuche blieben zurück, die schroffen Felsen rückten wieder näher, die Sonne brannte erbarmungslos. Was Cora wohl empfand? Sicher dachte sie jetzt an ihren Mann, der auch hier gegangen war und dann oben, auf dem Weg zum Gipfel, vom Schnee überrascht wurde.
»Soll ich Ihnen vielleicht das Kochgeschirr abnehmen?« fragte er. »Mein Rucksack ist viel leichter als der Ihre.«
Sie gab keine Antwort. Sie hockte sich auf einen Felsbrocken und strich mit dem Finger über die scharfkantigen Schrunden. Die Muskeln an ihrem Hals bewegten sich.
Am späten Nachmittag hatten sie die Stelle erreicht, an der sie nächtigen wollten. Große, rotgeäderte Felsplatten leuchteten in der Sonne, Geröll, Schotter und Steine bedeckten den Hang.
Sie breiteten die Schlafmatten aus, suchten dürres Gehölz, saßen abends am Feuer und sahen zu, wie der Himmel sich färbte, wie er dunkler wurde, wie die ersten Sterne aufleuchteten, und die Luft, fliederfarben, die Bergzacken wie mit rosa Tusche in den Himmel malte.
»Es ist ... gigantisch«, sagte David. »So still. Und die Sterne ... so nah.«
Cora streifte ihn mit einem Blick. »Ja. Gigantisch. Unfassbar. Überwältigend. Und ... schrecklich.« Sie lehnte sich zurück und bettete den Kopf auf die verschränkten Arme. Ihr Gesicht war ganz weiß.
»Ich dachte, ich könnte nie mehr hierherkommen. Aber man kann alles, wenn man will.«
David starrte ins Feuer. »Wie ist es passiert?«
Coras Stimme klang nüchtern, sachlich. »Dort oben war's. Wo die kleinen Höhlen sind. Er hat versucht, in einer der Höhlen zu überleben, aber der Temperatursturz war zu groß. Er ist erfroren.«
David schwieg, und Cora sah wieder zu den Höhlen hinüber. »Es ist, als sei alles, was mein Leben ausgemacht hat, hier oben geblieben. Hier drüben ...« Sie machte eine kraftlose Bewegung mit der Hand. »Du bist noch so jung, du wirst es nicht verstehen. Etwas geht zu Ende. Ein Mensch, den du sehr geliebt hast, ist fort ... Ich habe ihn immer geliebt. Schon zu einer Zeit, da ich noch jünger war als du. Wenn er ins Haus kam ... Und wie er lachte. So unbekümmert. So fröhlich. Weißt du, was der Name Cora bedeutet? fragte er mich einmal und hob mich hoch und setzte mich auf die Schaukel im Garten meiner Eltern. Cora bedeutet Augapfel, Liebling der Götter ... Liebling der Götter.« Sie schnalzte verächtlich mit der Zunge. Schwieg eine Weile. Und sagte dann noch einmal: »Ich habe ihn immer geliebt. Bis zuletzt.«
Das dürre Holz knackte.
»Warum haben Sie ausgerechnet mich mitgenommen? fragte David beklommen.
Sie lachte auf, es klang verzweifelt. »Weil du ihm so ähnlich bist. Du siehst aus, wie er aussah, als er zum ersten Mal in unser Haus kam. Der schmale Rücken, die braunen Haare ... Genau wie er.« Sie presste die Hände an die Augen. »Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dir zusammen auf diesen Berg gehen müsse. Um etwas zu verstehen. Oder zu erfahren, wer weiß?«
Ein blaues Licht zuckte in der Ferne. Irgendwo, drüben an der Küste, gab's ein Gewitter. David legte einen Arm um Coras Schultern und drückte sie unbeholfen an sich. Jetzt dachte er nicht mehr ein Stückchen weiter – er dachte ein Stück zurück. Cora und ich vor hundert Jahren, dachte er. Drunten im Hochland. In einem der grauen Gehöfte. Er sah Coras Hände, sie kneteten Schafskäse und rührten in einer Schüssel mit Kastanienbrei. Er sah lange Bergwinter vor sich, hörte den Sturm, der ums Haus pfiff. Er sah sich die Herden beschützen, gehüllt in einen Mantel aus Ziegenfell, während Cora an der offenen Feuerstelle Fleisch briet.
Sein Arm begann zu zittern. Und ein Wind kam auf und zerrte an den Gurten des Biwakzeltes. Der Mond war voll. Eine Wolkenbank schob sich davor.
Cora wandte sich David mit geschlossenen Augen zu und umarmte ihn. Sie tastete nach seinem Gesicht und flüsterte einen fremden Namen. In der Ferne zuckten die blauen Lichter wie Zungen, die über den Himmel leckten. Der Wind trug den Geruch der sonnenwarmen Felsen und des Feuers zu ihnen herüber.
Am nächsten Morgen verbarg sie ihr Gesicht wieder hinter der dunklen Brille. Sie sprach nur das Nötigste. Als sie den Gipfel des Berges erreichten, nahm sie die Brille ab.
»Schau ...«, sagte sie. »Im Westen siehst du bis zum Golf von Ajaccio, im Norden kannst du Calvi erkennen und das Cap Corse.« Sie wandte sich ab und stand lange auf demselben Fleck. Dann setzte sie die Brille wieder auf.
Sie brachte ihn mit dem Auto zum Hotel zurück. David stieg aus, schulterte seinen Rucksack und pfiff ein bisschen durch die Zähne. Wieder war es später Nachmittag, die gleiche Stunde wie tags zuvor, als sie ihre Schlafmatten ausgebreitet und dürres Holz gesucht hatten.
Sie kurbelte das Seitenfenster herunter.
»Ich fahre nächste Woche nach Hause«, sagte David. Die Sonne brannte auf seinen Kopf, er fuhr mit der Zunge über die Lippen, auf der sich kleine Bläschen gebildet hatten.
Cora sah geradeaus. Ihre Augen waren weit geöffnet.
Er wartete noch eine Weile und malte mit der Schuhspitze ein großes C in den Straßenstaub.
»Viel Glück, David«, sagte Cora. »Und danke, dass du mitgekommen bist.«
Er nickte und ging auf das Hotel zu. Er drehte sich nicht um. Er hatte sich geschworen, sich nicht umzudrehen.
»Wie war sie, die Witwe?« fragten die jungen Leute.
»Nett. Kameradschaftlich«, antwortete David und erinnerte sich an Coras Hände, die nach seinem Gesicht tasteten.
»Wie alt ist sie eigentlich?«
»Achtundzwanzig.«
»Viel zu jung für eine Witwe. Und der Cinto? Wie war's auf dem Cinto?«
»Toller Berg. Tolle Tour.«
»Habt ihr zusammen in einem Zelt übernachtet?« Sie knufften ihn in die Seite.
»Ich habe im Freien geschlafen, in meinem Schlafsack«, sagte David.
Ja. Im Freien hatten sie geschlafen. Und es schmerzte, die Sterne zu sehen und zu wissen, dass man nichts war, gar nichts. Ein bisschen Fleisch, Blut und Knochen auf einem Berg, der sich nicht um einen kümmerte. Wie Fliegendreck auf einem riesigen Felsen, so war man.
Am nächsten Abend sagte ihm der Hotelbesitzer, die Witwe, die nebenan wohne, wolle ihn dringend sprechen. David schlüpfte in saubere Jeans und ein frisches Shirt und ging zu Coras Haus hinüber.
Auf der Terrasse stand eine große schlanke Frau, die David nicht kannte. Sie war wesentlich älter als Cora, doch sie hatte Coras helle Augen und ihr gekraustes Haar.
Sie wirkte beunruhigt. »Sind Sie der junge Mann, der mit Cora auf dem Cinto war?«
»Ja«, antwortete David erstaunt.
»Ich bin Coras Schwester, ich kam heute Nachmittag erst auf die Insel.« Sie musterte ihn. »Cora erzählte mir noch am Telefon, dass sie mit Ihnen auf den Cinto wolle.« Ihr Gesicht verschattete sich. »Ich selbst gehe nicht mehr in die Berge, seit mein Mann ... Nun, Sie werden's ja gehört haben, dass er bei einem Schneesturm umkam.«
Für einen Moment war alles still. Kein Lüftchen regte sich.
Dann sagte David: »Ja. Ich habe davon gehört. Es tut mir sehr leid.«
Sie sagte ihm, wie beunruhigt sie sei. Denn Cora habe sich, nachdem sie ihn beim Hotel abgesetzt habe, entschlossen, wieder zum Asco-Tal zurückzufahren. Lediglich eine Nachricht habe sie hinterlassen, die nichts besage und über nichts Auskunft gebe. Nur, dass sie zum Cinto zurückkehre. Ob sie etwas vergessen habe, einen Rucksack vielleicht, oder ob sie sich mit anderen Bergsteigern habe treffen wollen?
Davids Herz verkrampfte sich. Er schüttelte den Kopf. »Sie hat nichts gesagt, gar nichts.«