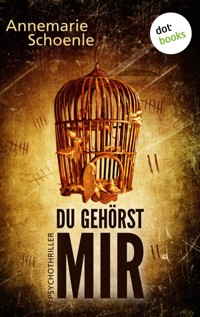Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Viertelstunde später war alles klar. Sie war schwanger. Der Blinddarm war kein Blinddarm, der Blinddarm war ein Kind. Schwanger, Job weg, Mann weg. Eigentlich hatte sich Theresa nur auf eine kleine Affäre mit dem gutaussehenden Victor eingelassen, um der Tristesse ihres Alltags zu entfliehen – und nun ist sie alleinerziehende Mutter und arbeitslos. Weder ihr Ehemann, noch ihr Liebhaber wollen etwas von dem Kind wissen. Was also tun? Theresa hat zwar keine Ahnung, dafür aber jede Menge Träume! Sie lässt sich nicht unterkriegen und ist sich sicher: Ich werde mein Glück finden! Annemarie Schoenle gelingt es wie keiner anderen, zugleich so leicht und so ernst zu erzählen. Jetzt als eBook: "Nur eine kleine Affäre" von Annemarie Schoenle. dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schwanger, Job weg, Mann weg. Eigentlich hatte sich Theresa nur auf eine kleine Affäre mit dem gutaussehenden Victor eingelassen, um der Tristesse ihres Alltags zu entfliehen – und nun ist sie alleinerziehende Mutter und arbeitslos. Weder ihr Ehemann, noch ihr Liebhaber wollen etwas von dem Kind wissen. Was also tun? Theresa hat zwar keine Ahnung, dafür aber jede Menge Träume! Sie lässt sich nicht unterkriegen und ist sich sicher: Ich werden mein Glück finden!
Über die Autorin:
Die Romane Annemarie Schoenles werden millionenfach gelesen, zudem ist sie eine der begehrtesten Drehbuchautorinnen Deutschlands (u. a. Grimme-Preis). Sie ist Mutter einer erwachsenen Tochter und lebt mit ihrem Mann in der Nähe von München.
Annemarie Schoenle veröffentlichte bei dotbooks bereits »Frauen lügen besser« »Frühstück zu viert« »Verdammt, er liebt mich« »Nur eine kleine Affäre« »Du gehörst mir« »Eine ungehorsame Frau« »Ringelblume sucht Löwenzahn« »Ich habe nein gesagt« »Familie ist was Wunderbares« »Abends nur noch Mondschein« und die Sammelbände »Frauen lügen besser & Nur eine kleine Affäre« »Ringelblume sucht Löwenzahn & Abends nur noch Mondschein« sowie die Erzählbände »Der Teufel steckt im Stöckelschuh« »Die Rache kommt im Minirock« »Die Luft ist wie Champagner« »Das Leben ist ein Blumenstrauß« »Dreitagebart trifft Minirock« »Tanz im Regen« »Zuckerherz und Liebesapfel«.
Die Website der Autorin: annemarieschoenle.de
***
Überarbeitete Neuausgabe Februar 2024
Copyright © der Originalausgabe 1993 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2013 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nicola Bernhart Feines Grafikdesign, München unter Verwendung von © belarusochka – vectorstock.de
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-95520-424-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Annemarie Schoenle
Nur eine kleine Affäre
Roman
dotbooks.
Eins
Es regnete schon seit Tagen. Die Straßen glänzten vor Nässe, graufeuchte Nebelschwaden hingen in den kahlen Bäumen, deren Äste sich im eisigen Märzwind bogen, und auf der mächtigen Pranke eines der stolz aufgerichteten Löwen vor der Münchner Residenz hockte eine Taube und starrte vorwurfsvoll auf Teresas lilafarbenen, mit neckischen Schleifen und Rüschen verzierten Schirm. Der Schirm gehörte Oma Neutze und stammte aus einer Zeit, als man Petticoats trug und auf nierenförmigen Tischen Poker spielte.
Teresa schniefte in ein Taschentuch und lief auf hohen, bleistiftdünnen Absätzen durch den Hofgarten. Sie hoffte inständig, ihr Make-up, dessen Krönung ein blauglitzerndes Herzchen auf ihrer bemerkenswert klaren, weißen Stirn war, möge noch ein paar Schritte, genauer gesagt bis zum Eingang des Hotels »Vier Jahreszeiten« halten. Dieses Make-up und die Kleidung, die sie trug – ein pinkfarbener Schlauchrock, schwarze Netzstrümpfe und ein schwarzer netzdurchwirkter Kasack –, waren Teresas ureigenste Erfindung und sollten Valentin Brettschneider, Deutschlands bekanntesten Modedesigner, dazu bringen, ein gänzlich brachliegendes Talent zu erkennen. Kurzum, Teresa hatte den sehnlichen Wunsch, das weibliche Pendant zu Valentin zu werden: der deutschen Frauen größte Modeschöpferin.
Leider tippte sie bis jetzt nur für ihn. Doch das würde sich ändern, dachte sie, als sie auf dickem Teppich zu seinem Zimmer ging: Sie hatte am Morgen ihre Tarotkarten gelegt, und es fand sich die Karte der Kraft beim Rad des Schicksals – ein untrügliches Zeichen, daß Teresas Fähigkeit, dem Leben und seinen Problemen mit optimistischer Hoffnung zu begegnen, eine Veränderung der Umstände signalisierte.
»Das Rad wird sich drehen«, hatte sie zu Heiner, ihrem Mann, gesagt. Doch der hatte nur in einem abscheulichen Brei aus Hirse, Roggen, Korn und Quark gerührt und einen strafenden Blick auf Teresas Brot geworfen, das, dick bestrichen mit Butter, neben der Karte der Kraft lag.
Valentin Brettschneider bot Teresa höflich einen Stuhl an und diktierte einen Brief an ein Modehaus in Castrop-Rauxel. Zwischendurch telefonierte er, kramte in einer Mappe mit Entwürfen und blickte, die Zeichnung eines atemberaubenden Abendkleides in der Hand, nachdenklich auf Teresas netzbestrumpfte Beine. Sofort schlug sie die Beine so aufreizend reizend übereinander, wie sie es in einem uralten Spielfilm mit Sonja Ziemann gesehen hatte – Das Hotel hatte der Streifen sinnigerweise geheißen –, und legte in ihr Lächeln knisternde Verführung. »Ach ja, Frau Gärtner ... Wenn ich die Briefe bis morgen vormittag haben könnte?« sagte Valentin Brettschneider, weit davon entfernt, die Kontrolle über sich zu verlieren. Teresa beschlich der Verdacht, daß er, wie viele seiner Kollegen, mehr dem eigenen Geschlecht zugeneigt war. Gütiger Himmel! Welch eine Verschwendung! Bei diesem sensiblen Gesicht! Diesen Lippen! Diesen Händen! Teresas Kopfhaut begann zu kribbeln. Auf dem Nachhauseweg beschloß sie, noch einen Supermarkt aufzusuchen; denn sie jobbte nicht nur als Schreibkraft durchreisender Geschäftsleute, sie befaßte sich auch mit Testbefragungen, die der Marktanalyse von sehr unterschiedlichen Produkten dienten – eine frustrierende Angelegenheit, wenn man bedachte, daß sie dadurch den Machern in den diversen Chefetagen das Material lieferte, Bedürfnisse zu wecken, die keine waren. Doch was half s! Heiners Lehrergehalt reichte hinten und vorne nicht, und sie selbst hatte sich, trotz ihrer schon achtundzwanzig Jahre, immer noch nicht entschieden, welch anderer Beruf als der der Modedesignerin ihren Fähigkeiten gerecht werden könnte.
»Daß dich diese Kurzzeit-Jobs nicht ankotzen!« pflegte Heiner verächtlich auszurufen, wenn sie auf ihrer alten Olympia Briefe tippte oder mit wichtigem Gesicht blaue, grüne und rosarote Testbogen vor sich ausbreitete. Heiner war, ebenfalls achtundzwanzigjährig, Gymnasiallehrer. Biologie und Chemie – also da fragte man sich wirklich, was deprimierender war!
Die Gänge zwischen den Verkaufsständen waren gähnend leer, ein langweiliger Dienstagnachmittag tröpfelte vor sich hin. Teresa holte einen der Bogen aus ihrer mit bunten Mickymäusen bemalten Plastiktasche und stellte sich dann, ganz unauffällig in ihrem offenen Trenchcoat, den schwarzen Netzstrümpfen und dem pinkfarbenen Schlauchrock, neben den Stand mit den Zahncremes.
Kauft der Kunde spontan eine Zahncreme, oder verweilt er unentschlossen am Regal?
Teresa blickte sich um. Es verweilte niemand. Nur eine Frau mittleren Alters, in spießigen grünen Loden gekleidet, raffte sehr spontan ein paar Dosen mit Hundefutter an sich. Über Hundefutter hatte Teresa keinen Testbogen. Also nahm sie eine der Zahncremes, weil man Zahncreme schließlich immer brauchte, ging zur Kasse und zahlte. Die Frau mit dem Hundefutter betrachtete fasziniert Teresas Glitzerherzchen auf der Stirn und schüttelte den Kopf. Ha! Schon wieder eine Ignorantin in Sachen modischen Fortschritts und ein Beweis mehr, wie sehr die deutsche Frau einer Modeschöpferin von Teresas Format bedurfte. Die ihr in die Wiege gelegte Berufung – sie hatte schon als Vierjährige ihre Latzhosen mit Buntlackspray bearbeitet – war keine fragwürdige Illusion, sondern zwingende Realität.
Heiner kam nach Hause, als Teresa vor dem großen Spiegel im Flur stand und auf den pinkfarbenen Schlauchrock eine schwarze Tüllschleife nähte.
»Unmöglich«, sagte er und warf seine Aktentasche auf den Schreibtisch, der in einer efeuumrankten Ecke des Schlafzimmers stand. Teresa und Heiner bewohnten eine triste Neubauwohnung in der Nähe der Isarauen. Sie hatte einen quadratischen Flur, eine quadratische Küche, ein quadratisches Wohnzimmer, ein quadratisches Schlafzimmer und ein quadratisches Bad. Nur die Toilettenschüssel war nicht quadratisch. Ein eklatanter Stilbruch, wie Teresa fand.
»Sieht es nicht sensationell aus?« fragte sie und schob ihr Gesicht nah an den Spiegel. Das Gesicht war hellhäutig, schmal, unter den graublauen Augen lagen feine Schatten, die Augenbrauen waren hellblond, so hellblond wie das schulterlange, glatte Haar. Teresa lächelte sich zu. Einer ihrer Vorderzähne stand schräg – sie hatte es abgelehnt, sich noch mit siebzehn Jahren einer Kieferregulierung zu unterziehen und mit Zahnspange herumzulaufen. Dieser leicht schräg gestellte Vorderzahn verlieh ihr ein pfiffiges Aussehen: Sie war ein hochgewachsener, überschlanker, augenzwinkernder Schelm, bildhübsch, mit sympathischen Mängeln, und ein verrücktes Huhn, wie Heiner noch bei ihrer Hochzeit vor drei Jahren zärtlich geflüstert hatte. Inzwischen war seine Vorliebe für ausgefallene Ideen völlig erloschen, auch hatte seine Stimme an Volumen zugenommen, und Teresa erkannte immer öfter ein begehrliches Funkeln in seinen Augen, wenn er im Werbefernsehen dezent gekleidete junge Hausfrauen betrachtete, die Wäsche auf eine fünfzig Kilometer lange Leine hängten.
»Wozu die rosarote Aufmachung?« fragte er.
»Besuch zum Essen. Ingeborg und Karlheinz.«
»Na, wunderbar. Und ich habe noch Wolfgang Engel eingeladen. Der arme Kerl lief mir heute über den Weg, bleich wie ein Gespenst. Er komponiert immer noch an seinen Sieben Todsünden und sieht selber schon wie eine solche aus.«
Teresa zuckte die Achseln. »Na und? Kriegt er halt auch etwas zu essen.«
»Eine interessante Zusammenstellung. Ingeborg und Karlheinz, die Yuppies aus der Versicherungsbranche, Wolfgang, der Musiklehrer mit dem Mozarttick ... und du.« Dieses »und du« klang beileibe nicht nach Hochachtung.
»Was soll der abfällige Ton, mein Herzchen?«
»Mein Herzchen«, oder, noch schlimmer, »mein grüner Heinrich«, waren Teresas beliebteste Kampfansagen. »Oh, nichts, nichts.« Heiner gähnte und schlurfte in die Küche, und Teresa fragte sich, sehr konkret, was sie eigentlich bewogen hatte, ihn zu heiraten. Er war schon äußerlich nicht ihr Typ – sie bevorzugte mittelgroße, kräftige, blonde, bartlose Männer. Heiner aber war groß, hager, hatte braunes Haar, braune Augen, einen albernen kleinen Schnurrbart, der so wenig gedieh wie Schnittlauch auf dem Fensterbrett, dunkel behaarte Hände, dunkel behaarte Beine und den strengen Blick des fanatischen Asketen. Er trug Breitcordhosen, in der Dritten Welt gefertigte Rupfenhemden und Birkenstocktreter (nur gut, daß Valentin Brettschneider ihn niemals zu Gesicht bekam!). Auch innerlich war er weit davon entfernt, sie dauerhaft zu überzeugen. Zu Fall gebracht hatte sie eigentlich nur seine nie versiegende Zielstrebigkeit, eine Eigenschaft, die Teresas Wesen so fremd war wie Enthusiasmus dem Phlegmatiker und der sie von jeher recht hilflos gegenüberstand.
»Was hast du gekocht?«
Teresa überhörte die Frage geflissentlich.
»Darf ich raten?«
Teresa schwieg.
»Schnitzel und Pommes frites?«
»Ha, daneben!« schrie Teresa triumphierend.
»Dann gibt es Cannelloni aus der Dose.«
»Richtig.«
Heiner funkelte sie an. »Bist du verrückt? Ein Essen für fünf Leute! Eine Dose Cannelloni kostet vier Mark fünfundsechzig! Du mußt mindestens fünf Dosen aufmachen, um allein den gefräßigen Karlheinz abzufüttern. Also brauchst du sicherlich insgesamt zehn Dosen.«
»Fünfzehn Dosen, nachdem du auch noch deinen Wolfgang Engel anschleppst«, sagte Teresa eisig. »Und nimm bitte zur Kenntnis, daß die Cannelloni im Sonderangebot sind. Sie kosten diese Woche vier Mark fünfundfünfzig.«
»Toll. Lässige siebzig Mark also. Warum stellst du dich nicht ausnahmsweise einmal selbst in die Küche? Du hast doch nichts zu tun den ganzen Tag!«
»Ich war bei Valentin Brettschneider im ›Vier Jahreszeiten‹. Und habe Marktanalyse für Zahnpasta gemacht. Für Marktanalyse braucht man Geduld und Beobachtungsgabe. Wie sonst könnte ich so wichtige Fragen beantworten wie Welche Zahncreme nimmt der Kunde in die Hand und in welcher Reihenfolge? Du siehst also, ich konnte beim besten Willen nicht auch noch selbst kochen.« Teresa lachte verächtlich. »Ach ja«, sagte sie dann, weil ihr trotzdem an einer Verständigung lag, »außerdem ist heute ›Alf-Tag‹. Ich muß also, bevor die Meute kommt, auch noch fernsehen.«
»Wer ist Alf?«
»Ein Außerirdischer.«
»Spinnst du?«
»Ich nicht. Aber du. Weil du dich wirklich um nichts kümmerst, was deiner Allgemeinbildung zugute käme. Wer interessiert sich schon für chemische Formeln! Aber daß Alf seine Raumfähre nach Melmac verpaßt hat und nun festsitzt bei der Familie Tanner, das solltest du mit deinen Schulkindern diskutieren!«
Heiner betrachtete sie mit dem gleichen Widerwillen, mit dem er am Morgen ihr Butterbrot beäugt hatte. »Wie du durchs Abitur gekommen bist, ist mir ein Rätsel. So was von schlechtem Geschmack und desolater Halbbildung! Bloß gut, daß du das Pädagogikstudium an den Nagel gehängt hast. Stell dir vor, man hätte dich auf Deutschlands Kinder losgelassen!«
»Hätte Deutschland bestimmt gutgetan. Mit mir hätten die Kinder wenigstens ihren Spaß gehabt.«
»Und deine Unterrichtsstunden über Fernsehserien und Mickymaus würden sie natürlich weiterbringen im Leben!«
»Natürlich. Ich würde sie lehren, Romantik zu bejahen, sich zu Sentimentalitäten zu bekennen und so eine Front zu bilden gegen euch Naturwissenschaftler. Euer cooles Gequatsche ist nämlich auch nur Klischee.«
»Sich dem Leben zu stellen und sich darin zurechtzufinden, das ist es, was man den Kindern beibringen muß.«
»Arme Kinder. Klingt wie die Hatz auf kleine Häschen«, sagte Teresa. Und weil in Heiners Augen wieder jenes gnadenlose moralische Funkeln trat, das Teresa bis zur Weißglut reizte, setzte sie heftig hinzu: »Wenn du wüßtest, wie du mich manchmal anödest.«
»Du mich auch«, erwiderte er und holte sich Hefeflocken mit Frischkeimlingen aus dem Kühlschrank. Sofort klebte sich Teresa dicke Hartwurst auf ein Stück Weißbrot. Frust erzeugt Hunger! Und daß dieser lächerliche Pauker auf Hefeflocken mit Keimlingen abfuhr, war bezeichnend. Lebten nicht auch die Puritaner so schrecklich gesund? Wandelte Cromwell nicht einst in grobem Bauernlinnen? Der fanatische Henker!
Am Abend saßen sie in der quadratischen Küche um einen quadratischen Tisch: Ingeborg, Teresas beste Freundin, Karlheinz, ihr Mann, und Wolfgang Engel. Ingeborg war eine schwerknochige, dunkelhaarige Frau mit tiefer Stimme, breiten Hüften und schwellenden Körperformen. Diese schwellenden Rundungen, die schweren Augenlider, die schwarzen Wimpern und die ausgeprägte Schaljapin-Stimme verführten manchen Mann, an schlummernde, gleich Lava ausbrechende Leidenschaft zu glauben, an schwüle Nächte und Tage voll mütterlicher Reife, Assoziationen, die Ingeborg sehr belustigten. Denn sie war, zwei Jahre jünger als Teresa, eine nüchterne, sachliche Person von kühlem Temperament, distanziertem Wesen und äußerst modernen Ansichten. Sie war tüchtig, gescheit und belesen, und ihre ab und zu aufflammende Leidenschaft galt eher ihrer Karriere als Sachbearbeiterin einer Versicherungsgesellschaft als den abenteuerlichen Träumen einiger ihrer Kollegen.
Karlheinz, ein dreißigjähriger, etwas zur Fülle neigender Mann, Betriebswirtschaftler und bei der gleichen Versicherungsgesellschaft wie Ingeborg tätig, betonte gern, daß er Ingeborg geheiratet habe, weil sie in der Schadensabteilung für Haftpflicht die Frau mit den fundiertesten Kenntnissen gewesen sei und weil er eine Vorliebe für moderne, gescheite Frauen habe. Teresa vermutete, daß ihm eher an Ingeborgs unverbrüchlicher Solidarität lag – es hieß, er sei polygam, ein Faun, wenn es um leibliche Genüsse jedweder Art ging. Tatsache war, daß er stundenlang über ein Soßenrezept diskutieren und gleichzeitig die Frauen an seinem Tisch taxieren konnte wie ein Sperber ein paar sorglos gackernde Hühner im Getreidefeld.
Teresas Blick wanderte zu Wolfgang Engel. Ihn kannte sie erst seit einem Jahr, sie mochte ihn, und in dem Maße, wie er sie mit spöttisch-freundlicher Herablassung behandelte, als sei sie ein Kind, dem man manches nachsah und verzieh, wuchs ihre Neugierde. Er war untersetzt, muskulös, hatte schwarzes, glattes Haar, das in den Nacken wucherte, dunkle Augen, eine mächtig vorspringende Nase, er trug eine randlose Brille und war ein quirliger Mensch mit einer aggressiv-fröhlichen Ausstrahlung. Er unterrichtete an der gleichen Schule wie Heiner, war Musiklehrer, doch nur, wie er immer wieder erklärte, des schnöden Mammons wegen. Er nährte ebenfalls eine Berufung: Er komponierte; dies und die Tatsache, daß er Dustin Hoffman glich, war der Grund, warum Teresa ihn so gut leiden konnte. Mit Berufungen, vor allen Dingen mit solchen, die noch nicht von Erfolg gekrönt waren, kannte sie sich aus, und Dustin Hoffmans Filme versetzten sie von jeher in bewundernde Anbetung.
»Aber irgendwann«, sagte Wolfgang Engel gerade mit sehr sicherer Stimme, »werden meine Kompositionen auch Erfolg haben.«
»Komponist ...«, Teresa lächelte. »Ich stelle mir da immer Beethoven vor mit zerstrubbeltem Haar und musikalischem Irrsinn in den Augen. Oder Mozart. Ach ja, Mozart. Wie er die Kleine Nachtmusik komponiert und reihenweise die Frauen vernascht.«
»Na, das paßt doch ausgezeichnet«, sagte Heiner. »Wolfgang verehrt Mozart über alles, und was seinen Konsum an Frauen anbelangt ...«
»Was willst du! Ich bin Junggeselle, ich kann's mir erlauben.«
»Erlauben tun sich's andere auch«, warf Ingeborg ein und sah Karlheinz an.
»Sind die Cannelloni selbst gemacht?« fragte Karlheinz.
»Selbst warm gemacht«, antwortete Teresa. Dann zwinkerte sie Ingeborg zu. »Hast du Lust, dir meine neue Kreation anzusehen? Zigeunerlook. Ziehe ich morgen abend an, wenn wir zu Veronika in die ›Drehorgel‹ gehen.« Sie wandte sich an Wolfgang. »Veronika ist eine Freundin. Sie will Schauspielerin werden und jobbt als Bedienung.«
»Auch so ein verrücktes Huhn wie meine teure Gattin«, witzelte Heiner. »Nur einen Achtstundentag will keine durchstehen.«
»Du doch auch nicht. Oder willst du sagen, du bist Lehrer geworden, weil du dich rund um die Uhr nur für die heranwachsende Jugend interessierst?« Teresa schnitt eine Grimasse. »Wenn du mich fragst, bist du sowieso ungeeignet für den Lehrberuf. Oberförster ... Das wäre das richtige für dich.«
»Wie das?« fragte Wolfgang Engel verdutzt.
»Weil Bäume und Tiere nicht widersprechen können. Und weil so viel gesunde Luft um ihn wäre. Keine Abgase! Kresse und Frischkeimlinge im eigenen Gärtchen! Pausbäckige Kinder in der Wiege!«
Heiner warf ihr einen scharfen Blick zu.
»Nein? Keine Kinder?« fragte Teresa.
»Kennst du einen vernünftigen Lehrer, der nach ein paar Jahren Schuldienst noch eigene Kinder will?«
»Na! Mit Pestalozzi hast du aber auch nicht viel gemein.«
»Ich hatte eine Kollegin, die zehn Jahre die lieben Kleinen in einer Grundschule betreut hat. Dann heiratete sie und bekam drei Kinder. Eines Tages drehte sie durch. Sie ging nach England und machte eine Geschlechtsumwandlung.«
»Kommst du, Ingeborg?« fragte Teresa spitz. Wenn das Thema auf Kinder kam, wurde Heiner so giftig wie ein Röhrchen Blausäure.
Im Schlafzimmer setzte sich Ingeborg auf Heiners Schreibtisch und glättete sorgsam die Falten ihres Seidenrockes.
»Karlheinz hat schon wieder eine Neue«, sagte sie. »Sie ist neunzehn. Maniküre bei seinem Nobelfriseur. Eine Maniküre mit Abitur, wohin soll das bloß noch führen.«
»Macht dir das nichts aus?«
»Daß sie Abitur hat?«
»Blöde Gans. Daß er ein Verhältnis hat.«
»Was willst du ... Er verwirklicht sich eben. Er hing doch viel zu lange an den Rockschößen seiner Mutter. Jetzt hat er natürlich einen ungeheuren sexuellen Nachholbedarf.«
»Warum hat er dann geheiratet?«
»Er wollte keine Bindungsängste aufkommen lassen. Außerdem hätten seine Eltern einem Zusammenleben ohne Trauschein sehr ablehnend gegenübergestanden.«
»Wer fragt heute schon noch die Eltern?«
»Kinder, die erben wollen. Aber das war nicht das Ausschlaggebende. Wir wollten heiraten, um zu beweisen, daß man das Zusammenleben auch progressiv gestalten kann. Jeder kann tun und lassen, was er will! Solange man nur ehrlich ist zueinander.«
»Die total moderne Ehe. Ich weiß nicht ...« Teresa zog die Schultern hoch.
Ingeborg sprang vom Schreibtisch und lachte. »Du Ignorantin. Eine Traumehe führst du doch auch nicht. Obwohl du so schön romantisch vor dich hindöst.«
»Es gibt keine Traumehen. Und Heiner ist schon okay. Seine Ansichten sind ein bißchen fanatisch. Und daß er sich jetzt der Ökowelle verschrieben hat und nur noch biologisch angebautes Obst ißt und diese Körner in sich hineinstopft ...« Teresa kicherte. »Gestern hat er ein Kilo Äpfel verschlungen. War ein Sonderangebot vom Supermarkt. Wußte er aber nicht. Er dachte, es sei reinrassiger Demeter-Anbau.«
»Na, laß dich bloß nicht von ihm erwischen. Wie ich ihn kenne, wäre das der absolute Scheidungsgrund.«
»1 wo«, sagte Teresa vergnügt. »Er ist doch froh, daß er mich hat. Fanatiker brauchen Leute um sich, die alles falsch machen. Wen sollten sie sonst wohl bekehren?«
Mitten in der Nacht, genauer gesagt um sieben Uhr siebenundzwanzig, sprang Heiner aus dem Bett, stürzte in seinen Jogginganzug und murmelte etwas von »Tee, wenn ich wiederkomme«.
Teresa starrte zur quadratischen Decke ihres quadratischen Schlafzimmers. Früher hatte Heiner auch manches Mal gejoggt ... danach. Und sich verabschiedet mit einem zärtlichen Küßchen auf die Nase. Teresa setzte sich auf. Bei Erica Jong hatte sie gelesen, daß ein paar Jahre Ehe bereits lüstern machten nach anderen Partnern. Ob Heiner deshalb schüsselweise Haferflocken verspeiste? Sie warf ihr Laken zurück und stellte sich vor den großen Schrankspiegel. Mit dem weißen Männerhemd, auf das sie Daisy Duck gebügelt hatte, sah sie aus wie ein zu lang geratenes blondes Kind. Keinerlei Sex-Appeal. Nur zerzaustes Haar, blasses Gesicht und hohe Storchenbeine. Erica Jong. Ob die wirklich alles erlebt hatte, was sie so von sich gab? Mannomann!
Sie duschte, schlüpfte in ihren hübschesten Morgenrock und deckte den Frühstückstisch:
Fette Butter – gehärtete Pflanzenmargarine.Nitritbelastete Wurst – Frischrahm mit Honig.Weißbrot – Sechskornbrot.Kuchen – Frischkornbrei.Industriezucker – Süßstoff.Bohnenkaffee – Vierfruchttee.
Teresas prüfender Blick schweifte über die Tafel. Ihr Unbehagen legte sich auf der Stelle. Exakt fünfzig Prozent Gesundheit sprangen ihr in die Augen. Wenn das nicht ein total tolerantes Breakfast war! Mann, Teresa, du bist absolute Spitze, hätte Alf jetzt gesagt.
Aber typisch Fanatiker – Heiner nörgelte nur am Weißbrot herum und an der nitritbelasteten Wurst.
»Wie sieht dein Tag heute aus?« fragte er dann muffig.
»Briefe abgeben im Hotel. Marktanalyse Zahnpasta und Butterkekse. Oma Neutze besuchen. Abends die ›Drehorgel‹. Veronika hat Geburtstag. Kommst du mit?«
»Nein, danke. Die rauchige Luft macht mich ganz krank. Und Veronika erst recht.«
»Ich möchte aber gern, daß du mitkommst.«
»Ich kann nicht. Heute ist Mittwoch. Und Mittwoch abends gebe ich meine Atemtherapie.«
»Du liebe Güte. Wissen die Leute denn wirklich nicht, wie sie atmen sollen?«
»Atmen bedeutet mehr als Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben, mein Schatz. Der Atem verbindet Soma und Psyche.«
»Soma was?«
»Weißt du natürlich wieder nicht. Ich hab' dir's ja gesagt: deine desolate Halbbildung!«
»Mein grüner Heinrich, werd' bloß nicht ausfallend.« Teresa wurde wütend. Sie warf drei Stück gewürfelten Industriezucker in ihren Kaffee und schnitt sich ein dickes Stück Schinken ab. Nicht, daß sie noch Hunger gehabt hätte! Aber bei Schinken bekam Heiner immer ganz feuchte Augen und schluckte bei jedem Bissen mit. Sein Soma gab sich einfach nicht zufrieden mit Bambussprossen auf Quark und reagierte, wie es schon bei Adam reagiert hatte: schwach.
»Willst du?« fragte sie.
Er war doch noch nicht rettungslos verloren. Er verzehrte den Schinken mit geradezu unanständiger Hast.
Derart ermutigt, ließ Teresa ihren hübschen Morgenrock mit vollendeter Marilyn-Monroe-Pose von den Schultern gleiten. »Und dazu unverfälscht natürliche Vollwertkost, Honey«, hauchte sie. Und da sie Daisy Duck nach dem Duschen nicht mehr angezogen hatte, trat eine Umkehrung der Verhältnisse ein.
Heiners Psyche verfiel, und sein Soma stärkte sich. Diese Puritaner! Ein bißchen Fleisch, und schon verrieten sie all ihre Ideale!
Zwei Stunden später gab Teresa im Hotel »Vier Jahreszeiten« die sauber getippten Briefe an der Rezeption ab. »Herr Brettschneider wird heute nachmittag abreisen«, teilte man ihr mit, »und erst in einigen Wochen wieder in München sein.«
Teresa war enttäuscht. Sie hatte ihre orientalischen Pluderhosen aus schwarzem Samt und ein rotes, knapp sitzendes Jäckchen, das ebenfalls aus Oma Neutzes Fundus stammte, angezogen und sich mit silbernen Halbmond-Ohrringen geschmückt für den Fall, daß Valentin sie in sein Zimmer bitten und weitere geschäftliche Aktionen mit ihr besprechen wollte. Nun mußte sie sich mit den Pluderhosen schon am Vormittag in den Supermarkt stellen, um Zahncreme und Butterkekse zu testen, obwohl ihr Aufzug sicherlich besser zum Produkt »Türkischer Honig« gepaßt hätte. Doch Türkischer Honig war, soviel Teresa wußte, noch nie getestet worden.
Guten Tag, Sie haben gerade Dr. Müllers Butterkekse in ganz neuer Verpackung gekauft. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Produkt stellen?
Zwei Hausfrauen starrten auf Teresas Hosen und schoben ihre Einkaufswagen, ohne ein Wort zu sagen, weiter. Ein ziemlich betagter Punker mit einem Korb voller Babynahrung und Bierdosen (wenn Punkies nun schon mit Henkelkörben wie Rotkäppchen herumliefen, wohin sollte es noch kommen mit der Welt!) lud sie ein, eine der Dosen mit ihm zu leeren, und ein typischer Banker zog seinen Schlips gerade und sagte, daß er schrecklich im Streß sei und leider nicht dienen könne mit seiner maßgeblichen Meinung. Nur ein junges Mädchen gab bereitwillig Auskunft. Nein, ihr sei die neue Verpackung gar nicht aufgefallen. Sie kaufe diese blöden Kekse immer für ihren blöden Bruder. Der stopfe sich wie ein Wahnsinniger damit voll, aber das sei echt gut, dann halte er wenigstens den Mund.
Bei den Zahncremes tat sich auch nicht viel. Die meisten Leute griffen nach einem Produkt, das Teresa nicht testen sollte. Ihr blieb also nur übrig, die kluge und in den Testbogen bereits vorgedruckte Frage zu stellen: Würden Sie mir bitte sagen, warum Sie sich heute für eine andere Zahncreme entschieden haben?
Den Vogel schoß ein Mittvierziger ab. Er meinte, er habe jeden einzelnen seiner verdammten Zähne verloren, obwohl er sich mindestens zweimal die Woche die verdammten Zähne geputzt habe. Mit Teresas verdammter Zahncreme.
»Herzlichen Dank für das Interview«, antwortete Teresa artig. Auch dieser Satz war bereits vorgegeben. Für wie blöd hielten die Marktforschungsinstitute ihre Mitarbeiter eigentlich? Teresa kaufte in der Backwarenabteilung zwei Stück Prinzregententorte, so frustriert war sie. Nur Oma Neutzes tintenschwarzer Kaffee konnte ihr noch aus der Banalität des Lebens helfen.
Die Straße, in der Oma Neutze wohnte, war noch gediegenes altes München. Die Wohnung auch. Sie hatte sechs Zimmer, drei Kammern und eine Küche, in der normalerweise eine zehnköpfige Familie Platz gehabt hätte.
Als Teresa die ausgetretenen, bohnergewachsten Treppen hinaufkeuchte, stand Oma Neutze in einer Kittelschürze an der Wohnungstür und putzte das Namensschild. »Mechthild Neutze«, das »M« von Mechthild war mit einer Girlande umschlungen. »Das Schild stammt noch von meiner Großmutter. Sie war es auch, die darauf bestand, mich mit ihrem monströsen Vornamen zu beglücken«, sagte sie. Und, mit einem Blick auf Teresa: »Nett siehst du aus. Ja, ja, dieses rote Jäckchen. Das hatte ich zu meinem ersten Faschingsball an. Da habe ich deinen Großvater kennengelernt. Ich war Haremsdame, er Sindbad. Wir sind zwei Nächte nicht nach Haus gegangen, und mein Vater tobte. Er hat deinen Großvater ins Arbeitszimmer zitiert und ihm gesagt, wenn er mich nicht auf der Stelle heirate, werde er ihn mit der Peitsche an den Altar treiben. Aber das war gar nicht nötig. Dein Großvater und ich, wir waren auch ohne Peitsche bereits im siebten Himmel. Und wären es heute noch, wenn er damals nicht in Sibirien geblieben wäre.« Sie spritzte ein bißchen Sidol auf das Wörtchen »Neutze«, und Teresa fragte sich, was aus ihr wohl geworden wäre ohne diese muntere kleine Frau, die niemals klagte, nie aufgab, die dem Leben ihre Zähigkeit entgegensetzte, ihre Fröhlichkeit, ihren nie erlahmenden Glauben an das Gute und die auch, ohne Groll, den Tod als unentrinnbares Schicksal akzeptierte. Er hatte ihr, außer Teresa, alle Menschen genommen, die sie liebte: ihre Eltern, ihre Geschwister, ihren Mann und ihr Kind, Teresas Mutter, die ein halbes Jahr nach Teresas Geburt durch einen Autounfall gestorben war und die den Namen von Teresas Vater nie genannt hatte. »Wahrscheinlich weil sie ihn selbst nicht wußte«, pflegte Oma Neutze lakonisch zu sagen. Mehr sagte sie nicht, und Teresa, die eine verblaßte Fotografie besaß, auf der eine blonde, überschlanke Frau erschrocken auf den Säugling in ihren Armen starrte, billigte Oma Neutzes Schweigsamkeit und wischte ohne Tränen die Erinnerung an jene Jahre aus, in denen sie noch nach den Eltern gefragt und nie eine befriedigende Antwort erhalten hatte. Mit der Zeit bedeutete für sie Oma Neutze alles an Familie, was sie sich wünschte und dessen sie bedurfte, und plötzlich, im düsteren Treppenhaus stehend, kam ihr in den Sinn, daß sie Heiner nicht dazurechnete. Heiner war ihr Mann, gut und schön, aber sie sah sich nicht mit ihm alt werden. Einen Heiner, der mit gebeugtem Rücken und grauem Haar mit ihr durch die Tage des Alters ging, gab es nicht. Warum, wußte sie nicht zu sagen. Vielleicht weil er ihr heute schon manches Mal so entsetzlich vergreist vorkam und sie sich weder vorstellen konnte, daß dieser üble Eindruck noch einer Steigerung fähig war, noch, daß sie geeignet wäre, einem gebeugten alten Mann sein Sechskornbrot in mundgerechte Würfel zu schneiden. »Ich hab' getestet und bin ganz schlapp. Machst du deine schwarze Tinte?«
»Aber gern, Kindchen. Und einen guten Cognac habe ich auch da. Vom Oberst aus dem zweiten Stock. Seine Kinder wollen, daß er ins Altersheim geht, und ich mußte ihn trösten.« Sie seufzte und schob das Putztuch in die Tasche ihrer Kittelschürze. »Außerdem habe ich Neuigkeiten.«
Wenn Oma Neutze Neuigkeiten hatte, änderte sich meist nicht nur ihr Leben. Die deutlichen Offenbarungen, die sie in den Stunden regen Nachdenkens überfielen, hatten schon mancherlei bewirkt: daß Teresa, erst zehnjährig, mit Nadel und Faden umzugehen lernte und mit zwölf bereits ihr erstes selbstgeschneidertes Kleid trug, daß man aus einer engen Neubauwohnung auszog und diese Sechszimmerwohnung mietete, um einzelne Zimmer gewinnbringend an alleinstehende Berufstätige weitervermieten zu können, daß aus einem Nachlaß eine ganze Bibliothek ersteigert wurde, »weil nur Leute, die lesen, ihre Scheuklappen ablegen«, und, erst vor kurzem, die Anschaffung eines kleinen Autos, das »die klapprige Frieda« genannt wurde und das Oma Neutze erst fahren konnte, als sie mit sechsundsechzig Jahren ihren Führerschein machte.
»Welche Neuigkeiten?« fragte Teresa.
»Der Oberst hat mich draufgebracht. Er ist ein so rüstiger Mann. Es ist eine Schande, daß er ins Altersheim soll.«
»Willst du ihn heiraten?«
»Aber nein. Ich habe nur deinen Großvater geliebt. Und dabei bleibt es.«
»Was dann? Männern kann man, meines Erachtens, nur helfen, wenn man sie heiratet.«
»Ich gründe eine Wohngemeinschaft für alte Menschen. Ich selbst bin erst achtundsechzig und kerngesund. Die Wohnung ist leer, seit meine zwei Studenten ausgezogen sind, also, was meinst du? Ist das nicht eine herrliche Idee?«
»Eine Graue-Panther-WG. Ich weiß nicht ...« Teresa beschlich Unbehagen bei der Vorstellung alter, krummbeiniger Menschen, auf die der Tod lauerte und die durch die sonnigen Zimmer ihrer Kindheit schlurften. Sie vermeinte schon jetzt die trostlosen Gerüche des Alters zu verspüren, Kampfer, Essigsaure Tonerde, Kamille.
»Ich denke an Frau Reintinger aus dem Nebenhaus, die soll auch ins Altersheim, weil ihr Mann gestorben ist und die Wohnung viel zu groß ist für sie. Und an die dicke Martha. Die ist schon in einem Heim und will unbedingt wieder raus. Dann der Oberst. Und ich.«
»Eine heiße Sache. Der Oberst wird sich vorkommen wie ein Gockel im Hühnerhof. Aber mal im Ernst ... Du bürdest dir eine Unmenge Verantwortung und Arbeit auf. Die anderen sind viel älter als du. Wenn sie mal bettlägerig werden ...«
»Dann gibt es Pflegepersonal. Wir legen unsere Renten zusammen, und jeder hat Erspartes.« Oma Neutze holte die Cognacflasche und Zigaretten. »Man kann doch nicht alles, was über sechzig ist, in ein Heim abschieben!«
»Aber was sagt der Vermieter dazu?«
»Wieso? Ich habe bis jetzt auch untervermietet, und er hatte nichts dagegen. Na, laß nur Kindchen. Heute abend treffen wir uns und reden über das Projekt.« Sie zündete sich eine Zigarette an und trank einen Schluck Cognac. »Und nun zu dir. Wie geht's?«
Teresa zuckte die Achseln. »Der schöne Valentin ist abgereist, ohne mich überhaupt wahrzunehmen. Meine Tests laufen auch miserabel. Und Heiner wird immer wunderlicher. Jetzt hat er sich auch noch eine Getreidemühle zugelegt und ein putziges kleines Holzschäufelchen. Damit schaufelt er aus Leinensäckchen die verschiedensten Körnchen in die Mühle, gibt alles in ein Schüsselchen, schnitzelt ein Äpfelchen hinzu, verrührt Joghurt und kriegt dabei einen so selbstzufriedenen Gesichtsausdruck, daß ich schreien könnte.«
»Na, na. Sei ein bißchen tolerant. Jeder kann doch essen, was er will!«
»Das ist es gar nicht«, rief Teresa erbost. »Es ist die Philosophie, die dahintersteckt! Mag sein, daß andere Naturapostel weniger fanatisch sind, aber er, er schießt wieder einmal den Vogel ab. Alles, was er macht, macht er zweihundertprozentig, sogar unsere Atemtechnik will er umstellen.«
»Wie das denn?«
»Ich darf nicht mehr atmen, wie ich will. Achtundzwanzig Jahre hab' ich mich wohl gefühlt mit meiner Nase und meinem Brustkorb und meinem Zwerchfell, aber alles war verkehrt. Jetzt soll ich mit ihm lernen, wie man wirklich atmet. Den verlängerten Atem, die Siebener-Atmung, den Windmühlen-Atem, den Schnüffel-Atem.« Teresa begann zu lachen. »Der Schnüffel-Atem! Der bildet den Abschluß des Tages. Stell dir vor! Ich liege in den Kissen, voller Sehnsucht auf meinen Herzallerliebsten wartend. Der sitzt mit durchgedrücktem Kreuz und starrem Blick auf dem Bettvorleger, holt tief Luft, hält sie an. Ich erröte hold, denn ich denke natürlich, es sei meinetwegen. Ist aber nicht meinetwegen. Ist die neue Entspannungstechnik. Kurz vor einem Erstickungsanfall, bevor ihm die Augen endgültig aus dem Kopf fallen, stößt er seinen kostbaren Atem in einem leidenschaftlichen Stakkato aus, schnüffelnd wie ein Hund, der ein Bäumchen sucht. Und wozu das Ganze, verehrtes Publikum? Um der Vitalität willen. Der Schnüffel-Atem soll erfrischen und Kraft schenken.«
»Tut er's denn?«
»Mitnichten. Mein grüner Heinrich steigt nach dieser Übung ins Bett und wünscht eine geruhsame Nacht, und ich habe nicht den blassesten Dunst, was er macht mit seiner neugewonnenen Vitalität. Auf jeden Fall nichts, was mich erfreut.«
Nun lachte auch Oma Neutze. Ihr kleines Gesicht mit der ledrigen, von Falten durchzogenen Haut der starken Raucherin schob sich zusammen. »Das gibt sich wieder, wart's ab«, sagte sie. »Willst du zum Essen bleiben?«
»Nein. Ich hab's eilig. Heute abend ist Geburtstagsfeier in der ›Drehorgel‹. Veronika wird dreißig. Irgendein Typ soll kommen, der ihr eine kleine Rolle in einem Boulevardstück geben will. Ist das nicht super?«
»Mit dreißig wird es auch höchste Zeit, daß sie irgend etwas mit sich anfängt. Wenn sie noch ein bißchen wartet, bleiben ihr bloß noch Mutterrollen. Ich kenne aber keine einzige Schauspielerin, die mit Mutterrollen angefangen hat.«
»Die Schauspielerei ist halt Veronikas Berufung.«
»Irgendwann einmal ist der Zug abgefahren für Berufungen«, erwiderte Oma Neutze, und Teresa fragte sich erschrocken, ob ihr Zug auch schon abgefahren sei. Aber dann fiel ihr ein, daß Modeschöpferinnen sicherlich sehr großer menschlicher Reife bedürfen, um zu erkennen, was die Frauen kleidet und den Männern gefällt. »Vielleicht für Veronika«, sagte sie. »Aber nicht für mich.«
»Na! Von nichts kommt nichts. Und daß du wichtige Jahre vertrödelst mit Briefetippen ... ich weiß nicht recht.«
Teresa verabschiedete sich. Sie mußte noch Backofen-Frites besorgen fürs Abendessen. Und für Heiner Weizenkleie. Oma Neutze war sicher eine intelligente Frau. Aber von künstlerischen Reifeprozessen und dem Konkurrenzkampf auf dem weiblichen Arbeitsmarkt hatte sie nicht die leiseste Ahnung.
Es war gegen halb zwölf, als die vollbusige, rothaarige Veronika das »Gretchen« deklamierte und die ganze »Drehorgel« sich kaputtlachte. Der Typ, der ihr eine Rolle in einem Boulevardstück versprochen hatte, lag quer über dem Tisch und sah eigentlich mehr wie ein total betrunkener Beleuchter aus. Teresa, in einem knallroten Zigeunerrock und einem schwarzen Oberteil, hätte wetten mögen, daß er zuerst bei Veronika Kaffee trinken wollte, bevor er sich näher über diese geheimnisvolle Rolle ausließ.
»Was glaubst du«, flüsterte sie Ingeborg zu. »Ist er Regisseur oder nicht?«
»Wenn der Regisseur ist, bin ich Cinderella. Ich weiß nicht, wo Veronika immer diese Nieten auftreibt.«
»Sag es ihr nicht. Nicht heute abend. Sie hat doch Geburtstag.«