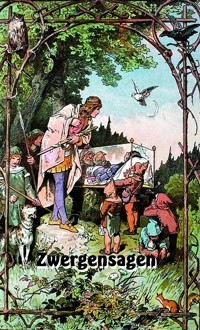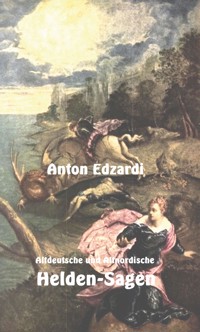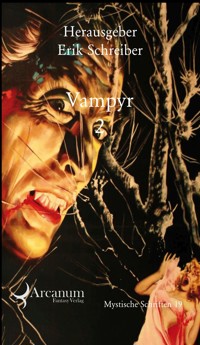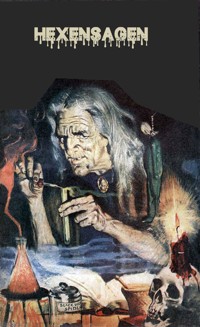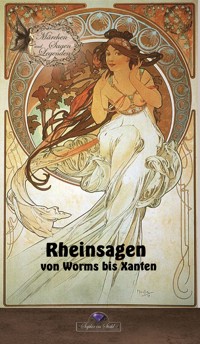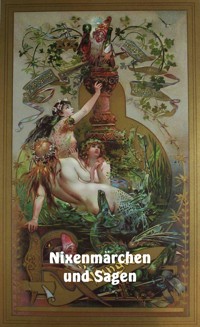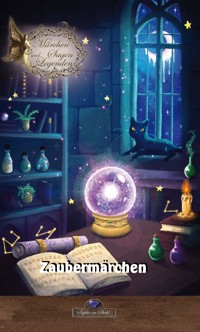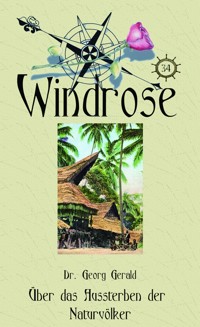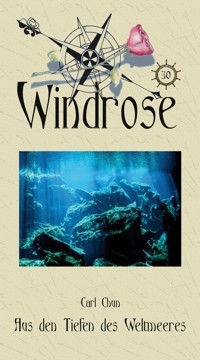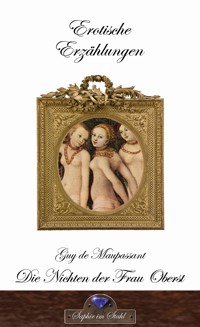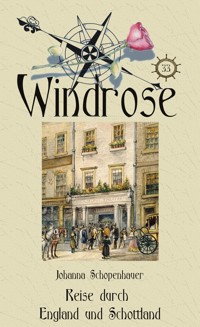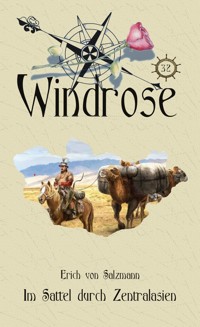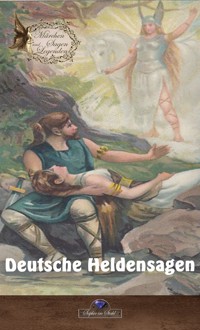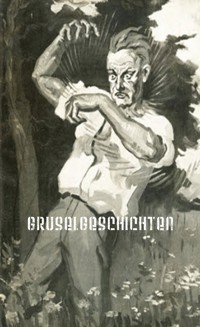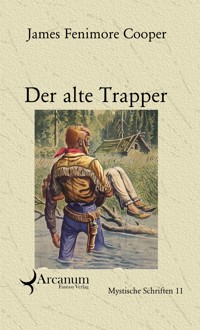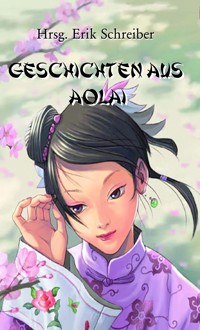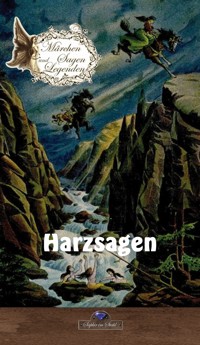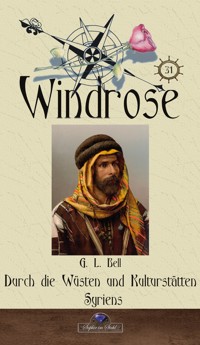
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Windrose
- Sprache: Deutsch
Die Reihe "Windrose" aus dem Verlag Saphir im Stahl publiziert alte Reiseberichte namhafter Forschungsreisender. Die Forschungsreisenden vom 18ten Jahrhundert bis zum 20sten Jahrhundert zeigen die Unterschiede zwischen dem heutigen Wissen und dem damaligen Forschungsdrang. Auf diese Weise lernt man in der heutigen Zeit dessen Wissenstand der Vergangenheit kennen und die Entdeckungsreisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 31
Reiseerzählungen
G. L. Bell
Durch die Wüsten und Kulturstätten
Syriens
Saphir im Stahl
Reiserzählungen 31
e-book 316
G. L. Bell - Durch die Wüsten und Kulturstätten Syriens (1908)
Erscheinungstermin 01.11.2025
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Archiv Andromeda
Lektorat Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 31
Reiseerzählungen
G. L. Bell
Durch die Wüsten und Kulturstätten
Syriens
Saphir im Stahl
Ihm dünkt die unbekannte Ferne der liebste Freund; er wandelt,
wo über ihm die Mutter all der Myriaden von Sternen ihre Bahn zieht.
Ta'abata Sharran.
Vorwort.
Wer es heutzutage als Nichtgelehrter und Nichtpolitiker wagt, zu der ungeheuer umfangreichen Reiseliteratur einen neuen Band hinzuzufügen, muss mindestens mit einer Entschuldigung ausgerüstet sein. Die meinige ist bereit und ist, wie ich hoffe, auch so überzeugend und glaubhaft, wie solche Dinge sein müssen. Ich wollte weniger eine Reisebeschreibung liefern als vielmehr eine Schilderung der Leute, denen ich begegnet bin, oder die mich auf meinen Wegen begleitet haben, wollte berichten, in was für einer Welt sie leben und mit welchem Auge sie dieselbe betrachten. Und da ich es für besser hielt, die Leute so viel als möglich selbst reden zu lassen, habe ich ihre Worte in meine Wanderungen eingeflochten, habe getreulich wiederholt, was ich gehört: die Erzählungen, womit der Hirt sowie der Bewaffnete die Stunden des Marsches kürzten, die Unterhaltungen, die am Lagerfeuer, im schwarzen Zelt der Araber und im Gastgemach der Drusen von Mund zu Mund gingen, sowie die vorsichtigeren Äußerungen der türkischen und syrischen Beamten. Ihre Politik beschränkt sich auf Vermutungen -- oft sind sie scharfsinnig genug -- über die Resultate, die das Zusammenwirken unbekannter Kräfte, deren Stärke und Zweck meist nur undeutlich erfasst werden, ergeben könnte; sie schöpfen ihr Wissen aus so ganz anderen Informationsquellen, legen bei ihren Vergleichen einen so ganz anderen Maßstab an als wir, und treten an die ihnen vorgelegten Probleme mit einem von dem unseren ganz verschiedenen Anschauungskreis heran. Der Orientale ist ein altes Kind. Mancher Wissenszweig, der uns von elementarster Notwendigkeit erscheint, ist ihm unbekannt; meist, nicht immer, bereitet ihm auch die Pflicht, sich solches Wissen anzueignen, wenig genug Sorge, und er kümmert sich kaum um das, was wir praktischen Nutzen nennen. Nach unsrer Auffassung des Wortes praktisch ist er nicht praktischer als ein Kind, und sein Begriff von Nutzen weicht sehr von dem unseren ab. Andrerseits wieder wird sein Tun und Lassen durch überlieferte Sitten- und Umgangsgesetze geregelt, die bis auf den Beginn der Zivilisation zurückdatieren, Gesetze, die bis jetzt noch durch keinen Wechsel der Lebensweise, der sie entsprungen sind und auf die sie sich beziehen, eine größere Veränderung zu erfahren brauchten. Abgesehen davon ist der Orientale ganz wie wir auch; die menschliche Natur verändert sich jenseits des Suezkanals nicht vollständig, auch ist es nicht etwa unmöglich, sich mit den Bewohnern jener Himmelsstriche auf freundlichen, ja freundschaftlichen Fuß zu stellen. Ja, in gewisser Beziehung ist es sogar leichter als in Europa. Ist doch die Verkehrsweise des Ostens weit weniger durch künstliche Fesseln eingeengt, herrscht doch infolge der größeren Verschiedenheit auch eine viel weitgehendere Duldsamkeit. Kasten, Stämme und Sekten teilen die Gesellschaft in zahllose Gruppen, deren jede ihrem eignen Gesetz folgt, und mag dieses Gesetz unsrer Meinung nach noch so phantastisch sein, dem Orientalen ist es eine ausreichende Erklärung für jede Sonderbarkeit. Ob ein Mann sich bis an die Augen in Schleier gehüllt zeigt, oder ob es ihm gefällt, nur mit einem Gürtel bekleidet zu erscheinen -- es wird keine Bemerkung über ihn fallen. Warum auch?
Gehorcht er doch, wie ein jeder, lediglich seinem eignen Gesetz. So kann auch der Europäer die weltfremdesten Orte bereisen, ohne großer Kritik, ja auch nur Neugier zu begegnen. Man wird die Neuigkeiten, die er bringt, voll Interesse, seine Ansichten voll Aufmerksamkeit anhören, aber niemand wird ihn für sonderbar oder närrisch oder auch nur für im Irrtum befangen halten, weil seine Gewohnheiten und seine Anschauungsweise von denen des Volkes abweichen, in dem er sich gerade aufhält. „Adat-hu“: es ist so Brauch bei ihm. Der Ausländer handelt deshalb auch am klügsten, wenn er gar nicht versucht, sich bei den Orientalen dadurch einzuschmeicheln, dass er ihre Gewohnheiten nachäfft, außer wenn er es geschickt genug tut, um für einen der Ihrigen gelten zu können. Im allgemeinen mag er den Bräuchen andrer achtungsvoll begegnen, sich selbst aber genau an seine eignen halten -- das wird ihm die größte Achtung sichern. Die Beachtung dieser Regel ist vor allem für Frauen von höchster Wichtigkeit, denn eine Frau kann nie ganz sich selbst verleugnen. Dass sie einer großen und geachteten Nation angehört, deren Sitten unantastbar sind, wird für sie die beste Gewähr für allgemeine Rücksichtnahme sein.
Keins der Länder, die ich besucht habe, ist dem Reisenden jungfräuliches Land, wenn auch manche dieser Gegenden bisher nur selten aufgesucht und nur in teuren und meist schwer erhältlichen Werken beschrieben worden sind. Von solchen Orten habe ich einen kurzen Bericht gegeben und alle die Photographien hinzugefügt, die mir von Interesse zu sein schienen. Bei den Städten Nordsyriens habe ich auch jener historischen Überreste Erwähnung getan, die dem gelegentlichen Beobachter ins Auge fallen. Es gibt in Syrien und am Rande der Wüste noch viel Forscherarbeit zu tun, noch manches schwierige Problem zu lösen. De Vogüé, Wetzstein, Brünnow, Sachau, Dussaud, Puchstein und seine Kollegen, die Glieder der Princetonschen Expedition u. a. m. haben das Werk mit gutem Erfolg begonnen, und auf ihre Schriften verweise ich alle diejenigen, denen daran liegt zu erfahren, wie unermesslich reich das Land an architektonischen Monumenten und schriftlichen Überresten einer weit zurückliegenden Geschichte ist.
Meine Reise endete nicht in Alexandretta, wie dieser Bericht hier. In Kleinasien habe ich mich jedoch hauptsächlich mit Archäologie beschäftigt; die Resultate meiner dortigen Forschung sind in einer Serie von Artikeln in der „Revue Archéologique“ veröffentlicht worden, wo sie dank der Güte Monsieur Salomon Reinachs, des Herausgebers, einen weit günstigeren Platz gefunden haben, als ihnen die Seiten dieses Buches bieten konnten.
Ich kenne weder die Leute noch die Sprache Kleinasiens gut genug, um in engere Fühlung mit dem Lande zu kommen, aber selbst auf meine spärliche Bekanntschaft hin bin ich bereit, dem türkischen Bauer ein ehrenvolles Zeugnis auszustellen. Ihn zeichnen viele Tugenden aus, unter denen die Gastfreundschaft oben ansteht.
Ich habe mich bemüht, auch die politische Stellung unwichtiger Personen zu schildern. Sie erscheinen denen, die in ihrer Mitte leben, gar nicht so nebensächlich, und ich meinesteils bin immer denen dankbar gewesen, die mir über ihre gegenseitigen Beziehungen Aufschluss gegeben haben. Aber es kommt mir nicht zu, die Regierung des Türken zu rechtfertigen oder zu verdammen. Ich habe lange genug in Syrien gelebt, um einzusehen, dass seine Verwaltung weit davon entfernt ist, eine ideale zu sein, habe aber auch die unruhigen Elemente genügend kennen gelernt, die er mehr oder weniger gut im Zaum hält, um zu wissen, dass seine Stellung eine schwierige ist. Ich glaube nicht, dass irgendeine andre Regierung allgemeine Zufriedenheit ernten würde: gibt es doch wenige, die selbst in geeinigteren Ländern dieses ersehnte Ziel zu erreichen imstande sind.
Aber diese Erwägungen liegen außerhalb des Rahmens unsres Buches. Ich schließe mein Vorwort wohl am besten damit, womit jeder orientalische Verfasser es begonnen haben würde: Im Namen Gottes, des Barmherzigen und Gnädigen.
Erstes Kapitel.
Dem Angehörigen höherer Stände bieten sich selten Momente freudigerer Erwartung, als wenn er an der Schwelle einer Reise in ferne Länder steht. Die Pforten der Enge öffnen sich ihm; es fällt die Kette vor dem Eingang ins Heiligtum, mit unsicherem Blick nach rechts und links schreitet er vorwärts und blickt -- ins Unermessliche. In die Welt der Abenteuer und großen Taten, die Welt voll schwarzer Wetter und lockenden Sonnenscheins, die in jeder ihrer Falten eine unbeantwortete Frage, einen unlösbaren Zweifel bringt. Du musst allein hineinschreiten, musst dich absondern von den Scharen deiner Freunde, die die Rosengärten aufsuchen, musst den Purpur und das feine Linnen zurücklassen, die den kämpfenden Arm hindern, -- freudlos, heimat- und besitzlos will sie dich haben, diese Welt der Wunder. Statt der überredenden Worte deiner Ratgeber wirst du das Rauschen des Windes hören, Regenschauer und scharfer Frost werden dir ein stärkerer Ansporn sein als Lob und Tadel, und die Not wird ein entschiedeneres Muss sprechen als die armselige Stimme der Einsicht, die wir Menschen ganz nach Belieben zu befolgen oder zu missachten pflegen. Du verlässt dein schützendes Heim und fühlst, sobald du den Pfad betrittst, der über die gerundeten Schultern der Erde dahinführt, gleich dem Manne im Märchen; die Reifen lösen sich, die dein Herz gefesselt halten.
Es war ein stürmischer Morgen, der 5. Februar. Der Westwind erhob sich aus dem Mittelmeer, fegte über die Erde dahin, wo die Kanaaniter Krieg führten mit den hartköpfigen Bergbewohnern Judäas, übersprang die gewaltige Gebirgsmauer, die die Könige von Assyrien und Ägypten vergebens zu überwinden versucht, schrie nach Jerusalem die Kunde von kommendem Regen hinein, jagte weiter über die öden Osthänge hinab, setzte mit einem Sprung über das tiefeingeschnittene Bett des Jordans und verschwand jenseits der hohen moabitischen Höhen in der Wüste. Und die ganze Meute des Sturmes jagte ihm nach, ein kläffendes Rudel, ostwärts jagend und sich des tollen Tanzes freuend.
Wer, mit frischem Leben in den Adern, möchte wohl an einem solchen Tage zu Hause bleiben? Für mich gab es überhaupt keine Wahl. Schon im grauen Dämmern waren die Maultiere mit all meinen Habseligkeiten ausgezogen.
Zwei Zelte, ein Lebensmittelwagen mit so wenig luxuriösen Vorräten für einen Monat, dass selbst der abgehärtetste Reisende sich nicht mit weniger begnügen kann, zwei kleine Maultierkörbe voll photographischer Artikel, einige wenige Bücher und ein stattliches Paket Landkarten -- das war alles. Mit den aus Beirut mitgebrachten Maultieren und ihren drei Führern war ich zufrieden und beabsichtigte, dieselben auch auf der Weiterreise mitzunehmen. Die Männer stammten alle aus dem Libanon, zwei, Vater und Sohn, beide Christen, aus einem Dorfe nördlich von Beirut. Der Vater -- Ibrahim mit Namen -- ein altes, zahnloses Individuum, saß rittlings über den Maultierkörben und murmelte fromme Worte, Segenssprüche und Beteuerungen seiner Ergebenheit gegen seinen gnädigsten Auftraggeber, ohne sich jedoch bewogen zu sehen, weitere Anstrengungen zum Wohle der Gesellschaft zu machen. Der Sohn, Habīb, zählte zwei- oder dreiundzwanzig Jahre, war dunkel, stämmig, breitschulterig, mit kühnem Blick unter schwarzen Brauen hervor, und einem Profil, das ein Grieche ihm hätte neiden können. Treiber Nummer drei war ein Druse, ein großer, schlottriger, unverbesserlich träger Mensch, ein Schurke im kleinen, der freilich meinen gerechten Unwillen hinsichtlich gestohlenen Zuckers und fehlender Piaster stets durch einen bittenden Blick aus seinen glänzenden Hundeaugen wieder zu bannen wusste. Er zeigte sich gefräßig und stumpfsinnig, Fehler, die bei einer Kost von trocknem Brot, Reis und ranziger Butter freilich wohl schwer vermeidlich sind, aber selbst mitten unter seine Todfeinde gestellt, leierte er seine Arbeit weiter und schlurfte mit derselben Miene blöder Gleichgültigkeit hinter seinen Maultieren und seinem Esel her, die er in den Straßen von Beirut zeigte. Er hieß Mohammed.
Das letzte Glied unserer Karawane war Michaïl, der Koch, ein Jerusalemer und Christ, dem die Religion freilich nicht viel Kopfzerbrechen machte. Er hatte Mr. Mark Sykes auf Reisen begleitet und von ihm folgendes Zeugnis erhalten: „Mit Ausnahme dessen, was er bei mir gelernt hat, versteht er nicht viel vom Kochen, aber er macht sich keinen Strohhalm daraus, ob er lebt oder getötet wird.“ Als ich Michaïl diese Worte vorlas, lachte er immer wieder in sich hinein, und ich engagierte ihn auf der Stelle. Es war freilich ein ungenügender Grund, aber ebenso gut, wie mancher andere. Seinen Fähigkeiten entsprechend diente er mir gut, aber er war ein empfindliches, hitziges Männchen, das mit einer Einbildungskraft, deren Größe ich selbst in unserer dreimonatigen Bekanntschaft nicht ganz ergründet habe, überall und in allem eine beabsichtigte Beleidigung witterte. Unglücklicherweise hatte Michaïl in den Jahren, die seit seinem Schiffbruch auf dem See Wan mit Mr. Sykes verflossen waren, außer dem Kochen auch noch einiges andere gelernt. Es ist typisch für ihn, dass er sich nie die Mühe gab, mir jenes Abenteuer zu schildern, obwohl er einmal, als ich es erwähnte, kopfnickend bemerkte: „Wir waren damals dem Tode so nahe, wie ein Bettler der Armut, aber Exzellenz weiß ja, dass der Mensch nur einmal sterben kann.“ Dagegen traktierte er meine Ohren beständig mit Geschichten von Reisenden, die da behauptet hatten, ohne Michaïls kulinarische Künste nicht in Syrien reisen zu können und zu wollen. Die Arrakflasche war die Schwäche, die ihm verhängnisvoll werden sollte, und nachdem ich alle Maßregeln, von überredender Schmeichelei bis zur Jagdpeitsche, angewendet hatte, entließ ich ihn an der cilicischen Küste mit anderm Bedauern als der Sehnsucht nach zähen Ragouts und kalten Pfannkuchen.
Ich hegte den Wunsch, den einsamen Weg nach Jericho ganz allein hinabzureiten, wie ich schon zuvor getan hatte, als mein Antlitz auch der Wüste zugewendet war, aber Michaïl war der Meinung, dass sich das mit meiner Würde nicht vertrüge, und ich hegte die Überzeugung, dass selbst seine schwatzhafte Gegenwart diesen Weg nicht der Einsamkeit entkleiden konnte. Um neun Uhr saßen wir im Sattel, ritten um die Mauern von Jerusalem in das Tal des Kidron hinab, vorbei an dem Schmerzensgarten von Gethsemane, und den Ölberg hinan.
Hier hielt ich inne, um mich wieder dem Eindruck hinzugeben, den keine Vertrautheit mit der Gegend abschwächen kann, dem Eindruck der mauerumgürteten Stadt, die unter einem bleiernen Himmel grau inmitten der grauen Landschaft liegt, und doch vergoldet wird von der Hoffnung und dem unauslöschbaren Sehnen aller Pilger. Menschliches Hoffen, das blinde Tasten der gefesselten Seele nach einem Ziel, das jedem Wunsche Erfüllung, jedem müden Herzen Frieden geben wird, -- das ist es, was die Stadt gleich einem halb lichten, halb wehmütigen Glorienschein umgibt, den so manche Zähre benetzt, manche Enttäuschung befleckt hat. Der West wandte mein Pferd, und vorwärts galoppierten wir über den Gipfel des Hügels und die Straße hinab, die sich durch die judäische Wüste hinzieht.
Am Fuße des ersten Abstieges liegt eine Quelle, „Ain esh Shems“, d. i. „Sonnenquell“, von den Arabern genannt, während die christlichen Pilger ihr den Namen „Apostelbrunnen“ beigelegt haben. Selten wird man hier während des Winters vorüberkommen, ohne russische Bauern zu finden, die auf ihrem beschwerlichen Wege vom Jordan herauf hier rasten. Tausende überschwemmen alljährlich das Land, alte Männer und Frauen zumeist, die ein Menschenalter lang gedarbt und gespart haben, um die etwa 150 Rubel zu erübrigen, die sie nach Jerusalem bringen sollen. Von den fernsten Grenzen des russischen Reiches kommen sie zu Fuß nach dem Schwarzen Meere, wo sie sich als Deckpassagiere auf den kleinen schmutzigen russischen Dampfern einschiffen. Als einziger Kajütenpassagier habe ich einst mit 300 dieser Pilger die Überfahrt von Smyrna nach Jaffa gemacht. Es war tiefer Winter, stürmisch und kalt für den an Deck Schlafenden, selbst wenn er mit Schafpelz und gefütterten Schaftstiefeln ausgerüstet war. Meine Reisegefährten hatten aus Sparsamkeit ihre Lebensmittel selbst mitgebracht: Ein Laib Brot, etliche Oliven, eine rohe Zwiebel waren ihre tägliche Nahrung. Am Morgen und am Abend vereinigten sie sich um ein in der Schiffsküche hängendes Muttergottesbild zum Gebet, und das Summen ihrer Litaneien vereinigte sich auf seinem Wege himmelan mit dem Stampfen der Schraube und dem Plätschern der aufgewühlten Flut. Die Pilgrime erreichen Jerusalem gegen Weihnachten und verweilen bis nach Ostern, damit sie noch ihre Kerzen an der heiligen Flamme entzünden können, die am Auferstehungsmorgen aus dem Grabe Christi hervorbricht. Zu Fuß wandern sie an alle die heiligen Stätten, Obdach in den großen Unterkunftshäusern findend, die die russische Regierung für sie erbaut hat. Viele sterben infolge von Mangel, Ermüdung und den Unbilden eines unvertrauten Klimas; aber in Palästina sterben, ist ja die höchste Gunst, die die göttliche Hand verleihen kann: ruhen doch die Gebeine friedlich im Heiligen Lande, während die Seele unmittelbar ins Paradies eilt. Man kann diesen kindlich einfältigen Reisenden auf jeder Landstraße begegnen; im heimischen Pelz pilgern sie durch Sommerglut und Winterregen dahin, gestützt auf den Stab, den die eigne Hand am steilen Jordanufer geschnitten. Sie verleihen der von so schwermütiger Poesie erfüllten Landschaft einen noch ernsteren Charakter. In Jerusalem wurde mir einst eine Geschichte erzählt, die das Wesen der russischen Pilger besser beleuchtet, als es seitenlange Schilderungen vermögen. Ein Einbrecher war überführt und nach Sibirien geschickt worden, wo er viele Jahre als Sträfling verbrachte. Als seine Zeit um war, kehrte er gebessert zu seiner alten Mutter zurück, und die beiden brachen nach dem Heiligen Lande auf, wo er für seine Sünden Buße tun wollte. Nun versammelt sich um die Zeit, wo die Pilger dort weilen, der ganze Abschaum von Syrien in Jerusalem, um zu betteln und die arglosen Wallfahrer zu betrügen. Einer dieser Vagabunden ging den russischen Büßer um ein Almosen an, als dieser gerade selbst nichts hatte. Durch die Zurückweisung erbittert, schlug der Syrier den andern zu Boden und verletzte ihn so schwer, dass er drei Monate im Hospital liegen musste. Nach seiner Genesung kam der russische Konsul zu ihm und sprach: „Wir haben den Burschen, der dich fast getötet hat; du musst Zeugnis ablegen gegen ihn, ehe du fortgehst.“ Der Pilgrim aber versetzte: „Nein, lassen Sie ihn laufen. Ich bin auch ein Verbrecher.“
Jenseits des Quells lag die Straße menschenleer, und obgleich sie mir schon bekannt war, überraschte mich doch diese tiefe Einsamkeit aufs neue. Kein lebendes Wesen, keine Blume, die kahlen Stängel der vorjährigen Disteln nur, die nackten Höhen, der steinige Weg. Und doch hat die Wüste von Judäa so manchem Feuergeiste das Leben gegeben. Grimme Propheten sind aus ihr hervorgegangen, die eine Welt mit Gottes Zorn bedrohten, an der sie selbst keinen Teil hatten, die sie nicht verstanden; die Täler sind voll von Höhlen, die jene Männer beherbergten; ja bis zum heutigen Tage sind einige von hungernden, abgemagerten Asketen bevölkert, die an einer überlieferten Religionsausübung festhalten, der selbst unser nüchterner Verstand nur schwer die Berechtigung absprechen kann. Bevor es Mittag war, erreichten wir die Karawanserei, die halbwegs nach Jericho und zwar an der Stelle liegt, wo der Legende nach der barmherzige Samariter den unter die Mörder Gefallenen fand. Ich ging hinein, um geschützt vor dem kalten Wind zu frühstücken. Drei deutsche Handlungsreisende schrieben Ansichtspostkarten im Gastzimmer und handelten mit dem Wirt um imitierte Beduinenmesser. Ich saß und horchte auf ihr Geschwätz -- es waren die letzten Worte, die ich auf Wochen hinaus in einer europäischen Sprache hören sollte, aber ich fand keine Ursache, der Zivilisation nachzutrauern, die ich hinter mir ließ. Ostwärts von der Karawanserei senkt sich der Weg und kreuzt ein trocknes Flussbett, das mancher Gräueltat zum Schauplatz gedient hat. An den Ufern verborgen, pflegten die Beduinen den vorüberziehenden Pilgern aufzulauern, sie auszuplündern und zu morden. Denn noch vor 15 Jahren war die Straße ebenso wenig vom Auge des Gesetzes behütet, wie jetzt das Ostjordanland; im letzten Jahrzehnt hat sich die öffentliche Sicherheit ein paar Meilen weiter ostwärts ausgedehnt. Endlich erreichten wir den Gipfel des letzten Hügels und blickten in das Tal des Jordans, auf das Tote Meer und die verschleierten moabitischen Berge im Hintergrund -- die Grenze der Wüste. Zu unsern Füßen Jericho, ein unromantischer Haufen baufälliger Gasthäuser und Hütten, in denen die einzigen Araber hausen, die der Tourist zu Gesicht bekommt, ein Mischgesindel von Beduinen und Negersklaven. Ich ließ mein Pferd bei den Maultiertreibern oben am Hang, „Der Herr schenke Ihnen Gedeihen!“
„Gelobt sei Gott!“
„Wenn es Eurer Exzellenz gut geht, sind wir zufrieden!“ und lief bergab in das Dorf. Aber Jericho genügte mir nicht für diesen herrlichen ersten Reisetag; ich sehnte mich danach, Touristen, Hotels und Ansichtspostkarten hinter mir zu lassen. Zwei weitere Stunden würden uns an das Jordanufer bringen, und dort, an der hölzernen Brücke, die West und Ost verbindet, konnten wir an einem geschützten Platz zwischen den Erdhügeln, im Dickicht von Rohr und Tamarisken unsre Zelte aufschlagen. Ein kurzer Halt, um Futter für die Pferde und Maultiere zu kaufen, und weiter ging es über den schmalen Streifen Ackerland, der Jericho umgibt, dem Ghor, dem Tale des Jordan, zu.
Ist die Straße nach Jericho schon öde genug, so bietet das Jordantal einen Anblick fast unheimlicher Unwirtlichkeit. Hätten die Propheten des Alten Testamentes ihren Fluch über diese Gegend geschleudert, ebenso wie sie es über Babylon oder Tyrus taten, es könnte keinen besseren Beweis für die Wahrheit ihrer Prophezeiungen geben; aber sie schwiegen, und unsre Einbildungskraft muss auf die Flammen von Sodom und Gomorrha zurückgreifen, auf jenes legendenhafte Strafgericht, das in unsrer eignen Kindheit ebenso spukte, wie es in den Kindheitstagen der semitischen Rasse gespukt hat. Eine schwere, schwüle Atmosphäre lastete über diesem tiefstgelegenen Teile der Erdoberfläche; über unsern Häuptern, oben auf den Gipfeln der Hügel, wo der Mensch die freie Gottesluft atmet, raste der Wind dahin, im Tale aber war alles leb- und bewegungslos wie in der Tiefe des Meeres. Wir bahnten uns einen Weg durch das niedrige Buschwerk des dornigen Sidrbaumes, des Christusdornes, aus dessen Zweigen angeblich Christi Dornenkrone geflochten war. Man kennt zwei Arten des Christusdorns, die Araber nennen sie Zakūm und Dōm. Aus dem Zakūm ziehen sie ein medizinisches Öl, der Dōm aber trägt kleine, dem Holzapfel ähnelnde Früchte, die zur Zeit der Reife eine rötlichbraune, einladende Farbe aufweisen. Sie sind das wahre Abbild des Toten Meeres, verlockend anzusehen, auf den Lippen aber eine sandige Bitterkeit zurücklassend. Das Sidrgestrüpp lichtete sich und blieb hinter uns; wir befanden uns auf einer trocknen Schlammdecke, die nichts Grünes trägt. Sie ist von gelber Farbe und hier und da mit grauweißem, giftigem Salz bestreut, dessen Lebensfeindlichkeit sich dem Auge ganz unbewusst von selbst aufdrängt.
Während wir so dahinritten, überfiel uns plötzlich ein schwerer Regenschauer. Die Maultiertreiber schauten besorgt drein, selbst Michaïls Gesicht zog sich lang: lagen doch vor uns die Schlammhänge von Genesis, die Pferd und Maultier nur bei vollständiger Trockenheit überschreiten können. Der Regen währte zwar nur sehr wenige Minuten, genügte aber, um den harten Schlamm in der Ebene in eine butterähnliche Masse zu verwandeln. Die Pferde versanken darin bis zu den Fesseln, und mein Hund Kurt winselte, als er seine Pfoten aus dem gelben Leim zog. So kamen wir an die Schlammhänge, die größte Seltsamkeit dieses unwirtlichen Landes. Eine Viertelmeile westwärts vom Jordan -- auf dem Ostufer des Stromes ist dieser Streifen viel schmäler -- verwandelte sich die platte Ebene plötzlich in eine Kette steiler, durch tiefe Einschnitte getrennter Schlammbänke. Sie sind nicht hoch, höchstens 30 bis 40 Fuß, aber die Gipfel sind so spitz, die Seiten so steil abfallend, dass der Reisende sich seinen Weg über und um dieselben mit der größten Sorgfalt bahnen muss. Der Regen hatte die Abhänge glatt wie Glas gemacht; selbst für den Fußgänger war es fast unmöglich, sich aufrecht zu halten. Mein Pferd stürzte, als ich es darüber führte, da wir uns aber glücklicherweise auf einem kleinen Grat befanden, gelang es dem Tiere, sich durch die erstaunlichsten gymnastischen Anstrengungen wieder emporzuarbeiten. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, als meine kleine Karawane aus dem Bereich der Schlammhänge war; bei anhaltendem Regen wären wir möglicherweise zu stundenlangem Warten verurteilt worden, denn wenn der Reiter in eine der schlammigen Vertiefungen stürzt, muss er darin warten, bis der Boden wieder trocken ist.
Am Flussufer war Leben. Der Boden war mit jungem Gras und gelben Gänseblümchen bedeckt, das rostfarbene Gezweig der Tamarisken zeigte die ersten Spuren des Frühlings. Ich sprengte auf die große Brücke mit dem Balkendach und den Seiten aus Gitterwerk zu -- auf dieses Tor zur Wüste, das dem Reisenden einen tiefen Eindruck hinterlässt. Da lag der freie, mit kurzem Gras bewachsene, von den Schlammbänken begrenzte große Platz, den ich so gut in der Erinnerung hatte, und -- dem Himmel sei Dank -- er war leer. Wir hatten Ursache zur Besorgnis in dieser Hinsicht gehabt. Die türkische Regierung zog in dieser Zeit alle verfügbaren Truppen zusammen, um den Aufstand in Jemen zu unterdrücken.
Die Regimenter des südlichen Syriens zogen über die Brücke nach Ammān, von wo sie mit der Bahn auf der Mekkalinie bis zu der damaligen Endstation Ma'ān, in der Nahe von Petra, befördert wurden. Von Ma'ān aus führte sie ein schrecklicher Marsch durch eine Sandwüste an die Spitze des Golfes von Akaba. Viel hundert Mann, viel tausend Kamele kamen um, ehe das Ziel erreicht war, denn auf dem ganzen Wege gibt es (so sagen die Araber) nur drei Brunnen, von denen der eine ungefähr zwei Meilen abseits der Heerstraße liegt und allen denen unauffindbar ist, die nicht mit dem Lande vertraut sind.
Wir errichteten unsere Zelte, pflöckten die Pferde an und entzündeten ein mächtiges Feuer aus Weiden- und Tamariskenholz. Es war eine ruhige, trübe Nacht, auf den Bergen regnete es, -- bei uns nicht. Die jährliche Regenmenge beläuft sich auf nur wenige Zoll im Jordantal.
Wir waren nicht allein. Die türkische Regierung erhebt nämlich von allen Brückenpassanten einen kleinen Zoll und hat zu diesem Zweck einen Wächter dort stationiert. Er wohnt in einer Lattenhütte neben dem Brückentor, und zwei oder drei zerlumpte Araber aus el Ghor teilen seine Einsamkeit. Einer derselben, ein grauhaariger Neger, sammelte Feuerholz für uns und durfte zur Belohnung die Nacht bei uns verbringen. Er war eine vergnügte Seele, dieser Mabūk. Unbekümmert darum, dass ihn die Natur mit einer außergewöhnlich hässlichen Missgestalt bedacht hatte, tanzte er munter um das Lagerfeuer. Er erzählte gern von den Soldaten, den armen Burschen, die schon auf ihrer ersten Tagereise zerlumpt, mit zerfetzten Schuhen, dazu halb verhungert bei der Brücke ankamen. Am selben Morgen war ein Tābūr (900 Mann) durchgezogen, andere wurden morgen erwartet -- wir hatten sie gerade verfehlt. „Mascha'llah!“ sagte Michaïl, „Euer Exzellenz haben Glück. Erst entrinnen Sie den Schlammhängen und nun den Redīfs.“
„Gelobt sei Gott!“, murmelte Mabūk, und von dem Tage galt es für besiegelt, dass ich unter einem glücklichen Stern reiste. Mabūk brachte uns auch die erste Kunde aus der Wüste. Unaufhörlich sprach er von Ibn er Raschīd, dem jungen Häuptling der Schammār, dem sein mächtiger Onkel Mohammed einen so unsicheren Landbesitz in Zentral-Arabien als Erbe hinterlassen. Zwei Jahre lang hatte ich nichts von Nedjd gehört -- und was machte Ibn Sa'oud, der Beherrscher von Rīad und Ibn er Raschīds Nebenbuhler? Wie stand der Krieg zwischen ihnen? Mabūk hatte allerlei gehört, es hieß, Ibn er Raschīd sei in die Enge getrieben; vielleicht zogen die Redīfs gar nach Nedjd und nicht nach Jemen, -- wer weiß? Hatten wir auch schon gehört, dass die Ajārmeh einen Scheich der Suchūr ermordet hatten, gerade als der Stamm aus dem östlichen Weideland zurückkehrte? So lief das übliche Gespräch; die Themen der Wüste -- blutige Fehde und Kameldiebstahl -- alle wurden sie erörtert, ich hätte vor Freude weinen mögen, als ich ihnen wieder lauschte. Ein wahres Babel von arabischen Dialekten herrschte an diesem Abend um mein Feuer: Michaïl sprach das gewöhnlich klingende, jeder Vornehmheit entbehrende Jerusalemisch, Habīb drückte sich, außerordentlich schnellsprechend, im Dialekt des Libanon aus, und Mohammed hatte den langgezogenen, monoton beirutischen Akzent, während die Lippen des Negers ein der schönen, kraftvollen Beduinensprache ähnelndes Idiom formulierten. Selbst den Männern fiel die Verschiedenartigkeit der Dialekte auf, und sie wandten sich an mich mit der Frage, welches der richtige sei. Ich konnte nur erwidern: „Das weiß Gott allein, denn er ist allwissend!“ eine Antwort, die mit Lachen aufgenommen wurde, obgleich ich gestehen muss, dass ich sie nur zaghaft äußerte.
Grau und windstill brach der Morgen herein. Vom Augenblick meines Erwachens an bis zum Aufbruch waren 1 ½ Stunden für Vorbereitungen festgesetzt; manchmal kamen wir zehn Minuten früher fort, manchmal leider auch später. Die Wartezeit verplauderte ich mit dem Brückenwärter, einem Jerusalemer Kind. Er vertraute meinem mitleidigen Ohr all seine Kümmernisse, die Streiche, die ihm die Ottomanische Regierung zu spielen pflegte, und die Schwere des Daseins in den heißen Sommermonaten. Und dann das Gehalt! Ein reines Nichts! Sein Einkommen war jedoch größer, als er einzugestehen beliebte, denn ich entdeckte in der Folge, dass er für jedes meiner sieben Tiere drei statt zwei Piaster gefordert hatte. Es ist sehr leicht, sich gut mit den Orientalen zu stellen, und wenn sie ein Entgelt für ihre Freundschaft verlangen, so ist es gewöhnlich sehr bescheiden. Wir überschritten den Rubikon für drei Piaster pro Kopf und schlugen den nordwärts nach Salt führenden Weg ein. Der Südliche geht nach Mādeba in Moab, der Mittlere aber nach Heschbān, wo der schurkische Sultan ibn Ali id Diāb ul Adwān, der große Scheich aller Belkaaraber, wohnt. Die Ostseite des Jordantales ist viel fruchtbarer als das Westufer. Liefern doch die schönen Höhen von Ajlun Wasser genug, um die ganze Ebene in einen Garten zu verwandeln, aber das kostbare Nass wird nicht aufgespeichert, und die Araber vom Stamme Adwān begnügen sich damit, ein wenig Korn zu erbauen. Noch war die Zeit des Blühens nicht gekommen. Ende März aber ist das Ghor ein einziger Teppich aus den verschiedenartigsten lieblichen Blüten, die alle freilich nur einen Monat lang die sengende Hitze des Tales ertragen können, ja, dieser einzige Monat sieht die Pflanzen knospen, blühen und reifen Samen tragen. Ein armseliger Araber zeigte uns den Weg. Er war gekommen, um sich den Redīfs zuzugesellen, da ein wohlhabender Einwohner von Salt ihn gegen ein Entgelt von 50 Lire als Ersatzmann gedungen hatte. Aber er kam zu spät; als er die Brücke erreichte, war sein Regiment schon vor zwei Tagen durchmarschiert. Es tat ihm leid, denn gern wäre er dem Krieg entgegengezogen, -- überdies musste er auch wahrscheinlich die 50 Lire zurückerstatten -- aber seine Tochter würde sich freuen, denn sie hatte beim Abschied geweint. Er stand still, um seinen Lederpantoffel aus dem Schlamm zu ziehen.
„Nächstes Jahr,“ sprach er, nachdem er mich wieder eingeholt, „werde ich, so Gott will, nach Amerika gehen.“
Verwundert betrachtete ich die halbnackte Gestalt, die bloßen Füße in den zerrissenen Schuhen, den zerlumpten, von den Schultern gleitenden Rock, den Wüstenturban aus einem Tuch und Schnüren von Kamelshaar hergestellt.
„Kannst du Englisch?“, fragte ich.
„Nein“, erwiderte er gelassen, „aber ich werde dann das Reisegeld erspart haben. Hier ist bei Gott kein Vorwärtskommen möglich.“
Ich fragte, was er in den Vereinigten Staaten zu tun gedenke.
„Handeln,“ lautete die Antwort, „und wenn ich 200 Lire zusammen habe, komme ich wieder.“
Dieselbe Geschichte kann man durch ganz Syrien hören. Hunderte wandern alljährlich aus und finden, wohin sie auch kommen, mitleidige Landsleute, die ihnen eine helfende Hand reichen. Sie bieten billige Waren auf den Straßen feil, schlafen unter Brücken und leben von einer Kost, die kein freier Bürger auch nur eines Blickes würdigen würde, und kehren, haben sie ihre 200 Lire erworben, in die Heimat zurück, reiche Leute in den Augen ihres Dorfes. Im Ostjordanland sind die Auswanderungsgelüste nicht so groß, aber als ich einst im Gebirge von Haurān einen Drusen nach dem Weg fragte, gab er mir im reinsten Yankeeenglisch Bescheid. Ich hielt mein Pferd an, hörte seine Geschichte und fragte schließlich, ob er wieder nach Amerika wolle. Er wandte sich um nach den Steinhütten seines Dorfes, das knietief in Schlamm und schmelzendem Schnee eingebettet lag, „Gibt's nicht!“ erwiderte er, und als ich schon weiterritt, klang noch ein fröhliches „Mein Lebtag nicht!“ hinter mir her.
Ein zweistündiger Ritt brachte uns an das Gebirge, das wir durch ein gewundenes Tal betraten. Mein Freund nannte es Wād el Hassanīyyeh, nach dem Stamme gleiches Namens. Es war voll Anemonen, weißem Ginster (rattam nennen ihn die Araber), Cyclamen, Hyazinthen und wilden Mandelbäumen. Für nutzlose Pflanzen mögen sie noch so schön sein, hat der Araber keine Namen, sie heißen alle haschīsch, Gras, während das kleinste Gewächs, das von irgendwelchem Nutzen ist, in seiner Sprache bekannt und bezeichnet ist. Der Weg, ein bloßer Saumpfad, stieg allmählich bergan. Gerade, ehe wir in die Nebelschicht eintraten, die den Gipfel des Berges einhüllte, sahen wir unter uns, nach Süden hin, das Tote Meer wie eine riesige Milchglasscheibe unter dem bleiernen Himmel daliegen. Bei richtigem Gebirgswetter, einem feuchten, dahinjagenden Nebel, erreichten wir gegen 4 Uhr Salt. Dank dem Regen, der in der vergangenen Nacht über uns weggezogen und hier niedergefallen war, hatte sich die ganze Umgebung des Dorfes in einen Sumpf verwandelt. In der Hoffnung auf ein trockneres Unterkommen zögerte ich, die Zelte aufschlagen zu lassen. Es war mein erstes Bemühen, die Wohnung Habīb Effendi Fāris' ausfindig zu machen, um dessentwillen ich nach Salt gekommen war, obgleich ich ihn nicht kannte. Auf seiner Hilfe allein beruhte die Möglichkeit, meine Reise fortzusetzen. Ich hatte nur insofern Anrecht auf seinen Beistand, als er mit der Tochter eines eingebornen Priesters in Haifa, eines würdigen alten Mannes und guten Freundes von mir, verheiratet war. Urfa am Euphrat war der Stammplatz der Familie, aber Abu Namrūd hatte lange in Salt gelebt und kannte die Wüste. Die Stunden, in denen er mich Grammatik lehren sollte, verbrachten wir größtenteils damit, den Erzählungen der Araber und seines Sohnes Namrūd zu lauschen, der mit Habīb Fāris zusammen arbeitete, und dessen Name jedem Belkaaraber bekannt war.
„Wenn Sie je in die Wüste wollen, so müssen Sie zu Namrūd gehen“, sagte Abu Namrūd. Und darum war ich jetzt hier.
Nach kurzem Fragen fand ich die Wohnung Habīb Fāris'. Ich wurde freundlich aufgenommen; Habīb war ausgegangen, Namrūd auswärts (verließ mich mein guter Stern?), aber wollte ich nicht hereinkommen und ausruhen? Das Haus war klein und voller Kinder, und noch erwog ich bei mir die Frage, ob nicht der feuchte Erdboden draußen eine bessere Ruhestatt darbieten möchte, als plötzlich ein schöner, alter, ganz arabisch gekleideter Mann erschien mit der Erklärung, dass er, und kein anderer mich beherbergen würde, mein Pferd am Zügel nahm und mich mit sich führte. Das Tier wurde in der Karawanserei eingestellt, ich stieg eine hohe, schlüpfrige Treppe hinauf und betrat einen steingepflasterten Hof. Jūsef Effendi eilte voraus und öffnete die Tür seines Gastzimmers. Fußboden und Diwan waren mit dicken Teppichen belegt, die Fenster blitzten, wenn sie auch viele zerbrochene Scheiben aufwiesen, eine europäische Chiffonniere stand an der Wand: ich sah mich in meinen Erwartungen weit übertroffen. Einen Augenblick später war ich ganz heimisch, trank Jūsefs Kaffee und aß meinen eignen Kuchen dazu.
Jūsef Effendi Sukkar (Friede sei mit ihm!) ist Christ und einer der reichsten Bewohner von Salt. Er ist ein sehr lakonischer Mann, sucht aber als Wirt seinesgleichen. Er tischte mir ein ausgezeichnetes Abendessen auf, dessen Reste Michaïl vorgesetzt wurden, nachdem ich mich gütlich getan hatte. So sorgte er zwar für meine leiblichen Bedürfnisse, konnte oder wollte aber nichts tun, um meine Besorgnisse bezüglich der Weiterreise zu zerstreuen. Glücklicherweise erschienen in diesem Augenblick Habīb Fāris und seine Schwägerin Pauline, eine alte Bekannte von mir, sowie mehrere andere Personen, die sich alle die Ehre geben wollten, den Abend mit mir zu verplaudern. („Behüte, die Ehre ist ganz auf meiner Seite!“) Wir ließen uns nieder zu Kaffee, dem bitteren, schwarzen Kaffee der Araber, der jeden Nektar übertrifft. Die Tasse wird dir gereicht mit einem „Geruhe anzunehmen!“, leer gibst du sie zurück und murmelst dabei „Langes Leben dir!“ Während du trinkst, ruft dir eins zu „Gesundheit!“, und du erwiderst „Deinem Herzen!“ Als die Tassen ein- oder zweimal herumgegeben und alle erforderlichen Höflichkeitsbezeigungen ausgetauscht waren, brachte ich die Rede auf das Geschäftliche. Wie konnte ich das drusische Gebirge erreichen? Die Regierung würde mir wahrscheinlich die Erlaubnis verweigern, bei Ammān stand ein Militärposten am Eingang zur Wüste, und in Bosra kannte man mich, denn dort war ich ihnen vor fünf Jahren durch die Finger geschlüpft, ein Kunststück, das mir zum zweiten Mal schwerlich gelingen würde. Habīb dachte nach, und schließlich schmiedeten wir einen Plan. Er wollte mich am andern Morgen nach Tneib, am Rande der Wüste, schicken, wo seine Kornfelder lagen, und wo ich Namrūd finden würde. Der mochte einen der großen Stämme benachrichtigen, unter dessen Schutz und Geleit konnte ich dann völlig sicher in die Berge reisen. Jūsefs zwei Söhnchen hörten mit erstaunten Augen zu und brachten mir am Schlusse der Unterhaltung ein Stück Zeitung mit einer Karte von Amerika. Darauf zeigte ich ihnen meine Landkarten und erzählte ihnen, wie groß und schön die Welt sei, bis die Gesellschaft gegen zehn Uhr aufbrach, und mein Wirt Decken für meine Lagerstatt auszubreiten begann. Erst jetzt bekam ich meine Wirtin zu sehen. Sie war eine außerordentlich schöne Frau, groß und bleich, mit einem ovalen Gesicht und großen, sternengleichen Augen. Sie trug sich arabisch: ein enges, dunkelblaues Gewand schlug beim Gehen um ihre bloßen Knöchel, ein dunkelblauer Schleier war mit einem roten Tuch um die Stirn befestigt und fiel lang über ihren Rücken hinunter, bis fast auf die Erde. Nach der Weise der Beduinenfrauen waren ihr auf Kinn und Hals zierliche Muster in Indigofarbe tätowiert. Sie brachte Wasser und goss es mir über die Hände; ihre große, stattliche Gestalt bewegte sich schweigend im Zimmer und verschwand, nachdem alle Obliegenheiten erfüllt waren, ebenso ruhig wieder, wie sie gekommen. Ich sah sie nicht noch einmal.
„Sie trat herein und grüßte mich,“ sprach jener Dichter, der in Mekka gefangen lag, „dann erhob sie sich, um Abschied zu nehmen, und als sie meinen Blicken entschwand, folgte ihr meine Seele.“ Niemand darf Jūsefs Weib sehen. Obgleich er ein Christ ist, hält er sie doch in strengerer Abgeschlossenheit, als die Muselmänner ihre Frauen, -- und vielleicht tut er recht daran.
An meine Fenster schlug der Regen; während ich mich auf mein Lager streckte, klang mir Michaïls Ausruf in den Ohren: „Mascha'llah! Ew.
Exzellenz haben Glück!“
Zweites Kapitel.
Salt ist eine wohlhabende Gemeinde von über 10000 Einwohnern, die zur Hälfte Christen sind. Es liegt in einer reichen, um ihrer Trauben und Pfirsiche willen bekannten Gegend; schon im 14. Jahrhundert tut der Geograph Abu'l Fīda seiner Gärten Erwähnung. Auf dem Hügel liegt über den dichtgedrängten Dächern ein zerfallenes Kastell, welcher Zeit entstammend, weiß ich nicht. Die Bewohner glauben an ein sehr hohes Alter der Stadt, ja die Christen behaupten, in Salt sei eine der ersten Gläubigengemeinden gewesen; es geht sogar die Sage, dass Christus selbst hier das Evangelium gepredigt habe. Obgleich die Aprikosenbäume noch nichts weiter als ihre kahlen Zweige zeigten, trug doch das ganze Tal den Stempel freundlicher Wohlhabenheit, als ich mit Habīb Fāris durchritt, der sein Pferd bestiegen hatte, um mich auf den rechten Weg zu bringen. Er hatte auch seinen Anteil an den Weinbergen und Aprikosengärten und schmunzelte geschmeichelt, als ich mich lobend über sie aussprach. Wer hätte auch an einem solchen Morgen nicht schmunzeln sollen? Die Sonne schien, blitzender Frost lag auf der Erde, und die Luft zeigte jene durchsichtige Klarheit, die nur an hellen Wintertagen nach einem Regen zu beobachten ist. Aber es war nicht nur ein allgemeines Gefühl des Wohlwollens, dem meine anerkennenden Worte entsprangen: die Bewohner von Salt und Mādeba sind ein kluges, fleißiges Völkchen, das jedes Lob verdient. In den fünf Jahren, wo ich die Gegend nicht besuchte, hatten sie die Grenze des Ackerlandes um die Breite eines zweistündigen Rittes nach Osten hin vorgeschoben und den Wert des Bodens so unbestreitbar bewiesen, dass nach der Eröffnung der Haddjbahn der Sultan einen großen, im Süden bis Ma'ān reichenden Landstrich für sich reserviert hat, den er in eine königliche Farm umzuwandeln gedenkt. Er und seine Pächter werden Reichtümer ernten, denn wenn auch nur ein mäßig guter Regent, so ist der Sultan doch ein vorzüglicher Landwirt.
Eine halbe Stunde hinter Salt verabschiedete sich Habīb und überließ mich der Obhut seines Knechtes Jūsef, eines kräftigen Menschen, der mit seiner Holzkeule (Gunwā nennen sie die Araber) über der Schulter neben mir dahinschritt. Wir zogen durch die weiten, baumlosen, unbewohnten, ja fast unbebauten Täler, die die Belkaebene umgeben, und vorbei an der Öffnung des Wādi Sīr, durch welches man, immer durch die schönsten Eichenwälder reitend, bis in das Jordantal hinabgelangen kann. Auch die Berge würden hier Bäume tragen, wenn die Kohlenbrenner sie nur wachsen ließen -- wir fanden manches Eichen- und Schwarzdorndickicht auf unserm Wege --, aber ich möchte gar nichts geändert haben an dem herrlichen Ostjordanland. Zwei Menschenalter später wird es im Schmucke der Kornfelder stehen und mit Dörfern übersät sein; die Wasser des Wādi Sīr werden Mühlräder treiben, und man wird selbst Chausseen bauen, aber -- dem Himmel sei Dank -- ich werde das alles nicht sehen müssen. Solang ich lebe, wird das Hochland bleiben, als was es Omar Khayyām besingt: „Verstreuten Grüns ein schmales Band, trennt es die Wüste von dem Ackerland.“
Öde und menschenleer wird es auch ferner sein; nur hie und da wird ein einzelner Hirt, auf die langläufige Flinte gelehnt, mitten in seiner Herde stehen, und wenn ich den Reitersmann, der so selten nur sein Roß durch die Berge lenkt, frage, woher er kommt, wird er noch immer antworten: „Möge dir die Welt noch Raum genug bieten! Von den Arabern komme ich.“
Und hin zu den Arabern führte uns unsere Reise. In der Wüste gibt es weder Beduinen -- alle Zeltbewohner heißen Araber (mit einem kräftigen Rollen des Gutturallautes) -- noch auch Zelte, sondern nur Häuser, manchmal auch „Haarhäuser“, wenn eine nähere Bestimmung nötig ist, sonst schlechthin „Häuser“, eine Bezeichnung, die nur die äußerste Verachtung alles dessen erfinden konnte, was zu einem Haus gehört; denn mit einem solchen haben diese Zelte nichts gemeinsam als höchstens das Dach aus schwarzen Ziegenhaaren. Man kann Araber sein, auch wenn man zwischen Mauern wohnt. Die Leute von Salt zählen samt den Abādeh, den Da'dja und den Hassaniyyeh und mehreren anderen die große Schar der Adwān bildenden Arabern, zu den Belkastämmen. Zwei mächtige Stämme streiten um die Oberherrschaft in der Syrischen Wüste, die Beni Sachr und die Anazeh. Es besteht eine traditionelle, jetzt freilich durch bedauerliche Vorkommnisse getrübte Freundschaft zwischen den Suchūr und den Belkaarabern, und wahrscheinlich deshalb wurde mir hier erzählt, dass die Anazeh zwar die an Zahl überlegenere, an Mut aber die bei weitem untergeordnetere der beiden Parteien sei. Mit einem Sohne Talāl ul Fāiz', des Beherrschers aller Beni Sachr, verknüpft mich sozusagen eine Grußbekanntschaft. Vor fünf Jahren, aber einen Monat später, also gerade zu der Zeit, wo der ganze Stamm die heißen östlichen Weideländer verlässt und jordanwärts zieht, stieß ich gerade in dieser Gegend auf ihn. In Begleitung eines zirkassischen Polizeisoldaten ritt ich von Mādeba nach Mschitta -- es war, ehe die Deutschen die mit Steinbildwerk versehene Fassade von dem prächtigen Gebäude ablösten. Als wir die mit den Herden und schwarzen Zelten der Suchūr bedeckte Ebene kreuzten, kamen drei bis an die Zähne bewaffnete Reiter mit finsteren Brauen und drohenden Mienen auf uns zu, um uns den Weg abzuschneiden. Aus der Ferne schon riefen sie uns ihren Gruß zu, wandten aber um und ritten langsam zurück, sobald sie des Soldaten ansichtig wurden. Der Zirkassier lachte:
„Das war Scheich Fāiz“, sagte er, „Talāls Sohn. Wie die Schafe, wāllah! Wie die Schafe laufen sie, wenn sie einen von uns erblicken!“
Ich kenne die Anazeh nicht, da ihre Winterwohnplätze mehr nach dem Euphrat zu liegen, aber unbeschadet meiner sonstigen Hochachtung für die Suchūr, glaube ich, dass jene, ihre Nebenbuhler, die wahren Aristokraten der Wüste sind. Ihr Herrscherhaus, die Beni Scha'alān, trägt den stolzesten Namen, und ihre Pferde sind die besten in ganz Arabien; sogar die Schammār, Ibn er Raschīds Leute, kaufen sie gern, um ihre eigne Zucht damit aufzubessern.
Aus dem tief eingeschnittenen, das Jordantal überragenden Gebirge kamen wir in ein flaches Hügelland, in dem zahlreiche verfallene Plätze liegen. Eine Viertelstunde vor den an der Quelle des Wādi Sīr befindlichen Ruinen stießen wir auf eine ansehnliche Menge Mauerwerk und eine Zisterne, welche die Araber Birket Umm el Amūd (Brunnen der Mutter der Säule) nennen. Jūsef berichtete, dass dieser Name von einer Säule herrühre, die früher inmitten des Wassers gestanden; ein Araber schoss nach ihr und zerstörte sie, und nun liegen ihre Trümmer auf dem Grunde der Zisterne. Der Hügel (oder Tell, um ihm dem heimischen Namen zu geben) von Amēreh ist ganz mit Ruinen bedeckt, und weiterhin, in Jadūdeh, findet man Felsengräber und Sarkophage am Rande der Brunnen. Der ganze Saum der Wüste ist mit ähnlichen Zeugen einer vergangenen Bevölkerung übersät; wir finden Dörfer aus dem 5. und 6. Jahrhundert, der Zeit, wo Mādeba eine reiche, blühende Christenstadt war, ja einige entstammen zweifellos einer noch früheren, vielleicht vorrömischen Periode.
In Jadūdeh hat ein Christ aus Salt, der größte Kornproduzent der Gegend, seinen Wohnsitz aufgeschlagen; er bewohnt ein einfaches Landhaus auf der Spitze des Hügels. Man rechnet ihn zu den energischen Bahnbrechern, die bemüht sind, die Grenzen der Kultur immer weiter hinauszuschieben. Bei Jadūdeh verließen wir das Hügelland und betraten die endlose, mit spärlichem Grün bewachsene Ebene. Hie und da ein kegeliger Hügel oder ein niedriger Höhenzug, dann wieder weite, unbegrenzte Ebene. Ruhevoll dem Auge und doch nie monoton liegt sie, in die magische Glut des winterlichen Sonnenuntergangs getaucht; auf den sanft gewölbten Erhöhungen rastet noch das Licht, die leichten Bodensenkungen bergen schon die Schatten der Nacht, und über dem allen breitet sich der weite Himmelsdom aus, der Wüste und Meer gleichermaßen überwölbt. Die erste größere Erhebung ist der Tneib.
Wir erreichten ihn nach einem neunstündigen Marsch um ½ 6 Uhr, gerade als die Sonne sank, und schlugen unsere Zelte an der südlichen Berglehne auf. Der ganze Abhang war voller Ruinen: niedrige Mauern aus rohbehauenen Steinen ohne Mörtel, in Felsen gehauene Zisternen, deren einige ursprünglich jedenfalls weniger zu Wasser- als zu Kornbehältern benutzt worden, welchem Zweck sie auch jetzt noch dienen. Namrūd war zum Besuch eines benachbarten Landwirtes geritten, einer seiner Männer aber eilte sofort, ihn von meiner Ankunft zu benachrichtigen, und gegen 10 Uhr abends erschien er im Glanze der frostblitzenden Sterne mit vielen Freudenbezeigungen und der Versicherung, dass meine Wünsche leicht zu erfüllen seien. So legte ich mich zur Ruhe, eingehüllt in das kalte Schweigen der Wüste, und erwachte am andern Morgen zu einem Tage voll Sonnenschein und guter Aussichten.
Zunächst musste nun zu den Arabern geschickt werden. Nach einer Beratung entschieden wir uns für die Da'dja, einen Stamm der Belkaaraber, als für die nächsten und wahrscheinlich geeignetsten, und ein Bote wurde in ihr Lager entsandt. Wir verbrachten den Morgen mit Besichtigung der Ruinen und Betrachtung einer Menge Kupfermünzen, die Namrūds Pflugschar zu Tage gefördert. Lauter römische; eine zeigte undeutlich die Züge Konstantins, andre waren älter, keine entstammte der jüngeren byzantinischen Periode oder der Zeit der Kreuzzüge. Soweit die Münzfunde Zeugnis ablegen können, liegt Tneib seit dem Eindringen der Araber verödet. Namrūd hat die Totenstadt entdeckt, die Gräber aber leer gefunden; wahrscheinlich wurden sie schon vor Jahrhunderten ausgeplündert. Sie waren zisternenartig und in die Felsen gehauen.
Zwischen zwei massigen Steinsäulen ein schmaler Eingang dicht über dem Erdboden, einige wenige Vorsprünge zum Hinabsteigen in den Seitenwänden, im unteren Raume Nischen, die in übereinander liegenden Reihen rund um die Mauern liefen. Fast am Fuße des Südabhanges sahen wir die Grundmauern eines Gebäudes, das eine Kirche gewesen sein mochte. Aber das alles war nur ein zu armseliges Ergebnis für die Forschung eines ganzen Tages; wir machten deshalb am goldenen Nachmittag einen zweistündigen Ritt nordwärts in ein breites, zwischen niederen Hängen liegendes Tal. Um den ganzen Rand desselben lagen in Zwischenräumen Ruinen, und nach Osten zu standen verfallene Mauern auch in der Mitte des Tales, -- Namrūd nannte die Stelle Kuseir es Sahl, die kleine Wüstenburg. Unser Ziel aber war eine kleine Gruppe von Gebirgen am Westende, Chureibet es Suk. Zunächst kamen wir an ein kleines, halb im Sand begrabenes Bauwerk (41 Fuß zu 39 Fuß 8 Zoll, größte Ausdehnung von Ost nach West). Zwei Sarkophage zeigten an, dass es ein Mausoleum gewesen. In der Westwand war ein bogengeschmücktes Tor; den Pfeilerbogen krönte ein flaches Gesims. In der Höhe des Bogens verschmälerten sich die Mauern um einen kleinen Vorsprung, und etwas höher lief eine geschweifte Kranzleiste. Ein paar Hundert Meter westwärts von dem Kasr oder der Burg (die Araber benennen die meisten Ruinen Burg oder Kloster) liegt ein zerfallener Tempel, der augenscheinlich in irgendeiner Zeit einem anderen Zwecke gedient hat, als dem ihm von der Natur zukommenden, denn er zeigte eingestürzte Mauern um die beiden Reihen von je sieben Säulen und unerklärliche Querwände an der westlichen Seite des Säulenganges. Dahinter schien ein doppelter Hof gelegen zu haben, und noch weiter nach Westen hin befand sich ein ganzer Komplex von zerfallenem Mauerwerk. Das Tor sah nach Osten hin, seine Pfeiler zeigten feine Steinmeißelungen: ein Band, eine Palmette, ein zweites glattes Band, eine Weinranke, eine Haspel und Weife, einen Pfeil und eine zweite Palmette auf der oberen Leiste.
Das Ganze ähnelte außerordentlich den Kunstwerken in Palmyra -- es konnte kaum den Vergleich aushalten mit dem Steinbildwerk in Mahitta, war überhaupt nüchterner und den klassischen Mustern näher verwandt als jene Architektur. Nördlich vom Tempel stand auf einer kleinen Reihenerhebung noch eine Ruine, ein zweites Mausoleum. Es war ein längliches Rechteck aus großen, sorgsam ohne Mörtel gefügten Steinen. An der südöstlichen Ecke führte eine Treppe in eine Art Vorzimmer, das dank dem abfallenden Abhang in gleicher Höhe mit der Ostseite lag. An der Außenwand dieses Vorraums standen Säulenstümpfe, vermutlich die Überreste eines schmalen Säulenganges, der die Ostfassade geschmückt. Sechs Sarkophage standen längs der noch vorhandenen Mauern, je zwei an der Nord-, Süd- und Westwand. Über der Basis der zu beiden Seiten der Treppe befindlichen Säulen lief ein Fries, der einen kühnen Torus zwischen beiden Wänden aufwies, und dasselbe Motiv wiederholte sich auf der Innenseite der Sarkophage. Die Stützmauer auf der Südseite zeigte zwei Vorsprünge, im Übrigen war das Gebäude ganz einfach, nur einige der umherliegenden Fragmente schmückte ein lockeres Weinrankenmuster.
Dieses Mausoleum erinnert an das Pyramidengrab, das in Nordsyrien vielfach vorkommt, wenn ich auch kein zweites so weit südlich gesehen habe. Es mag vielleicht einst dem schönen Denkmal mit der Säulenfassade geähnelt haben, das eine der Sehenswürdigkeiten des südlichen Dāna ist, und die Fragmente von Weinrebenskulptur waren vielleicht Teile der Krönung.