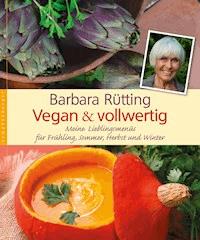19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ob Theater, Film oder Politik: eine der ungewöhnlichsten Frauen Deutschlands blickt auf über acht Jahrzehnte zurück. 'Aus Ihnen wird mal was', prophezeite ihr ein bereits berühmter Schauspieler, als sie bei ihrem ersten Auftritt als Komparsin über den Saum ihres geliehenen Abendkleides stolperte und der Länge nach hinfiel. Und er sollte recht behalten. Doch aus Barbara Rütting wurde nicht nur 'etwas', nein, was sie in mittlerweile über acht Jahrzehnten erlebt und durchlebt hat, würde bei anderen Menschen locker für mehrere Biografien reichen. Hätte sich das die kleine Waltraut Goltz (so Barbara Rüttings Taufname) träumen lassen, damals, in den 30er-Jahren in Wietstock an der Nuthe, einem idyllisch-verschlafenen 300-Seelen-Dorf im Brandenburgischen? Oder einige Jahre später, als nicht nur ihre Welt in Trümmern lag und die 16-Jährige ihr erstes eigenes 'Zuhause' in einem Bunker bezog? Mal heiter, mal melancholisch, aber immer ehrlich – die außergewöhnlic Autobiografie einer Frau, die nicht im Gestern, sondern im Heute lebt und von sich sagt: 'Noch nie habe ich so gerne gelebt, so dankbar.'
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
© Manuela Liebler
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.herbig-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook: 2015 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagfoto: Manuela Liebler
Satz und eBook-Produktion: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-7766-8218-2
Inhalt
Vorwort
Wie alles begann ...
Neuanfang in Berlin
Immer unterwegs – irgendwohin
Zurück aufs Land
Träumen allein genügt nicht
Aber die Maulwürfin buddelt weiter
Als Abgeordnete im Bayerischen Landtag
Ich bin angekommen!
Register
Vorwort
Weil ich schon so lange lebe, also eine sogenannte Zeitzeugin bin, höre ich oft, gerade von jungen Menschen: »Wie war denn das damals? Schreib das doch mal auf!« Ich habe mich lange davor gedrückt, denn es war klar, dass ich damit sehr viel von mir preisgeben müsste. Eine solche Bestandsaufnahme hat ehrlich zu sein – wenn schon, denn schon. Hier ist sie also. Wenn Sie mögen, nehmen Sie teil an diesem turbulenten Leben einer ewig Suchenden – einem Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, seinen Schmerzen und seinem Glück. Manche Episoden werden Sie aus meinen früheren Büchern kennen, sie gehören nun mal dazu.
Da will ich hin!
© Privatarchiv Barbara Rütting
Auch dieses Buch soll Mut machen, trotz aller Stolpersteine nicht aufzugeben, sondern als kleines, doch wichtiges Glied eines großen Ganzen unverdrossen daran mitzuarbeiten, dass diese Welt ein bisschen glücklicher wird. Eine bessere Welt ist möglich! Trotz Pleiten, Pech und Pannen kann ich heute sagen: Was bin ich doch für ein Glückspilz!
Wie alles begann …
Wietstock an der Nuthe
Klein-Waltraut träumt im Apfelbaum. In Wietstock an der Nuthe.
Wietstock an der Nuthe – das bedeutet für mich eine unbeschwerte, glückliche Kindheit mit vier jüngeren Geschwistern, drei Brüdern und einer Schwester. Vater Richard und Mutter Johanna waren Lehrer an der Zwergschule des kleinen Dorfes mit knapp dreihundert Einwohnern, alle Kinder von sechs bis vierzehn Jahren saßen in einem Raum. Aufregend und absolut angstfrei der Unterricht. Kein Kind, das sich nicht auf die Schule freute. Gelernt wurde, ohne dass man es merkte. Vater war ein großartiger Lehrer, damals schon eine Mischung aus Waldorf- und Montessori-Pädagoge. Beglückend die Arbeit im Kräutergarten der Schule, die Wanderungen auf Fontanes Spuren durch die brandenburgische Landschaft, der Duft von sonnentrockenen Kiefernnadeln in der Nase, Indianerspiele am Rötepfuhl, die abendliche Hausmusik – Vater spielte Geige, Mutter Klavier, am liebsten Schubert, wir Kinder Flöte.
Unser Leben war einfach und gesund. Das Gemüse wuchs im eigenen Garten, Vater schleuderte den Honig unserer Bienen. Da war der Duft von Bienenwachs und Jelängerjelieber, meiner Lieblingspflanze auch heute noch, die sich an der Geißblattlaube emporrankte, der Geruch von Teltower Rübchen. Und natürlich Mutters ansteckendes Lachen. Sie konnte lachen, bis ihr die Tränen kamen, das habe ich von ihr geerbt.
Was wir alles nicht hatten – und gar nicht vermissten! Von einem WC – water closet – konnte nicht die Rede sein, es gab nur ein Plumpsklo auf dem Hof. Keine Waschmaschine – die Wäsche wurde in der Waschküche in einem großen, mit Holz beheizten Kessel gewaschen, in dem auch der Zuckerrübensirup gekocht wurde. Es gab keine Spülmaschine, kein Telefon, keinen Fernsehapparat, kein Auto, meilenweit kein Kino, zu dritt besaßen wir größeren Kinder ein Fahrrad. Wenn ich aus meinen Kleidchen herausgewachsen war, nähte Mutter aus zwei alten ein neues.
Waltraut mit Puppe Ida
© Privatarchiv Barbara Rütting
Alle vierzehn Tage kam ein Friseur ins Dorf, um den Leuten die Haare zu schneiden. Da gab es die Leinölfrau und den Plundermann mit Schimmel und Planwagen, der allen möglichen Nähkram verkaufte; eine Frau, die mit einer riesigen Kiepe auf dem Rücken daherwandelte, und Bettler, die ihr Hab und Gut im Kinderwagen mit sich führten, aber sehr zufrieden schienen.
Werde ich gefragt, wo ich geboren wurde, betone ich jedes Mal: Nicht in Wietstock an der Dosse, nein, in Wietstock am Nuthegraben, bitte!
Wietstock, das bedeutete auch Paddelbootfahrten auf dieser Nuthe, quakende Frösche und Störche – ja, damals gab es noch Störche! Und den ersten Applaus als Schauspielerin erntete ich sogar bei einer Schulaufführung in der Rolle einer Störchin. Im Stechschritt, mit schwarzweißem Leibchen, die dünnen Beinchen in roten Strümpfen, stolzierte ich über die Bühne und sang dazu:
Auf unsrer Wiese gehet was,
watet durch die Sümpfe.
Es hat ein schwarzweiß Röcklein an
und trägt rote Strümpfe.
Fängt die Frösche, schnapp, schnapp, schnapp.
Klappert lustig, klapperdiklapp.
Wer kann das erraten?
Aber auch der Friedhof gleich neben unserem Schulhaus sollte mein Leben prägen und mir für immer das Wissen um die Vergänglichkeit alles Lebendigen in die Seele brennen, die Allgegenwart des Todes. Schon das kleine Mädchen erlebte die vielen Beerdigungen mit. Und da das kleine Mädchen im Zeichen Skorpion geboren wurde, fiel sein Geburtstag häufig auf den Totensonntag oder den Buß- und Bettag, ein Tag, an dem es immer ungemütlich nasskalt ist, schwermütiger November eben.
Vielleicht saß ich deshalb so gern auf meinem Lieblingsplatz in unserem großen Apfelbaum und träumte mich in die große weite Welt. Die lernte ich dann ja auch gründlich kennen, die große weite Welt. Und habe mich oft zurückgesehnt nach der kleinen Welt, nach Wietstock an der Nuthe.
Die Dreijährige
© Privatarchiv Barbara Rütting
Vater war ein so wunderbarer Lehrer, ist aber Nationalsozialist geworden. Aus Blauäugigkeit vermutlich. Unsere sanfte Mutter hat das offenbar nicht verhindern können. Ich habe nicht mehr mit ihm über diesen seinen katastrophalen und verhängnisvollen Irrtum sprechen können, der ihn schließlich das Leben gekostet hat. Die Trauer darüber wird mich nie verlassen.
Elf Jahre alt war ich, als der Krieg ausbrach. Drei Jahre lang hatte ich voller Stolz die Uniform meiner Jungmädel-Zugehörigkeit getragen, als Klassensprecherin gegen die Fortsetzung des Englischunterrichts protestiert: Wir wollten doch nicht die Sprache unserer Feinde lernen!
Aus der Kinderbeilage einer Hausfrauen-Fleischer-Zeitung hatte ich ein Gedicht abgeschrieben. Das betete ich jeden Abend vor dem Einschlafen. Die zweite Strophe lautete:
Doch das schönste Engelein
Mit dem lichten Gottesschein
Und dem silbernen Gefieder
Sende unserm Hitler nieder.
Es behüte seinen Schlummer
Und verscheuch ihm allen Kummer,
Dass er morgens froh erwache
Und sein Deutschland glücklich mache.
Lieber Gott, mit starker Hand
Schütze unser deutsches Land.
Amen.
Es folgte eine Gewissensfrage, die ich mir selbst auferlegt hatte. Nacheinander stellte ich mir meine gesamte Familie vor, die ich sehr liebte: Vater, Mutter und vier kleinere Geschwister: Wäre ich bereit, sie alle für »Führer und Vaterland« zu opfern, wenn es sein müsste? Ich war bereit, entschied ich jeden Abend aufs Neue.
Der Vater meines Vaters, ein armer Berliner Schuhmacher, war an Schwindsucht gestorben. Auf dem Totenbett soll er seinen Kindern gesagt haben: »Lasst euch nie mit Juden ein.« Vater hatte sich autodidaktisch zum Volksschullehrer emporgearbeitet, war aus der Kirche aus- und in die Partei der Nationalsozialisten eingetreten. Die Misere zu Hause hatte in ihm Sehnsucht nach dem Lande, nach einem gesunden »Blut-und-Boden-Leben« erweckt. Die Partei versprach, ihm das zu bieten. Vater rauchte und trank nicht. Er schrieb ein Buch, das er im Selbstverlag herausbrachte: Pädagogik als angewandte Biologie. Er widmete das Buch »Dem Führer« – doch die Partei verbot es: wegen kommunistischen Gedankenguts. Er vertrat darin die Ansicht, erworbene Eigenschaften seien vererbbar und die Umwelt bestimme den Charakter des Menschen. Das passte den Rassenfanatikern nicht.
Meine Mutter: aus großbürgerlicher Familie, wahrscheinlich schon deshalb gegen die Partei, aber auch aus religiösen Gründen. Sie ging zur Kirche, spielte sonntags in der Dorfkirche die Orgel. Wenn es zu Hause Differenzen gab, dann nur wegen der Partei. Ich liebte meinen Vater abgöttisch und übernahm blindlings jede seiner Ansichten. Immer. Als Mutter eines Nachts wieder einmal alle ihre fünf Kinder in den Luftschutzraum gebracht hatte und die Bomben niederhagelten, sagte sie verzweifelt: »Wenn bloß der Krieg zu Ende wäre, ganz egal wie!«
Ich weiß nicht mehr, habe ich es nur gedacht oder habe ich ihr geantwortet: »Für das, was du da eben gesagt hast, müsste man dich anzeigen.« Ich habe sie nicht angezeigt. Aber gedacht habe ich es …
Dass die Juden unerwünscht waren, wusste ich. Ich hatte noch nie einen Juden gesehen. Bei uns im Dorf gab es keine, doch ein benachbartes Gut gehörte einer jüdischen Familie. Deren Tochter war ungefähr so alt wie ich, ging aber nicht mit uns zur Schule, sondern wurde von einer Erzieherin unterrichtet. Ich kannte das Mädchen nicht. Eines Tages marschierten wir in unseren Uniformen am Gut vorbei, die anderen Kinder wollten ein Lied singen, in dem die Stelle vorkam: »die Juden heraus«, was Vater aber nicht erlaubte. Ich war froh darüber, aber gleichzeitig verstört bei der Vorstellung, wir hätten das Lied gesungen, und das kleine jüdische Mädchen hätte uns gehört. Es tat mir leid. Später war die Familie nicht mehr da. Nach England gefahren, hieß es …
Das Kind ist nicht vorzuzeigen
Ein heißer Sommertag, der Duft von sonnentrockenen Kiefernnadeln und Schokoladensuppe …: Vater und wir Kinder sitzen in der Geißblattlaube. Mutter schöpft aus der großen Suppenterrine. Sie lacht, sie hat eine rosa Bluse an, die weißen, duftigen Schneeklößchen wippen auf der dunkelbraunen Schokoladensuppe. Mutter rutschte schon mal die Hand aus, zum Beispiel, als mein Bruder Reinhard alle Tierfotos aus Vaters Brehms Tierleben riss oder mit anderen Kindern unter der Autobahnbrücke beim Rauchen ertappt wurde. Vater dagegen erzog uns bereits antiautoritär, wie man heute sagen würde.
Familie Goltz: hintere Reihe (von links): Mutter Johanna mit Volkmar, Oma Minna, Onkel Achim, Vater Richard; vorne: Waltraut, Hartmut, Reinhard
© Privatarchiv Barbara Rütting
Aber einmal bekam auch ich, die Artige, sein Liebling, von ihm eine Ohrfeige. Schuld war der Schulrat. Der hieß Radtke, war rund, rotgesichtig, glatzköpfig und eigentlich nett. Er kam einmal im Jahr, um sich von den Fortschritten der Schüler zu überzeugen. Jedes Mal war das ganze Dorf in heller Aufregung. An jenem Tag hatte sich Vater vor lauter Nervosität beim Rasieren geschnitten und versuchte nun, sich die Krawatte zu binden. Auch das gelang wohl nicht so recht. Mutter sauste umher und deckte in eben dieser Geißblattlaube für den Schulrat den Kaffeetisch, mit ihrer eingemachten Leberwurst, selbst gebackenem Brot, unserem Lindenhonig, von Vater geschleudert. Mir hatte man ein rot kariertes Kleidchen angezogen, aber der Schlüpfer war zu lang und schaute unter dem Kleidersaum hervor, einer dieser üppigen Barchentschlüpfer mit einem Gummiband oben und einem unten an jedem Bein. Wir hatten noch nicht so hübsche Sachen wie die Kinder heute, keine Strumpfhosen – unsere Strümpfe waren aus brauner, kratzender Wolle, die Strumpfhalter aus einem schwarzen Stück Gummi mit mehreren Löchern drin. In eins der Löcher wurde der am Strumpf angenähte Knopf gehakt. Oft waren die Strümpfe an den Knien gestopft, im schlimmsten Fall mit andersfarbiger Stopfwolle. Ich maulte wegen des unter dem Kleidchen hervorlugenden Schlüpfers, maulte und maulte, bis Vater, sonst sehr geduldig, die Hand ausrutschte. Diese berühmte Ohrfeige fiel so unglücklich aus, dass mir die Lippe aufsprang, das Blut hervorschoss, Mund und Backe fürchterlich anschwollen. Eine schlechte Reklame für einen Pädagogen! Vater entschied: »Das Kind ist nicht vorzuzeigen.«
Mein Vater Richard
© Privatarchiv Barbara Rütting
Ich musste vor dem Schulrat versteckt werden. Unser Dienstmädchen führte mich in den Wald. Da gingen wir erst einmal spazieren und setzten uns dann auf zwei Baumstümpfe. Wir durften erst zurückkommen, wenn Vater, auf dem Dach des Schulhauses stehend, eine kleine Glocke bimmeln lassen würde, die er sich extra beim Nachbarn ausborgen musste. Damit pflegte Frau Lehmann ihre Knechte und Mägde vom Feld nach Hause zu rufen, wenn das Essen fertig war. Es dauerte, bis der Schulrat endlich wieder weg war. Nach der Inspektion von Schülern und Schülerinnen, die verhältnismäßig schnell über die Bühne gegangen war, hatte sich der Schulrat endlos in der Geißblattlaube unseres Gartens erholen müssen.
Mein schöner zärtlicher Vater. Der später weinend aus dem Zimmer ging, als ich meinen ersten Liebesbrief bekam.
Edwin und geschmorte Gurken
Er war in der Schule eine Klasse über mir. Er war blond und gab mir den ersten Kuss. Auf einer Jägerkanzel in der Nähe der Schule, am Waldrand.
Ich verpasste den Zug, mit dem mein Bruder Hartmut und ich jeden Tag nach Hause fuhren. Um 17:30 Uhr kam ich heim und hatte trotzdem keinen Hunger. Wegen Edwin – und weil ich aufgewärmte Schmorgurken vom Mittag bekam; das einzige Gericht, außer Kartoffelpuffern, das ich nicht leiden konnte.
Edwin Oloff – meine Jugendliebe
© Privatarchiv Barbara Rütting
Edwin wurde kurz danach als Flakhelfer eingezogen. Er schickte mir ein Foto von sich in Marineuniform … und noch ein paar Briefe. Dann habe ich nichts mehr von ihm gehört.
Lehrers Kinder klauen Hafer
Mit dem Hafer konnte ich mich später als Erwachsene nur langsam anfreunden, denn ich hatte ihn in grausliger Erinnerung. Meine jüngeren Geschwister und ich mussten während der Kriegsjahre auf den Getreidefeldern der Bauern »stoppeln«, das heißt, liegen gebliebene Ähren auflesen. Vater schlug dann die Haferkörner heraus, Mutter mahlte sie in der Kaffeemühle, und aus dem so entstandenen Mehl wurde – Milch, Honig oder Zucker gab’s schon längst nicht mehr – mit Wasser und Salz eine ziemlich scheußliche Suppe gekocht, die wir Kinder hassten, weil die ganzen Getreidespelzen mit drin waren.
Eine Panne werde ich nie vergessen: Wir entdeckten ein Feld mit so vielen liegen gebliebenen Haferhalmen, dass wir schnell nach Hause liefen, Säcke holten und Vater freudestrahlend unsere Ausbeute präsentierten. Der, stutzig geworden, hörte sich bei dem Eigentümer des Haferfelds um – der Bauer hatte noch gar nicht geerntet!
Vater, Lehrer in einem kleinen Dorf von dreihundert Einwohnern, Wietstock an der Nuthe eben, konnte und wollte – Krieg hin, Krieg her – nicht riskieren, dass es im Dorf hieß, Lehrers Kinder klauen Hafer. Als es dunkel wurde, schleppten wir beschämt unsere Säcke zurück auf das Feld und verteilten dort sorgfältig die Haferhalme.
Bratäpfel und Lieblingsoma Minna
Wenn ich Bratäpfel mache, muss ich an meine Lieblingsoma Minna denken. Dieser Oma mütterlicherseits gehörte in Ludwigsfelde eine wunderschöne Villa, die ihr mein Urgroßvater Loth, ein damals bekannter Architekt, gebaut hatte. Das ganze Haus war im Jugendstil eingerichtet und strahlte eine Eleganz und Wohnkultur aus, wie ich sie nie wieder irgendwo angetroffen habe. Heute wundere ich mich, wie meine Mutter den zweifellos gewaltigen gesellschaftlichen Absturz ins primitive Lehrerhaus in Wietstock verkraftet hat. Es wurde nie darüber geredet. Sie hat ihn eben geliebt, diesen spinnerten Dorfschullehrer, der im flatternden Lodenmantel per Fahrrad daherkam.
Oma Minna besaß noch so einen grünen bullernden Kachelofen, in dem die Bratäpfel brutzelten und das ganze Haus mit dem Duft von Nelken und Zimt durchzogen.
Sie trug ihr seit ich denken kann schneeweißes und immer duftiges Haar zu einem Krönchen oben auf dem Kopf gewunden, war immer wie aus dem Ei gepellt, in schwarze Seide gekleidet, ihren Hals zierte ein schwarzes Samtband. Sie lachte viel; obwohl von der Gicht krumm gebeugt, lachte sie oft Tränen. Sie liebte es, auf dem Klavier Strauß-Walzer zu spielen. Als ich ihre feinste porzellanene Waschschüssel zerschlug und furchtbar weinte, tröstete sie mich mit Schokolade.
Die Oma väterlicherseits, Eugenie, war klein, drall, hatte die grauen Haare straff nach hinten zu einem winzigen Dutt gezwirbelt, stammte aus dem Spreewald und sprach den Dialekt der dort lebenden Sorben. Eine böse Oma, fand ich, seit sie meine arme Mutter einmal mit einer Suppenkelle durch das ganze Haus gejagt hatte.
An die Großväter oder gar Urgroßväter kann ich mich nicht erinnern, sie sind alle früh gestorben. Es muss der Urgroßvater Loth gewesen sein, der dem erlag, was wir heute einen Herzinfarkt nennen. Er soll über den Untergang der Titanic, von dem er durch ein vorsintflutliches Radiogerät erfuhr, dermaßen geschockt gewesen sein, dass er mit dem Schrei »Minna!« das Zeitliche gesegnet hat.
1938 wurde Vater von Wietstock nach Ludwigsfelde versetzt und Rektor an der Hermann-Löns-Schule. Unsere Familie, inklusive Oma Eugenie, bezog eine Dienstwohnung in der Nähe des Schulhauses – in der Adolf-Hitler-Straße. Die beiden kleineren Brüder gingen in diese Schule, Hartmut und ich fuhren täglich mit der Dampfbahn nach Berlin in die Oberschule. Um sieben Uhr zehn ging der Zug ab Ludwigsfelde, da wir aber immer zu spät aufstanden, wartete der Lokomotivführer, der uns über die Wiese rennen sah – das Frühstücksbrot noch in der Hand –, bis wir eingestiegen waren. Erst dann dampfte er los. Das waren noch Zeiten!
Waltraut als Säuglingsschwester
Mitten im Krieg gab es in unserer Familie noch einmal Nachwuchs – Mutter bekam Zwillinge, Reimute und Siegmar. Ich, die Älteste, bislang einziges Mädchen unter lauter Brüdern, musste notgedrungen mit meinen fünfzehn Jahren Hausfrau und Säuglingsschwester spielen. Um Mutter und die Zwillinge zu feiern, wollte ich einen Kuchen backen. Das war gar nicht so einfach, denn damals kochten wir Suppen aus Kartoffelschalen, Marmelade aus Ebereschen, Sirup aus Zuckerrüben. An Mehl oder gar Fett für den Kuchen war nicht zu denken. Ich kratzte ein paar Kartoffeln und Möhren zusammen, tat Sirup dran, und es kam eine Art Sandkuchen zustande, der uns damals ungeheuer delikat vorkam.
Die artige Waltraut
© Privatarchiv Barbara Rütting
Seit meinem ersten Möhrenkuchen sind Jahrzehnte vergangen. Viele Kuchen habe ich inzwischen selbst gebacken oder in aller Welt gekostet; und ich muss sagen, auf dem Kuchensektor unterscheiden sich die Nationen weniger voneinander als im übrigen kulinarischen Bereich. Ein Obstkuchen ist ein Obstkuchen, und eine Quarktorte ist eine Quarktorte (frei nach Gertrude Stein).
An der Gulaschkanone bei Meseritz
Herbst 1944. Meseritz, heute Polen. Meine Schulklasse war zum Osteinsatz abkommandiert, die Jungen zum Panzergräben-Ausheben, wir Mädchen zum Küchendienst. Alle fünfzehn oder sechzehn Jahre alt. Novemberwetter, Regen, die Welt in Schlamm versunken, die Front nahe, Geschützdonner Tag und Nacht.
Wir Mädchen schälten in einer zugigen Scheune mit klammen Fingern Zentner von Kartoffeln, während die Jungen schwere nasse Erde aufrissen, um das Vaterland vor den herannahenden russischen Panzern zu schützen.
Später stand ich bis über die Knöchel im Matsch an der Gulaschkanone, die ihrem Namen keine Ehre machte, und teilte unsere trübe Kartoffelsuppe aus. Die Jungen warteten wie aufgereihte Vogelscheuchen stumm in ihren viel zu großen Soldatenmänteln, ihr Kochgeschirr in der Hand, auf ihren Schlag Suppe. Keiner sprach. Alle waren so müde. Nur in der Ferne das Grollen der Geschütze. Und dieser Regen! Meine Wolljacke hing an mir wie ein nasser Sack.
Da kam einer von den Jungen, zog seinen Mantel aus und legte ihn mir um die Schultern.
Der Krieg ist aus
Als der Krieg zu Ende ging, war ich siebzehn. Ende April tauchte ein Mann bei uns auf, mit dem mein Vater früher befreundet gewesen war. Dieser Journalist war als Anti-Nazi nach Dänemark emigriert, dort von der Gestapo verhaftet worden und hatte drei Jahre lang im Berliner Gefängnis Plötzensee gesessen, zum Tode verurteilt. Aus dem Gefängnis heraus wurde er für den Volkssturm rekrutiert. Er flüchtete, erschien bei uns und bat meinen Vater, ihn bis »zur Befreiung«, wie er sich zu meinem Entsetzen ausdrückte, zu verstecken. Vater, obwohl Parteimitglied, versteckte den Mann tatsächlich, riskierte Kopf und Kragen. Ich wusste nicht ein noch aus, fand es richtig, dass wir einen zum Tode Verurteilten nicht fortschickten – aber er war für mich ein Verräter. Noch eine Woche vor der Kapitulation war ich fest davon überzeugt, »unser Führer« würde ein Wunder vollbringen. Dass wir den Krieg verlieren könnten, erschien mir unmöglich; denn natürlich glaubte ich, dass es ein gerechter Krieg sei und dass man gerechte Kriege gewinne. Eines Tages jedoch musste ich, als der Geschützdonner immer näher kam, in unseren Garten gehen und die Zeichen meiner Jungmädel-Zugehörigkeit, Schlips und Knoten und Literatur über »unsere Kolonien« und die »uns Deutschen zustehenden Gebiete« in Polen, vergraben, überzeugt, dass nicht nur ich das alles eines Tages wieder ausgraben, sondern dass auch »unser Führer« alles wieder zurückerobern würde, »was uns zustand«.
Der alte Vater unseres Emigranten, den wir inzwischen auch bei uns aufgenommen hatten, sah mir bei meiner »Grablegung« zu und spuckte hinter mir aus.
In endlosen Gesprächen nachts im Luftschutzkeller erzählte unser Flüchtling namens Hans Rütting, bleich und noch in der Erinnerung vor Aufregung zitternd, von seinen Erlebnissen in Dänemark und im Gefängnis, von Judenverfolgung und Konzentrationslagern. Mein Vater war stumm. Ich voller Abwehr und Hass. Ich weigerte mich, das alles zu glauben. Die Welt, in der ich bisher gelebt hatte, war die einzig mögliche Welt. Die ließ ich mir nicht so einfach zerstören. Eine Welt, in der es keinen »Führer« gab und nicht meinen Glauben an ihn, konnte ich mir nicht vorstellen. Darum durfte sie nicht sein.
Dann war es so weit. Ein wunderbarer Frühlingstag. Wir saßen wie schon so oft im Keller zwischen Bergen von Kartoffeln und Rüben, hörten die ersten russischen Panzer über die Straßen rattern, die ersten russischen Laute vor dem Haus – dann betrat der erste russische Soldat den Keller, in dem wir uns alle mit erhobenen Händen aufgestellt hatten. Er suchte uns nach Waffen ab und zielte zum Spaß mit seiner Maschinenpistole auf meine Großmutter, lachte dröhnend über unsere Angst und küsste meine kleine Schwester Reimute. »Die Russen sind also gar nicht so schlimm, wie wir gefürchtet haben!«, stellten wir erleichtert fest, umso mehr, als wir durch das Kellerfenster hindurch einen anderen Soldaten und eine Soldatin mit semmelblonden Zöpfen über unser Tulpenbeet springen sahen; ganz offensichtlich, um die Blumen nicht zu zertreten.
Wir wagten uns also nach oben in die Wohnung. Die Soldaten, die nun kamen, waren betrunken und verlangten Alkohol. Wir hatten keinen. So ging mein Vater in seiner Not in die Schulstube, nahm eine in Spiritus eingelegte Schlange, die seit Jahrzehnten als Anschauungsmaterial für den Naturkundeunterricht gedient hatte, aus ihrem Glasbehälter heraus und gab den Soldaten diesen Schlangenschnaps zu trinken. Glücklicherweise blieben sie am Leben. Die nächsten kamen nachts. Sie wollten Frauen. Wir hatten das Haus voller Flüchtlinge. Überall lagen sie schlafend auf dem Fußboden. Als sich einer der Soldaten auf mein Bett setzte, stürzte mein Vater auf die Straße und schrie nach dem Kommandanten. Die Kommandantur befand sich in der Nähe, Vergewaltigungen waren den Soldaten streng verboten. Der Soldat stand fluchend auf, schoss durch das Zimmer und traf meinen auf einer Matratze auf dem Boden schlafenden Bruder Hartmut ins Bein. Um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, hatten wir folgende Idee: Hinter der Wand des Schlafzimmers befand sich ein winziger Verschlag. Wir schlugen ein Loch in die Wand, meine Mutter und ich krochen hinein, Vater schob von außen einen Schrank davor. In diesem Versteck verbrachten wir zehn Nächte und blieben unentdeckt, wenn die Soldaten das Haus durchsuchten.
Gewaltmarsch von Berlin nach Flensburg
Als sich das Leben im Dorf einigermaßen normalisiert hatte, beschloss unser Emigrant, sich auf den Weg nach Dänemark zu machen. Zu Fuß. Denn Transportmittel gab es nicht mehr. Er erbot sich, zwei von uns Kindern in die »Westzone« mitzunehmen. Die übrige Familie sollte später versuchen nachzukommen.
Mein verwundeter Bruder Hartmut war unfähig zu gehen, die anderen Geschwister waren für die zu erwartenden langen Fußmärsche zu klein. So blieb allein ich übrig. Ich machte mich als alte Frau zurecht – das taten viele Frauen, um nicht vergewaltigt zu werden –, und dann zogen wir los, der Emigrant und ich. Am 17. Mai 1945. Vater begleitete uns bis zum Dorfausgang. Er weinte. Ich habe ihn nie wiedergesehen.
Mein Begleiter und ich marschierten am ersten Tag unserer Wanderung sechzig Kilometer, bis in die Nähe von Potsdam. Dort erhielt er einen Ausweis als »Displaced Person«, in den ich der Einfachheit halber als seine Frau mit eingetragen wurde.
Noch wochenlang versuchte ich, »der Idee« die Treue zu halten. Ich konnte es nicht fassen, wie leicht viele derjenigen, die noch vor einigen Tagen »Heil Hitler« geschrien hatten, zu einer neuen Fahne überlaufen konnten. Die Tatsache, dass der Krieg verloren war, schien mir kein Grund. Ich wollte Beweise, dass »die Idee« falsch war. Ich erhielt sie.
Eines Tages, nach einem langen Fußmarsch vorbei an von Panzern zermalmten Soldaten, russischen wie deutschen, und toten aufgeblähten Pferden, schliefen wir in Lüneburg in einem Flüchtlingslager. In den Baracken lagen auf Strohschütten nebeneinander Männer, Frauen und Kinder, ehemalige KZ-Häftlinge und ehemalige Soldaten. Neben mir eine belgische Jüdin. Sie hatte im KZ mit ansehen müssen, wie ihre kleinen Kinder von SS-Männern in die Luft geworfen und abgeschossen wurden. Nacht für Nacht wurde die Frau von diesem Bild verfolgt. Sie schrie im Traum, ich hielt sie im Arm, versuchte, sie zu trösten, und fand die Worte nicht. Und wusste nicht, wie ich weiterleben sollte.
Ich hätte gern Medizin studiert, wäre gern Ärztin geworden – aber diesen Traum musste ich begraben. Jetzt ging es einfach um das nackte Überleben. Wenn auch auf Umwegen, habe ich mein Lebensziel dann später im Grunde doch erreicht: mitzuwirken beim Heilmachen von allem, was Haut hat, Haar, Federn, Borsten oder Schuppen und glücklich sein will.
Mein Bunker und ich
Wir näherten uns schließlich der dänischen Grenze. Hans Rütting setzte mich auf dem Marktplatz von Flensburg ab und marschierte weiter nach Dänemark.
Da stand ich nun mit meinem Rucksack und sonst nichts, das bisher so behütete siebzehnjährige Mädchen. Die Sonne schien, ich entdeckte einen verlassenen, nur halb zerbombten Betonbunker am Fjord, der für die nächste Zeit mein Zuhause werden sollte. Der Bunker, den man nur von oben über das Dach betreten konnte, war voller undefinierbarem Gerümpel, darunter Gewehre und sonstige Schusswaffen, auch Munition, wie ich glücklicherweise erst später erfuhr. In einer Ecke räumte ich das Gerümpel beiseite und polsterte den Boden mit Stroh aus, das ich mir bei einem Bauern erbettelte. So hatte ich erst einmal einen Schlafplatz. Dann meldete ich mich beim Roten Kreuz und erhielt etwas zu essen – für eine Blutspende von einem halben Liter gab es dreißig Mark und ein warmes Mittagessen.
Um auf mein Strohlager zu gelangen, musste ich über eine eiserne Leiter auf das Dach des Bunkers klettern. Der Bunker lag oberhalb des Fjords, der Wind riss mir fast die Haare vom Kopf. Ich wusste nie, ob vielleicht noch jemand außer mir in den Bunker eingezogen war oder noch einziehen würde oder ob das ganze Ding vielleicht in die Luft fliegen würde. Zitternd vor Angst schrie ich auf dem Dach gegen den Sturm an, machte mir selbst Mut: Ich habe keine Angst – und ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder Angst haben – ich bin stark – ich bin mutig – ich lasse mich nicht unterkriegen …
Das Bunkererlebnis hat mich sehr geprägt und wohl dazu beigetragen, dass mein gesamtes späteres Leben so kühn und nahezu angstfrei verlaufen konnte.
Allerdings bin ich wohl auch mit einer gehörigen Portion Abenteuerlust ausgestattet, einem unbändigen Appetit auf Unbekanntes, auf Risiko, auf Bis-an-die-Grenzen-Gehen oder, noch besser, über die Grenzen hinaus. Eingefahrene Gleise sind mir ein Gräuel. Sitze ich im falschen Zug, steige ich aus oder springe notfalls ab – selbst auf die Gefahr hin, mir Knochen- oder sonstige Brüche zuzuziehen. Sind es Schicksalsschläge, bemühe ich mich, diese als Lernprozess zu verstehen und das Beste daraus zu machen, sei es, aus ein paar Resten im Kühlschrank eine leckere Suppe zu kreieren oder sonst eine Herausforderung zu meistern.
Vor Kurzem bestand ich bravourös die Nagelprobe. Ich wohne heute allein in einem kleinen Haus am Waldrand. Da ich spät schlafen gehe, saß ich wie üblich noch um halb zwölf Uhr nachts am Computer, als plötzlich ein Mann hinter mir stand. Sie werden es nicht für möglich halten, und ich kann es fast selbst nicht glauben: Zwar verblüfft, aber total ruhig und eher neugierig fragte ich ihn: »Ja, wer sind Siiiiee denn? Wie kommen Sie denn hier rein?«
Des Rätsels Lösung: Ich hatte versehentlich auf einen Knopf am Telefon gedrückt, der mich im Notfall mit der Organisation »Helfende Hände« verbindet, und ein Mitarbeiter, der über einen Schlüssel zu meinem Haus verfügt, war mitten in der Nacht losgerast, um mir zu Hilfe zu kommen!
Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut …
… und hätt’ er nicht drei Ecken, so wär’ es nicht mein Hut …, sangen wir als Kinder.
Irgendjemand hatte mir nicht nur ein ausrangiertes schäbiges Mäntelchen geschenkt mit einem ebenso schäbigen räudigen Pelzkrägelchen dran, sondern merkwürdigerweise auch einen Hut. Der hatte zwar nicht drei Ecken, war aber dennoch ein absolutes Unikat: Hauptbestandteil eine Art Diadem aus schwarzem Samt, unter dem Kinn mit einem Gummiband gehalten. Vom Samtdiadem herab fiel ein schwarzer Schleier über das Gesicht, oben auf dem Diadem prangte eine Feder. In diesem Outfit setzte ich mich, dem Sturm trotzend, auf das Dach meines Bunkers, rauchte meine erste Zigarette und kam mir ungeheuer verrucht vor.
»Fröken Waltraut graeder«
Das Rote Kreuz vermittelte mich nach einiger Zeit als Dienstmädchen an eine dänische Familie mit Kindern in meinem Alter. Ich wurde sehr liebevoll aufgenommen, bekam als »Fröken Waltraut« – Fräulein Waltraut – sogar ein eigenes Zimmer.
Der Auszug aus »meinem« Bunker verlief nicht ohne Wehmut. Ein so überwältigendes Gefühl von Freiheit habe ich später nie mehr erfahren.
Weihnachten 1945 erhielt ich die erste Nachricht von zu Hause. Mutter schrieb, dass Vater bereits Ende Mai mit anderen Lehrern zu einem »Umschulungskurs« abgeholt wurde und nicht zurückgekommen sei. Heiligabend saß ich schluchzend in der Flensburger Kirche.
»Fröken Waltraut graeder«, sagte der Sohn der dänischen Familie, als er sah, wie mir beim Abwaschen die Tränen über die Backen kullerten. »Fräulein Waltraut weint.«
Ich lernte schnell Dänisch und wurde bald »befördert« – vom Dienstmädchen zur Bibliothekshelferin in der dänischen Bibliothek. Und da verschlang ich nun die Bücher all der Schriftsteller, von denen mir der Emigrant Rütting während unseres Fußmarsches berichtet hatte: von Thomas Mann, Sartre, André Gide, Dostojewski – sie alle waren im »Dritten Reich« verboten – als entartet.
Eine neue Welt tat sich auf.
Illegal über die grüne Grenze
Hans Rütting meldete sich wieder aus Dänemark. Da er Verbindung zu den neuen Machthabern in Ostberlin hatte und einige von ihnen aus dem Gefängnis kannte, schlug er mir eine Scheinehe vor. »Mit dem neuen Außenminister der Ostzone habe ich gesessen. Wenn wir verheiratet wären, könnte ich mich für deinen Vater einsetzen!« – »Dein Vater lebt!«, behauptete er sogar, um meinen Hoffnungen neue Nahrung zu geben – zu einem Zeitpunkt, als, wie ich später erfuhr, Vater bereits tot war.
Schweren Herzens willigte ich ein. Unsere Scheinehe wurde in Dänemark geschlossen. Er holte mich nachts illegal über die grüne Grenze, denn ich hatte keinerlei Papiere. Die Wachhabenden hatte er bestochen, damit sie »wegsahen«. Eigentlich war er Bibliothekar, hielt sich jetzt aber über Wasser, indem er an Volkshochschulen Kasperletheater spielte. Wir lebten zunächst in seinem klapprigen VW. Während seiner abendlichen Auftritte hockte ich im Wald auf einem Baumstumpf, auf seine Rückkehr wartend. Er war mit einem Pfarrer befreundet, der bereit war, uns zu trauen, obwohl ich keine Papiere besaß.
Es war auf der Insel Fünen. Hans Rüttings Freunde glaubten an eine Liebesheirat. Sie hatten ein Hummergericht zubereitet. Ich weinte den ganzen Tag. Dem Pfarrer zitterten die Hände, als er sie auf meinen Kopf legte.
Hans übernahm meine weltanschauliche und literarische Ausbildung. Ich hatte so einen unbändigen Durst nach Wissen! Nach Erkenntnis! Nach Wahrheit! Nach Wahrheit vor allem. Kam mir so ungeheuerlich betrogen vor.
Hans machte sich lustig über unsere Familie, diese »Schrebergartenidylle« mit Hausmusik, und Gedichtelesen. Ich kam mir provinziell und hinterwälderisch vor und warf von einem Tag zum anderen meine romantische Vorstellung von der heilen Welt über Bord. Wollte sein wie die Helden von André Gides Falschmünzern, wie der Julien aus Stendhals Le Rouge et le Noir. Verleibte mir die Anschauungen der Bücherhelden mit Haut und Haar ein, wollte so sein wie sie.
Hans war verblüfft, das hatte er nicht erwartet. Wie beim Zauberlehrling entglitt der Schüler dem Lehrer. Als er alles rückgängig machen wollte, war es zu spät. Ich hatte genug von Gefühlen, vom Glauben vor allem, mir konnte man mit keiner Ideologie mehr kommen. Ich kam mir zynisch und toll vor.
Bald hatte ich perfekt Dänisch gelernt, auch ein Examen in dänischer Schreibmaschine und Stenografie absolviert und einen gut bezahlten Job als Fremdsprachenkorrespondentin in Kopenhagen, Vendersgade 26, bei Frode Hansen, einer Firma, die mit Därmen (!) handelte. Von Dänemark aus konnte ich Päckchen an meine hungernde Familie schicken. Jedes Päckchen durfte nicht mehr als ein halbes Pfund wiegen. Dank dieser Hilfe konnten meine Lieben überleben.
Es dauerte noch Jahre, bis ich es schaffte, diese Scheinehe zu beenden. Hans hatte sich in mich verliebt und wollte mich nicht gehen lassen, versuchte schließlich sogar mit Gewalt, mich festzuhalten, ich musste regelrecht flüchten. 1951 endlich gelang es mir, ich flog zurück nach Berlin und sah nach sechs Jahren endlich meine Familie wieder.
In Undine lässt Ingeborg Bachmann ihre Titelheldin sagen: »Ihr Menschen! Ihr Ungeheuer! Ihr Ungeheuer mit dem Namen Hans! Mit diesem Namen, den ich nie vergessen kann!«
Gibt es im Leben jeder Frau ein Ungeheuer namens Hans? Mein Hans hieß Rütting.
Nein, er hat mir nicht gutgetan, mein Hans.
Neuanfang in Berlin
Bei Tante Frida auf dem Dachboden
Nach Kriegsende musste jeder die Arbeit annehmen, die es gab, um sich über Wasser zu halten. So auch in meiner Familie. Hartmut arbeitete in einer Dorfschmiede, er wurde später Ingenieur in Westberlin; Reinhard in einer Bäckerei, er wurde später Lehrer in einem kleinen Ort an der neuen deutsch-polnischen Grenze. Die Dienstwohnung für Lehrer mussten sie von einem Tag auf den anderen räumen, Mutter und meine Geschwister fanden zunächst Unterschlupf in Wietstock, denn Oma Minnas Haus war überfüllt mit Flüchtlingen. Weil sie in Westberlin lebte und das als sicherer galt, kam ich in die Obhut von Vaters Schwester Tante Frida.
Die Familie war auseinandergerissen – und ist nie wieder heil geworden, wozu dann natürlich noch die am 13. August 1961 gebaute Mauer beitrug.
Diese Tante Frida war Mieterin einer winzigen Dachwohnung – für siebzehn Mark im Monat. Ich schlief auf einer Gummimatratze auf dem Fußboden. Mit einer monatlichen Blutspende verdiente ich dreißig Mark, dazu gab es jedes Mal gratis ein warmes Essen. Als ich hörte, dass man in den Filmstudios als Komparsin pro Drehtag ebenfalls dreißig Mark verdienen konnte, machte ich mich, ohne lange nachzudenken, auf den Weg ins Filmstudio Tempelhof und hatte Glück: In einem Film mit Ilse Werner durfte ich – in einem geborgten Abendkleid – über das Tanzparkett schreiten, wobei ich vor Aufregung ausrutschte und hinfiel. »Aus Ihnen wird mal etwas«, meinte einer der Schauspieler – es war Georg Thomalla!
Mit heutigen Augen betrachtet entsprang der Wunsch, Schauspielerin zu werden, der Flucht aus einer schwer zu ertragenden Wirklichkeit in eine schönere Traumwelt. Als heilige Johanna wollte ich auf den Brettern der Bühne die Menschheit retten. Tante Frida hörte mich geduldig ab, wenn ich, auf dem Dachboden hin- und herspazierend, die Minna von Barnhelm deklamierte – meinte jedoch vorsichtig, ob es nicht gescheiter wäre, in ein Bettengeschäft einzusteigen, ein befreundetes Ehepaar hätte keine Kinder und suche eine Nachfolgerin …
Es lief ganz gut mit der Komparserie. In der Kantine des Filmstudios sprach mich eines Tages ein Mann an, der Typ, der mich unwiderstehlich anzieht: groß, schlaksig, intellektuell und sensibel. Wie ich hatte er gerade den Lebens-Sinn verloren. Heio, wie er sich vorstellte, war – im Alter von zwanzig Jahren! – 1942 als Jagdflieger über Stalingrad abgeschossen worden, nachdem er selbst bereits fünfunddreißig »feindliche« Flugzeuge vom Himmel geholt hatte, und in russische Gefangenschaft geraten. Im gleichen Jahr wurde er in der Sowjetunion Mitbegründer und Aktivist des »Nationalkomitees Freies Deutschland«. Das machte sich zur Aufgabe, die deutschen Offiziere, Generäle und Soldaten von der Sinnlosigkeit einer Fortsetzung des Krieges zu überzeugen, und forderte sie durch Flugblätter und über Lautsprecher an der Front zum Überlaufen auf. Der »rote Graf«, auch »rote Socke« geschimpft, wurde deshalb noch jahrzehntelang in Deutschland als Verräter gebrandmarkt.
Er war enttäuscht und verbittert, nachdem er erkannt hatte, dass er – als Heinrich Graf von Einsiedel und Urenkel Bismarcks – in der Gefangenschaft von den Sowjets vor allem wegen seines Namens hofiert und politisch benutzt worden war. Zudem hatte er, nachdem er, zurück aus der Gefangenschaft, wie selbstverständlich in den Osten Deutschlands gegangen und dort als Journalist tätig geworden war, einsehen müssen, dass sich in der DDR kein demokratischer Sozialismus etablieren würde.
Heute wird Heinrich Graf von Einsiedel bescheinigt, er sei einer der wenigen gewesen, die von sich behaupten können, so früh sehr scharfsinnig eine Analyse der politischen Entwicklung der DDR abgegeben und die Konsequenzen daraus gezogen zu haben.
Über seine Erfahrungen hatte er ein Buch geschrieben, Tagebuch der Versuchung. Nun versuchte er sich, offenbar mit wenig Glück, als Drehbuchautor.
Die Kantine wollte längst schließen, wir saßen immer noch da, redeten und redeten. Er bot an, mich in seinem »Mäxchen« nach Hause zu fahren. Dieses Mäxchen war ein uralter klappriger Dixie, aber immerhin ein Cabriolet, rot lackiert mit einem flatternden Dach aus grünem Stoff.
Als wir bei Tante Frida eintrafen, blieben wir stundenlang im Mäxchen sitzen – konnten nicht aufhören zu reden, wollten uns nicht trennen. Zwei auf der Suche nach einem neuen Lebens-Sinn hatten sich ineinander verliebt.
Ich werde Schauspielerin!
Eines Tages traf in Tante Fridas Dachwohnung ein Telegramm ein – ich wurde zu Probeaufnahmen eingeladen. Ein Filmproduzent namens Buchholz suche eine Schauspielerin für die Rolle eines Flüchtlingsmädchens in einem Film über die Liebe zwischen einem ostdeutschen Mädchen und einem westdeutschen Jungen. Man schickte mir ein Taxi – ein Taxi! Ich fuhr ins Studio, machte die Probeaufnahmen, erhielt die Rolle, las das Drehbuch und – sagte ab.
Auf dem Weg zum Film
© Privatarchiv Barbara Rütting
Nachwuchs stellt sich vor
© Privatarchiv Barbara Rütting
Inzwischen verwöhnt durch Literaten wie Sartre, Stendhal, André Gide etc. fand ich das Drehbuch zu einfältig. Das war es auch. Tante Frida schlug die Hände über dem Kopf zusammen: Da sagt diese Waltraut ab, bei einem Honorar von 2400 Mark!
Mein Heio formulierte das etwas drastischer: »Du spinnst doch!« – packte mich tags darauf ins Mäxchen und fuhr mich ins Filmstudio, wo ich erklärte, ich hätte es mir anders überlegt, würde die Rolle annehmen. Heio hegte offenbar Zweifel an meiner Begabung für die Schauspielerei, denn er meinte gleich nach unserem Kennenlernen recht skeptisch: »Glauben Sie wirklich, dass Sie Talent haben?«
Der Filmproduzent zog gleich 1000 DM von den 2400 des Honorars ab – man habe ja die ganze Nacht über telefonieren und nach einem Ersatz für mich suchen müssen!
Ich wurde in einem Hotel einquartiert, für mich Luxus pur – und spielte meine erste Rolle, gleich eine Hauptrolle, obwohl ich nie eine Schauspielschule besucht hatte. Ich spielte das, was ich war, ein Flüchtlingsmädchen, das lachen und weinen konnte. Der Film hieß Postlagernd Turteltaube, Horst Niendorf war mein Partner. Der Film erregte kein besonders großes Aufsehen – aber ich. So schrieb Die Filmwoche am 22. November 1952 nach der Premiere:
Die Spur führt nach Berlin
© Privatarchiv Barbara Rütting
»Barbara Rütting – neuer Typ: Sie ist keine Schönheit, aber sie fällt auf. Im Gesicht dieser Fünfundzwanzigjährigen paaren sich auf seltsame Weise Neugier und Wissen. Ihre Augen verraten, dass in dieser jungen Frau Wunsch und Ehrgeiz leben. Ein beunruhigender Typ. Zigeuner, Vamp, Naturbursche. In Barbara Rütting, dem Mädchen mit der dunklen, etwas geheimnisvollen, fast rauhen Stimme, verkörpert sich der Typ der illusionslosen, dennoch heimlich fragenden, burschikosen, dennoch anmutigen, leicht verwilderten, dennoch maßhaltenden Frau.«
Sogar Der Spiegel äußerte sich: »Die Lehrerin in ›Postlagernd Turteltaube‹, Barbara Rütting, Berliner Jahrgang 1927, hatte als erotisch-exotische Bombe schon in die westsektorale Berliner Society eingeschlagen, aber als Schauspiel-Schülerin noch nicht viel studiert, als Buchholz sie entdeckte. ›Sie kann noch nicht viel, unter uns gesagt: Sie kann gar nichts‹, gesteht ihr Regisseur, ›aber die Gewalt des Photogenen erschlägt alles.‹«
Keine Schönheit – aber eine erotisch-exotische Bombe. Von einem Einschlag von mir als Bombe in die westsektorale Berliner Society hatte ich selbst gar nichts bemerkt – die Meldung war wohl als Anspielung auf meine Beziehung zu dem roten Grafen Heinrich von Einsiedel zu verstehen.
Der Kameramann Helmuth Ashley muss den Film gesehen haben – denn er schlug mich danach für eine kleine Rolle in dem Film Die Spur führt nach Berlin vor. Ich spielte eine russische Dolmetscherin, die sich in ihren amerikanischen Gefangenen verliebt, gespielt von Gordon Howard – und ihn entkommen lässt. Regisseur war der Tscheche Franz Cap, der mich dann später für die Geierwally engagierte.
Die verschiedenen Nationalitäten der Beteiligten führten zu witzigen Sprachproblemen. So hatte der Amerikaner Gordon Howard zu sagen: »Ich bin müde« – das hörte sich dann so an: »Ich bin mude«. Darauf der Regisseur Cap: »Das heißt nicht mude, das heißt mide!«
Wir drehten im zerstörten Reichstagsgebäude. Die Kritiker überschlugen sich geradezu:
»Wäre das Wort nicht so abgegriffen, müsste man sagen, dass dieser Film sensationell ist (…) wir glauben nicht, dass nach dem Krieg in Deutschland ein besserer und spannenderer Kriminalfilm gedreht wurde. Blendend fotografiert, hervorragend besetzt mit einem Aufgebot internationaler Künstler, jagt eine Handlung über die Leinwand, die unsere gegenwärtige unglückliche Lage zwischen Ost und West mit aller Deutlichkeit enthüllt … Allen voran Barbara Rütting, eigenwilliger Nachwuchs mit einem Gesicht voller Inhalt … ein glücklicher Gewinn für den Film, natürlich im Spiel und erfüllt von einem erotischen Fluidum …«
Bundesfilmpreis: Gary Cooper gratuliert
© Privatarchiv Barbara Rütting
Für meine kleine Rolle erhielt ich den Bundesfilmpreis als beste Nachwuchsschauspielerin.
Es gibt ein Foto, auf dem mir Gary Cooper gratuliert – ich aber völlig uninteressiert und geradezu blasiert irgendwo in die Ferne blicke. Das ist mir geblieben – noch heute bin ich total unbeeindruckt von angehimmelten Persönlichkeiten … seien es Schauspieler oder Politiker.
Ich war nun Schauspielerin – ohne jemals eine Ausbildung gemacht zu haben, hätte vermutlich später auch gar nicht auf einer Bühne stehen dürfen. Strich den Namen Waltraut und nannte mich fortan Barbara. Barbara bedeutet »die Fremde« – und passt hervorragend zu mir, denn fremd war ich auch in Zukunft immer wieder und überall, und das wird wohl auch so bleiben.
Die letzte Brücke
Danach ging es Schlag auf Schlag. Es folgte der Film Die letzte Brücke, damals der Antikriegsfilm. Ich denke, alle Beteiligten glaubten, dass nach diesem »Mahnmal der Menschlichkeit« Kriege bald der Vergangenheit angehören würden.
Poslednij Most – so der serbische Titel – wurde im Jahre 1953 in Jugoslawien gedreht, in Mostar mit der wunderschönen Brücke, die 1993 während des Bosnienkrieges zerstört, aber seitdem wieder aufgebaut wurde. Helmut Käutner führte Regie, Maria Schell spielte eine deutsche Ärztin, der noch unbekannte Bernhard Wicki einen Partisanen namens Boro. Ich als Partisanin Miliza hatte die deutsche Ärztin Maria Schell zu kidnappen, die nun in den Konflikt gerät: Als Ärztin ist es ihre Pflicht, Menschen zu helfen – aber auch dann, wenn es gilt, verwundete Feinde wieder zusammenzuflicken?
Wer ist Feind, wer Freund? Am Schluss des Films sind alle tot. Besser kann man den Wahnsinn des Krieges kaum darstellen.
Die letzte Brücke: Als Partisanin Miliza, mit Maria Schell
© Privatarchiv Barbara Rütting
Bei einer dieser Szenen hatte ich ein trauriges Aha-Erlebnis. Das Thermometer war auf fast vierzig Grad geklettert. Ich stand in meiner Männeruniform, Käppi auf dem Kopf, eine Maschinenpistole umgeschnallt, schweißüberströmt in der Sonne auf einem glühenden Felsen. Ich sollte laut Drehbuch rauchen, hatte aber noch nie geraucht. Wie bei einem Schlachtross auf einem alten Stich entwich mir der Rauch durch beide Nasenlöcher. Alles lachte. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich mich an meiner MP festhalten musste. Hilfesuchend schaute ich nach einem arrivierten Kollegen. Der aber machte sich nur lustig und sagte: »Mir hat früher keiner geholfen – jetzt helfe ich auch keinem.«
Die letzte Brücke: Getarnt als Einheimische
© Privatarchiv Barbara Rütting
Damals nahm ich mir vor: Sollte ich jemals zu den »Arrivierten« gehören und jemand braucht meine Hilfe – ich werde ihn nicht im Stich lassen.
Die letzte Brücke ist nach wie vor mein Lieblingsfilm, gerade wegen seiner Friedensbotschaft, dass sich Begriffe wie Freund und Feind, Vaterland und Feindesland auflösen lassen, wenn nicht länger in nationalistischen Bahnen gedacht wird.
Nach Drehschluss saßen wir meistens alle zusammen am Lagerfeuer, Freund und Feind. Die »echten« Jugoslawen tanzten Kolo, diesen wilden, schwermütigen Tanz. Nie vergesse ich den Text des Liedes, das der Partisan Bernhard Wicki der Ärztin Schell ins Deutsche übersetzte: »Bin gegangen mit mein Lämmchen nach Bembashu.«
Aus Anlass der 500. Klappe gab es eine deutsch-jugoslawische Feier im Dorfkrug Buna. Wir feierten, wie wir waren, in unseren nach einem anstrengenden Drehtag in glühender Hitze verschwitzten Partisanenuniformen, mit Käse und Knoblauch, viel Rotwein und Sliwowitz. Es ging bald so hoch her, dass mit den Tellern Ball gespielt wurde und schließlich die Hälfte des Geschirrs in das an der Schenke vorbeifließende Flüsschen geflogen war. Nie wieder in meinem Leben habe ich derartige Ovationen bekommen wie an diesem Abend von den Jugoslawen: »Miliza, Miliza, urra für die große Kamerad Miliza …«
Es war schon dunkel, als wir zu unserer Unterkunft aufbrachen. Ich wollte in das für die Schauspieler bereitstehende Auto steigen, da tobte der Jubel erst recht los. Auf einem offenen Lastwagen saßen das jugoslawische Team und die Statisten. Alle schrien aus vollem Hals: »Urra – urra – urra – za Barbaru«, – ich rannte mit ausgestreckten Armen auf den Lastwagen zu, wurde hinaufgezogen, und dann ratterten wir durch die Nacht und durch den Staub und die Haare flogen und Sliwowitz wurde aus der Flasche getrunken, die reihum ging, immer wieder »Urra Barbaru« – ein gurgelndes »Urra, Urra, Urra«, wir sangen und tranken, und als wir vor dem Hotel ankamen, noch einmal: drei »Urra« für »die große Kamerad Barbaru« – ich wurde vom Auto gehoben, erschöpft und glücklich, und hatte einen Kopf wie ein Ballon, vom Sliwowitz, vom Singen, vom Wind und vor Glück.
Selten in meinem Leben war ich so glücklich wie in diesen verrückten Minuten auf dem Lastwagen.
Oft waren die Dreharbeiten total chaotisch. Einmal schossen wir versehentlich mit scharfer Munition aufeinander, dann kippten wir aus den in der Strömung trudelnden Schlauchbooten in die reißende Neretva. Dann hatte der Regisseur Helmut Käutner sich ausgedacht, dass wir eine Brücke aus Menschen bilden sollten. Dicht an dicht standen wir nebeneinander im Wasser, jeder hielt ein Brett über dem Kopf, sodass eine Holzbrücke entstand, über die die Verwundeten von der einen auf die andere Seite des Flusses humpeln sollten. Aber die starke Strömung riss uns die Beine weg, ein Wunder, dass wir nicht alle ertranken.
Zwischendurch glaubte kaum noch jemand daran, dass dieser Film irgendwann fertig werden würde. »Lasst mich hier zurück«, hörte ich Helmut Käutner einmal jammern. »Seht zu, wie ihr nach Hause kommt, lasst mich hier zurück« …
Der Film wurde ein Welterfolg und erhielt 1954 bei den Filmfestspielen in Cannes den Prix International und bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin den David-O.-Selznick-Preis.
Ich wurde nicht zur Premiere eingeladen – was nicht nur mich, sondern auch die Presse wunderte. Maria Schell soll es verhindert haben.
Die Geierwally
Danach kam Die Geierwally, heute ein Kultfilm, der immer wieder im Fernsehen gezeigt wird – die Wally, mit einem Dickschädel wie ich, ist nach wie vor eine meiner Lieblingsrollen, eine frühe Feministin, die sich nicht verbiegen lässt. Der Vater will sie mit einem reichen Bauern verheiraten, sie aber liebt – und kriegt ihn schließlich auch – den Bärenjosef. Dafür nimmt sie sogar die Verbannung in eine trostlose Almhütte auf sich. Ihr einziger Freund ist der zahme Geier Hansl.
Die Geierwally, der Bärenjosef (Carl Möhner) und Geier Hansl (1956)
© Privatarchiv Barbara Rütting
Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, die von der Schriftstellerin und Schauspielerin Wilhelmine von Hillern 1875 in dem Roman Die Geierwally geschildert wurde. Für die damalige Zeit – Ende des 19. Jahrhunderts – war diese Frauenfigur geradezu revolutionär.
Zu meinem 87. Geburtstag schickte mir ein befreundeter Journalist Grüße mit einem Satz der Geierwally, den ich bereits vergessen hatte. Wally hat ein Lämmchen gerettet, das sich in den Bergen verirrt hat, legt es sich über die Schultern und sagt zu ihm: »Ihr müsst auch immer dahin, wo es nicht weitergeht! Genau wie ich …«
»Liebe Barbara«, schreibt der Journalist, »das kommt mir vor wie dein Lebensmotto. Mögen dir Kraft und Kreativität erhalten bleiben, um diesen Weg fortzusetzen, damit es weitergeht – auch dort, wo es nicht weitergeht!«
Ja, die Geierwally und ich haben schon viel gemeinsam.
Ich hatte keine Stunt-Frau, sondern spielte alle Szenen selbst. Eine Woche verbrachte ich bei dem wunderschönen Geier Hansl im Käfig, der sich ja an mich gewöhnen musste, denn er sollte mir in meine Verbannung folgen, zu mir fliegen und mir sogar den Kopf »kraulen«, wenn ich als Wally vor Liebeskummer zu weinen hatte. Das mit dem »Kraulen« gelang schließlich, nachdem ich auf die Idee gekommen war, mir kleine Fleischbrocken in meinen Haarkranz zu stecken. Neben den Fleischbrocken riss Hansl mir immer wieder Haarbüschel aus, aber ich spielte und weinte und spielte und weinte, obwohl mir bereits das Blut über das Gesicht lief, bis der Regisseur Franz Cap rief: »Halt, halt, Kamera aus – die Barbara verblutet uns ja!«
Franz Cap war ein wunderbarer Regisseur und äußerst sensibel. In einer Szene hatte ich den durch meine Schuld in eine Schlucht abgestürzten Bärenjosef zu retten. Den schweren Mann mit einem Strick um den Bauch festgebunden, wurde ich Hunderte von Metern an einer steilen Felswand emporgezogen und prallte dabei immer wieder gegen die Felswand. Der Strick schnürte mir fast die Luft zum Atmen ab. Franz Cap konnte das nicht mit ansehen, hörte ich später – er schloss die Augen, drehte sich um und murmelte nur: »Sagt mir, wenn sie oben ist …«
Mit Harald Krassnitzer vor der »Geierwally-Hütte«
© SWR
Im Juni 2013 lud mich der Schauspieler Harald Krassnitzer ein, zusammen mit ihm für einen Dokumentarfilm die Hütte zu besuchen, in der 1956 die Geierwally gedreht wurde. Es war geplant, dass ich für die Presse vor der Geierwally-Hütte im grünen Gras liegen sollte. Die Hafelekarspitze bei Innsbruck ist 2334 Meter hoch. Es hatte einen Kälteeinbruch gegeben, und so mussten Harald und ich bei eisiger Kälte und dichtem Nebel durch tiefen Schnee stapfen, von einer erfahrenen Bergführerin begleitet, die uns vor dem Absturz in die Tiefe bewahren sollte. Als die Hütte endlich aus dem Nebel auftauchte, schlug mein Herz schneller. Alles war unverändert – als sei es gestern gewesen, die Zeit stehen geblieben – nur der Geier war ein ausgestopfter aus dem Museum. Den echten, zahmen (!) Hansl hat ein Jäger bei einem seiner Freiflüge, von denen Hansl immer freiwillig nach Hause kam, abgeschossen.
Theaterdebüt in Krefeld
Doch Filmen war nicht das, was ich als Schauspielerin wirklich wollte. Mich zog es zum Theater. Das erfuhr der Krefelder Theaterintendant und bot mir die weibliche Hauptrolle in dem Stück Die Tochter des Brunnenmachers von Marcel Pagnol an. 1956 stand ich also zum ersten Mal auf einer Bühne und spielte meine Rolle als Mutter eines unehelichen Kindes offensichtlich so ergreifend, dass mir eine Krefelderin, die der Premiere beigewohnt hatte, vor Kurzem sagte, sie sei überzeugt gewesen, ich hätte das Schicksal dieser verzweifelten Kindsmutter selbst erlebt. Clou der Inszenierung war ein echtes Baby. Für eine Wiege war ich als alleinerziehende Mutter zu arm. So lag das Baby in einer an einem Baum hängenden Kiste und streckte, je nach Laune, ab und an ein Füßchen in die Höhe, was den Zuschauern jedes Mal entzückte Ausrufe entlockte. Vor der Premiere war ich so aufgeregt, dass ich abwechselnd Sekt trank und Baldriantropfen einnahm.
Während einer Probenpause zu Macbeth
© Privatarchiv Barbara Rütting
Ein lustiges Erlebnis hatte ich viele Jahre später in Krefeld bei einer Buchpräsentation. Ein wunderschöner großer, schwarzhaariger junger Mann strahlte mich an. »Wir kennen uns«, stutzte ich, »… aber woher?« – Darauf er: »Ich bin das Baby aus der Kiste!«
Lady Macbeth
© Privatarchiv Barbara Rütting
In den folgenden über dreißig Jahren meiner Schauspielkarriere spielte ich dann so gut wie alle Neurotikerinnen der Weltliteratur an den deutschsprachigen Bühnen, Ibsen, Strindberg, die Lady Macbeth, die Fürstin Eboli, die Mutter Courage von Bert Brecht und die Martha in Wer hat Angst vor Virginia Woolf? und daneben in insgesamt fünfundvierzig nationalen und internationalen Filmen.
Die Welt will ich zwar immer noch retten – aber weder als heilige Johanna noch als Bettenverkäuferin.
Verheiratet mit dem roten Grafen
Heio wollte unbedingt heiraten – aber eine offene Ehe führen, die Affären mit anderen Partnern zuließ … für uns beide. Das galt damals als chic. Ich schwärmte für den Existenzialismus. So schwebte mir eine Beziehung vor wie die berühmte zwischen Simone de Beauvoir und Sartre – die aber, wie wir heute wissen, alles andere war als glücklich. Ich hielt weder Heio noch mich für ehetauglich, womit ich recht behalten sollte. Zudem hatte ich, geprägt durch meine Kindheitserlebnisse, verlernt, an irgendetwas zu glauben, geschweige denn an die Dauer von Beziehungen.
Hochzeit mit Heinrich Graf von Einsiedel
© Privatarchiv Barbara Rütting
Warum auch immer – ich gab nach, fühlte mich sicherlich auch geschmeichelt, so umworben zu werden.
Die Trauung fand 1952 statt. Trauzeugen waren unser Freund Horst Buchholz, der später berühmte Schauspieler, und mein Bruder Hartmut. Meine Karriere ging steil nach oben. Ich war fast ständig unterwegs, mit Filmen im In- und Ausland, mit Theatertourneen.
Da nakajet Bog was
In dem amerikanischen Film Zeit zu leben und Zeit zu sterben (1958) nach dem Roman von Erich Maria Remarque spielte ich eine russische Gefangene, die, sich ihr eigenes Grab schaufelnd, in gellende Schreie ausbricht und sofort erschossen wird.
Alles sollte so lebensecht sein wie möglich, ich hatte meine Rolle wochenlang mit einem russischen Dolmetscher eingeübt. Ein wesentlicher Bestandteil des Parts war eine Fluchkaskade, die ich dem deutschen Erschießungskommando entgegenzuschleudern hatte. Auf Deutsch etwa so: »Gott verfluche euch und alle Deutschen, die ihr unser Land überfallen habt – Gott wird euch strafen bis in alle Ewigkeit – eure Kinder sollen verrecken, eure Frauen unfruchtbar werden« und so weiter und so fort.
In meiner Münchner Wohnung traute ich mich nicht, in voller Lautstärke zu üben. So ging ich in den Wald, meistens bei Regen, weil dann kaum Spaziergänger zu erwarten waren. Doch als ich einmal laut russisch brüllend durch den regennassen Forst stiefelte, sah ich ein altes Pärchen, das sich, offensichtlich beim Pilzesammeln, unter einer Tanne schutzsuchend aneinandergeklammert hatte und bei meinem Anblick bekreuzigte.
Vor Verlegenheit rettete ich mich in fröhliches Pfeifen.
Den Text meiner Fluchkaskade kann ich heute noch auswendig, nach über fünfzig Jahren. Wenn ich Russen treffe, überrasche ich sie damit – und ernte jedes Mal entsetzte Aufschreie.
1961 bot mir der Regisseur Gottfried Reinhardt eine Rolle in dem amerikanischen Film Stadt ohne Mitleid an, der nach einer wahren Begebenheit in einer süddeutschen Kleinstadt gedreht wurde. Vier amerikanische Soldaten hatten ein deutsches Mädchen, gespielt von Christine Kaufmann, vergewaltigt, ihnen drohte die Todesstrafe, die der Verteidiger, verkörpert von Kirk Douglas, zu verhindern suchte, indem er das Mädchen so fertigmachte, dass es sich schließlich umbrachte. Ich war eine deutsche Journalistin, die den Verteidiger zu interviewen hatte.
Wie war Kirk Douglas?, werde ich oft gefragt. Tja, was soll ich sagen – ich be- geschweige denn verurteile ungern andere Menschen. Man muss wohl so egomanisch sein, um ein wirklich großer Star zu werden – und zu bleiben. Sein nach meinem Empfinden ziemlich rücksichtsloses Verhalten, auch den Arbeitern am Set gegenüber, hat jedenfalls entscheidend dazu beigetragen, dass ich erkannte: Wenn man so sein muss, um in Hollywood Karriere zu machen, dann ist das nichts für mich. Da würde ich meine Seele verlieren.
»Sie sind ja überhaupt nicht ehrgeizig!«, meinte Gottfried Reinhardt dann auch am Schluss der Dreharbeiten erstaunt. »Wollen Sie denn nicht nach Hollywood? Jede andere Schauspielerin würde doch alles dafür tun!«
Christine Kaufmann hat da so ihre Erfahrungen gemacht … Jahre später war ich privat in Hollywood, habe für die Schweizer Weltwoche den Bericht »In Hollywood am Swimmingpool« geschrieben. Christine schickte mir mit einem kurzen Gruß ein Usambaraveilchen ins Hotel. Es war kurz vor dem Ende ihrer Ehe mit Tony Curtis.
Dreimal Suppe ist zu viel
Können Sie sich vorstellen, innerhalb von drei Stunden dreimal Suppe zu essen? Und das noch morgens zwischen neun und zwölf Uhr. Ein Schauspieler muss das manchmal und verdient sich damit sogar noch sein Brot. Denn bei Filmaufnahmen werden jeweils alle Szenen hintereinander gedreht, die in der gleichen Dekoration spielen, ganz egal, wie weit sie im Film zeitlich auseinanderliegen. Und so kann es geschehen, dass man an einem Tag nichts weiter tut als essen. Mir passiert im Film Mein Onkel Theodor (1975) mit Gert Fröbe als Ehemann.
Ort:
Esszimmer der gerade reich gewordenen Familie Wurster.
Personen:
Vater Wurster: Gert Fröbe
Mutter Wurster: ich – und die sechs Wurster-Kinder zwischen 1¾ und 17 Jahren. Fünf rothaarig wie der Vater, eines dunkel wie ich.
8.30 Uhr
1. Szene (wir hatten alle kurz vorher im Hotel gefrühstückt)
Frühstück: Kaffee, Eier, Brote mit Marmelade. Ich bin schlau und knabbere nur an einem trockenen Knäckebrot – Mutter Wurster achtet auf die Linie! Einer meiner Söhne, dem es anfangs noch Spaß macht, verspeist vier Toastbrote.
9.00 Uhr
2. Szene: Dampfende Nudelsuppe wird serviert. Da eine Szene immer mehrmals geprobt und gedreht wird, bringen wir es jeder auf mehrere Teller.
10.00 Uhr
3. Szene: Jetzt gibt’s Tomatensuppe. Einige meiner Söhne meutern bereits. Die Szene wird ebenfalls mehrmals geprobt und gedreht. Jeder kommt wieder auf einige Teller.
10.30 Uhr
4. Szene: Nun Gemüsesuppe. Alle Kinder protestieren, sie können nicht mehr. Das Baby Stefan brüllt und haut mit dem Löffel in seinen Teller. Der Regisseur mitleidlos: »Achtung, Aufnahme!« Wir löffeln verbissen. Bis die Szene »im Kasten« ist, haben wir wieder mehrere Teller verputzt.
Das Vormittagspensum ist geschafft. Wir atmen auf. Zu früh! Denn jetzt geht’s zum Mittagessen, das die Produktion dem gesamten Team täglich spendiert. Als der Ober die Leberknödelsuppe vor uns hinstellt, kriegen wir nur aus Höflichkeit keinen Schreikrampf.
Nie wieder eingeladen nach Wermelskirchen
Ganz besonders wohlschmeckende Kartoffeln wachsen in Wermelskirchen. Abgesehen von diesem erfreulichen Umstand habe ich das nette Städtchen im Bergischen eher in unliebsamer Erinnerung.
Bei Theatertourneen wird oft an Orten gespielt, die über kein eigenes Theater verfügen, in Allzwecksälen, Turnhallen oder Kinos. Das hat sogar einen gewissen Reiz, man glaubt sich in die Zeit der »Neuberin« zurückversetzt, der legendären fahrenden Komödiantin aus dem 18. Jahrhundert, der Tourneebus wird zum romantischen Thespiskarren. Die Qualität der Aufführungen allerdings lässt gelegentlich zu wünschen übrig, und das ist nicht immer die Schuld der Schauspieler.
Eine dieser Tourneen führte auch nach Wermelskirchen, es war in den sechziger Jahren. Diesmal spielten wir in einem Kino Die ehrbare Dirne von Jean-Paul Sartre, ein brisant politisches Stück. Ich spazierte vorher zufällig in der Nähe der Kasse vorbei und hörte zu meiner Verblüffung folgende Worte: »Farrkarrrte, bitte!« Aha, also auch einige Gastarbeiter, dachte ich erfreut – Gastarbeiter hießen die Zuwanderer in jener Zeit. Der Verkauf war ausgesprochen rege, und auf der Bühne vernahmen wir schon durch den geschlossenen Vorhang jenes Bienengesumme, das immer ein angeregtes Publikum verrät. So war es dann auch. Aber vielleicht durch das Wort »Dirne« im Titel animiert, wähnten sich die Leute wohl in einer Sexklamotte. Als mein Partner und ich in Dirne Lizzies armseliges Eisenbett fielen, das ausgerechnet an diesem Abend auch noch quietschte, war der Jubel grenzenlos. Er steigerte sich noch beim Auftritt des verfolgten »Negers« – so nannte man damals tatsächlich dunkelhäutige Menschen –, der irren Blicks die Dirne Lizzie um Hilfe vor seinen Verfolgern zu bitten hatte. Unser verzweifelter Kampf oben auf der Bühne, dem Publikum einen Hauch von Tragik zu vermitteln, kam den Bemühungen des Sisyphus gleich. Besonders angesichts des von den Weißen gejagten »Negers« schlugen sie sich unten auf die Schenkel vor Vergnügen. Mir wurde heiß vor ohnmächtiger Wut – und als ich dann in einer Szene eine Pistole in der Hand hatte, mit der ich den »Neger« vor den Weißen beschützen sollte, geschah es: Ich riss die Pistole herum, richtete sie auf das johlende Publikum und schrie: »Da gibt’s nichts zu lachen, verdammt noch mal! Wer’s nicht kapiert, geht nach Hause! Also?« – Totenstille. Ich hielt krampfhaft die Pistole auf das Publikum gerichtet (sie war natürlich nicht geladen). Da sagte unten im Parkett ein dünnes Stimmchen furchtsam: »Bravo!« – und der Mutige klatschte zweimal kurz in die Hände. Dann wieder Totenstille. Wir spielten weiter, als sei nichts geschehen. Das Publikum gab den ganzen Abend vor Angst keinen Mucks mehr von sich.
Später saß ich im Restaurant, genoss die wunderbaren mehligen Wermelskirchner Kartoffeln und konnte es nicht fassen, dass ich mich derart hatte hinreißen lassen. Nach Wermelskirchen bin ich nie wieder eingeladen worden.
Na warte, Maximilian (Schell)!
1958 spielten Maximilian Schell und ich in dem Film Ein wunderbarer Sommer ein armes Häuslerehepaar. Der Mann kauft auf dem Viehmarkt eine kleine mickrige Kuh, weil sie so schöne Augen hat – die dann, oh Wunder, so viel Milch gibt, dass sie Milchleistungssiegerin wird, jedoch am Ende vor Erschöpfung stirbt. Ein zauberhafter, auch trauriger Film nach einem Roman von Paul Gallico. Georg Tressler führte Regie. Gedreht wurde in Liechtenstein.
Mit Maximilian Schell in Ein wunderbarer Sommer
© Privatarchiv Barbara Rütting
Alles sollte so echt wie möglich sein, das war bei Maximilian wie auch beim Regisseur geradezu eine fixe Idee. So fanden unsere Bettszenen in einem echten alten Bauernhaus statt, in echten Bauernbetten, in denen das Bauernehepaar vorher geschlafen hatte. In dem engen Zimmer bei der enormen Hitze durch die vielen Lampen strömte die – natürlich ungewaschene – Bettwäsche einen derart penetranten ranzigen Geruch aus, dass ich mich mit meiner empfindlichen Nase ständig einer Ohnmacht nahe fühlte.