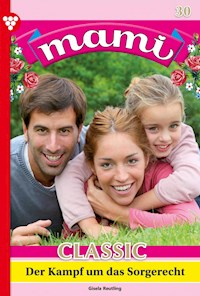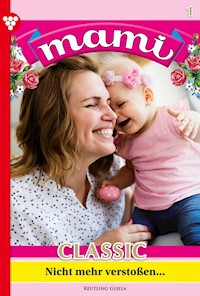Inhaltsverzeichnis
E-Book 1739: Dich verlassen? Niemals!
E-Book 1740: Gritli, das Kind aus dem Dorf
E-Book 1741: Papi ist ein Abenteurer
E-Book 1742: Eine Hochzeit in Sicht?
E-Book 1743: Hoffnung für ein verlassenes Kind
E-Book 1744: …und plötzlich war eine Cousine da
E-Book 1745: Armes reiches Kind
E-Book 1746: Traurige Kinderaugen tun weh
E-Book 1747: Für immer ohne Vater…
E-Book 1748: Das Opfer war Jonathan
»Normalerweise nehmen wir nur Lehrkräfte mit Berufserfahrung«, sagte Erich Knobel, Leiter der deutschen Schule im südamerikanischen Montelindo. Er umfing die jugendliche Erscheinung im bunten Batik-Look mit einem skeptischen Blick.
»Ach wissen Sie, es wird jetzt überall gespart«, entgegnete Kati Busch unbeschwert, »je länger man im Dienst ist, um so höher sind die Bezüge. Ich dagegen als Berufsanfänger bin heilfroh, überhaupt unterzukommen und daher ausgesprochen preiswert.«
Sie ordnete die Falten ihres locker fallenden Baumwollgewandes, das sie offensichtlich an einem der staubigen Straßenstände in ihrer neuen Heimat erworben hatte, und schenkte ihrem zukünftigen Chef ein gewinnendes Lächeln.
Er seufzte, blätterte in den Unterlagen auf seinem Schreibtisch und gab zu bedenken, daß zwischen Studium und Praxis ein gewaltiger Unterschied liege, nicht nur bei Medizinern, sondern auch bei Lehrern. Am täglichen Umgang mit Kindern seien schon viele nach bestandenem Examen gescheitert.
»Also in diesem Punkt kann ich Sie beruhigen«, erklärte Kati Busch vergnügt, »wir sind zu Hause fünf Geschwister, und ich bin die Zweitälteste. An alles, was da anfällt, bin ich gewöhnt. Krach und Zoff, wenn Sie das meinen, machen mir nichts aus.«
Erich Knobel gab sich geschlagen.
Zwar hatte Katharina Busch aus dem niederrheinischen Battenberg seine Bedenken keineswegs zerstreut, aber da sie nun einmal da war, mußte man ihr eine Chance geben, mindestens ein Jahr lang.
»Sprechen Sie Spanisch?« fragte er der Ordnung halber.
»Als ich die Zusage bekam, habe ich gleich einen Crash-Kursus gemacht«, war die offene Antwort.
»Aha. Nun, dies ist eine deutsche Schule, und die erste Sprache ist natürlich Deutsch. Trotzdem sind Kenntnisse in der Landessprache unerläßlich. Warum, wenn ich so neugierig sein darf, haben Sie sich um eine Stelle in Montelindo beworben?«
»Oh, ich war nicht auf diese Gegend fixiert. Ich wäre auch nach Alaska gegangen oder nach Südafrika. Aber man muß nehmen, was man kriegt, nicht wahr? Ich wollte unbedingt weg, weit weg. Das war mir die Hauptsache.«
»Aha«, murmelte Erich Knobel, räusperte sich und fügte hinzu: »So so.« Weiter zu fragen verbot ihm seine Zurückhaltung, aber das brauchte er auch gar nicht, denn Kati Busch schlug die klarblauen Augen vertrauensvoll zu ihm auf und bekannte freimütig, ihre Gründe seien persönlicher Art gewesen.
»Beziehungsstreß, wissen Sie.«
Der im Auslandsdienst ergraute Schulmann Erich Knobel wußte keineswegs, was damit gemeint war. Die neue Generation, die da in der alten Heimat heranwuchs, brachte nicht nur andere Gewohnheiten und Gedankengänge mit. Sie hatte offenbar auch andere Sprachregeln entwickelt.
»Beziehungsstreß«, wiederholte er stirnrunzelnd, »was genau ist darunter zu verstehen?«
»Na ja, ich war drei Jahre lang mit Achim zusammen, so ähnlich wie verlobt, wissen Sie. Aber eines Tages kamen wir nicht mehr klar miteinander. Wenn ich keinen Schlußstrich gezogen hätte, dann wäre das noch ewig so gegangen. Für mich ist es bestimmt das Beste, die Tapeten zu wechseln und mit ganz anderen Problemen konfrontiert zu werden.«
»Hoffentlich haben Sie sich nicht zuviel vorgenommen«, murmelte Erich Knobel und fuhr sich mit der Hand durchs dichte weiße Haar, »ein Tapetenwechsel von Battenberg nach Montelindo ist ziemlich kraß, und die Probleme, mit denen Sie es hier zu tun kriegen, sind nicht zu unterschätzen. Wir arbeiten seit dreißig Jahren in diesen Ländern, meine Frau und ich, und bis heute haben wir uns an manche Härten nicht gewöhnen können. Aber vielleicht bleibt Ihnen der Einblick in die hiesige Welt erspart, denn innerhalb unserer Schule spielt sich alles im gewohnten europäischen Rahmen ab. Wir singen sogar deutsche Volkslieder«, fügte er lächelnd hinzu. In die kleine Pause, die er seinen Worten folgen ließ, wehte zweistimmig aus dem Innenhof eine fast vergessene Weise herein: »Wenn alle Brünnlein fließen…«
Kati traute ihren Ohren nicht.
Kaum zu glauben, dachte sie, bei uns zu Hause wird ja sogar in der Kirche eher Gospelmusik gespielt als schlichtes deutsches Liedgut! Na, macht nichts. Da lerne ich eben noch was dazu.
Die anschließende Besichtigung der Schule versetzte sie in erneutes Erstaunen. Alle Klassenräume lagen in Einzel-Bungalows, die durch lauschige, blumengeschmückte Innenhöfe miteinander verbunden waren. Vom Kindergarten bis zum Abitur reichte das Angebot. Für alles war gesorgt, von morgens um halb neun bis nachmittags um vier Uhr. Es gab eine umfangreiche Bibliothek, einen Musiksaal mit Instrumenten, gut bestückte Räumlichkeiten für naturwissenschaftliche Fächer, viel Luft und Licht und Spielgerät für die Kleinen.
Eine großzügigere Anlage war nicht vorstellbar.
»Ja, ja«, lächelte Angelika Knobel, die Frau des Schulleiters, eine zeitlose Erscheinung mit jungem Gesicht unter sonnengebleichtem Haar, »hier bei uns ist die Welt noch in Ordnung. Wir wollen Sie bei den Erstkläßlern einsetzen. Ist Ihnen das recht?«
»Aber ja, aber sicher«, beeilte sich Kati atemlos zuzustimmen, »ich fülle jeden Platz aus, den Sie mir zuweisen.«
»Fein, dann können Sie am Montagmorgen anfangen. Das Wochenende werden Sie brauchen, um Ihre Sachen auszupacken und sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Wissen Sie schon, wo Sie wohnen?«
»Nein, ich bin gestern mit einem Gutschein für das Hotel Imperial angekommen, aber der gilt nur für zwei Nächte.«
»Machen Sie sich darum keine Sorgen. Alle ausländischen Kräfte werden für die Dauer ihres Aufenthalts ganz in der Nähe untergebracht. Warten wir noch bis zur großen Pause, dann gehe ich mit Ihnen hinüber.«
Die Wohnsiedlung war in der gleichen offenen Bauweise angelegt wie die Schule, und zu Katis sprachloser Verwunderung erhielt sie einen eigenen kleinen Bungalow mit Innenhof und Vordergärtchen, sowie einer mütterlichen, einheimischen Zugehfrau namens Serafina.
»Ich kann’s nicht fassen«, sagte sie zu Frau Knobel, die ihr das Schlafzimmer mit den eingebauten Schränken, den luftigen großen Wohnraum und die perfekt eingerichtete Küche zeigte, »in meinem ganzen Leben habe ich nicht so komfortabel gewohnt.«
»Dafür müssen Sie auf einiges andere verzichten«, erwiderte die Frau des Schulleiters mit ihrem verhaltenen Lächeln, »zum Beispiel auf ein Auto, das importiert werden müßte und daher in der Anschaffung viel zu teuer wäre.«
»Ach, daran bin ich sowieso nicht gewöhnt«, bekannte Kati offenherzig, »bei uns zu Hause im Flachland haben wir Fahrräder, und in den Städten benutzen wir öffentliche Verkehrsmittel.«
»Damit sieht es hier nicht so gut aus«, erwiderte Angelika Knobel mit warnendem Unterton in der sanften Stimme, »wenn Sie die altersschwachen Busse gesehen haben, an denen Trauben von Menschen hängen – das sind die einzigen Fortbewegungsmittel außer den Taxis. Aber alles, was Sie fürs tägliche Leben brauchen, finden Sie in nächster Nähe. Serafina wird Sie überall hinführen und auch für Sie einkaufen, wenn Sie das wollen. Sie ist absolut zuverlässig. Eine bessere Hilfe könnte ich Ihnen nicht empfehlen. Durch die lange Zusammenarbeit mit ausländischen Mietern hat sie etwas Deutsch gelernt, und im Spanischen kann sie Ihnen viel beibringen.«
»Großartig«, sagte Kati dankbar und erleichtert, »das ist nämlich der einzige Punkt, der mir Kopfzerbrechen macht. Alles andere dürfte kein Problem sein, ganz im Gegenteil! Bis jetzt kann ich nur sagen, daß Montelindo meine Erwartungen bei weitem übertrifft!«
»Wollen wir hoffen, daß es so bleibt«, lächelte Angelika Knobel, setzte ihre Sonnenbrille auf und trat in den gleißenden Sonnenschein vor der blau gestrichenen Haustür, »wenn Ihnen etwas fehlt, rufen Sie uns an. Die Telefonnummer steht auf der kleinen Liste neben dem Apparat. Ansonsten sehen wir uns am Montagmorgen.«
Den Rest des Tages verbrachte Kati glücklich in ihrem neuen Heim, wo sie barfuß über die Steinfußböden lief, den Inhalt ihres großen Koffers und der beiden Reisetaschen in die eingebauten Schränke räumte, die Dusche ausprobierte und Serafina beim Kochen zusah.
Es gab Fleischbällchen mit Reis in einer würzigen Soße, die einen verführerischen Duft verbreitete. Hübsches, buntes Geschirr wurde durch das weit geöffnete Küchenfenster auf eine breite, steinerne Fensterbank geschoben. Draußen, unter einem Ziegeldach öffnete sich der Innenhof, mit Hibiskus und wilden Orchideen und einem kleinen Springbrunnen. Der Eßplatz mit rundem Tisch und vier Stühlen befand sich praktischerweise gleich vor dem Küchenfenster.
Kati nahm Teller und Besteck, Schüsseln und Gläser entgegen und stellte benommen fest, daß nicht einmal ein Serviettenständer fehlte.
Sie kam sich vor wie Alice im Wunderland bis zu dem Moment, da Serafina freundlich und bestimmt ablehnte, sich zu ihr zu setzen.
Aber das Essen war so köstlich, die selbstgebraute Zitronenlimonade mit Minzeblättchen so erfrischend und Serafinas Miene so zufrieden, daß sich der kleine Schatten rasch wieder verzog.
Die Mittagsstunde verbrachte Kati auf ihrem Bett liegend und vor sich hin träumend, nachdem sich Serafina bis zum nächsten Morgen verabschiedet hatte.
Am späten Nachmittag besichtigte Kati ihren kleinen Vorgarten, goß ein paar üppige Fettpflanzen neben dem Eingang und ein paar Küchenkräuter in einem Blumenkasten.
Sie sah zu, wie die Sonne hinter einer weiß leuchtenden Kirche im Kolonialstil unterging und zuckte erschrocken zusammen, als ein Motorroller heranbrauste, eine Staubfahne hinter sich her zog und mit Getöse vor dem Nebengärtchen zum Stehen kam.
»Hallo«, sagte der Fahrer und wandte ihr sein staubbedecktes Gesicht zu, »sind wir vielleicht Landsleute?«
»Könnte gut sein«, erwiderte Kati, die Gestalt in Jeans und T-Shirt neugierig betrachtend, »ich komme aus Deutschland.«
»Ich auch«, erklärte der Rollerfahrer mit bemerkenswertem Gleichmut und blies sich ein Büschel glatter heller Haare aus der Stirn, die ebenso verstaubt waren wie seine Unterarme, »die meisten in dieser Wohnanlage sind Deutsche. Ein paar Amerikaner gibt es auch, und ab und zu kommen zwei Italiener von einer Baufirma. Bist du neu im Land?«
»Kann man sagen, ja. Seit gestern. Ich habe eine Stelle in der deutschen Schule. Und du?«
»In der Botschaft. Übrigens, ich bin Christof.«
Er streckte ihr eine ölverschmierte Hand entgegen, die sie herzhaft schüttelte.
»Trägst du keinen Helm?« fragte sie erstaunt.
Er fuhr sich unwillkürlich durchs Haar.
»Ach so – wegen dem Roller! Nein, das tut hier kein Mensch!«
»Solltest du aber«, meinte Kati, nickte ihm zu und griff wieder nach ihrer Gießkanne.
»Man merkt’s doch immer gleich«, seufzte Christof.
»Was?«
»Wenn man eine Lehrerin vor sich hat!«
»Paß auf, daß ich dich nicht begieße!«
»Mit dem bißchen Wasser in dem Kännchen kannst du mich nicht schrecken! Außerdem muß ich sowieso jetzt duschen. Also, mach’s gut. Wenn du mich erreichen willst, brauchst du nur gegen deine Wohnzimmerwand zu hämmern. Oder in deinem Patio nach mir zu rufen. Wie heißt du überhaupt?«
»Kati.«
»Aus Bayern?«
»Nein, vom Niederrhein.«
»Na dann, Kati, adios und guten Start in Montelindo! Samstags um fünf ist bei mir Happy Hour. Würde mich freuen, dich zu sehen.«
»Was genau ist das?«
»Eine gute tropische Sitte. Drinks, Musik, nette Gesellschaft. Wird dir bestimmt gefallen. Ist ein guter Ausgleich zur strengen Schulordnung.«
Er warf seine staubigen blonden Haare zurück, grinste sie an und schob seinen Roller ins Haus.
Kopfschüttelnd kehrte Kati zu ihren Pflanzen zurück. Der war ja richtig verwildert, der Typ!
Und so was arbeitete in der Botschaft! Diplomaten, dachte Kati, habe ich mir immer ganz anders vorgestellt.
Den Abend verbrachte sie mit Eintragungen in ihr Tagebuch und einem langen Brief an ihre Eltern und Geschwister mit begeisterten Schilderungen ihrer neuen Umgebung.
Die Versuchung, auch an Achim zu schreiben, ging vorüber. Gott sei Dank. Schließlich war sie hier, um ihn zu vergessen. Zu tief hatte er sie enttäuscht.
Daran ließ sich im Nachhinein nichts mehr ändern, so sehr er es auch darauf anlegte.
Nein, sie wollte unerreichbar sein und bleiben, ihm keine Zeile schicken und vor allem keine Adresse.
»Vorbei ist vorbei!« sagte Kati laut in die Stille ihres Schlafzimmers, wo man die Musik aus dem Nachbarpatio nicht hören konnte.
Auf ihrem Bett liegend legte sie ein Vokabelheft an und notierte sich alle spanischen Wörter, die sie heute gehört hatte.
Am nächsten Morgen kam Serafina schon früh, zeigte Kati den eingebauten Safe hinter der Küche, gab ihr den Schlüssel und legte ihr nahe, alle Wertsachen einzuschließen.
Dann machten sie sich gemeinsam auf den Weg zu den kleinen Geschäften und dem großen Einkaufszentrum, wo es von Menschen wimmelte, dann überquerten sie die breite Straße, besuchten die schöne, kühle alte Kolonialkirche, in der gerade eine Taufe stattfand, und kehrten zurück in die vergleichsweise ruhige Umgebung der Wohnanlage mit den schmalen, von Araukarien gesäumten Wegen und den gepflegten Vordergärtchen.
Auf Anraten Serafinas hatten sie eine Tageszeitung gekauft, fast so dick wie ein Buch, mit vielen, leicht verschwommenen, bunten Bildern und unzähligen Anzeigen. Nichts, so erklärte Serafina, bringt einem Menschen die neue Heimat und die Umgangssprache so nahe wie die Tageszeitung. Noch effizienter erschien ihr das Fernsehprogramm, aber in Katis Behausung in der Caille Santa Trinidad Nummer 12 gab es aus unerfindlichen Gründen keinen Fernseher.
Nebenan, bei Don Christof, teilte Serafina ihrer neuen Schutzbefohlenen mit, könne sie, wenn sie wolle, sicher ab und zu wenigstens die Nachrichten sehen. Er nämlich habe sich einen Apparat gekauft, noch dazu einen tragbaren, der leicht überallhin mitzunehmen sei. Sogar an den Strand. Allerdings nicht auf einem Motorroller.
Aber manchmal verfüge Don Christof über ein Auto von der Botschaft. Sollte Kati etwas zu transportieren haben, würde er das sicher gern für sie erledigen.
Kati bedankte sich für die Information, hoffte jedoch zuversichtlich, ohne Don Christofs Hilfe auszukommen, jedenfalls vorläufig, und sah Serafina zu, die ein halbes Dutzend kleine grüne Bananen in einer großen Pfanne briet.
Sie schmeckten zuckersüß und waren so sättigend, daß Kati den Gemüseeintopf, der gleichzeitig fertig war, später in den Kühlschrank stellte für den nächsten Tag, den Sonntag, an dem Serafina frei hatte.
Abends um sechs Uhr landete ein Ping-Pong-Bällchen im Patio, das an die Happy Hour bei Nachbar Christof erinnerte, woraufhin sich Kati in einen langen Rock mit Bluse und Westchen warf und hinüberging. Sie fand ein kleines Grüppchen internationaler Jugend vor, bunte Vögel aus aller Herren Länder, die um acht Uhr abends loszogen zum Steak-Essen in einer Hazienda.
»Komm doch mit!« rief Christof.
Kati schüttelte entschieden den Kopf.
»Warum denn nicht?«
»Ich gehe doch nicht in ein Restaurant, wenn ich den ganzen Kühlschrank voll leckerer Sachen habe!«
Christof runzelte verdutzt die Stirn.
»Wenn du das so siehst, wirst du in Montelindo nie anderswo essen als zu Hause. Serafina wird dich immer mit allem versorgen! Sie ist eine Weltmeisterin im Kochen!«
Kati zuckte die Schultern, winkte der Gruppe zum Abschied zu und fiel im Hinausgehen fast über den Motorroller, der mitten im Wohnzimmer stand.
Höchste Zeit, daß ich hier wegkomme, dachte sie, ich bin ja schon leicht benebelt. Nach nur zwei Drinks! Aber die hatten es in sich! Meine Güte! Das scheint ja eine trinkfeste Bande zu sein! Im Vergleich dazu bin ich überhaupt nicht im Training!
In dieser Nacht schlief Kati so fest, daß sie weder die Rückkehr der feucht-fröhlichen Gesellschaft hörte noch die Klopfgeräusche an ihrer Wohnzimmerwand. Dafür war sie am Sonntagmorgen gegen acht Uhr so ausgeruht und munter, daß sie beschloß, in die Kirche zu gehen und eine Messe zu erleben. Anschließend, da alle Geschäfte offen waren, kaufte sie sich ein Eis, zwei kleine Brötchen und ein buntes Stirnband. Dann schlenderte sie gemächlich nach Hause.
»Hallo, Professora!« rief eine krächzende Stimme aus dem Nachbarpatio.
Kati, die reglos an ihrem runden Eßtisch über der aufgeschlagenen Zeitung saß, hob unwillig den Kopf.
»Nur der Ordnung halber«, gab sie knapp zurück, »ich bin Grundschullehrerin, nichts weiter!«
»Egal. Hier werden alle Lehrer mit Professor angesprochen. Warum bist du denn so grantig, hm? Du hast doch gar keinen Grund dazu!«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil du garantiert keinen Kater hast!«
»Du vielleicht?«
»Und ob! Ich habe mir gerade einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer gegönnt und einen heiligen Eid abgelegt!«
»Ach wirklich? Welchen denn?«
»Keinen Rum mehr zu kaufen, keine Cocktails mehr zu mischen und keine Happy Hour mehr zu veranstalten, zumindest keine, die länger als zwei Stunden dauert.«
»Ein löblicher Vorsatz! Wie oft hast du ihn schon gefaßt?«
»Mehrmals, ich gebe es zu, und meistens am Sonntag nach dem Aufwachen. Aber diesmal mache ich Ernst damit. Ehrlich. Sag mal, was treibst du eigentlich?«
»Ich lese die Zeitung.«
»Du hast nicht zufällig trockenes Brot im Haus?«
»Nur ein Brötchen und Toastbrot. Warum? Verträgt dein Magen nichts anderes?«
»Du sagst es.«
»Kommst du über die Mauer oder durch die Vordertür?«
»Frühsport steht heute nicht auf meinem Programm«, war die resignierte Antwort, »einen Klimmzug über die Zwei-Meter-Hürde würde ich auch gar nicht schaffen.«
»Schäm dich«, sagte Kati, stand auf und ging zur Vordertür.
Er trug pludrige bunte Baumwollhosen, ein ärmelloses rotes Shirt und ein Glas mit roter Flüssigkeit in der Hand.
»Aha, der Tomatensaft«, bemerkte Kati.
»Wenn ich ihn in deiner Gesellschaft trinken dürfte? Da schmeckt er zwar auch noch herb genug, aber so – ganz allein – kriege ich ihn überhaupt nicht runter«, murmelte Christof und schob sich durch die Tür.
Mit unverhüllter Neugier musterte er die winzigen Veränderungen, die Kati im Wohnzimmer vorgenommen hatte: eine dicke, blaue Kerze in einem Keramikleuchter stand auf der steinernen Fensterbank, zwei runde Kissen mit Sonnenmuster hellten das graue Sofa auf und eine kleine Fotosammlung in bunten Rahmen füllten das Ecktischchen.
»Du hast dich ja schon richtig häuslich eingerichtet«, stellte er anerkennend fest, »in zwei Tagen sieht es bei dir ja wirklich wohnlicher aus als bei mir nach zwei Jahren.«
»Ich brauche eben keinen Motorroller unterzubringen.«
»Richtig! Ich wünschte, ich hätte eine Garage! Wenn ich das Ding vor der Haustür abstelle, ist es binnen vierundzwanzig Stunden geklaut.«
»Na komm«, sagte Kati gnädig, »setz dich in mein Freiluft-Eßzimmer und iß ein trockenes Brötchen zu deinem schauderhaften Gemüsegebräu.«
Christof tat, wie ihm geheißen, schob die Zeitung beiseite und stellte sein Glas auf der blauen Tischdecke ab.
»Du kannst schon Spanisch lesen?«
»Mehr schlecht und recht. Serafina meint, es wäre eine gute Übung.«
»Ganz bestimmt. Aus dem gleichen Grund habe ich deutsche Illustrierten gelesen, bevor ich den Job in der Botschaft bekam.«
»Du mußtest Deutsch lernen, obwohl du Deutscher bist?« fragte Kati ungläubig.
Er rührte mit einem Strohhalm in seinem Glas, nahm das Brötchen entgegen und schenkte ihr ein dankbares Lächeln.
»Das wird mir guttun. Nun, ich mußte es nicht eigentlich lernen, dafür sorgten meine Mutter und die Lehrer in der deutschen Schule. Aber ich mußte höllisch aufpassen, daß ich es nicht gleich wieder verlerne. So was geht schneller, als man denkt, wenn man hier zu Hause ist und Deutschland nur vom Hörensagen kennt. Verstehst du?«
Ja, das verstand Kati durchaus.
Sie füllte sich ein Glas Zitronenlimonade aus dem großen Krug, den Serafina bereitet hatte, und setzte sich zu Christof an den Tisch. »Hör mal«, begann sie mit verhaltener Stimme und schob ihm die aufgeschlagene Zeitung zu, »da du dich hier so gut auskennst – kannst du mir sagen, was das soll?«
Er trank seinen Tomatensaft aus, kniff die Augen zusammen, schüttelte sich und beugte sich über das Blatt.
Das Brötchen knabbernd studierte er die vier verschwommenen Kinderfotos und die dazugehörigen Textspalten, während Kati an ihrer Limonade nippte.
»Das sind die ausgesetzten Kinder dieser Woche«, sagte er langsam, »sie wurden auf den Stufen der Kolonialkirche gefunden, gleich da drüben.«
»Ich weiß, wo sie liegt, ich war heute morgen dort in der Messe! Aber Christof, das ist doch erschütternd! Darüber kann ich doch nicht einfach hinwegblättern! Sieh dir doch mal dieses Gesichtchen an! Diese Verzweiflung! Bei einem sechs Monate alten Kind! Das ist ja nicht auszuhalten!«
Christof seufzte, warf sein feuchtes, frischgewaschenes Blondhaar zurück und beugte sich wieder über die Zeitung.
»Miguel Lesanto«, las er halblaut. »Tatsächlich, da steht, daß er ein halbes Jahr alt ist.«
»Aber woher wissen sie, wie er heißt?«
»Sie wissen es nicht. Sie geben jedem Kind einen Namen, sobald es im Waisenhaus aufgenommen wird. Irgendwie müssen sie es schließlich nennen.«
»Ja, natürlich, das sehe ich ein. Mit der Veröffentlichung werden Familien für diese Kinder gesucht, nicht wahr?«
»Genau.«
»Und wie stehen die Chancen?«
»Keine Ahnung.«
»Na hör mal, so was mußt du doch wissen, wo du hier aufgewachsen bist. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Erfahrungswerte.«
Christof lehnte sich zurück und sah angestrengt vor sich hin.
»Kati«, sagte er schließlich, »frag mich, wieviel Hubraum ein Landrover hat, frag mich, wieviel Sprit ein Motorroller pro Kilometer verbraucht, aber frag mich nicht, welche Chancen dieses Kerlchen hat!«
Er trommelte mit dem Zeigefinger auf das verschwommene Foto des Kleinkinds namens Miguel Lesanto.
»Na gut«, gab Kati unwirsch zurück, »dann werde ich es eben anderswo herausfinden.«
»Warum denn nur?«
»Weil es mich interessiert. Weil es mir keine Ruhe läßt. Weil es mir wichtiger ist als dein Motorroller und dein Spritverbrauch.«
Sie zog die Zeitung unter seiner Hand weg und nahm sie an sich.
»Jeder hat seinen Tick«, murmelte Christof gedehnt, »schon mal was von Toleranz gehört, hm?«
Kati schwieg.
»Irgendwie«, sinnierte Christof, »bist du anders als die Mädchen, die ich kenne.«
»Ach wirklich?«
»Ja.«
»Inwiefern?«
»Du bist schwierig.«
»Jetzt hör aber auf! Ich bin der unkomplizierteste Mensch, den man sich vorstellen kann!«
»Hahaha!«
»Doch, das bin ich. Unkompliziert, jawohl. Aber nicht oberflächlich. Das sind zwei ganz verschiedene Begriffe! Die kann man nicht einfach verwechseln!«
»Entschuldige bitte, Professora«, sagte Christof belustigt, verwirrt und etwas verunsichert, »Ich bin nur ein ungeschliffener Auslandsdeutscher. Die Feinheiten hat mir niemand beigebracht, oder besser gesagt: ich war nicht besonders erpicht darauf. Meine Mutter hat sich wahrhaftig alle Mühe gegeben«, er lachte, griff nach seinem leeren Glas und stand auf, »aber mein Widerstand war stärker! Na dann, schönen Sonntag! Hast du was Bestimmtes vor?«
»Nein, nichts Besonderes. Morgen ist mein erster Arbeitstag, da will ich frisch und ausgeruht sein.«
»Viel Spaß«, lächelte Christof im Hinausgehen, »und laß dich nicht unterkriegen von den Kids!«
Kati schloß die Tür hinter ihm, legte die Zeitung wieder auf den Tisch, strich sie glatt und vertiefte sich in die Seite mit den Kinderbildern. Miguel war nicht einmal der Jüngste. Aber sein Anblick schnitt ihr besonders ins Herz. Den runden, kleinen Kopf zurückgeworfen, weinte er hemmungslos. Ein Bild der Verlassenheit. Es ging ihr so nahe, daß sie sein verzweifeltes Stimmchen zu hören glaubte.
Statt mich dermaßen niederdrücken zu lassen, sollte ich etwas unternehmen, dachte Kati, faltete die Zeitung zusammen und packte sie in die bunte Stofftasche, die sie am nächsten Morgen mit in die Schule zu nehmen gedachte.
Im Vergleich zu den Erstkläßlern, die Kati während ihrer Ausbildung kennengelernt hatte, waren die Sechsjährigen in der Deutschen Schule von Montelindo diszipliniert, aufmerksam und leicht zu lenken. Fremd und scheu fühlte sich keines, denn sie alle hatten bereits den Kindergarten besucht, die Umgebung war ihnen vertraut. Die neue junge Lehrerin erregte Neugier, aber keine Befangenheit.
Die Lehrpläne schienen keine nennenswerten Problemen zu bieten. Eher schon die Eltern, denen eine fremde junge Person suspekt erschien und die vertraute Erscheinung Angelika Knobels lieber gewesen wäre.
Aber darüber machte sich Kati kein Kopfzerbrechen. Mit den Kindern würde sie zurechtkommen, davon war sie überzeugt. Sie hatte schon nach den ersten Stunden ein gutes Gefühl, und ihr ausgezeichnetes Namensgedächtnis kam ihr zur Hilfe.
Mittags, beim gemeinsamen Imbiß, wurde sie von den Knobels einem halben Dutzend Kollegen und Kolleginnen vorgestellt, die nur zum kleinen Teil aus Deutschland stammten, sich jedoch brennend dafür interessierten. Am späten Nachmittag, als Kati ihre bunte Tasche schulterte, um nach Hause zu gehen, hatte sie bereits drei Einladungen zum Abendessen und eine weitere für ein Konzert.
Um nicht unhöflich zu erscheine, hatte sie überall zugesagt und sich vorgenommen, einen Terminkalender zu führen.
Die Zeitung knisterte in der Tasche, aber es sollte noch eine Weile dauern, bis Kati eingehend mit jemandem darauf zu sprechen kommen konnte.
Serafina, bei der sie es am selben Tag versuchte, nickte nur bekümmert vor sich hin und meinte, es sei eine Schande, daß Kinder ausgesetzt würden. Selbst wenn es aus Not geschähe, eine Schande bliebe es trotzdem.
Soviel sie wisse, fänden nur die wenigsten Aufnahme in einer Familie. Nicht etwa, weil die Leute in Montelindo so hartherzig wären, ganz im Gegenteil. Aber die meisten könnten die Bedingungen nicht erfüllen, die an eine Adoption geknüpft seien. Man müsse ein festes Einkommen nachweisen, eine ausreichend große Wohnung und viele andere materielle Dinge, damit so ein armer Wurm nicht vom Regen unter die Traufe geriete. An diesen gußeisernen Bedingungen scheitere so manches Begehren potentieller Eltern, fügte Serafina traurig hinzu, um sich gleich wieder den Tagesproblemen zuzuwenden.
»Sie haben ja ihr ganzes Geschirr gespült«, bemerkte sie vorwurfsvoll, »das sollten Sie nicht tun, Senorita!«
»Nennen Sie mich Katharina«, bat Kati, »und gewöhnen Sie sich daran, daß ich mein Geschirr abwasche, wann immer ich Zeit dafür habe.«
»Sie sollten sich mit anderen Dingen beschäftigen«, murmelte Serafina kopfschüttelnd, »so, wie die deutschen Männer. Don Christof zum Beispiel«, ihre Stimme klang wohlgefällig, »hat noch nie ein Glas gespült, noch nie!«
»Don Christof hat auch nie in Deutschland gelebt«, erwiderte Kati kurz, »und wenn er es täte, er würde sich wundern!«
Den nächsten Vorstoß machte sie bei den Knobels. Nach dem Klavierkonzert in der Aula der Universität, zu dem das gesamte Kollegium eingeladen war, traf man sich in der Mensa, wo auf langen Tischen ein bescheidenes Büffet aufgebaut worden war.
»Nehmen Sie eine dieser spanischen Omeletten«, empfahl Angelika Knobel, »sie sind mit Bratkartoffeln gefüllt und wunderbar gewürzt, erinnern mich immer an ein deutsches Bauernfrühstück.«
Kati bediente sich rasch und reichlich.
Es war fast Mitternacht. Seit einer Ewigkeit hatte sie nichts Vernünftiges mehr zu sich genommen. Taumelnd vor Hunger folgte sie Frau Knobel zu einer tiefen Fensternische.
»Ja, an die späten Abendessenszeiten in Montelindo muß man sich erst gewöhnen«, bemerkte die Frau des Schulleiters mitfühlend.
»Kann man das?« fragte Kati zweifelnd.
Angelika Knobel wiegte schmunzelnd den schmalen Kopf.
»Wir nicht«, gestand sie, »mein Mann und ich haben jeden Abend um sieben Uhr unsere Hauptmahlzeit, auch dann, wenn wir zu einem großen Essen gehen. Anfangs wußten wir noch nicht, daß ein Abendessen in Montelindo nicht vor elf Uhr serviert wird, obwohl man für acht Uhr eingeladen ist. Das Essen ist der Abschluß einer jeden Abendeinladung. Die Gäste verabschieden sich, sobald sie den letzten Bissen heruntergeschluckt haben, und das geschieht nie vor Mitternacht.«
»Gut, daß Sie mir das sagen«, murmelte Kati, »von jetzt an esse ich auch um sieben Uhr zu Hause. Ich habe diese Woche noch ein paar Einladungen vor mir, die ich sonst gar nicht überstehen würde.«
Angelika Knobel lachte.
»Ich finde, Sie leben sich erstaunlich schnell ein. Keine Magenbeschwerden, keine Kreislaufprobleme. Sie sind eben noch jung und frisch! Beneidenswert!«
»Warten wir’s ab«, murmelte Kati, deren Magen soeben schmerzlich zu drücken begann, »ich merke schon, daß ich es mir nicht oft leisten kann, stundenlang den Hunger zu übergehen und mich dann so vollzustopfen wie jetzt.«
»Trinken Sie einen Schluck Kokosmilch«, riet die erfahrene Frau Knobel, »Nichts besänftigt die Magennerven besser. Mein Mann schwört darauf als Schlaftrunk – mit oder ohne einen Schuß Rum. Gefällt Ihnen das Häuschen in der Caille Trinidad?«
»Ich habe noch nie so komfortabel gewohnt«, erwiderte Kati wahrheitsgemäß, »ich komme mir richtig privilegiert vor. Genau das macht mir auf der anderen Seite auch wieder zu schaffen.«
»Auf welcher Seite?«
»Also«, begann Kati, holte tief Luft und sprudelte ihre ganze Reaktion auf die Zeitung vom Wochenende hervor, auf die Seite mit den Fotos der ausgesetzten Kleinkinder, die Verzweiflung im Gesichtchen des kleinen Miguel, alles, was ihr so bedrückend erschien.
Angelika Knobel hörte ruhig zu.
»Ja, die Probleme dieser Länder lassen sich nicht verbergen«, sagte sie schließlich, »wer hier lebt, wird damit konfrontiert. Viele bringen es fertig, darüber hinwegzusehen. Uns hat das Elend auch immer belastet, von Anfang an.«
»Was kann man tun?« fragte Kati eifrig.
»Zunächst einmal darf es nicht nach Einmischung aussehen«, erklärte Frau Knobel eindringlich, »was auch immer man unternimmt – es muß sorgfältig bedacht und abgewogen werden. Die Menschen hier sind außerordentlich empfindlich, und so manche gute Tat kam nicht zustande, weil sie als Besserwisserei aufgefaßt wurde. Im Falle der Kinder, die Ihnen so zu Herzen gehen, wüßte ich auch gar nicht, wo man ansetzen könnte. Warten Sie mal«, Angelika Knobel richtete sich auf und ließ den Blick über die wogende Menge schweifen, »vorhin habe ich Dona Herta gesehen, aber sie scheint schon wieder gegangen zu sein.«
»Wer ist das?«
»Eine deutsche Dame älteren Jahrgangs, sozusagen eine Institution in Montelindo. Sie verwaltet sämtliche Hilfsfonds und hat daher eher Zugang zu den verschiedenen Einrichtungen, wahrscheinlich auch zum Waisenhaus. Schade, daß sie schon weg ist. An sie heranzukommen ist schwer, denn abgesehen davon, daß sie viel zu tun hat, ist sie auch sehr zurückhaltend. Nun, vielleicht gelingt es uns trotzdem, sie bei nächster Gelegenheit einmal anzusprechen.«
Kati nickte, obwohl das alles nicht besonders zuversichtlich klang und die Aussicht, Dona Herta jemals zu Gesicht zu kriegen, eher gering schien.
Solange warte ich gar nicht, dachte Kati und trank ihren Becher Kokosmilch aus, am Samstag, wenn ich frei habe, kaufe ich ein paar Sächelchen und nehme mir ein Taxi ins Waisenhaus. Es wird ja wohl nicht verboten sein, den Kindern etwas zu schenken.
Angelika Knobel nahm ihren leeren Teller von der Fensterbank und sah Kati prüfend an, so, als könne sie Gedanken lesen.
»Die Leiterin des Waisenhauses heißt Dona Dolores«, sagte sie mit einem warnenden Unterton in der Stimme, »man sagt allgemein, mit ihr sei wirklich nicht gut Kirschen essen.«
Kati rückte verlegen ihr Stirnband zurecht. Was war nur mit ihr los? Seit wann sah man ihr an, was sie dachte?
Zu ihrer Erleichterung näherte sich vom Büffet her ihr Chef, Erich Knobel, der demonstrativ auf seine Armbanduhr zeigte.
»Um acht Uhr fängt die erste Stunde an«, raunte er, ein paar Studenten beiseite schiebend, »Angelika, wir gehen! Und Sie, Katharina, nehmen wir mit!«
»Keine Happy Hour heute«, erklärte Christof, der in seinen pludrigen bunten Baumwollhosen vor seinem Roller auf den Knien lag und mit einem Schraubenzieher hantierte, »es ist zwar Samstag, aber ich habe keine Zeit.«
»Ich auch nicht«, erwiderte Kati, ihre Blumen im Vordergärtchen gießend.
»Morgen könnte ich dir eine Fahrt an den Strand bieten«, kam seine Stimme gepreßt unter dem Schutzblech hervor, »vorausgesetzt, daß ich die Mühle heute noch in Schwung bringe.«
»Nett von dir, vielen Dank, aber ich habe noch jede Menge zu tun.«
»Hast du kein Vertrauen zu mir?«
»Doch, aber nicht zu deinem Roller.«
»Puuuh«, machte Christof und blies sich die Haare aus der Stirn, »ist das heiß heute! Ich gäbe was drum, jetzt ins Meer springen zu können! Oder wenigstens in einen Swimming-Pool. Ich nehme an, du hast eine entsprechende Einladung.«
»Was für eine Einladung?«
»Zu einer Pool-Party irgendwo bei deinen Kollegen.«
»Was du für Ideen hast!« wunderte sich Kati.
»Also nicht?«
»Nein, wirklich nicht.«
Sekundenlang war sie versucht, ihn in ihren Plan einzuweihen, aber dann sah sie davon ab.
Etwas später, als sie mit ihrer Reisetasche das Haus verließ und zum Taxistand ging, war er mitsamt seinem Roller verschwunden.
Das Waisenhaus lag im heißen, brodelnden Zentrum der Stadt, wo der Verkehr ins Stocken geriet, weil die Straßen von Menschen wimmelten, wo ahnungslose Fremde sich bedrängt und bedroht fühlten, wo nichts an die hübschen, mit schattigen Bäumen bestandenen Straßen erinnerte, die es im höher gelegenen Stadtteil gab.
Auch das Waisenhaus hatte absolut nichts gemeinsam mit den freundlichen, ebenerdigen, weitläufigen Anlagen der Deutschen Schule.
Es war ein würfelförmiger, alter Bau, vormals ein Regierungsgebäude, das an einem großen Platz lag, Tag und Nacht umbrandet vom Kreisverkehr: klapprige Busse, Laster, Motorräder, Taxis und Schrottfahrzeuge aller Art knatterten, qualmten, dröhnten und hupten um die Wette.
Zwei staubige Palmen flankierten den Eingang, von dessen einstiger Pracht nur noch ein Rundbogen zeugte. Darauf stand in abblätternder Goldschrift: Casa de Santa Monica.
Kati drückte dem Taxifahrer das Geld in die Hand und schwenkte energisch die Reisetasche, gefüllt mit Babysachen, auf die flachen Stufen der ehemaligen Freitreppe.
Aufatmend blieb sie stehen und legte sich ihr Sprüchlein auf Spanisch zurecht, als sich das altersschwache Portal wie von Geisterhand öffnete und eine krächzende Stimme sie darauf hinwies, daß die Bushaltestelle sich drei Häuser weiter befinde.
»Aber ich will nicht zum Bus«, beeilte sich Kati zu versichern, »ich will ins Waisenhaus.«
»Warum?«
»Nur einen Besuch machen – ich habe ein paar Geschenke mitgebracht.«
Ein zerknittertes braunes Gesicht erschien, eine knochige alte Hand streckte sich Kati entgegen.
»Geben Sie die Sachen her!«
»Nein«, sagte Kati, hob die Tasche von der Stufe und preßte sie an sich zum Zeichen ihrer Entschlossenheit.
»Was ist da draußen los, Pilar?« rief eine ungeduldige spanische Stimme aus dem dunklen Hintergrund.
»Jemand will herein.«
»Wer ist es?«
»Eine Dame, eine Fremde —«
Schritte erklangen, und eine hagere schwarz gekleidete Person unbestimmbaren Alters starrte Kati mißtrauisch aus zusammengekniffenen Augen an.
»Was wünschen Sie, Senora?«
»Ich komme von der deutschen Schule«, erklärte Kati, der eine innere Stimme plötzlich zu einer anerkannten Legitimation riet, »wir haben einige Sachen gesammelt für die Kinder hier – mein Spanisch ist leider noch sehr schlecht – entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich nicht richtig ausdrücke.«
Die schwarz gekleidete Frau im Türrahmen machte eine nervöse Handbewegung. Ihre abweisende Miene wurde um einen Schein freundlicher.
»Schon gut. Wir haben öfters mit Deutschen zu tun. Falls Dona Herta Sie geschickt hat – eine Wohltäterin unseres Hauses.«
»Oh, Dona Herta«, wiederholte Kati, sich an den Namen klammernd wie an einen Strohhalm, »und Dona Angelika Knobel und Don Erich…«
»Kenne ich nicht«, unterbrach die nervöse Person, von der Kati annahm, daß sie die Leiterin des Waisenhauses war, Dona Dolores, vor der Frau Knobel sie gewarnt hatte, »wenn Sie mir jetzt die Spende aushändigen würden – oder brauchen Sie eine Quittung?«
»Nein, das nicht, aber die Tasche müßte ich wieder mitnehmen.«
»Kommen Sie herein«, sagte Dona Dolores ungnädig, »und warten Sie hier! Pilar«, sie drehte sich um, »geh einen Korb holen!«
Die kleine Alte tauchte auf und verschwand wie ein Spuk.
In die geflieste dämmerige Halle fiel nur wenig Licht. Es war kühl und gruftig. Kati fröstelte, wartete und sah sich verstohlen um. Hinter zwei halb offenen Türen erspähte sie ein Kinderbettchen neben dem anderen. Außer einem gelegentlichen Wimmern und Räuspern war nichts zu hören.
»Wir halten gerade unsere Siesta«, sagte Dona Dolores und huschte über die Fliesen, um beide Türen mit Nachdruck zu schließen.
»Darf man die Kinder nicht besuchen?« fragte Kati halblaut in die unnatürliche Stille.
»Nur in besonderen Fällen«, erwiderte Dona Dolores, »und auch dann nur nach Vereinbarung. Sehen Sie«, ihre Stimme senkte sich, »wenn wir die Regel lockern würden, gäbe das zuviel Unruhe. Ein ständiges Kommen und Gehen täte weder den Kindern noch dem Personal gut. Dona Herta kennt ja die Grenzen, die uns gesetzt sind.«
Die kleine Alte schlurfte wieder herbei, stellte einen Korb auf den Boden und füllte den Inhalt der Reisetasche hinein.
»Sie haben ja lauter neue Sachen gebracht«, bemerkte Dona Dolores stirnrunzelnd.
»Ja, zum Anziehen für Babys zwischen sechs und neun Monaten.«
»Sagten Sie nicht, Sie hätten sie gesammelt?«
»Wir – nun, wir haben dafür zusammengelegt«, stammelte Kati und tat so, als verstünde sie nur die Hälfte, und Dona Dolores Miene besagte, daß sie es ihr auch nur zur Hälfte glaubte.
»Nun, wie auch immer«, sagte sie steif, »wir danken Ihnen im Namen der Kinder von Santa Monica. Grüßen Sie Dona Herta von mir.« Damit öffnete sie die schwere Eingangstür und fügte unmißverständlich hinzu: »Adios, Senora, kommen Sie gut wieder nach Hause!«
Alte Hexe! dachte Kati, die Tasche wütend schwenkend. Keinen einzigen Blick auf die Kleinen hat sie mir gegönnt! Na warte! Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder, und ich lerne hochgestellte Persönlichkeiten von großem Einfluß kennen, vor denen sich diese Türen wie von selbst öffnen.
An diesem Gedanken berauschte sie sich nur so lange, bis ihr Dona Herta einfiel, deren Namen sie soeben mißbraucht hatte.
Du lieber Gott! Wenn die zickige Dolores nun auf die Idee kam, sich bei Dona Herta nach einer gewissen jungen Deutschen zu erkundigen, die sozusagen in ihrem Auftrag Babyklamotten abgeliefert hatte!
Wer weiß, welche Mißverständnisse sich daraus entwickeln konnten!
Da gehe ich niemehr hin, dachte Kati, das abweisende Gebäude mit einem letzten Blick umfassend, bevor sie in ein klappriges Taxi stieg. Aber dann fiel ihr Miguel ein, sein kleines verweintes Gesicht, sein verzweifelt zurückgeworfenes Köpfchen, und sie knallte die Tasche auf den Rücksitz, knirschte mit den Zähnen und gab einen trotzigen Laut von sich.
Der Fahrer sah sich erstaunt nach ihr um.
So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen! dachte Kati und beugte sich über die schmuddelige Lehne. »Ich möchte in die Caille Trinidad Nummer zwölf. Kennen Sie übrigens das Waisenhaus? Waren Sie da schon einmal drin?«
»Ach ja, Senora«, er lächelte melancholisch und gab Gas, »lange genug. Von meinem dritten bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr!«
»Irgend etwas stimmt da nicht«, sagte Dona Dolores mit bebender Stimme, »ich habe es sofort gemerkt! Diese junge Deutsche kam mir verdächtig vor!«
»Und sie hat sich wirklich auf mich berufen?« fragte Herta Hersfeld zweifelnd.
»Ja, so wahr ich hier stehe! Es ist erst eine halbe Stunde her. Sie hatte diesen scharfen, kontrollierenden Blick, den sie durch den Türspalt ins Babyzimmer wandern ließ. Sie wissen ja, wie sehr ich mich vorsehen muß. Es gibt immer undurchsichtige Elemente, die sich an unsere Kinder heranmachen. Der Menschenhandel blüht nach wie vor, auch wenn einzelne Fälle nicht mehr bekannt werden.«
»Ich weiß, ich weiß«, murmelte Herta Hersfeld und angelte nach ihrer Kaffeetasse, »aber da die junge Frau sich so ungeschickt verhalten hat, besteht die Hoffnung, daß sie nicht viel kriminelles Potential besitzt. Trotzdem werde ich der Sache nachgehen, Dona Dolores. Sie können sich darauf verlassen.«
»Wie ich schon sagte«, wisperte Dona Dolores, »außer Ihnen hat sie die deutsche Schule erwähnt. Aber vielleicht weiß man dort auch nichts.«
Herta Hersfeld legte den Hörer auf, seufzte und warf einen Blick auf die goldenen Ziffern der kleinen alten Pendulen-Uhr, die unter ihrem Glassturz tickte.
Halb drei. Immer noch Siesta-Zeit in Montelindo.
Noch dazu war es Samstag, und jedem galt das Wochenende als heilig.
Aber Dona Dolores war ebenso hartnäckig wie mißtrauisch. Nicht zuletzt deshalb stand sie dem Waisenhaus seit zwanzig Jahren vor. Spätestens heute abend würde sie sich wieder melden mit der Frage, was die Leitung der deutschen Schule zu dem seltsamen Auftritt der jungen Frau in der Casa de Santa Monica geäußert hatte.
Herta Hersfeld stand auf, um die Kaffeemaschine noch einmal anzuwerfen, ein Gerät, das außer ihr und dem Botschafter kein Mensch in Montelindo besaß.
Auch die Tatsache, daß sie ein Apartment im ersten Stock eines Geschäftshauses bewohnte, war untypisch für eine Frau ihres Alters und ihres Standes. Normalerweise hätte sie in einer Villa mit Schwimmbad logieren und mindestens zwei Dienstboten beschäftigen müssen. Aber über all diese gesellschaftlichen Zwänge war Herta Hersfeld schon lange hinaus.
Der große Wohnraum, mit Antiquitäten und Erinnerungsstücken ausgestattet, diente ihr als Büro, die Terrasse mit üppig rankenden blühenden Pflanzen als Sitzplatz. Küche, Bad und Schlafzimmer lagen hinter einem bogenförmigen Durchgang.
Die Wohnung war leicht zu bewirtschaften, bedurfte außer einer Zugehfrau keines Personals und lag in unmittelbarer Nähe des großen Einkaufszentrums. Herta Hersfeld in ihrem fünfundfünfzigsten Jahr weinte dem verschachtelten Hanghaus mit seinen undurchdringlichen Gärten, das sie früher bewohnt hatte, keine Träne nach.
In ein bequemes weites Gewand aus braunem Leinen gekleidet, das ihre hagere Gestalt bis zu den Waden umhüllte und nur am Halsausschnitt eine schmale Stickereiborte aufwies, ging Herta, die Kaffeetasse in der Hand, ungeduldig vor ihrem Schreibtisch auf und ab. Ihr dichtes, erdbraunes Haar war kurz geschnitten, ihre bernsteinfarbenen Augen blickten von Zeit zu Zeit auf die Uhr.
Na endlich! Halb vier. Jetzt durfte man es wagen, die Knobels anzurufen, ohne allzu unhöflich zu erscheinen.
»Das kann nur unsere neue Junglehrerin gewesen sein«, meinte Erich Knobel bedächtig, nachdem ihm Herta den Sachverhalt erklärt hatte, »schade, daß meine Frau gerade beim Frisör ist. Sie könnte Ihnen genauer Auskunft geben. Wir haben schon versucht, Katharina von allen Aktivitäten abzubringen, die sie sich in den Kopf gesetzt hat – ohne Erfolg, wie ich nun festellen muß.«
»Katharina?«
»So heißt sie. Katharina Busch. Jung, idealistisch, frisch aus der Heimat importiert – sie kann sich mit den Gegebenheiten noch nicht abfinden. Aber sie wird es lernen, wie wir es alle gelernt haben. Keinesfalls steckt irgendeine unlautere Absicht hinter ihrem Besuch in der Casa de Santa Monica. Das kann ich Ihnen guten Gewissens versichern. Wollen Sie vielleicht selbst mit ihr sprechen?«
»Nicht unbedingt«, sagte Herta zögernd.
»Es könnte hilfreich sein, Frau Hersfeld.«
»Nun, da sie sich auf mich bezogen hat, ohne mich auch nur zu kennen, wäre es tatsächlich angebracht. Wer weiß, was sie sich noch einfallen läßt!«
Erich Knobel ließ ein unbehagliches Lachen hören.
»Also damit brauchen wir wohl nicht zu rechnen. Trotzdem will ich gern veranlassen, daß sie sich bei Ihnen meldet.«
»Das kann nicht schaden«, erwiderte Herta trocken, »ich wünsche Ihnen ein schönes Wochende, und grüßen Sie Ihre Frau von mir!«
Gegen sechs Uhr, als Herta Hersfeld das Haus verließ, um sich ein paar frische Tortillas an der Ecke zu kaufen, sah sie ein Mädchen in der Passage stehen und ein halbes Dutzend Klingelknöpfe studieren, die ohne Namensschilder in eine große, polierte Steinplatte eingelassen waren.
Herta ging hinüber zu dem offenen Öfchen, plauderte ein bißchen mit der Tortilla-Bäckerin, ließ sich einen kleinen Stapel der heißen Fladen einpacken und traf das Mädchen immer noch vor der geschlossenen Eingangstür in der Passage an.
Herta steckte den Schlüssel ins Schloß und hielt plötzlich inne, weil ihr ein Gedanke kam.
»Suchen Sie jemanden?« fragte sie auf Deutsch.
Das angespannte junge Gesicht strahlte auf vor Erleichterung.
»Ja – ich suche Dona Herta Hersfeld.«
»Sie haben sie gerade gefunden«, sagte Herta gelassen, »normalerweise empfange ich keine Besuche ohne vorherige telefonische Anmeldung.«
»Oh, das tut mir leid, ich hatte Herrn Knobel so verstanden, daß ich Sie sofort aufsuchen soll.«
»Aha. Sie sind also die junge Lehrerin, die sich im Waisenhaus auf mich berufen hat!«
»Ich bin Katharina Busch«, stammelte das Mädchen, das ein blaues, mit Sternen besätes Kleid trug, »Sie können mich gern Kati nennen!«
»Na, dann herein mit Ihnen«, sagte Herta und schloß endlich die Tür auf.
»Es stehen keine Namen an den Klingelschildern«, bemerkte das Mädchen verwirrt.
»Aus Sicherheitsgründen.«
»Und Briefkästen gibt es auch keine?«
»Nein, wir haben Postfächer.«
»Ich hätte Sie ja nie gefunden«, murmelte Kati, die steinerne Innentreppe hinauf stolpernd, »wenn Sie nicht zufällig gekommen wären!«
»Nein, gewiß nicht«, bestätigte Herta, »ich habe auch nicht damit gerechnet, daß Sie mich aufsuchen, nur, daß Sie mich anrufen.«
»Ach wissen Sie, ich habe in meinem Häuschen kein Telefon. Herr Knobel hat Serafina zu mir geschickt mit der Nachricht, ich solle mich so bald wie möglich bei Ihnen melden. Serafina ist die Haushaltshilfe für die ganze Nachbarschaft, sie kennt sich überall aus – sie wußte sogar, wo Sie wohnen.«
»Kein Wunder«, murmelte Herta, wies ihrem unangemeldeten Besuch einen Rattanstuhl auf der Terrasse an und ging in die Küche, um die Tortillas abzulegen.
Als sie zwei Gläser und eine Karaffe Orangensaft brachte, hatte Katharian Busch den kleinen Tisch bereits mit einer Zeitung bedeckt.
»Hier«, sagte sie eindringlich und tippte mit dem Zeigefinger auf ein verschwommenes Foto, »können Sie sehen, um wen es mir geht. Er heißt Miguel. Ich habe ja bestimmt alles falsch gemacht, was man überhaupt verkehrt machen kann, aber ich bin bereit, noch einmal ganz von vorn anzufangen!«
Herta stellte die Karaffe und die Gläser auf der Terrassenmauer ab und warf einen widerstrebenden Blick auf die vier abgebildeten Kleinkinder. Sie griff mechanisch nach der Brille, die sie an einem goldenen Kettchen um den Hals trug, und beugte sich über das Blatt. Das Baby namens Miguel, soviel sah man gleich, war ein kleiner Indio-Junge, mit kahlem, kugelförmigen Köpfchen und den üblichen Mangelerscheinungen: dünnen Gliedmaßen und unterentwickeltem Knochengerüst.
»Und was wollen Sie für ihn tun?« erkundigte sich Herta sachlich.
»Ich möchte mich um ihn kümmern«, erklärte das merkwürdige Geschöpf, dessen Augen mit dem Blau seines Kleides um die Wette leuchteten.
»Soviel ich weiß, sind Sie als Lehrerin in der deutschen Schule angestellt«, bemerkte Herta, »wann wollen Sie sich da noch um ein bedürftiges Kind kümmern?«
»In meiner Freizeit«, war die entschlossene Antwort, »ich würde es gern tun – richtig, regelmäßig, zuverlässig – nicht so halbherzig, wie Sie vielleicht befürchten.«
Herta verkniff sich ein Lächeln.
»Also das«, sagte sie, ihre Brille absetzend, »befürchte ich eigentlich weniger. Die Schwierigkeit liegt woanders.«
»Bei Dona Dolores, nicht wahr?«
»Auch. Vor allem aber an den Regeln, den Vorschriften, den ganzen Strukturen, die einem Waisenheim zugrunde liegen. Wir können uns nicht einfach darüber hinwegsetzen, nur weil wir aus Europa kommen und anderes gewöhnt sind. Es ist nicht einmal gesagt, daß unsere Sicht der Dinge die einzig wahre ist.«
»Das will ich auch gar nicht behaupten«, ereiferte sich Kati, »ich will auch keine Kritik üben. Ich will ja nur diesem kleinen Jungen etwas von dem geben dürfen, das er sichtlich braucht: Wärme und Zuneigung. Wenn Sie mir sagen, das ist nicht möglich, weil keine Ausnahmen gemacht werden können – gut, dann kümmere ich mich eben auch um das halbe Dutzend, das mit ihm zusammen ist. Hauptsache, ich komme an ihn heran!«
»So leicht, wie Sie sich das vorstellen, lassen sich solche Pläne nicht verwirklichen«, sagte Herta Hersfeld mit Nachdruck, schlug die Zeitung zu und stellte die beiden Gläser auf den Tisch, »das gilt nicht nur für die Casa de Santa Monica in Montelindo, sondern für jede Einrichtung dieser Art. Hier jedoch ist man ganz besonders auf der Hut, denn so manches Kind ist spurlos verschwunden in den letzten Jahren, abgesehen von den Säuglingen, die verschachert worden sind. Niemand würde behaupten, daß ein Waisenhaus ein ideales Umfeld ist, was schon daraus hervorgeht, daß Donna Dolores rastlos und unermüdlich nach Eltern für ihre Schützlinge sucht. Aber solange ein Kind in der Casa de Santa Monica ist, wissen wir wenigstens, wo man es finden kann, wie es sich entwickelt, was aus ihm wird. Ein ungewisses Schicksal, das sich jeder Kontrolle entzieht, ist bei weitem das größere Übel. Und nun trinken Sie einen Schluck, Sie sehen ja schon ganz ausgedörrt aus!«
Kati nickte zerstreut, griff nach dem Glas und leerte es mit einem langen Zug.
»Aah, das tut gut!«
»Nur zu! Ich habe noch mehr davon«, sagte Herta belustigt, »wie wäre es mit ein paar Tortillas? Oder sind Sie mit den einheimischen Eßgewohnheiten noch nicht vertraut?«
»Serafina kocht für mich«, erwiderte Kati, »ob ich will oder nicht. Es ist ihr Job, und sie macht ihn toll. Aber sie hat sich auf deutsche Gerichte spezialisiert, denn sie arbeitet vorwiegend für Deutsche. Deshalb kenne ich die hiesige Küche überhaupt nicht.«
»Na, dann werden Sie jetzt mal eine kleine Kostprobe bekommen. Tortillas mit Käse. Ich hole sie mir gelegentlich abends unten an der Ecke.«
»Reichen sie denn für mich mit? Sie haben schließlich nicht mit mir gerechnet«, wandte Kati ein.
»Wenn nicht, gehen wir hinunter und holen Nachschub«, erwiderte Herta sorglos.
Es kam selten vor, daß sie mit jemandem in ihrem Apartment aß. Einladungen, die sie regelmäßig vornehmen mußte, um sich zu revanchieren, tätigte sie seit der Aufgabe des Hauses nur noch in einem guten Restaurant. Das hatte den Vorteil, daß man nicht bis zum bitteren Ende ausharren und zu später Stunde noch Kaffee servieren mußte, während sich das Geschirr in der ganzen Küche stapelte und die letzten alkoholisierten Gäste ihre endlosen Lebensgeschichten erzählten.
Dergleichen hatte Herta auch früher schon gestört, aber mit fortschreitenden Jahren war sie diesem Ausklang einer jeden Abendeinladung in den eigenen vier Wänden zunehmend überdrüssig geworden.
Wo auch immer sie selbst zu Gast war, gehörte sie stets zu den ersten, die sich verabschiedeten, und da sie schon lange eine Gewohnheit daraus gemacht hatte, zeigte sich niemand mehr befremdet darüber.
Ausnahmsweise erschien es ihr nicht unangenehm, die Tortillas mit der frisch aus Deutschland importierten Jung-Lehrerin zu teilen, die so überraschend hereingeschneit war.
Ganz im Gegenteil. Die Gedankengänge der Katharina Busch, so unorthodox sie auch sein mochten, boten sich als Gesprächsthema eher an als das übliche Party-Geschwätz.
Außerdem, falls man sich dazu durchringen sollte, ihr behilflich zu sein, war es unbedingt erforderlich, sie besser kennenzulernen.
Gegen acht Uhr, als Kati noch einmal gegangen war, um weitere Käse-Tortillas zu kaufen – die Dinger waren ja nur handtellergroß – rief Herta Hersfeld in der Casa de Santa Monica an, um Dona Dolores weitgehend zu beruhigen.
Die junge Deutsche war über jeden Zweifel erhaben. Sie hatte vorzügliche Referenzen.
Ihr einziges Problem war die spanische Sprache. Aber das würde sich mit der Zeit noch lösen.
»Möglicherweise«, schloß Herta mit Bedacht, »eignet sie sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich könnte mir vorstellen, sie gelegentlich einzusetzen.«
»Für den Hilfsfond?« fragte Dona Dolores ehrfürchtig.
»Wir wollen sehen«, entwortete Herta Hersfeld, »was sich ergibt und wieviel Zeit sie erübrigen kann. Schließlich gehört sie zum Kollegium der Deutschen Schule. Nächste Woche komme ich zu einer kleinen Besprechung zu Ihnen. Bis dahin kann ich Ihnen vielleicht schon mehr sagen.«
»Ich danke Ihnen, Dona Herta«, preßte Dona Dolores inbrünstig hervor, »Sie sind uns jederzeit willkommen!«
Den Sonntag verbrachte Kati in einer seltsamen Stimmung.
Erstmals seit sie in Montelindo war, dachte sie unausgesetzt an ihre Heimat, an ihre Familie und an Achim Unger.
Es lag wahrscheinlich daran, daß sie gestern bei Dona Herta so offenherzig gewesen war und ihre ganze Beziehungsgeschichte erzählt hatte.
Meine Güte, dachte Kati, die Arme hinter dem Kopf verschränkt in einem Liegestuhl ausgestreckt, ich habe ja wirklich nichts ausgelassen! Armer Achim! Es wäre ihm bestimmt furchtbar peinlich! Normalerweise bin ich ja auch nicht so geschwätzig. Vielleicht mußte ich es nur einfach mal loswerden. So bald werde ich nicht mehr darüber reden. Im Grunde geht es ja auch keinen etwas an.
Kati versuchte, an etwas anderes zu denken, aber irgendwie blieb Achim gegenwärtig.
Sie kannten sich seit ewigen Zeiten, hatten zusammen im Sandkasten gespielt, sich an Kindergeburtstagen um die Preise gestritten und beim Tanzkurs gegenseitig auf die Füße getreten.
Nähergekommen waren sie sich, nachdem sie Battenberg verlassen hatten, um zu studieren, Kati Pädagogik, Achim Machinenbau. Drei Jahre lag wohnten sie im selben Haus, Kati mit zwei anderen Mädchen im ersten Stock, Achim mit zwei Studienkollegen im Erdgeschoß.
Sie galten als das ideale Paar, weil sie auf eine gemeinsame Heimatstadt und eine gemeinsame Kindheit zurückblicken konnten. Achim mit seinem karottenfarbenen Wuschelkopf und den karierten Holzfällerhemden war ein unverwechselbarer Typ, er sah lustig aus und galt als alternativ. Er spielte Saxophon und Schlagzeug, leitete vorübergehend eine Studenten-Band, gründete einen Schachklub und gab Nachhilfestunden in Mathematik.
Er war mitreißend, gesellig, aufgeschlossen, und im Laufe der Zeit nahm er auch das Studium ernster.
Alles hätte ein denkbar gutes Ende genommen, wäre da nicht jener vertrackte Verdacht auf Schwangerschaft aufgetaucht, der Kati zwar nervös, aber nicht unglücklich machte. Was konnte schon passieren? Sie hatte ihre Abschlußprüfung bereits hinter sich, mit Achim war sie sich seit drei Jahren einig, einer Heirat stand nichts im Wege, war nur noch eine Frage der Zeit.
Dachte Kati.
Achims Reaktion stürzte sie aus dem Himmel der Liebe ins tiefe Tal der Illusionslosigkeit.
Im Prinzip, erklärte Achim, wolle er natürlich Nachwuchs, ganz klar. Nur nicht gerade jetzt.
Man müsse dergleichen unsentimental sehen, zukunftsorientiert, frei von emotionalen Verdrängungen.
Gerade weil ihm ein Kind viel bedeute, müsse er zum gegenwärtigen Zeitpunkt darauf verzichten, aus ökonomischen Gründen, aus lerntechnischen Gründen, aus
räumlichen Gründen, und auch deshalb, weil er sich noch nicht reif genug dafür fühle.
»Du elender Feigling«, hatte kati gerufen, »Hör auf mit deinem hochtrabenden Geschwafel! Gib doch zu, daß kein Verlaß auf dich ist!«
Nein, so wollte er das nicht ausgedrückt haben.
Versprechungen, sofern er welche gebe, halte er immer ein. Nur: für diesen Fall habe er keine gemacht. Von einem Kind sei in all den Jahren nie die Rede gewesen.
Die Überheblichkeit, mit der er diese Diskussionen führte, hatte Kati abgestoßen und fast noch mehr erbittert als seine Weigerung, sich zu einem gemeinsamen Kind zu bekennen. Viele junge Männer, wenn sie aus heiterem Himmel mit einer Vaterschaft konfrontiert wurden, zeigten sich zuerst erschrocken und hilflos. Aber sobald sie sich an den Gedanken gewöhnt hatten, stellte sich Freude ein, nicht selten auch Stolz.
Achim aber führte Diskussionen von der hohen Warte aus. Er hörte nicht auf, die unüberwindlichen Schwierigkeiten darzulegen, die ein Kind zu diesem Zeitpunkt bereiten würde, im Hinblick auf seine Situation. Im Hinblick auf ihrer beider ungesicherten nahen Zukunft und überhaupt…
Kati ließ ihn reden und zog sich zurück. Sie war wütend, gekränkt und zutiefst enttäuscht.
Einen Monat später stellte sich heraus, daß sie kein Kind erwartete, und Achim war wie umgewandelt. Reizend, liebreich, aufgekratzt. Er zog alle Register seines Charmes und konnte gar nicht verstehen, daß Kati nicht sofort darauf ansprach.
Sie blieb auf der Hut vor ihm, aber sie merkte schon, daß sie auf die Dauer nicht standhalten, daß sie wieder schwach werden und ihm verzeihen würde, ohne jedoch das ganze Drama und die unwürdige Rolle, die er darin gespielt hatte, jemals vergessen zu können.
Das ist keine Basis für einen Neuanfang, hatte sich Kati gesagt, obwohl sie an ihm hing, denn er war ihr erster Freund gewesen, der Mann ihres Lebens… bis vor kurzer Zeit jedenfalls.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, lautete ihre Entscheidung, die er natürlich nicht akzeptierte und zu unterlaufen versuchte, wo immer er konnte. Aber wachsam und vorsichtig, wie sie geworden war, weihte sie ihn in ihre Pläne gar nicht ein. Erst als sie ihren Vertrag mit der Deutschen Schule in Montelindo in der Tasche hatte, stellte sie ihn vor die vollendete Tatsache, daß sie für zwei Jahre nach Südamerika gehen würde.
Er war total verblüfft, gab sich cool und überlegen und machte einen großen Witz daraus, indem er spöttisch um eine Ansichtskarte bat. Aber kurz vor ihrem Abflug kam er nach Battenberg, wo sie Abschied von ihrer Familie nahm, und seine Überlegenheit war wie weggeblasen. Offenbar ging ihm jetzt erst auf, daß sie im Begriff war, aus seinem Leben zu verschwinden – vielleicht für immer.
Nie zuvor hatte sie ihn so hilflos gesehen, nach Worten suchend, die ihm nicht einfallen wollten, denn selbst ihm wurde klar, daß diesmal keine Zeit für Diskussionen mehr blieb.
Kati, in ihrem Liegestuhl ausgestreckt, erwog minutenlang, ob sie Achim nicht allmählich die versprochene Ansichtskarte schicken sollte.
In diesem Moment ertönte eine verzerrte Ansagerstimme von nebenan, gefolgt von röhrendem Jubel und anfeuerndem Gebrüll. Gleichzeitig landeten zwei Ping-Pong-Bällchen auf ihrem winzigen Rasen, und Christofs Kopf erschien hochrot vor Aufregung sekundenlang über der Mauer.
»Komm sofort rüber, das darfst du nicht verpassen! Deutschland spielt gegen Uruguay! Ich hab’ mir ja nicht träumen lassen, daß ich mal ein Weltklassespiel in meinen Fernseher kriege!«
Christofs Haustür stand sperrangelweit offen. Auf seinem Teppich hockte ein halbes Dutzend einheimischer Kinder mit ihren fußballbegeisterten Vätern, klammerten sich an klebrige Cola-Dosen und schnatterten um die Wette.
Christof zog Kati auf eine Indio-Decke, die er in Sichtweite des Bildschirms ausgebreitet hatte, drückte ihr einen Pappbecher mit einer undefinierbaren Flüssigkeit in die Hand, und nahm einen jungen Hund zwischen die Knie, der offenbar zu den Kindern gehörte.
»Ist es nicht phantastisch?« raunte er ihr zu. »Eine deutsche Nationalelf im Original zu sehen – live zu erleben – und auch noch gegen eine südamerikanische Mannschaft! In diesem Spielzeug-Gerät! Ohne Spezialantenne! In der Botschaft ist das natürlich was anderes, aber ausgerechnet heute ist der Chef nicht da, und allein würde ich mich nicht in seinem Allerheiligsten vor den Bildschirm setzen. Ich hätte nie gedacht, daß ich das Spiel hier in meinem Flimmerkasten sehen könnte.«
Seine Begeisterung und die der versammelten Nachbarschaft war so ansteckend, daß Kati beim ersten deutschen Tor ihre Hand mit dem Becher so heftig empor warf, daß die dubiose Cocktailmischung überschwappte. Der junge Hund schüttelte unwillig den Kopf und säuberte sich minutenlang die weiße Pfote.
»Entschuldige bitte«, sagte Kati und kraulte ihm den Hals.
»Er heißt Chico«, bemerkte Christof, »ich wette, er ist für Uruguay.«
»Wahrscheinlich sind wir die einzigen, die für Deutschland sind«, mutmaßte Kati mit einem Blick in die Runde. Aber das deutsche Tor war allgemein bejubelt worden, und Christof meinte, in Montelindo schätze man den deutschen Fußball sehr. Für eine starke Mannschaft wie Uruguay habe man sich einen respektablen Gegner gewünscht. Außerdem sei es ein Gebot der Höflichkeit, in einem deutschen Haus dem Team des Gastgebers zu applaudieren. Fünf Minuten später fiel das erste uruguayische Tor, und der Beifall übertraf alles Vorhergehende.
Chico sprang auf und bellte. Der Lärm war ohrenbetäubend.
Christof verteilte weitere Cola-Dosen, das Spiel, durch Werbeblöcke unterbrochen, nahm seinen Verlauf.
Katis Becher war leer, sie fühlte sich angenehm belebt, lehnte aber standhaft den nächsten Drink ab und nahm statt dessen eine Kokosnuß mit Strohhalm entgegen.
In der Halbzeit stand es eins zu eins. Jeder Paß wurde kommentiert, jeder starke Spieler belobigt, egal, auf welcher Seite er stand. Dann wurde es ernst. Die Spannung stieg mit jeder Minute. Kati vergaß, daß sie sich so neutral wie möglich verhalten wollte, und als in der letzten Viertelstunde noch einmal der Schrei »Tor!« durch den vollbesetzten Raum hallte und Christof ihr im Überschwang der Begeisterung um den Hals fiel, weil es sich um ein deutsches Tor handelte, fand sie das ganz in Ordnung.
Ebenso empfanden die Gäste, die etwas später, nachdem das zwei zu eins für Deutschland verkündet worden war, von einem Klasse-Spiel und einem verdienten Sieg sprachen.
Statt enttäuschter Mienen zeigten die Leute von Montelindo strahlende Mitfreude, und als Christof aufsprang und Kati wie wild herumschwenkte, sangen sie alle aus voller Kehle die Macarena und klatschten den Takt dazu.
»Toll, daß sie uns den Sieg so neidlos gönnen«, japste Kati.
»Wieso? Ist doch klar. Wenn es umgekehrt ausgegangen wäre, hätten wir ja auch mit ihnen gefeiert! Hauptsache, man ist zusammen!«
Gegen sechs Uhr, als es dunkel wurde, verlief sich die Gesellschaft, nur der Hund blieb.
»Na, und du?« fragte Kati, die Indio-Decke ausschüttelnd und zusammenlegend.
»Er geht später«, meinte Christof, »oder auch nicht.«
»Wem gehört er denn?«
»Keine Ahnung. Er läuft meistens mit den Kindern herum. Ab und zu läßt er sich im Eingang nieder.«
»Fütterst du ihn?«
»Natürlich. Er kriegt immer etwas von dem, was ich gerade da habe. Am liebsten sind ihm Tortillas mit Käse, wahrscheinlich ist er daran gewöhnt.«
»Ach wirklich? Die habe ich gestern abend auch zum ersten Mal probiert.«
»Und? Wie haben sie dir geschmeckt?«
»Fremd, aber gut. Gibt es welche in der Nähe?«
»Sicher, am Ende der Caille Trinidad, da, wo unsere Fußballfreunde wohnen. Wollen wir uns ein paar holen? Chico wird es uns bestimmt danken!«
Etwas später saßen sie einträchtig am Tisch in Katis Patio, wohin ihnen der Hund gefolgt war, und teilten sich einen Stapel Tortillas.
»Was hältst du von etwas Ketchup?« fragte Christof.
»Gute Idee. Gestern, bei Dona Herta, gab es ein paar scharfe Fondue-Soßen dazu.«
»Du warst bei Dona Herta?«
»Ja. Kennst du sie?«
Christof rollte eine Tortilla zusammen, reichte sie dem Hund und griff nach seiner Papierserviette.