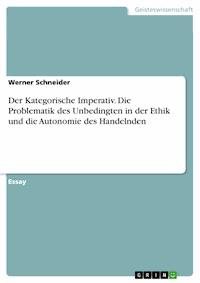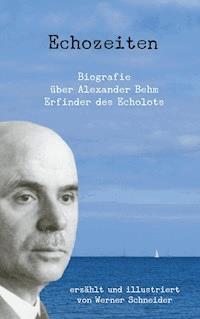
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch erzählt die turbulente Geschichte des Echolot-Erfinders Alexander Behm (1880-1952) und seiner Ehefrau Johanna (1880 - 1956). Anlass für die Erfindung war der Untergang der "Titanic" 1912. Die Eheleute lebten in Norddeutschland, vor allem in Kiel und Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg). Die gesellschaftlichen Umbrüche zwischen dem Kaiserreich und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland prägten ihre Zeit. Bahnbrechende Entwicklungen in der maritimen Technik hat Behm mit seinen über 100 Patenten mitgestaltet. Hierzu gehörte auch ein Höhen-Messgerät (Höhen-Lot) für Zeppeline. Berühmte Pioniere wie der Kieler Erfinder des Kreisel-Kompasses, Anschütz-Kaempfe, der Polarforscher, Roald Amundsen und der Flensburger Zeppelin-Pilot Hugo Eckener gehörten zu seinem Bekanntenkreis. Was hat sie getrieben, die Welt zu erforschen? Wie haben die Behms zwei Kriege, den Kieler Matrosenaufstand, das Hitlerregime und den Holocaust erlebt? Wie wurde er zu einem Pionier des Schalls? Wie wurde er erfolgreicher Jäger und Angler, dessen künstliche Angelköder heute noch weltweit nachgebaut werden? Welche Rolle spielte dabei seine Ehefrau? Auf der Basis von Archivmaterialien und Berichten von Zeitzeugen gibt die Biografie Antworten. In der Form einer spannenden Erzählung verknüpft sie das Leben der Eheleute mit den geschichtlichen, kulturellen und technologischen Umwälzungen, die ihre Zeit geprägt haben. Ansporn und Triebkraft für seine zahlreichen Erfindungen war die Liebe zu Johanna, seiner Ehefrau. Damit gewinnt die Biografie die Dimension einer Liebesgeschichte. Sie entführt uns in eine Zeit, in der das Echolot zwischen Bombenlärm und Musikklängen zum Symbol für die Sehnsucht nach Orientierung und Frieden wird. Die Aktualisierungen und Änderungen in der Neuauflage 2018 beruhen auf neuen Erkenntnissen und Anregungen aus Rezensionen, Vortragsreisen und dem Kreis der Leserschaft. Zahlreiche Abbildungen machen die Lebensgeschichte anschaulich und das Lebenswerk des Erfinders nachvollziehbar. Das "virtuelle Archiv" unter www.alexander-behm-echolot.de, in dem der Autor die Ergebnisse jahrelanger Recherchen systematisch aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht hat, bietet ergänzend zum Buch weitere Materialien und Informationen über die Hintergründe des Buches. Damit wird es zu einer Fundgrube für alle, die sich für die Technikentwicklung in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts und für die Kieler Stadtgeschichte interessieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch erzählt die turbulente Geschichte des Echolot-Erfinders Alexander Behm (1880-1952) und seiner Ehefrau Johanna (1880 – 1956). Anlass für die Erfindung war der Untergang der „Titanic“ am 15. April 1912. Die Eheleute Behm lebten in Norddeutschland, vor allem in Kiel und Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg). Die gesellschaftlichen Umbrüche zwischen Kaiserreich und Gründung der Bundesrepublik Deutschland prägten ihre Zeit. Bahnbrechende Entwicklungen in der Unterwasserakustik hat Behm mitgestaltet.
Wie haben die Behms zwei Kriege, Matrosenaufstand, Hitlerregime und Holocaust erlebt? Wie wurde er zu einem Pionier des Schalls? Welche Rolle spielte dabei Johanna, seine Ehefrau? Auf der Basis von Archivmaterialien und der - auch subjektiven - Eindrücke von Zeitzeugen gibt die Biografie Antworten. Sie führen in eine Welt der Akustik, in der das Echolot zwischen Bombenlärm und Musikklängen zum Symbol für die Suche nach Orientierung wird.
Die Aktualisierungen und Änderungen in der Neuauflage 2018 beruhen auf neuen Erkenntnissen und Anregungen aus Rezensionen, Vortragsreisen und dem Kreis der Leserschaft.
Der Autor, Jahrgang 1948, wurde im Nachbarhaus des Erfinders in Tarp geboren. An Johanna Behm, die 1956 starb, erinnert er sich gut. Seine bisherigen Veröffentlichungen konzentrieren sich auf fachliche und politische Themen der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Finanzpolitik. Dies ist seine erste Biografie. Der Autor lebt heute in Berlin-Pankow.
Abb. 1 Treene bei Tarp Kreis Schleswig-Flensburg
Inhalt
Intro
Erstes Kapitel: Hadersleben
Zweites Kapitel: Karlsruhe
Drittes Kapitel: Wien
Viertes Kapitel: Kiel
Fünftes Kapitel: Treenetal
Sechstes Kapitel: Behmianer
Epilog
Chronik
Abbildungsverzeichnis
Bildnachweis
Intro
Er kam von dem Ereignis nicht los. Jeden Tag nach dem denkwürdigen Montag, den 15. April 1912, kamen neue Details heraus. Als Behm wieder einen Artikel ausschnitt, starrte er wie gelähmt auf den Zeitungsbericht. Dann legte er die Schere zur Seite und bedeckte mit einer Hand seine Augen.
„Was hast du?“, fragte Johanna besorgt.
„Es ist nicht zu fassen! Hier, lies, wozu Menschen in der Not fähig sind.“ Es war der Bericht eines britischen Überlebenden. Die Schilderungen betrafen die Zeitspanne zwischen dem vollständigen Sinken der „Titanic“ und der Ankunft der „Carpathia“, die auf die Notsignale reagiert hatte. Sie dauerte etwa zwei Stunden. Die sechzehn Rettungsboote hatten sich in Eile von dem untergehenden Ozeanriesen wegbewegt. Von den Booten aus waren die Hilferufe der im eiskalten Polarwasser Treibenden gut zu hören. Die Unglücklichen klammerten sich an alles, was greifbar war, zerbrochene Holzplanken, beschädigtes Mobiliar, schwimmende Kesselteile. Aus der Bordinformation wussten die Passagiere, dass die Wassertemperatur in diesem Gebiet unter Null Grad lag, knapp oberhalb des Gefrierpunktes von Meerwasser. Den meisten war bekannt, dass kein menschlicher Körper gegen solch frostige Temperaturen gewappnet war, zumindest nicht für Stunden. Die Mitglieder der Schiffsbesatzung wussten das immer schon.
Die Nacht war sternenklar und die See glatt wie ein Spiegel. Nur die grellen Schreie der Treibenden und die Ruderschläge der Rettungsboote waren zu hören. Schon nach wenigen Minuten kamen die Rufe in größeren Abständen. Anfangs klangen sie wie Bitten, die von Minute zu Minute vorwurfsvoller wurden. Bald mischte sich ein verzweifelter Unterton in die Schreie. Und dann war das Entsetzen erkennbar. Es war zu spüren, dass die Treibenden ihre schreckliche Lage erkannten. Nach zwanzig Minuten war nur noch ein hoffnungsloses Wimmern zu hören. Nach vierzig Minuten hörte auch dieses auf. Es war kein Laut mehr zu vernehmen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt musste allen bewusst sein, dass gerade hunderte Menschen an Unterkühlung starben.
In der entsetzlichen Todesstille bewegte sich nur das Rettungsboot mit der Nummer vier. Es barg fünf Erfrierende. Zwei von ihnen starben kurz danach. Ein weiteres Boot war nahezu leer. Seine Passagiere waren in andere Boote umgestiegen. Es konnte noch drei Menschen retten. Die übrigen Menschenbündel, mit dünnen Eisfäden an ihre treibenden Särge geklebt, schluckte die eisige Nacht.
Zeugen bestätigten, dass es in fast allen Rettungsbooten freie Plätze gab. Mitglieder der Untersuchungskommission hatten sie addiert.
„Wären alle geflüchteten Boote rechtzeitig umgekehrt, hätten weitere fünfhundert Menschen gerettet werden können!“, stieß Johanna fassungslos hervor. Sie legte den Zeitungsabschnitt auf den Tisch und verwischte mit ihrem Handrücken zwei Tränen. Behm schwieg.
Obwohl die Zeitungen noch wochenlang berichteten, hörte Behm auf, Zeitungsartikel auszuschneiden. Mit Johanna sprach er nicht mehr über die Katastrophe. Auch mit anderen nicht. Überhaupt wurde er schweigsam. Morgens verschwand er mit seiner Angel und kam erst im Dunkeln zurück. Als er zum Fischen keine Lust mehr hatte, saß er von früh bis spät im Sessel und schaute aus dem Fenster. Dort konnte er auf die frisch ergrünten Baumkronen und die Dächer der Wiener Nachbarhäuser blicken. Irgendwann hielt Johanna seine Schweigsamkeit nicht mehr aus:
„Sag mir, was los ist!“ Dabei zog sie ihre Augenbrauen zusammen.
„Es muss doch möglich sein, solche Tragödien zu verhindern“, antwortete er unwirsch und verschwand für den Rest des Tages. Das war es also. Behm brütete, wie sich so eine Tragödie verhindern ließ. Diese Gedanken brachten ihn um den Schlaf. Zum Schutz gegen Eisberge gab es nichts, außer dem Blick der frierenden Matrosen im Ausguck.
Die Zahl der Seereisenden hatte in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Auch die Menge der Gütertransporte zur See war gestiegen. Kein Wunder, dass die Schiffshavarien von Jahr zu Jahr häufiger und ihre Folgen dramatischer wurden. Behm konnte sich jedoch nicht erinnern, jemals von einer vergleichbar tödlichen Kollision mit einem Eisberg gehört zu haben.
Menschen auf hoher See bewegen sich auf unsicheren Planken. Alle Welt wusste es. Behm kannte einige Seeleute. Junge Leute aus seiner Parchimer Heimat hatten in Rostock geheiratet und Familien gegründet. Jetzt fuhren sie zur See. Behm musste an sie denken. Sie hatten gelernt, mit ihren Ängsten umzugehen. Aber nach einem solchen Ereignis? Was fühlten sie, wenn sie Nacht für Nacht in ihr Abenteuer hinausfuhren?
Es häuften sich die Nächte, in denen er vom Ertrinken träumte. Wenn er morgens aufwachte, war er unruhig. Und er blieb es den ganzen Tag über. Das Thema hatte ihn gefesselt.
Erstes Kapitel: Hadersleben
Konrad Dunker - 1898
Als er Johanna das erste Mal sah, war sie mit ihrer älteren Schwester, Alwine, und ihrem Schwager, Dr. Magaard, gekommen. Sie trafen sich in der Wohnung von Professor Dunker in der Storegade Nummer 492. Dunker zog die schweren Vorhänge in seinem ebenerdig gelegenen Arbeitszimmer zu, so dass es fast stockfinster wurde. Die drei Gäste blickten gebannt auf die knisternden Funken zwischen den Metallkugeln.
„Nach allem was wir inzwischen wissen“, erläuterte Dunker, „pflanzen sich elektrische Wellen in Kupferdrähten mit Lichtgeschwindigkeit fort.“
Dunker zeigte auf die Elektrisiermaschine, die er im Physikunterricht Influenzmaschine nannte. Alexander Behm hatte sie auf dem massiven Holztisch aufgebaut. Sie hatte zwei vertikal angeordnete Scheiben aus Hartgummi. Behm drehte die Antriebskurbel. Sie setzte eine der beiden Gummischeiben in kreisende Bewegung. Es hörte sich an, als würde jemand mit einem Reisigbesen den Steinboden fegen. Die beiden Metallkugeln hatten einen Abstand von zehn Zentimetern. Plötzlich schossen erneut Funken, die sekundenlang in einem bizarren Blitz verharrten. Diesmal waren sie an der rechten Kugel blau-violett. Zur linken Kugel wurden sie heller und mündeten in einem kleinen weißen Punkt. Für einen Augenblick erleuchteten sie den Raum, so dass Behm Johannas Gesicht sehen konnte. Sie war hübsch, wahrscheinlich etwas älter als er, vielleicht knapp neunzehn, und hatte ein geblümtes Sommerkleid an. Ihre dunklen Haare waren zu Zöpfen geflochten, die bei jeder Kopfbewegung hin und her flogen.
„Das war eine Sprühentladung“, erläuterte Dunker, mit der Hand über sein schütteres Haar streichend. Die Luft roch nach verbranntem Staub und erhitztem Kautschuk. Behm kannte diese aus Reibung entstehenden elektrischen Entladungseffekte. Er öffnete den Vorhang einen Spalt. Das Licht der Straßenlaterne fiel als Streifen auf die Kalkwand. Die Kupferdrähte der Anordnung blinkten. Behm vergrößerte den Abstand zwischen den Metallkugeln. Er spürte Johannas Blicke, die auf seine Hände gerichtet waren. Die Aufmerksamkeit der jungen Frau, die erst heute aus ihrer mecklenburgischen Heimat angereist war, irritierte ihn. Als er abwartend zur Seite trat, schimmerten zwei gläserne Ballonflaschen im Laternenschein. Sie standen unter dem hellen Buchenholztisch und waren innen und außen mit Stanniol belegt.
Dunker schob den Vorhang wieder zu. Mit kräftigen Kurbeldrehungen ertönte wieder das gleichmäßige Schleifgeräusch der Bürsten. Bald knisterte es. Frau Magaard räusperte sich. Danach waren in der Dunkelheit nur noch die Atemgeräusche der Anwesenden zu hören. Nach einer Weile, die Behm wie eine lange Minute vorkam, zuckten die Gäste plötzlich zusammen. Sie hörten einen Knall wie von einem Revolverschuss. Er war von einem schneeweißen Blitzstrahl begleitet. Aus Frau Magaards Tasse schwappte der Tee auf ihre Bluse. Sie schimpfte. Johanna lachte schallend. Behm musste grinsen. Frau Magaard versuchte erfolglos, mit ihrem Taschentuch den Tee von ihrer weißen Bluse zu tupfen.
Dunker schob die Vorhänge jetzt ganz zur Seite und öffnete einen Fensterflügel. Die hereinströmende herbstliche Abendluft tat gut. Sie bewegte den baumelnden Fliegenfänger und vertrieb eine Rauchspur, die sich über der elektrischen Entladung gebildet hatte. Der Geruch frischer Pferdeäpfel drang von draußen herein. Dunker räusperte sich und fingerte an seiner Brille:
„Wir haben in den beiden letzten Jahrzehnten ja wirklich umwerfende Entwicklungen in der Elektronik und in der Technik erlebt.“
Ihm war anzusehen, dass er sein Wissen mit Freude weitergab. Vor allem das Fachgebiet der Elektronik war seine Welt. Er nannte Werner von Siemens’ Generator bahnbrechend. Edinsons Kohlefadenglühlampe würde sich auch auf dem Land bald durchsetzen. Vor allem Heinrich Hertz mit seinen elektromagnetischen Wellen sei ein Pionier der Physik. Bei Alex Popow geriet Dunker in Verzückung. Popow sei erstmals vor vier Jahren eine drahtlose Funkstrecke von zweihundertfünfzig Metern gelungen. Seine Erfindung sei genial. Auch in den letzten Schulversuchen habe man mit Popows drahtloser Telegrafie experimentiert. Erhitzt öffnete Dunker seinen obersten Hemdknopf. Der Telegrafie prophezeite er eine große Zukunft. Sie werde bald in der Lage sein, die Menschen näher zusammenzubringen. Vor allem für den Handel und die Industrie sei sie von Nutzen. Der Gastgeber war in seinem Element. Behm spürte wieder einmal, wie Dunkers Begeisterung auf ihn übersprang. Diese physikalischen Präsentationen im Freundes- und Bekanntenkreis machten ihm Spaß. Offenbar kamen sie auch dem wachsenden Interesse der Menschen an der Technik entgegen. Zumindest brachten sie Abwechslung in das kleinstädtische Leben in Hadersleben.
„Wo habt ihr diese großen Flaschenbatterien her? Ich habe solche noch nie gesehen“, wollte Dr. Magaard wissen. Sein dänischer Akzent verriet seine Herkunft.
„Das war Behms Idee“, antwortete Dunker. „Ursprünglich waren das Fünfzig-Liter-Salzsäureballons. Wir haben sie dem Apotheker Hansen für sechzig Pfennig abgekauft. Mit dem Stanniol kamen uns die Flaschen auf weniger als eine Mark das Stück.“
Auf den ungläubigen Blick Dr. Magaards ergänzte Behm, auf eine Flasche zeigend:
„Das Stanniol haben wir mit Stärkekleister außen und innen ans Glas geklebt. Hierfür haben wir mit einer Gasflamme das Loch in die Flasche gebrannt.“
„Ein Loch durch dieses dicke Glas?“ Frau Magaard blickte erstaunt.
„Nicht wir, sondern Behm hat das in seiner Werkstatt gemacht“, korrigierte Dunker. „Er hat mit der Kreide einen faustgroßen Kreis auf das Glas gemalt. Dann hat er die Flamme des Gasbrenners über den Kreidestrich geführt. Mit einem triefendnassen Tuch hat er sofort danach die erhitzte Strecke gekühlt. An dieser Stelle ist das Glas gesprungen. Und dann haben wir das Stanniol mit Hilfe der Elektrisiermaschine aufgeladen. Innen positiv und außen negativ. Von den Batterien haben wir inzwischen elf Stück.“ Dunkers Gesicht erhellte sich. „Und mit diesen enormen Elektrizitätsmengen machen wir Sachen, die an unserer Schule bisher nicht möglich waren. Ich glaube nicht, dass solche Schulversuche überhaupt jemals gemacht wurden. Bei der letzten Präsentation hat die gesamte Ober- und Unterprima applaudiert.“ Dunker schloss das Fenster und entzündete eine Gasleuchte.
„Auf unseren Versuch mit den X-Strahlen müssen wir heute leider verzichten“, bedauerte er. „Aber dafür können wir Ihnen etwas zeigen, das Sie bestimmt noch nicht gesehen haben.“
„Schade“, dem Dorfarzt war seine Enttäuschung anzusehen. „Erst vor wenigen Wochen habe ich in unserer Tageszeitung ‚Dannevirke’ gelesen, dass man mit solchen Strahlen die Knochen eines Menschen erkennen kann.“
„Leider ist diese Röntgenröhre“, Dunker hielt eine kugelförmige Röhre aus geblasenem Glas hoch, „bei unserem letzten Schulversuch unbrauchbar geworden. Eine neue ist bei der Berliner Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft bestellt. Aber wir konnten letzte Woche dieses Foto machen.“ Er reichte dem Arzt eine quadratische Glasplatte.
„Phantastisch!“, rief dieser überrascht, „das sieht ja genauso aus, wie das von Professor Röntgen veröffentlichte Foto.“ Magaard hielt das Glasnegativ in das Licht der Lampe. Er schaute abwechselnd auf seine Hand und das Handskelett auf dem Foto: Bis auf das etwas verschwommene Kahn- und das Mondbein waren die Konturen aller anderen Knochen hell und klar zu sehen. Frau Magaard beugte sich zu ihrem Mann. Johanna stand auf und schaute gebannt auf das Handskelett. Behm sah, wie sie ihr Kleid glatt strich und ihre Zöpfe mit einer energischen Kopfbewegung nach hinten warf.
„Das von Professor Röntgen veröffentlichte Foto zeigt die Hand seiner Frau“, erwiderte Dunker.
Beim Anblick der über die Röntgenaufnahme gebeugten Köpfe musste Behm an die weißhaarige alte Frau denken. Wie aus dem Nichts war sie im vorigen Jahr zum Erntedankfest auf dem Bauernmarkt aufgetaucht. Keiner kannte sie. Er hatte unentschlossen vor ihrem runden Zelt gestanden. Am Wegesrand hatte eine junge Sängerin barfüßig auf einer Holzkiste gestanden, sich im Dreivierteltakt ihres Gesangs gedreht und dabei in die Hände geklatscht:
„Lütt Matten de Haas´
De maak sik en Spaaß“,
Behm kannte den Text, Wort für Wort,
„He weer bi’t Studeern
Dat Danzen to lehrn“,
so dass er, eher unbeabsichtigt, mitflüsterte,
„Un danz ganz alleen
Op de achtersten Been.
Keem Reinke, de Voß,
Un dach dat’s en Kost!“
Es war das Gedicht von Klaus Groth, das alle Kinder zwischen dem Stettiner Haff und der Flensburger Förde in der Schule auswendig lernten.
„Un seggt: Lüttje Matten
So flink opp de Padden?
Un danzst hier alleen
Oppe achtersten Been?
Kumm, lat uns tosam!
Ik kann as de Daam!“
An der Stelle machte sie einen Knicks. Die mit dunkler Stimme gesungene Melodie tönte klagend. Sie passte nicht zum heiteren Rhythmus des Ländlers. Behm erinnerte sich, dass sie das Gedicht über den kleinen Hasen „Matten“ auf dem Gymnasium in Parchim besprochen hatten. Bei der Interpretation des Gedichts war es zwischen den Schülern zum Streit gekommen.
Behm war dann doch in das Zelt geschlichen, in dem es süßlich, wie nach verdorbenen Kartoffeln, roch. Behm erinnerte sich an die fettigen Haarsträhnen und den starren Blick der Alten auf seine Handlinien. In einer Ecke ihres Zeltes hing der glänzende Schwanz eines Fischotters. Sie hatte ihn unfreundlich aufgefordert, die dreißig Pfennig vorher zu bezahlen. Draußen sang das Mädchen weiter:
„De Kreih, de spelt Fitel,
„Denn geiht dat kanditel,
Denn geiht dat mal schöön
Op de achtersten Been!“
Während die Alte ihren Blick auf seine Hände richtete, bewegte sie sich nicht. Dann schloss sie ihre Augen und kündigte mit kratziger Stimme dunkle Zeiten an. Behms Leben sei eine einzige Düsternis. Aber er sei auch ein Glückspilz. Menschen würden kommen, die ihm Wege aus der Finsternis zeigten. Seine Hände seien begnadet. Am Ende hatte sie mit dem Otterschwanz über beide Handflächen gestrichen. Behm erinnerte sich, wie ihn die Berührung des weichen Fells auf seiner Haut seltsam erregt hatte.
Als er wieder ins Helle trat, hatte das Mädchen das gleiche Lied von vorne begonnen, von Strophe zu Strophe immer lauter. Jetzt schrie sie fast, mit ausgestreckter Hand, wie zum Gruß:
„Lütt Matten gev Poot.“ Und dann lachend:
„De Voß beet em doot;
Un sett sik in Schatten,
Verspies’ de lütt Matten;
De Kreih de kreeg een
Vun de achtersten Been.“
Dabei strich sie sich mit ihrer Hand über den Bauch, als wollte sie zeigen, wie gut der Hase dem Fuchs und der Krähe schmeckte. Behm hatte an dieser Stelle würgen müssen. In der Schule meinten damals einige schulterzuckend, Klaus Groth habe nur den Lauf der Natur beschrieben. Es sei eben so, dass die Starken die Schwachen besiegten. Und das müsse auch so sein. Andere glaubten, dass es eine Warnung sei. Der tanzende Hase sei für das Sterben noch zu jung gewesen. Er habe sein Leben ja nur wegen seines Leichtsinns und seiner Gutgläubigkeit verloren. Er hätte achtsamer sein müssen. Dann wäre er dem listigen Fuchs nicht auf den Leim gegangen.
Die dunklen Wolken, von denen die Alte gesprochen hatte, waren schneller gekommen, als er dachte. Sein letztes Schuljahr im Johanneum zu Hadersleben lag noch keine zwei Jahre zurück. Wie hatte er das düstere Backsteingebäude mit den Zinnengiebeln und Rundbogenfenstern gehasst! Weit und breit gab es nur einen Lichtblick, das war sein Physikprofessor Dunker. Behm war überzeugt, dass Dunker der einzige seiner Lehrer war, der ihn mochte. Behm wusste, wie lästig er sein konnte. Er wollte immer bis in die Einzelheiten wissen, wie alles funktioniert. So mancher reagierte genervt. Aber Dunker blieb nie eine Antwort schuldig.
Seit dem Frühjahr arbeitete Behm beim Büchsenmacher des Garderegiments in Hadersleben. Er wollte dort praktische Erfahrungen sammeln. Abends half er mit den Werkzeugen seines Meisters, die Geräte des Physiklabors an der Schule zu reparieren. So war er neben der Arbeit in der Werkstatt allmählich Dunkers Assistent geworden. Behm hatte den Eindruck, dass ihre gemeinsame Arbeit ankam. Die Schulversuche waren anspruchsvoller geworden. Das bunte Spektakel im Physikunterricht hatte sich an dem streng reglementierten Johanneum zu einer Attraktion entwickelt.
Als die Gäste sich erhoben, hantierte Behm an den Drähten. Johanna sprach ihn an:
„Darf ich Sie etwas fragen? Ich bleibe den ganzen Sommer bei meiner Schwester in Hadersleben und möchte gerne mehr über Ihre Ausbildung beim Büchsenmacher erfahren.“
Behm errötete und stotterte:
„Es … ist … keine richtige Lehrzeit, nur ein Praktikumsjahr. Aber ggggerne zeige ich Ihnen die Werkstatt.“
Als wäre es die unwichtigste Nebensache der Welt, erwähnte Dunker beim Abschied: „Übrigens habe ich die Hälfte der Sommerferien damit verbracht, über unsere Schulversuche mit der Elektrisiermaschine einen Fachbeitrag zu schreiben. Dieser wird in der übernächsten Ausgabe der ‚Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht’ veröffentlicht.“ Auch Behm habe er ermuntert, über seine Glasbatterien eine solche Schulschrift zu verfassen. Der Verlag von Julius Springer in Berlin habe Interesse bekundet.
Dr. Magaard nickte anerkennend. Im Abschied gab er Behm die Hand:
„Respekt, junger Mann!“
Johanna Glamann und Alexander Behm verabredeten sich für Sonntag, den 10. September, zum Sonnenuntergang an der Wassermühle des Haderslebener Damms. Das war in einer Woche.
Johanna Glamann - 1898
Behm war bereits am Sonntagnachmittag aufgebrochen. Vorher hatte er noch einmal in den Spiegel geschaut. Sein Äußeres gefiel ihm nicht: Sein Gesicht schien irgendwie zu jungenhaft. Er glaubte, jünger als ein Siebzehnjähriger auszusehen. Dann versuchte er, die noch spärlich sprießenden Barthaare zu einem Schnurrbart zu zwirbeln. Er bürstete seine borstigen Kopfhaare, krempelte die Ärmel seines grünen Leinenhemdes hoch und marschierte mit forschen Schritten los. Seine Angelrute, den Kescher und einen Rucksack hatte er geschultert. Den Eimer trug er in der Linken. Die frische Ostseebrise war abgeflaut. Über den geernteten Kornfeldern jenseits des Damms zogen Wolken zusammen. Im Vorübergehen nickte er den Bahnarbeitern zu:
„Moin Moin!“
Behm hatte in den zwei Jahren seit dem Wohnortwechsel von Parchim nach Hadersleben verschiedene ertragreiche Angelreviere in den umliegenden Gewässern entdeckt. Sein Favorit war die Mündung des Skallebæk, eines Bachs, der sich in der Nähe der Militär-Badeanstalt in den Damm ergoss. Der Damm war ein Binnensee. Zur Altstadt hin war er durch einen künstlichen Wall und eine Wassermühle von der Ostseeförde abgetrennt. Prachtexemplare von Barschen hatte er an der Bachmündung schon herausgeholt.
Behm fischte heute mit Regenwürmern. Seitdem er gelegentlich Gefälligkeiten für den Müller erledigte, war ihm der Platz vor dem knarrenden Mühlrad vertraut geworden. Zwischen einem Erlenstrauch und einer jungen Trauerweide hatte er den Schwimmer seiner Angel und zugleich die Brücke im Blick. Der Wurmköder war heute offensichtlich wenig reizvoll für die Fische. Der Schwimmer trieb müde.
Zwei Stunden später sah er auf der Brücke Johanna kommen. Sie war um einen Kopf kleiner als er. Ihr Körper federte bei jedem Schritt. Sie schaute nach oben, als beobachte sie die kreischenden Möwen. Mit ihrem hellblauen Kleid und den gelb leuchtenden Haarbändern wirkte sie wie eine Ausflüglerin aus der Bezirkshauptstadt. Sie winkte ihm zu.
„Moin! Beten se?“, erkundigte sie sich.
Johanna sprach, wie der Revierförster in Parchim gesprochen hatte: halb hochdeutsch, halb niederdeutsch. Jedenfalls konnte man das Mecklenburgische heraushören. Auch Behm redete ähnlich gemischt. Sie erschien ihm sofort wie eine Verbündete.
„Heute nichts. Das kommt vor“, antwortete er, Selbstbewusstsein vortäuschend. In Verabredungen mit jungen Damen hatte er keine Erfahrung.
„In Hadersleben scheint es außer uns beiden und meiner Schwester keine weiteren Mecklenburger zu geben. Wie hat es Sie hierher verschlagen?“, wollte sie wissen.
„Mein Vater ist Postbeamter und wurde wieder einmal versetzt. So wechselte unsere Familie innerhalb weniger Jahre von Sternberg nach Rhena, dann nach Parchim und jetzt an diesen Nordzipfel Deutschlands.“
„Das hört sich an, als wären Sie lieber in Parchim geblieben.“
„Das kann man wohl sagen.“ Dabei nickte Behm heftig.
„Kann ich verstehen. Ich war schon öfter dort, wirklich schön.“ Zögernd gingen sie los. „Es liegt nicht weit von meinem kleinen Dorf östlich von Waren entfernt“, ergänzte sie. „Der größte See dort ist die Müritz. Mein Lieblingssee, ganz klein, vor unserer ehemaligen Haustür, ist der Torgelower See. Es ist eine Bilderbuchlandschaft.“
Johanna erzählte von ihrer Heimat und dem Gut, das ihr Vater, Alexis, bis vor wenigen Jahren verwaltet hat. Als ihre Mutter 1881 bei der Geburt ihres zehnten Kindes an Kindsbettfieber starb, war Johanna gerade ein Jahr alt. Ihre Ziehmutter war ihre ältere Schwester, Olga. Ihre Schwester Valeska lebte inzwischen als Malerin in München und ihre älteste Schwester, Alwine, war Frau Doktor Magaard geworden, die Behm ja kannte. Bei ihr verbrachte Johanna in jedem Sommer ihre Ferien. Mit einem Lächeln fuhr sie fort:
„Vor wenigen Jahren hat sich mein Vater zur Ruhe gesetzt. Seitdem wohne ich mit ihm und meinen noch unverheirateten Geschwistern in unserem Haus in der Friedrichstraße 33 in Rostock.“ Behm beobachtete sie. Ihr Haar hatte sie heute hochgesteckt.
Am Horizont türmten sich dunkle Wolken. Die stehende Luft wurde schwülwarm. Aus der Ferne hörten sie das Grummeln des nahenden Gewitters. Neben einer ungeschnittenen Korbweide, die ihr Wurzelwerk in das trübe Gewässer streckte, blieb Behm plötzlich stehen:
„Ich habe hier nach Sonnenuntergang einmal einen Fischotter gesehen. Erstaunlich, ein Otternest so nah am Ort. Ein Prachtexemplar, mit Schwanz bestimmt einen Meter lang. Ein solches Tier benötigt Unmengen Fisch, vor allem, wenn Junge im Bau sitzen.“
„An unseren Seen gibt es sie auch in großer Zahl, zum Leidwesen der Fischer.“ Johanna runzelte die Stirn.
„Der Revierförster in Parchim hat mir einmal fünfzig Pfennig für jeden erlegten Otter angeboten“, erzählte Behm stolz. „Und diesen hier werde ich auch noch kriegen. Ist nicht leicht, weil der Eingang des Baus unterhalb der Wasseroberfläche liegt. Und die Viecher sind pfeilschnell und blitzgescheit.“
Sie überquerten den fast menschenleeren Marktplatz, den die Dänen Torvet nannten. Klassizistische Bürgerhäuser zeigten ihre Giebelpracht. Aus der Domkirche hörten sie Orgelmusik. Als sie den großen Regimentsplatz mit dem riesigen Backsteingebäude der Garnison erreicht hatten, rief Johanna erfreut:
„Wie prachtvoll, diese Kletterrosen sieht man selten so üppig.“ Mit kräftigen, schwefelgelben Blüten umrankten sie den Eingang der Werkstatt. Johanna roch an einer großen Blüte: „Wie sie duften.“
Behm schloss einen Torflügel auf und kam mit einer Astschere heraus. Mit energischen Schnitten hatte er schnell einen Strauß zusammen, dessen Stiele er mit Packpapier aus einer Materialkiste umwickelte.
„Ich wünsche viel Freude damit“, sagte er mit unbeholfener Geste. Johanna strahlte:
„Meine ältere Schwester Valeska hat solche Rosen gemalt. Eins ihrer Ölbilder hängt in meinem Zimmer in Rostock.“
Behm konnte Johannas Begeisterung verstehen. Es war eine alte Sorte mit betörendem Duft.
Ein Soldat in Gardeuniform ritt über den Regimentsplatz. Behm nahm Haltung an und salutierte ungeschickt. In der Werkstatt roch es nach Öl und Schießpulver. Der Boden glänzte fettig. Auf der Werkbank lagen mehrere Feilen und Schraubenzieher, die Behm sofort wegräumte. Behm schloss einen eisernen Schrank auf. Als eine Reihe von Gewehren unterschiedlicher Größe zum Vorschein kam, sah er Johanna an.
„Dies ist noch eines der berühmt gewordenen Dreyse-Hinterlader.“ Behm zeigte auf das erste Gewehr im Ständer: „Dreyse war der Konstrukteur dieses Zündnadelgewehrs. Es wurde im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 das erste Mal eingesetzt und brachte für unsere Seite enorme Vorteile.“
„Weshalb das preußische Heer auch gesiegt hat“, ergänzte Johanna.
„Schwierig zu sagen, ob eine solche Waffe ausschlaggebend war. Vielleicht waren die Krupp-Geschütze wichtiger. Die Hinterladerkanonen mit den gezogenen Läufen waren damals neu. Mit ihnen konnte man über die Bucht bei Sonderburg hinweg ballern. Ich glaube, sie haben den dänischen Schanzen großen Schaden zugefügt.“
„Wahrscheinlich war aber auch die neue Eisenbahnverbindung wichtig“, entgegnete sie.
„Bestimmt, denn sie machte den schnellen Truppentransport von Berlin hierhin möglich“, bestätigte er, um mit erhobenem Kopf fortzufahren: „Deutsche Technik ist eben weiter als andere!“ Seine dünnen Schnurrbarthaare zitterten. Er deutete nun auf das zweite Gewehr:
“Dies ist die Sensation in unserer Werkstatt, eine Neuheit, die unser Kaiser erst im Frühjahr als Versuchswaffe für Preußen eingeführt hat...“
Ein plötzliches Krachen unterbrach ihn. Das Gewitter hatte die Stadt erreicht. Mit dicken Tropfen setzte der Regen ein. Behm holte zwei Stühle hervor.
„Wir können hier im Trockenen warten, das Gewitter ist gleich vorüber.“
Noch ehe der Satz ausgesprochen war, schoss ein gezackter Blitz aus den Wolken. Unmittelbar darauf folgte ein gewaltiger Donnerschlag. Johanna hielt sich die Ohren zu.
„Sie müssen keine Angst haben. Auch wenn es so aussieht; das Gewitter ist hier auf dem Regimentsplatz noch lange nicht angekommen.“
„Das hat sich aber so angehört. Kaum drei Sekunden auf den Blitz folgte der Donner schon.“
„Der gefährliche Teil des Gewitters ist die elektrische Entladung. Wir sehen sie als Blitz. Er verursacht eine Schallwelle, den Donner. Was wir hören, ist also nicht die Entladung. Es ist nur ihr Schall. Soeben hat der Donner vom Blitz bis zu unseren Ohren einen Kilometer zurückgelegt. Das Gewitter ist also noch in sicherer Entfernung.“
Johanna sah ihn zweifelnd an.
„Das ist ganz einfach. Man kennt die Geschwindigkeit, mit der sich Schallwellen in der Luft fortpflanzen, bei dieser Lufttemperatur mit etwa dreihundertvierzig Metern in der Sekunde. Wenn der Donnerschall drei Sekunden bis zu uns braucht, ist die Entladung folglich rund tausend Meter von uns entfernt.“ Johanna runzelte die Stirn.
„Das gehörte am Johanneum zu den Grundlagen des Physikunterrichts von Dunker.“
„Was ist das für ein Gerät?“ Johanna zeigte auf ein Wandregal.
„Das ist mein Mikroskop.“ Behm nahm es herunter und stellte es behutsam auf die Werkbank. „Das habe ich im letzten Winter hier in der Werkstatt gebaut.“
Johanna schaute es verwundert von allen Seiten an.
„Wie kann das? Aber doch nicht alles, nicht die Linse?“
„Doch, alles. Hiermit“, er zeigte auf einen Gebläse-Glasbrenner, „lassen sich aus Glas Fäden ziehen. Die kann man zu einer symmetrischen Kugel zusammenschmelzen. Wenn keine Luftblasen drin sind, wird das eine Linse. Diese habe ich dann mit Schellack in die gelochte Blechscheibe geklebt.“ Behm deutete auf die Einzelteile. „Dieses Zwischenstück ist eine abgeschnittene Patronenhülse. Für den Tubus und die übrigen Teile habe ich alte Fahrräder, Nähmaschinen und Petroleumlampen ausgeschlachtet.“ Mit schneller Hand riss er eines seiner dunklen Haare heraus und klemmte es unter die Linse:
„Schauen Sie hinein, es vergrößert dreihundertfach.“
Johanna rückte näher heran und beugte sich über das Wunderwerk. Behm hielt die Lampe. Die Nähe zu Johanna verunsicherte ihn. Sie roch nach Lavendelblüten. Er schwitzte.
„Das sieht ja aus, als wäre das Haar seit Monaten nicht mehr gewaschen.“ Ihr Lachen steckte ihn an.
Dann fragte sie Behm, warum er beim Büchsenmacher arbeite. Er müsse seinem Alter nach zu urteilen doch kurz vor dem Abitur stehen.
„Das ist eine lange Geschichte“, antwortete er ausweichend.
„Sie interessiert mich“, beharrte sie.
„Ich habe das Gymnasium nach dem Einjährigen beendet.“
„Warum?“
Behm zögerte. Schule war nicht sein Thema. Schon der Gedanke an das Gymnasium konnte ihm Übelkeit bereiten. Irgendetwas aber brachte ihn dazu, sich zu öffnen:
„Ich war kein guter Schüler“, begann er stockend. „Schon in Parchim, auf dem Friedrich-Franz-Gymnasium, musste ich die Quarta wiederholen.“
„In welchen Fächern lag das Problem?“
„Ich hätte insgesamt mehr tun müssen, weniger angeln, weniger im Wald vertrödeln. Deshalb war ich außer in naturwissenschaftlichen Fächern in fast allen anderen schwach. Dieses Johanneum hier in Hadersleben macht es einem aber auch nicht leicht.“
Johanna schwieg abwartend. Mit größeren Unterbrechungen, in denen er geräuschvoll Luft holte, erzählte Behm immer mehr. Er sprach von seiner Familie, von seinen beiden jüngeren Brüdern, Otto und Werner, von seiner Mutter, Paula, die ihn vor der drohenden Bestrafung durch den Vater so oft gerettet hatte. Der Umzug von Parchim in das zwischen Deutschland und Dänemark umstrittene Nordschleswig war für Behm ein tiefer Einschnitt. In der ländlichen Stadt Parchim hatte er sich eingerichtet. Inmitten ausgedehnter Wälder und fischreicher Seen hatte er sich wie in einem Paradies gefühlt. Die Flucht vor den schulischen Pflichten war ein Kinderspiel gewesen. Statt durchzugreifen hatten seine Lehrer teils resigniert und teils nachsichtig kapituliert. Immerhin war er in den naturkundlichen Themen ungewöhnlich kenntnisreich. Als pflichtbewusster Postbeamter hatte sich Alexanders Vater, Ernst Behm, widerspruchslos in den nördlichsten Teil Preußens versetzen lassen. Die dänische Landesgrenze lag eine Fahrradstunde entfernt. Und Behm war sicher, hinter den nordschleswigschen Moorgebieten am Ende der Welt gelandet zu sein. Von Anfang an wollte er nach Parchim zurück. In die Untersekunda eingestuft spürte Behm bereits in den ersten Wochen, dass er den Anforderungen seines neuen Klassenlehrers, Professor Göcker, nicht genügen werde. Er flüchtete in die Natur, öfter als seine Pflichten es erlaubten. Johanna hörte ihm gespannt zu. Dann gestand er:
„Professor Dunker hat sich bei der Versetzungskonferenz für mich eingesetzt. Damit hat er erreicht, dass mir mit dem Schulabgang wenigstens das Einjährige erteilt wurde. Ohne ihn hätte ich noch nicht einmal das.“ Behm blickte über Johanna hinweg.
„Und jetzt wollen Sie Büchsenmacher werden?“
„Ich bereite mich auf das Studium der Elektrotechnik vor. Mit dem Einjährigen und einer praktischen Ausbildung ist eine Immatrikulation an einer technischen Hochschule möglich. Hierfür gibt mir Professor Dunker noch Privatunterricht in der höheren Mathematik.“
Das Gewitter hatte sich verzogen. Behm betrachtete das Thema Schule als abgeschlossen. Keinem Menschen hatte er bisher über seine Schulzeit erzählt. Und die ganze Woche hatte er nicht so viel geredet wie in der letzten Stunde. Mit prüfendem Blick in den Himmel stellte sie fest:
„Es wird trocken.“ Und kurz danach: „Sollen wir nicht ‚Du’ zueinander sagen?“
„Gerne, ich heiße Karl Friedrich Franz Alexander. Suchen Sie sich etwas aus.“
„Du!“, korrigierte sie. „Ach, wie lustig. Mich hat man neben Johanna auch noch nach verschiedenen Vorfahren auf Marie, Erna und Auguste getauft.“ Beide schauten sich belustigt an.
„Was hältst du davon, wenn ich trotzdem bei ‚Behm’ bleibe. Das ist so schön kurz. Außerdem liegt es zwischen Baum und Lehm.“ Dabei gluckste sie in sich hinein.
„Hauptsache ‚Du’“, antwortete er unsicher.
Der Heimweg war von wenigen Gaslaternen nur karg beleuchtet. Behm glaubte, für den Bruchteil einer Sekunde ein hohes Pfeifgeräusch zu hören. Es kam von einer Fledermaus, die mit abrupten Wendungen aus dem Kirchturm schnellte. Erschrocken drückte sich Johanna einen Moment an seine Schulter. Auf dem Straßenpflaster polterte ein mit Heu beladener Zweispänner an ihnen vorüber. Vor der letzten Biegung des Weges nahm sie plötzlich seine Hand und ließ sie bis zum Haus des Dorfarztes nicht mehr los. Sie lag warm und weich in seiner. Er blieb stehen und schaute sie an. Seine Blicke suchten ihren Mund, auf dem er die Spur eines Lächelns entdeckte. Es wirkte sinnlich, vielleicht etwas spöttisch, auf jeden Fall aber geheimnisvoll. Es blieb wie ein Foto in seinem Gedächtnis, auch, als Johanna eine Woche später ohne Abschied wieder abgereist war.
Im folgenden Sommer kam sie nur für drei Wochen nach Hadersleben und im Sommer danach gar nicht. Von ihrer Schwester erfuhr Behm, dass ihr Vater nach längerer Krankheit in Rostock gestorben war. Er war nur zweiundfünfzig Jahre alt geworden.
Abb. 2 Haderslev mit Domkirche 2018
Ernst Behm - 1901
Als der Schuss krachte, wusste Behm schon, dass er den Feldhasen nicht getroffen hatte. Im Schießen hatte der inzwischen einundzwanzigjährige Behm beim Büchsenmacher große Fortschritte gemacht. Der Meister hatte ihm gezeigt, wie der Kugellauf einer Flinte einzuschießen und die Visiereinrichtung zu justieren ist. Inzwischen wusste er um die Bedeutung des Dralls, des Rückstoßes und der Laufbewegung des Geschosses. Er hatte mit verschiedenen Jagdgewehren, Patronen und Schießpulversorten experimentiert. Und beim Revierförster lernte er, die Bewegung und Entfernung des Wildes, Windstärke und Windrichtung einzuschätzen. Er befasste sich mit der ballistischen Kurve, in der sich die Schwerkraft des Geschosses auf seine Flugbahn auswirkt.
Die Hasenspur am Rande des Stoppelfeldes war frisch und im angetauten Schnee gut erkennbar. Behms Geduld wurde nicht lange auf die Probe gestellt, als ein prächtiger Rammler am Feldrand erschien, sich auf seinen Hinterläufen zu einem Kegel aufrichtete und die Löffel spitzte. Behm hatte die doppelläufige Flinte noch in Anschlag bringen und das regungslose Tier ins Visier nehmen können. Plötzlich hatte Behm ganz leise gemurmelt:
„De Krei, de kreeg een – vun de achtersten Been.“ Die letzte Zeile aus dem Gedicht „Matten Haas’“ kam ihm ungewollt über seine Lippen geflogen. Aufgeschreckt flüchtete der wachsame Hase hakenschlagend in Richtung Westerholz. Nur seine Atemwolke blieb in der frostigen Luft eine kurze Weile stehen.
Schade! Ernst Behm, Alexanders Vater, feierte heute seinen fünfzigsten Geburtstag. Und Hasenkeulen gehörten zu seinen Lieblingsgerichten. Aber daraus wurde heute nichts mehr. Jetzt gab es auf dem Heimweg nur noch eine Chance, die Barsche an der Skallebæker Seemündung.
Als Behm mit drei großen Barschen zu Hause erschien, hatte sein Vater bereits eine erste Geburtstagsrunde auf der Poststation in der Bahnhofstrasse hinter sich. Seinen Freund und Kollegen Nils brachte Ernst Behm mit nach Hause. In der warmen Stube dauerte es auch nicht lange, bis sie zu zweit kraftvoll sangen. Behm hörte es schon von weitem:
„Im Herzen Europas da thront ein Kaiser - mit Fürsten in einem tapferen Volk…“
Behm wartete, bis sie das Lied mit einem patriotischen „Hurra!“ beendeten, bevor er eintrat.
Für Behms Eltern war die reiche Fisch- und Wildbeute ihres Ältesten ein Beitrag zum Familienunterhalt. Behms Vater zeigte über die Fische seines Sohnes deshalb nur verhaltene Freude. Heute hatte Paula, Behms Mutter, Aale gedünstet. „Aal grün“, war eines der Lieblingsgerichte ihres Mannes. Gemeinsam mit dem Gast, Nils, und Behms beiden jüngeren Brüdern, Otto und Werner, saßen sie um den großen Tisch. Behms Brüder redeten durcheinander und langten mit glänzenden Mündern nach den gebutterten Aalstücken. Das herzhafte Mahl kam an. Zur Feier des Tages öffnete Vater Ernst eine Flasche Rotwein aus dem Präsentkorb seiner Kollegen. Paula hatte den fünfarmigen Kerzenleuchter auf den Tisch gestellt. Beim Anstoßen erklangen die Gläser und das Kerzenlicht verbreitete eine festliche Stimmung.
„Es gibt eine wichtige Neuigkeit“, kündete Behms Vater kauend an. „Otto hat heute Post von der Universität Darmstadt erhalten, eine Zusage.“
„Ja, von der juristischen Fakultät. Ich fahre übernächste Woche“, ergänzte der um zwei Jahre jüngere Bruder. Und in Richtung Alexander:
„Vater hat mir eine Zugverbindung quer durch Deutschland herausgesucht. Ich werde dreiundzwanzig Stunden unterwegs sein.“
Alexander schluckte und starrte auf sein Weinglas. Alle schauten ihn an.
„Finde ich gut, viel Glück“, kam es gedrückt.
„Und wie sehen deine Pläne aus?“, wollte Nils von Behm wissen.
Offenbar wusste Nils, dass Behm, anders als sein Bruder Otto, kein Abitur hatte.
„Ich werde Elektrotechnik studieren.“ Behms Reaktion klang unfreundlicher als er beabsichtigt hatte.
An der Haustür klopfte jemand. Es war Professor Conrad Dunker, der sich, ohne eine Aufforderung abzuwarten, sofort auf die Holzbank neben Behm setzte.
„Jetzt ist es passiert“, er war noch außer Atem, als er die ‚Nordschleswigsche Zeitung’ zwischen den Tellern und Gläsern ausbreitete:
„Hier steht es: Röntgen hat für seine Entdeckung der X-Strahlen vom schwedischen Komitee den Nobelpreis für Physik erhalten. Das ist der erste Nobelpreis, der für Physik vergeben wird.“ Dunkers Augen blitzten hinter der Brille:
„Hier steht es: ‚Als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes, den er sich durch die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen erworben hat’.“ Er klopfte Behm begeistert auf die Schulter. Und zur Geburtstagsrunde gewandt:
„Röntgen hat seine Strahlen erst vor sechs Jahren entdeckt. Und wir beide experimentieren bereits seit drei Jahren damit.“ Dunker beobachtete die Wirkung seiner Worte und ergänzte:
„Und Röntgen, das wissen die wenigsten, hat auf eine Patentierung verzichtet. Seine für die Menschheit wichtige Entdeckung soll sich so schnell wie möglich verbreiten. Und das Preisgeld, fünfzigtausend Schwedische Kronen, will er seiner Universität in Würzburg stiften.“
Behm freute sich über den Themenwechsel. In der Nähe dieses klugen Mannes fühlte er sich sicher.
“Herr Professor“, Mutter Paula reichte Dunker die mit Aal aufgefüllte Schüssel, „wir haben soeben über Alexanders Zukunft gesprochen. Sollte er nicht bald mal einen richtigen Beruf lernen?“
Behm verzog sein Gesicht. Sein Vater schenkte Wein nach und ergänzte:
„In deinem Alter war ich schon Beamter des preußischen Königreichs in Sternberg.“ Werner, Behms jüngster Bruder, mischte sich ein:
„Wollen wir nicht lieber über was anderes reden?“
Dunker hob beschwichtigend beide Hände:
„Lieber Herr Oberpostsekretär, Ihr Sohn wird ein erfolgreicher Elektrotechniker, da bin ich sicher.“
Nun meldete sich auch Behm mit ungeduldiger Gebärde:
„Ich brauche noch ein paar Monate Mathematikunterricht bei Professor Dunker. Dann gehe ich nach Karlsruhe. Ich werde dort an der Technischen Hochschule Elektrotechnik studieren.“
Sein Vater runzelte die Stirn und seine Mutter machte sich am gusseisernen Herd zu schaffen. Es entstand eine längere Pause, die Behm peinlich war.
„Hast du etwas von Johanna gehört. Wann kommt sie wieder nach Hadersleben?“, versuchte Paula, das Thema zu wechseln.
Behm hatte Johanna im vorletzten Sommer zuletzt gesehen. In den drei Wochen waren sie fast täglich zusammen. Am liebsten waren sie entlang der Fördebuchten gewandert. Johanna hatte ihn auch beim Jagen und Angeln begleitet. Und Behm spürte, dass sie seine Begeisterung hierfür teilte. Immer, wenn sie den Weg am Damm passierten, kam auf der Höhe des Otterbaus sein Spruch:
„Den kregen wi ok to faten!“
„Dat hest du in letzt Johr al anseggt“, war dann ihre Antwort. Dabei lachte sie. Und ihre Fröhlichkeit wirkte ansteckend. Kurz vor ihrer Abreise, Ende August vorletzten Jahres, hatte er sie mit nach Hause gebracht.
„Ich glaube, sie wird erst Anfang Juli wieder bei den Magaards sein.“ Behm stocherte appetitlos in den erkalteten Kartoffeln und schob den Teller beiseite.
Obwohl sie sich wegen der Krankheit von Johannas Vater im letzten Sommer nicht sehen konnten, war ihre Beziehung vertrauter geworden. Sie schrieben sich Briefe. Über ihre Zukunft hatten sie jedoch nie gesprochen.
Behms Vater legte Dunkers Geburtstagsgeschenk, eine Schellackplatte, auf den Grammophonteller.
Dunker fragte in die Runde:
„Haben Sie in der Zeitung über den Auftritt des Kaisers in Kiel gelesen?“
Außer Dunker offensichtlich keiner. Wilhelm sei in seiner Ansprache, so Dunker, auch auf die Menschen in Nordschleswig eingegangen.
„Also auf uns“, Dunkers Geste umfasste die ganze Runde, „und dabei hat er uns gelobt. Er ist stolz darauf, dass es sein deutsches Volk in so kurzer Zeit geschafft hat, das dänische Gebiet wieder heim ins Reich zu holen.“
Behms Vater widersprach mit schwerer Zunge:
„Heim? Das sieht doch nur so aus! In Wirklichkeit ist Hadersleben doch dänisch geblieben. Drei Jahrzehnte nach dem Krieg sind wir doch immer noch die Fremden.“
Sein Kollege Nils hatte von Bier und Wein eine gerötete Nase. Er trank noch hastig einen großen Schluck und rief:
“Wir können ja im Eingang unseres Postamts ein Schild aufstellen“, seine Hände gestikulierten ein breites Band, „auf dem steht ‚Amtssprache ist Deutsch’. Dann wollen wir doch mal sehen.“
Die Vorstellung, wie sich die deutsche Kaisermacht ihren Hoheitsanspruch über die Grenzregion Nordschleswig mit Hilfe der Postbeamten sicherte, gefiel ihnen sichtlich. Dunker hob seinen Zeigefinger:
„Liebe Freunde, vergesst nicht, wer den zweiten Schleswigschen Krieg 1864 angezettelt hat. Es waren doch nicht unsere dänischen Nachbarn, sondern…“
„…Widerspruch, falsch“, unterbrach Nils gereizt, „das grenzt ja fast an Majestätsbeleidigung.“
Auch Ernst verzog sein Gesicht verärgert. Er sprang auf und stürzte zum Grammophon, um Dunker seine Schellackplatte zurück zu geben. Dabei streifte seine Schulter eines der gerahmten Fotos, die Paula an die Wand gehängt hatte. Es fiel auf den Boden. Das Glas zersprang in kleine Stücke, die sich klirrend im Raum verteilten. Ernst blickte betroffen auf den angerichteten Schaden.
„Da liegt er jetzt, unser stolzer Kaiser“, rief er mit bekümmerter Ehrfurcht. Er bückte sich vorsichtig, nahm die Fotografie in beide Hände und hob sie langsam auf. Erst jetzt sah er, dass der junge Mann in Gardeuniform mit Pickelhaube und Schnurrbart nicht Wilhelm, der Kaiser, sondern Alexander, sein Sohn war. Alexander hatte vor Weihnachten einen Fotografen aufgesucht. Dieser hatte geschäftig vorgeschlagen, Behm mit diversen Utensilien etwas herauszuputzen. Alexander hatte seinen Schnurrbart mit Bartwichse eingeschmiert, nach kaiserlichem Vorbild bis zur Nasenwurzel hochgezwirbelt und die preußische Gardeuniform angezogen. Seine Eltern waren von dem Weihnachtsgeschenk begeistert.
Vater Ernst rieb seine Augen und wandte sich erneut Dunker zu. Als Beamter fühlte er sich verpflichtet, jede kritische Äußerung über den Deutschen Kaiser und den König von Preußen konsequent zu beanstanden. Gerade setzte er mit gehobener Stimme zu einem unmissverständlichen Tadel an. Dann stutzte er. Seine Augen wanderten zur Küchentür. In dieser stand Johanna Glamann, die dicke Schneeflocken von ihrem Wintermantel abschüttelte. In dem Tumult hatte keiner das Klopfen an der Haustür gehört. Sie verstummten jäh und schauten auf die Besucherin. Dem Hausherrn streckte sie eine in Geschenkpapier eingewickelte Flasche entgegen:
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.“ Und für Behm hatte sie auch ein Päckchen:
„Etwas aus der Heimat.“ Ihr Gesichtsausdruck war pure Freude. Behm öffnete es sofort:
„Fritz Reuter, Ut mine Festungstid“, murmelte er und schaute auf ihren Mund. Sie lächelte ihn an.
Es war ihre letzte Begegnung in Hadersleben. Bevor der Frühling im Norden Fuß fasste, hatte Behm sich in Richtung Süden auf den Weg gemacht.
Abb. 3 Behms erste Veröffentlichung 1900 „Über die elektrische Batterie“ (mit K. Dunker)
Zweites Kapitel: Karlsruhe
Fridericiana - 1902
In Flensburg war die Hälfte der Reisenden ausgestiegen. Hierzu gehörte ein nach Schweinemist riechender Landwirt. Behm riss das Abteilfenster auf. Er schaute dem Bauern hinterher. Dieser war mit einem Jutesack bepackt, aus dem ein Ferkel unentwegt quiekte. Schon fuhr der Zug mit monotonem Rattern über Tarp in Richtung Schleswig, wo eine Gruppe junger Marinesoldaten in blau-weißen Uniformen zustieg. Sie unterhielten sich so laut, dass Behm sich in einen anderen Wagen verzog. Er wollte allein sein. Seit Beginn seiner Reise hatte er fortwährend an Johanna denken müssen. In diesem Jahr hatte sie erstmals die Weihnachtsfeiertage bei ihrer Schwester in Hadersleben verbracht. Ihr plötzlicher Besuch zum Geburtstag seines Vaters hatte die Gesellschaft vom deutsch-dänischen Konflikt abgelenkt. Und es hatte nicht lange gedauert, bis sie gemeinsam mit Inbrunst ihre nordischen Lieder über die Liebe, den Wind und die Ostsee sangen.
Kurz nach Neujahr hatte Behm einen langen Brief an Johanna geschrieben. Eine ganze Woche hatte er gebraucht, um die richtigen Worte zu finden. Solche Briefe lagen ihm nicht. Schließlich kamen eine knappe Schilderung seiner jüngeren Waiderlebnisse und eine etwas hölzerne Beschreibung seiner Zukunftspläne zustande. Dann zögerte er, den Brief abzuschicken. Erst nach einer weiteren Woche ging der Brief in die Post. Am Ende hatte Behm noch einige Zeilen ergänzt, die seine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft andeuteten.
Behm schaute aus dem Fenster. Inzwischen trugen die Bäume wieder ihr erstes Frühlingsgrün. Er versuchte, mit seinem Blick die Telegrafenmasten entlang der Bahntrasse einzufangen. Ruckartig bewegte er seinen Kopf hin und her. Zwischen den Holzmasten beugten sich die Drahtleitungen wie sanfte Wellen, deren wiegende Bewegungen sich mit zunehmender Geschwindigkeit des Zuges beschleunigten. Er schaute auf die Viehweiden, mit denen sich kleinere und größere Waldstücke abwechselten. Die Konturen der am Zugfenster vorbeisausenden Natur kamen ihm ebenfalls wellenförmig vor. Behm ließ seine Gedanken schweifen. Selbstverständlich war es nicht die Natur draußen, sondern der Zug, der sich bewegte. Das Auge ließ sich täuschen; draußen bewegte sich scheinbar alles in Wellen. Er musste an Dunker und die Physik denken. Dunker hatte über die Beziehung zwischen Kraft und Bewegung gesprochen. Er hatte Isaac Newton erwähnt. Mit dem durch die Landschaft brausenden Zug vollzog sich der Transport von Energie durch den Raum. Auch Wasserwellen und Naturgewalten hatten etwas mit Energietransport zu tun. Behm dachte an den Unterschied von Licht- und Schallwellen. Dabei kam ihm Johannas Lachen in den Sinn. Er hatte sie beim letzten Abschied in den Arm genommen und ihre Wärme gespürt. Das hinter ihrer frischen Bluse versteckte Wellental zwischen den Brüsten hatte ihn erregt. Mit diesem Bild schlief er in seiner Ecke am Fenster ein.
Als er aufwachte, fiel sein Blick wieder auf die Telegrafenleitung. Mehrere Monate hatte Dunker seine Physikstunden der spannenden Geschichte der Telegrafie gewidmet. Dabei hatte er auch über den Engländer Michael Faraday berichtet. Dieser hatte 1832 die elektromagnetisch erzeugte Spannung entdeckt. Behm erfuhr, dass es viele kleine Schritte und Reihen von Pionieren aus verschiedenen Ländern waren, denen die Entdeckung und Ausbreitung der Telegrafie zu verdanken war. Und am Ende hatten sich die Codierungen des amerikanischen Malers und Bildhauers Samuel Morse durchgesetzt. Begeistert hatte Behm der Geschichte über die Verlegung eines Telegrafenkabels zwischen Großbritannien und Amerika quer durch den Atlantik gelauscht.
Behm erinnerte sich, wie Dunker über den Bau der „Great Eastern“ erzählte. Das war 1857. Sie war damals das größte Schiff der Welt mit sechs Segelmasten und zehn Dampfkesseln. Der Riese hatte Platz für viertausend Passagiere und vierhundert Mann Besatzung. Er konnte die Welt ohne Zwischenstopp zum Kohlebunkern umrunden. Konstrukteur war der englische Ingenieur Isambard Kingdom Brunel. Beim Stapellauf war es zum Desaster gekommen: Eine Stahlkette zerbrach. Ein Arbeiter verunglückte tödlich und das Schiff wollte sich nicht ins Wasser bewegen. Dann erlitt der Pionier Brunel am Tag vor der Jungfernfahrt einen Schlaganfall, dem er kurz darauf mit dreiundfünfzig Jahren erlag. Behm hatte diese Geschichte sofort seinen beiden jüngeren Brüdern erzählt. Mit hochroten Köpfen hörten sie ihm zu. Wenn er auf die vielen Unglücke der „Great Eastern“, die technischen Schwierigkeiten und Katastrophen zu sprechen kam, bohrten sie ihn mit ihren Fragen. Immerhin überstand die „Great Eastern“ die Havarien, sogar den Dreißig-Meter-Riss in der Stahlwand, als der Koloss im August 1862 auf ein Riff vor New York gelaufen war. Und als die Pioniere 1865 begannen, für die gigantische Strecke durch den Atlantik über viertausend Kilometer Telegrafenkabel zu bauen, kam nur dieses eine Schiff für die Verlegung in Frage. Inzwischen wurden die Morsecodes mit Hilfe elektromagnetischer Impulse und der Geschwindigkeit eines Gewitterblitzes befördert. Das ging quer durch das Kaiserreich und dank der „Great Eastern“ sogar über den Ozean. Am Ziel wurden die Impulse in lesbare Nachrichten zurück verwandelt.
Jetzt war Behm auf dem Weg nach Karlsruhe. In der letzten Nacht überbrückte er eine längere Wartezeit im verwaisten Bahnhof von Bielefeld. Seine Sachen hatte er in zwei Seesäcken verstaut, die er nicht aus den Augen ließ. In Dortmund fand er in einem Abteil eine zerfledderte Ausgabe des „Vorwärts“. Die Schlagzeile „Geheimpläne des Vizeadmirals von Tirpitz“ machte ihn neugierig. So erfuhr er, dass es bereits seit einigen Jahren Pläne zur Aufrüstung der Kaiserlichen Marine gab, die aber erst vor kurzem an die Öffentlichkeit gedrungen waren. Berliner Sozialdemokraten hatten Anstoß genommen. Von Tirpitz rechtfertigte die Pläne.
Als er in Karlsruhe um kurz vor drei Uhr nachmittags am dritten Reisetag ankam, war er von den Eindrücken der letzten Tage überwältigt. Die Badische Residenz- und Landeshauptstadt war mit ihren rund hunderttausend Einwohnern erst vor kurzem zur Großstadt erhoben geworden. Von Dunker hatte er die Adresse einer studentischen Zimmervermittlung bekommen, die er zielstrebig aufsuchte. Seinen privaten Mathematikunterricht bei Dunker hatte er bis Mitte März regelmäßig fortgesetzt. Beim Buchbinder wurden seine Übungshefte zu einem dicken Buch gefasst und in Rindsleder gebunden. Jetzt drückte es im Seesack sperrig auf seinen verschwitzten Rücken. Da er nicht wählerisch war, stand seine Bleibe in der Durlacher Allee Nummer 4 bereits am Abend fest:
„Keinen Damenbesuch und spätestens um zweiundzwanzig Uhr Licht aus!“, hatte ihm die Vermieterin noch nachgerufen, als er die schmale Holztreppe in den vierten Stock hinaufstieg. Er schlief wie ein Stein und erwachte mit dem Sonnenaufgang.
Das Frühstück wurde in dem mit Polstermöbeln überladenen Wohnzimmer der Vermieterin, Frau Liebelein, serviert. Sie war nett, aber kaum zu verstehen. Sie stellte ihm einen weiteren Mieter vor, Adrian Willem Engelen aus Rotterdam. Dieser wohnte im Nachbarzimmer. Adrian hatte sein Studium des Maschinenbaus bereits im Vorjahr begonnen. Bereitwillig informierte er Behm über die örtlichen und akademischen Gegebenheiten:
„An der Hochschule sind inzwischen fast zweitausend Studenten eingeschrieben.“
Behm hörte gespannt zu.
„Gegen den Widerstand einiger verknöcherter Professoren“, setzte Adrian fort, „wurden an unserer Hochschule im vorletzten Jahr einige Änderungen eingeführt: Jetzt kann auch bei uns promoviert werden, nicht mehr nur an den Universitäten. Wir werden aufgewertet“, sein Finger zeigte nach oben, „und das haben wir Eurem Kaiser zu verdanken. Offenbar hat er die Bedeutung der Technik für den Fortschritt erkannt.“ Adrian war zwei Jahre älter, einen Kopf größer und erschien halb so dünn wie Behm.
„Und in der nächsten Woche“, setzte Adrian fort, „wird es am Hof des Großherzogs ein großes Fest geben: Friedrich feiert am 12. April sein fünfzigjähriges Regierungsjubiläum“, Adrians Stimme wurde feierlich, „und unsere Hochschule wird dann den Namen ‚Fridericiana’ tragen.“
Behm nickte mit respektvoller Miene. Adrian gefiel ihm.
Gemeinsam nahmen sie den Weg über den Campus, vorbei am Botanischen Institut und am Durlacher Tor zum Hochschulsekretariat. Als das Elektrotechnische Institut in Sicht war, erläuterte Adrian:
„Du wirst im neuesten Gebäude des Campus studieren.“ An der Aula blieb Behm sprachlos stehen. Vor der prunkvollen Fassade im säulengerahmten Neo-Renaissancestil kam er sich klein und unbedeutend vor.
„Das musst du dir erst einmal von innen ansehen“, tönte Adrian sichtlich belustigt.
„Was muss das wohl gekostet haben“, dachte Behm laut.
„Der Bau ist erst vor drei Jahren fertig geworden. Und das ganze konnte nur deshalb so üppig werden, weil der Großherzog einen dicken Brocken finanziert hat. Auch die regionale Wirtschaft und sogar die Professoren und Ehemaligen haben gespendet.“ Behm blickte auf Fenstergewölbe und Zinnen. Ihm wurde unbehaglich.
Vor dem Sekretariat reihte er sich in die Warteschlange junger Männer ein. Sein Anliegen trug er einem bereits ergrauten Sekretariatsbeamten vor, der in Ärmelschonern hinter einem hölzernen Tresen stand. Gegen die barsche Aufforderung, ein Formular auszufüllen und es mitsamt dem Abitur-Zeugnis vorzulegen, protestierte Behm zaghaft:
„Nicht Abitur, sondern Einjähriges in Kombination mit privatem Mathematikunterricht und praktischem Jahr.“
„Nein“, der Beamte schaute Behm missmutig an. „Das war einmal, ist nicht mehr!“ Behm glaubte, sein schwäbisches Genuschel falsch verstanden zu haben:
„Nach der Studienordnung reicht für die Immatrikulation das Einjährigen-Zeugnis, ergänzt um ein praktisches Jahr bei einem Handwerksmeister. Darüber hinaus habe ich noch eine Bestätigung eines Gymnasiallehrers über meine Mathematikkenntnisse. Damit habe ich die Voraussetzungen erfüllt.“
„Sie haben wohl die Entwicklung verschlafen“, donnerte der Beamte. „Sie sind hier nicht mehr am Polytechnikum, sondern an einer Hochschule. Hier werden nicht länger Ingenieure, sondern Diplom-Ingenieure und Doktoren ausgebildet.“
Behm schaute ihn ungläubig an.
„Nun verschwinden Sie endlich, Sie halten den Betrieb auf“, brüllte der Beamte, dessen buschige Augenbrauen bedrohlich über dem Brillenrand wippten. Behm blieb wie angewurzelt stehen, unfähig zu einer Reaktion. Sein sonnenfrisches Gesicht wurde blass. Sein Schnurrbart zitterte. Jetzt kam der Beamte, Unverständliches schimpfend, hinter dem Tresen hervor. Seine Körpergröße reichte bis zu Behms Schultern. Mit Behms Gewicht konnte seine füllige Gestalt jedoch mithalten.
„Wenn Sie nicht auf der Stelle hier verschwinden, muss ich den studentischen Ordnungsdienst rufen lassen.“ Unwirsch fasste er Behm am Arm und zog und stieß ihn zur Tür.
„Und das Formular brauchen Sie erst gar nicht auszufüllen“, schnauzte der Beamte hinter ihm her.
August Schleiermacher - 1902
Behm fühlte sich wie ein Verbannter. Panisch irrte er in den Fluren der Hochschule umher. In einem Nebengebäude fand er das Büro der Freien Studentenschaft, eine formell anerkannte Studentenorganisation. Sie kümmerte sich vor allem um Studenten, die nicht in einer der vielen Verbindungen organisiert waren. Dort riet man zu einem neuen Anlauf und hielt Professor August Schleiermacher für die richtige Adresse. Behm musste sich dabei jedoch längere Ausführungen zur Historie der Hochschule anhören. So erfuhr er, dass auch der von Conrad Dunker so bewunderte Heinrich Hertz an der TH Karlsruhe gelehrt hatte. Hertz war damals der Nachfolger des Physikers Ferdinand Braun. An Hertz’ Versuchsanordnungen zur Übertragung elektromagnetischer Wellen hatte auch sein damaliger Assistent, Dr. Schleiermacher, mitgewirkt. Später waren sie sogar Freunde geworden. 1892, nach dem Wechsel von Hertz an die Bonner Universität, wurde das Ordinariat der Elektrotechnik Schleiermacher übertragen. Das neue Institutsgebäude machte die gewachsene Bedeutung dieses Fachs deutlich. Vor diesem Gebäude stand Behm nun. Ihm war heiß und kalt zugleich.
„Herr Professor Schleiermacher, es geht um meine Immatrikulation“, begann Behm, nachdem ihn der freundlich blickende Professor gebeten hatte, sein Anliegen knapp und präzise zu benennen. Behm schilderte zunehmend flüssiger seinen holprigen Schulwerdegang. Schleiermacher wirkte anfangs ungeduldig. Als Behm über Dunkers Schulversuche und die selbstkonstruierten Laborgerätschaften sprach, blickte Schleiermacher auf. Zu Dunkers Versuchen mit den Röntgenstrahlen und der drahtlosen Telegrafie wollte er mehr hören.
„Welcher Art war der Privatunterricht in Mathematik?“, wollte der knapp fünfzigjährige Schleiermacher noch wissen. Behm kramte in seiner Aktentasche und zog das rindsledergebundene Übungsbuch heraus. Interessiert blätterte der Professor. Zwischendurch wackelte er mit dem Kopf, so als sei die Sache unklar. „Die Studienordnung ist erst vor kurzem geändert worden. Sie hätten sich besser informieren müssen. Schade, dass Sie nicht bis zum Abitur weitergemacht haben“, leitete er seine Antwort ein. Behm rutschte im gepolsterten Stuhl nervös auf die Kante. „Damit haben Sie Ihre berufliche Zukunft aufs Spiel gesetzt.“ Schleiermacher kraulte seinen dunklen Vollbart.
„Ich habe ja neben meiner handwerklichen Arbeit weiter gemacht“, entgegnete Behm, „nicht nur durch meine Assistenz der Schulversuche und mit den Mathematikstunden.“ Behm tupfte sich den Schweiß von der Stirn. „Ich habe Leidener Flaschen in einer Größe konstruiert, wie es sie vorher meines Wissens nicht gegeben hat. Und ständig habe ich neue Apparate für die physikalischen Versuche von Professor Dunker gebaut.“
„Das klingt gut“, Schleiermachers wache Augen fixierten Behm, „aber wie soll ich Ihren eigenen Beitrag in der Kürze der Zeit jetzt nachvollziehen? Eine Aufnahmeprüfung gibt es hier nicht. Und Ausnahmen können wir nach der schwierigen Geburt der neuen Studienordnung unter keinen Umständen machen.“
„Ich habe zusammen mit meinem Physiklehrer einen Fachbeitrag über die elektrische Batterie veröffentlicht.“ Behm zog seinen Fachaufsatz hervor, den er vor zwei Jahren in der „Zeitschrift für physikalisch-chemischen Unterricht“ veröffentlicht hatte. Schleiermacher begann, mit gerunzelter Stirn zu lesen.
Behm war davon überzeugt, dass von den kommenden Minuten sein Lebensschicksal abhing. Seine Gedanken rasten.
‚Was ist, wenn sich dieser Mann gegen mich entscheidet? Was mache ich dann? Was habe ich nur gemacht?’