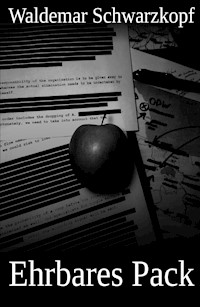
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Sieben Spiegel
- Sprache: Deutsch
Die Buchreihe "Sieben Spiegel" diskutiert die sieben Todsünden als grundlegende Eigenschaft der Menschen und zeigt dabei auf, wie tief der Drang zum Verderblichen in der menschlichen Natur verankert ist. Durch die zynisch penetrante Hyperbel wird dabei die Gesellschaftskritik deutlich. Jedoch bedingt jede Sünde auch die Möglichkeit zu einer Tugend - welche jedoch, wie auch in der Realität, oft nicht direkt ersichtlich ist. Ehrbares Pack behandelt als erstes Buch dieser Reihe die Todsünde des Hochmuts, welchem in seiner durchdringendsten Ausprägung, dem Hochmut durch Machtpotenzial, konsequent freie Verfügung über fiktive Personen in einer nicht-fiktiven Welt gewährt wird. Die Folge dieses Gedankenexperiments ist eine zwar fortschrittliche, jedoch entmenschlichte und triste Dystopie, in welcher die Auswirkungen von Machtkämpfen die Menschheit unter die Fuchtel einer Aristokratenfamilie bringen, deren Handeln durch und durch plausibel erscheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Dirk. Danke für Deine Hilfe und die Unterstützung.
-
Nie getan.
Nie gedacht.
Nie erahnt, was die Macht
Aus des Menschen Geist erschafft.
-
Waldemar Schwarzkopf
Ehrbares Pack
© 2021 Waldemar Schwarzkopf
Autor: Waldemar Schwarzkopf
Umschlaggestaltung, Illustration: Waldemar Schwarzkopf
Lektorat, Korrektorat: Dirk Schanz
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-347-31831-1 (Paperback)
ISBN: 978-3-347-32170-0 (Hardcover)
ISBN: 978-3-347-31832-8 (e-Book)
Verlag & Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Prolog
Der Junge tippte eifrig mit, während sein alter Herr scheinbar wirr seine Erinnerungen nuschelnd und schwach vor Krankheit vor sich hin brabbelte. Der Junge verstand ihn, er war das Geschwätz gewohnt. Das Geschwätz des Legendären, des Unerbittlichen. Des alten Mannes, dessen glanzvolle Tage schon längst untergegangen waren, und das noch bevor er überhaupt des Glanzes derselben gewahr wurde. Die Gedanken waren nicht wirr, sie waren erodiert. Die Schmerzen der Medikamente, die doch nur Gift waren, ließen ihn vieles vergessen und zwangen ihn dazu, von einer Insel des ihm noch Vertrauten zur anderen zu springen, und dabei die tiefen, dunklen Schluchten seiner Amnesie zu meiden. Es hätte nichts gebracht, sich ewig lang daran zu versuchen, sich an die vergessenen Dinge zu erinnern, denn viel Zeit blieb ihm nicht. Und so tippte der Junge ungefragt weiter, versuchte so viel als nur möglich zu retten für die Ewigkeit, für die ewige Bibliothek der Ahnen, um den zukünftigen Generationen stolz die Kunde seines Vaters zu überbringen. Er schrieb, um den Leser nicht in den Hochmut zu treiben – in den Glauben, diese Dinge selbst erlebt zu haben – nicht in der ersten Person, sondern behielt immerzu Abstand von den Gedanken seines Vaters, der ihm doch beigebracht hatte, sich immer seiner selbst gewahr zu bleiben.
Obschon das Zimmer kalt war, steril, in blassem Grau gehalten und mit kaltem Licht erleuchtet, hielt ihn die Verantwortung und der Stolz aufrecht und konzentriert. Es wäre Verrat gewesen, diese Bürde nicht zu tragen. Es wäre Verrat gewesen, diesen alten Mann, der nur noch ein Elend seiner Selbst war, seine Bürde alleine tragen zu lassen, und so tippte er alles nieder, wenn sein Vater wach war, korrigierte die Passagen als dieser schlief, und kümmerte sich um ihn, als dieser seine letzten Kräfte für den Kampf gegen den Tod mobilisierte. Der Junge schlief nicht, aß kaum, diente bis zur Erschöpfung – bis zur Erschöpfung seines alten Herren.
Dann begrub er ihn in der alten Erde.
Und begrub das Buch in der Bibliothek.
Kapitel 1
1
Die Blätter einer Schwarzeiche fielen in den regelmäßig erscheinenden Windböen mal schneller, mal langsamer zu Boden. Das entfernte Rascheln der Laubhaufen, durchmengt mit dem Geschrei zweier Schulkinder, hallte an den Palisaden wider, sodass man nicht sicher sagen konnte, woher die Geräusche kamen. Während die Kinder noch spielen durften, wandten sich die Erwachsenen dem Tagesgeschäft zu. Dieses bestand an diesem Oktobermorgen zur Freude ihrer verkaterten Gemüter lediglich darin, einige Geschäftsleute zu treffen und sich mit ihnen über gewisse Einzelheiten zu unterhalten, die als viel zu brisant für eine unpersönliche Korrespondenz angesehen wurden.
Wer ob der Brisanz der Gesprächsthemen entschied, oblag in dieser Runde freilich niemanden zu interessieren. Es waren keine hochrangigen Funktionäre, sondern Vorposten. Ob diese sich jemals vorarbeiten könnten, hing weder von ihrem Fleiß ab noch von dem Gutwillen ihrer Vorgesetzten. Denn Fleiß war eine Selbstverständlichkeit, und die Vorgesetzten beförderten niemanden wegen derartig irrelevanten Kriterien wie obligatorischen Verdiensten. Wenn überhaupt, so wurde man damit entlohnt, weniger Arbeit verrichten zu müssen, wenn man seinen Dienst an der Sache geleistet oder gar die Erwartungen übertroffen hatte. Die einzig akzeptable Grundlage für so etwas wie eine Beförderung war die absolut strategische Notwendigkeit, wie etwa das Dahinscheiden des vorherigen Würdenträgers. Doch da allesamt zurzeit noch gesund blieben und niemandem Anlass dazu gaben, einen Unfall heraufzubeschwören, standen solche Überlegungen nicht zur Debatte.
Die grauen Anzüge der verkaterten Herrschaften ließen sie wie graue, leblose Betonstatuen inmitten der farbenfrohen, goldherbstlichen Szene erscheinen. Lediglich die Auf- und Ab- Bewegungen ihrer Hände, welche große, knollige Zigarren in der Hand hielten, ließen erkennen, dass es lebendige Wesen waren.
Sie rührten sich noch nicht einmal, als die Limousine bis auf wenige Meter vor ihren kleinen Tischchen parkte, auf denen literweise starker Kaffee serviert stand. Einer der Herren rührte sich jedoch nach einigem Aufwiegen und zerstörte damit die ruhige, stoische Kulisse.
„Guten Tag, setzen Sie sich. Wir sollten gleich zur Sache kommen, denn ich denke, das ist auch in ihrem Interesse“, sagte der runde, dicke, kleine Mann, der den Investoren begrüßte.
„Vielen Dank für Ihre Höflichkeit und Direktheit, Mister Swarz“, erwiderte der junge, naive Angelsachse mit dem automatisch aufgesetzten Lächeln.
„Bitte – ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, nicht Englisch zu sprechen. Man weiß ja nie, wer zuhört. Aber meinetwegen können wir auch spanisch reden. Oder ist es hier doch zu sehr verbreitet?“
„Nicht in diesem Gebiet, Mister Swarz. Mir ist es egal – ähm – einerlei, meine Sprachkenntnisse erlauben mir Flexibilität. Worüber wollten Sie denn gerne sprechen, meine Herren?“
Der schnelle Prozess des verbalen Abtastens wich einem kargen, analytischen Gespräch über die Handelsverträge, die es galt, noch einmal zu überarbeiten und sie der wachsenden Gefahr aus den Schwellenländern anzupassen. Die Herren verstanden sich gut, schmunzelten über die ein oder andere Bemerkung des anderen, tranken Kaffee und vertieften sich immer weiter in die Diskussion, die Zahlen, die vertraglichen Einzelheiten über die Zuständigkeitsbereiche ihrer Unternehmen. Der einzige, der nicht viel sagte, war etwa nicht der Verkatertste, sondern der Mann, der die Analysen aufgestellt und den Fehler entdeckt hatte: Der Mann, der Interesse fingierte und dabei jedoch einfach nur abwartete, ob die Falle zuschnappen würde. Der Mann, der eigentlich genauso gut mit den Kindern im Laub spielen könnte, denn er hatte seinen Soll erfüllt und die anderen waren nun an der Reihe. Der uninteressierte Blick täuschte über die Ruhe und raubtierartige Geduld des Analysten hinweg, der genau wusste, dass man lieber den Dummen spielen sollte, dem kein Kommentar zur Diskussion einfiel, als der offensichtlich gefährliche Ruhige der Runde zu sein. Das hätte den jungen Idioten wahrscheinlich aufgescheucht. Doch so funktionierte es. Er war mit den Vorschlägen der Vereinigung, wie sie ihm vorgestellt hatten, einverstanden. Man musste nur noch darauf bedacht sein, dass dieser es auch an seinen Vorgesetzten weiter gab. Also ließ man ihn darüber grübeln und winkte einige hübsche Kellnerinnen vorbei, die ihm eine Zigarre anboten, einen Martini servierten und sich dabei etwas mehr als nötig vorbeugten.
Zusammen mit der scheinbar nebensächlichen Bemerkung, dass die Bonuszahlungen für etwaige Manager wieder angehoben wurden, zeigten die Bemühungen ihre Wirkung. Nach nur einer halben Cohiba nickte der junge Aufsteiger mit einem Lächeln und bat die Herren um Entschuldigung, er wolle mit seinem Vorgesetzten sprechen.
Der ruhig gebliebene Analyst zwang sich, nicht mehr zu lächeln als es der reinen Höflichkeit gerecht werden würde. Nach einigen Minuten ruhigen, aber entschlossenen Erklärens verabschiedete sich der Gast von seinem Gesprächspartner am Telefon, schritt glücklich zurück zur Gruppe der anderen Anzugträger und fragte, ob man denn zum Abschluss des Geschäfts noch einen Brandy trinken würde.
„Selbstverständlich, selbstverständlich!“, kam von einem der Jüngeren zurück. Der Dicke beteuerte und fand, dass es wohl ein gutes Zeichen war, dass auch die jungen Leute die Traditionen respektierten.
„So kann ich mit Ruhe und Gelassenheit in den Ruhestand gehen!“ Einer der jüngeren klopften ihm auf die Schulter: „Lass gut sein, Mister Swarz, bist ja bald in Rente. Dann kannst du den ganzen Tag dein Liedchen singen.“
Der junge Gast schien nicht richtig zu verstehen, lachte dennoch mit der Gruppe mit. Der Dicke selbst schüttelte nur den Kopf. Er hätte sich tatsächlich einen besseren Decknamen aussuchen sollen, diese Idioten nutzten nämlich jede Gelegenheit, sich über ihn lustig zu machen. „Unverschämte Rotznasen“, nuschelte er in gespielt beleidigtem Ton und zog an der Zigarre.
Während sich die Älteren mal wieder voll laufen ließen, da nun immerhin die Arbeit für die nächsten zwei Wochen endgültig getan war, spielten die zwei Jungen um einem nicht allzu entfernten Baumhaus herum mit ihren Spielzeugpistolen. Der eine, dürr, blond und sommersprossig, gab gerade seinem Cousin, der etwas kräftiger war, mit schwarzen Haaren und einem Gesicht wie eine Bulldogge, die er von seinem Vater geerbt hatte, Deckung. Es war inzwischen früher Nachmittag, und die beiden merkten allmählich, dass es an der Zeit war, etwas zu essen.
„Ok, Raph, ich glaub ich hab Hunger. Hast du nicht auch Hunger?“
„Ja, doch, ich weiß nicht. Was gibt es denn zu essen? Weißt du’s?“, kam vom Blonden aus einigen Metern Entfernung zurück.
Mir egal. Hauptsache es geht schnell und macht satt. Ich hab keine Lust die Gespräche von deinem Papa mit Onkel James zu hören. Die sind immer so langweilig.“
„Wo ist dein Papa eigentlich?“
Die beiden packten ihre Sachen in den Rucksack, der am Schluss überquoll vor lauter Spielzeugen: Pistolen, Actionfiguren, Autos und, nicht zu vergessen, ein Paar Brotboxen, die jedoch schon seit einigen Stunden leer waren.
„Der ist im Einsatz irgendwo in der Nähe, aber ich glaube er kommt morgen oder so zurück.“
„Was macht er denn? Erschießt er jemanden?“
„Klar doch – das ist ja sein Job. Also. Ich hab die Tasche hergetragen, du trägst sie zurück. Das war der Deal.“
„Das war der Deal“, erwiderte der Blonde.
„Mir egal was er macht, Hauptsache er bekommt danach frei und wir können in den Freizeitpark. Ich hab gehört, es gibt dort Autoscooter.“
Die beiden kannten sich in dem Waldstück ganz gut aus, wenn man bedachte, dass sie sich erst vor einer Woche her kamen. Es war ohnehin keine lange Bleibe, da die Schule bald wieder anfing. Die willkommene Abwechslung tat den beiden gut. Ansonsten wurde stets erwartet, dass die beiden gute Noten schrieben, sich anständig in der Schule verhielten und sich nichts zu Schulden kommen ließen. Doch hier durften die beiden Jungen Spaß haben. Zumindest bis übermorgen, denn dann ging es zurück in die Heimat, die Schulbank drücken.
Obschon beide de facto Einzelkinder waren, hatten sie sich nie so gefühlt. Sie hatten immer einander, und waren daher froh, dass sich ihre Väter so gut verstanden, auch wenn diese gänzlich verschiedene Berufe hatten. Ihre Mütter waren zwar noch enger befreundet, was der Tatsache geschuldet war, dass diese den gleichen Beruf ausübten, aber das schien ohnehin keinen großen Effekt auf das Leben der beiden Jungen zu haben. Womöglich lag dies daran, dass die beiden deren Jobs ziemlich öde fanden. Doch letztendlich spielten die Eltern für die Knirpse wohl weniger eine Rolle als sie es gerne täten. Raphael verstand sich deshalb so gut mit seinem Cousin, weil die beiden sich immer gegenseitig Deckung gaben. Loyalität, so wurde ihnen eingetrichtert, war wichtig. Da war es nur natürlich, dass man den Spielkameraden beibehielt, der nicht viel von Loyalität sprach, sie jedoch umsetzte.
Die Harmonie zwischen den beiden hatte umgekehrt sogar Auswirkungen auf ihre Eltern. Diese versuchten wann immer möglich, nah beieinander zu wohnen, oder zumindest den eigenen Sohn beim Anderen zu lassen, wenn man weg musste. Ein eingespieltes Team, so fanden beide Väter, würde bei weitem mehr Erfolg für jeden einzelnen versprechen, unabhängig von den Begabungen der Kinder. Und so schlossen sie einen unausgesprochenen Vertrag ab, den einzuhalten die Ehre von ihnen verlangte.
Oft sprachen die Kinder davon, was sie später werden wollten. Während ihre Altersgenossen meist davon redeten, Präsident zu werden oder Astronaut, Rennfahrer oder sonstiges, spekulierten die beiden über anderweitige Berufe. General, Manager, Informationsbeschaffer, Auftragskiller. Doch dafür gab es freilich andere Begriffe, die man zu nutzen pflegte, und so schimpften ihre Mütter der beiden jedes Mal auf sie ein, dass sie diese ja lernen sollten. Nicht auszumalen, was passieren würde, wenn sie diese Gespräche in der Öffentlichkeit führten.
Die Kindheit verlief jedoch nicht immer so gleichsam, so ähnlich für die beiden. Dies war nicht nur den Berufen ihrer Väter geschuldet, sondern auch den verschiedenen Charakteren der beiden Buben.
Während Raphael immerzu schüchtern war und lieber ruhig zuhörte, und seine Unauffälligkeit zwar verfluchte, jedoch zu nutzen wusste, war sein Cousin Immanuel einer jener vorlauten Kinder, die immer ihre Meinung zu sagen hatten und sich selbst nie was sagen ließen.
Doch seit dem sich die beiden im zweiten Lebensjahr kennen gelernt hatten, erwuchs in ihnen instinktiv der Wille zur Kooperation. Wehe dem, der Raphael etwas zu leide tat. Und wehe dem, der Immanuels vorlautes Mundwerk auszuspielen versuchte.
Bis auf die typisch kindlichen Streitigkeiten um Spielzeuge und derartige Belanglosigkeiten, die von ihren Eltern nicht wirklich beachtet wurden, da sie diese ihre Probleme weitestgehend selbst lösen lassen wollten, blieben die beiden wie Pech und Schwefel und stärkten ihre Freundschaft gar mit jedem weiteren, kleinen Konflikt.
Nur einmal, als Immanuel seinem Cousin die Nase blutig schlug – weshalb, weiß keiner mehr – und Raphael daraufhin seine Spielzeuge die Toilette runterspülte, gab es Anlass zu einem klärenden Gespräch mit den Vätern. Doch nachdem diese ihre der Mentalität entsprechenden Wutreden über die Idiotie ihrer Strolche beendet hatten, schienen beide keine Lust mehr auf ernsthafte Auseinandersetzungen untereinander zu verspüren. Dass diese ihre Mitschüler in der Grundschule feldzugartig terrorisierten, war wenn nicht gewollt, so zumindest von ihren Eltern gebilligt worden.
Eine Konsequenz des Zusammenhalts ihrer Eltern war die Tatsache, dass Raphaels Vater, der dem jungen Manager dabei zusah, wie er immer betrunkener wurde, sich kurz bei der Runde entschuldigte und vorgab, zur Toilette zu müssen.
„Piss doch ins Gebüsch du Weichei“, maulte ihn einer der anderen an. Der alte, Dicke schaute diesen jedoch mit derart durchdringendem Blick an, dass der Vorlaute verstummte und mit von Reue erfülltem Blick einen großen Schluck Luis Felipe nahm, worauf der strenge Blick des Alten sich schlagartig wieder in Heiterkeit auflöste. Tatsächlich musste der Analyst abtreten, jedoch nahm er auf dem Rückweg eine Abkürzung durch die Küche, vorgeblich, um Zigarrennachschub zu organisieren. Tatsächlich jedoch ging er ans Telefon, und bestellte seiner Tante liebe Grüße, sie solle sich wieder bei ihm melden, wenn sie wieder in der Stadt sei. Er kam zurück in die Runde, entschuldigte sich und bekam einige Momente später von den Kellnerinnen eine weitere Zigarre in die Hand gedrückt.
Später am Abend wurde der volltrunkene Manager von seiner Limousine ins Hotel gefahren, welches von seiner Firma großzügig dafür bezahlt wurde, dass einer der Pagen dem jungen Mann jeden Wunsch erfüllte, den er auszusprechen vermochte. Zum Glück des Pagen bekam der jedoch inzwischen kaum ein Wort zustande, torkelte stattdessen halbwegs gerade zum Fahrstuhl und schlief auf dem Weg nach oben beinahe ein. Das Hotel war ein Hochhaus aus den Siebzigern, relativ gut gepflegt von außen, vorzüglich ausgestattet von innen, und beherbergte neben unzähligen Räumen in der unteren Etage auch einige große Suites, von denen man die Skyline sehen konnte. Eine davon hatte einen relativ abgeschotteten Südbalkon, der die Sicht in nur eine Richtung beschränkte. Umringt war das zwanzigstöckige Haus von Gebäuden ähnlicher Höhe, jedoch übertraf die Anzahl der kleineren Firmengebäude die der größeren Bauten in diesem Stadtviertel. Die Nacht war ruhig, es hatte nachmittags kurz geregnet, typisch für die Jahreszeit, doch es sollte des Nachts trocken bleiben. Die milden Temperaturen ließen einen trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit kaum müde werden. Nachdem der erfolgreiche Manager, des Erfolges und des Schnapses, trunken sein Lieblingsalbum der Beatles auf volle Lautstärke drehte, nahm er sich eine Zigarette aus seinem Etui heraus, stampfte die Krawatte in die Ecke schmeißend auf den Balkon und zündete sie an.
Vortrefflich. Denn er hatte, wohl zu besoffen, vergessen, das Hauptlicht im Wohnzimmer anzumachen, weshalb der Scharfschütze ihn nun gut erkennen konnte. Der glimmende Zigarettenstummel jedoch gab dem Schützen die perfekte Zielmarkierung. Während er die Windrichtung anhand einiger Flaggen abschätzte, und die automatischen Berechnungen anstellte, kam ihm wieder in den Sinn, wie die Deutschen an der Westfront gegen Ende des Krieges sich das Rauchen abgewöhnen mussten, da die Bomber anhand der glimmenden Zigaretten regelrechte Positionsmarkierungen der Stellungen geschenkt bekamen. Schön blöd, da versucht man sich langsam ins Grab zu bringen und plötzlich kommt eine Bombe, ein Projektil oder sonst was angeschossen, dachte er sich, atmete aus, spürte seinen Herzschlag – und drückte ab. Das Blut spritzte auf die Vorhänge, welche bis auf ein kurzes Zittern unbeeindruckt weiter im sanften Ostwind schaukelten. Sonst keine Regung. Mit geübter Schnelligkeit packte der Schütze das Gewehr wieder ein, verstaute es in einer Art Aktenkoffer, nahm seine eigene Hülse mit, platzierte jedoch eine andere, die auf den ersten Blick der anderen gleich sah, auf dieselbe Stelle. Ohne Fernrohr sah man nichts von den Blutspritzern, zumal das fehlende Licht in dem Wohnzimmer das tiefe Rot unmerklich schwarz erscheinen ließ. In den Suites darüber und darunter ging auch kein Licht an, es hatte also tatsächlich niemand etwas bemerkt, und so sollte es mindestens bis morgen Mittag bleiben, bis der gut bezahlte Page stutzig werden würde, da der junge Mann für gewöhnlich mehr vertrug und nicht so lange auskaterte. Man würde durch die Ballistik darauf kommen, dass der Schütze hier gelegen hatte, man würde die Hülse finden, sie abgleichen und auf den Hinweis stoßen, der die Ermittlungen in eine Richtung lenken würde, die den Auftraggebern des Schützen nicht nur die Hunde vom Leib halten, sondern in eine Richtung lenken würde, die für die Familie von unschätzbarem Vorteil wäre. Mehr wusste der Schütze nicht, und es interessierte ihn nicht. Er vertraute den anderen, denn sie vertrauten ihm – und er hatte einmal mehr bewiesen, dass dieses Vertrauen kein fauler Kredit war. Beruhigt über die gewohnte Distanz zu seiner Beute schritt der Schütze schnell, jedoch ohne zu hetzen die Treppe hinunter, stieg, seinen Anzug nochmal auf Staub überprüfend in den Aufzug und tat so, als wäre er seiner Aufgabe überdrüssig, den Aktenkoffer irgendwo an irgendwen um diese unchristliche Uhrzeit auszuhändigen. Der scheinbar übermüdete Geschäftsmann schritt in der Tiefgarage in seinen Wagen, schlug die Autotür zu und atmete tief durch.
„Endlich Urlaub“, schnaufte er vor sich hin, er schaltete den Motor an und versuchte schnellstmöglich zuhause zu sein, denn morgen ging es mit Sohn und Neffen in den Freizeitpark.
2
„Die Grundlage aller Kriegsführung ist die Täuschung.“
Dieses Mantra hing Raphael zu den Ohren raus. Es interessierte ihn nicht. Er war mehr an Mathematik interessiert, einem Fach, welches sich der Logik versprach, nicht den Machenschaften irgendwelcher, aufrechtgehender Primaten. Und doch hörte er, wenn auch nur dumpf und von seinen eigenen Gedanken an die Unkenntlichkeit grenzend verstummt, diesen Satz. Die Stimme war rau und klebrig. Ungefähr so wie der Bitumenbeschlag auf dem Dach, dachte er sich, während er sich an der Narbe am Knie kratzte, die er sich damals beim Raufen mit seinem Cousin geholt hatte, als diese auf dem Dach des Hauses seiner Tante gespielt hatten. Was wohl Immanuel so macht? Ist er gerade in Zürich? Oder war er doch in Südamerika? Wo auch immer es seinen Vater hin verschlagen hatte, es gab wohl Gründe dafür. Welche genau, hatte er bisher noch nie bedacht. Es hat ihn nicht sonderlich interessiert. Primatensachen eben.
„Raphael, wann war die Schlacht von Verdun?“, hörte er im Hintergrund den alten Geschichtslehrer fragen.
Der alte, kettenrauchende Wicht von nur einem Meter sechzig schaute ihn inmitten seines kahlen Möchtegern-Wissenstempels von Klassenzimmer unbeeindruckt, jedoch mit einem gewissen Hauch von Verachtung an. Es war nicht die Verachtung an sich, die einen Schüler sich schlecht fühlen ließ, sondern dieser peinliche Hauch davon. Dieses Desinteresse. So als hätte er schon längst die Hoffnung in einen aufgegeben. Und das tat eben mehr weh – das wusste Herr Weber. Zumindest traute man ihm so viel Kalkül zu, wo er doch, mit seinem Wissen um die Geschichte, sehr wohl zu Kalkül fähig war, sofern es die Schüler in irgendeiner Art und Weise motivierte.
Raphael schreckte nicht auf. Er erkannte allmählich, dass er mal wieder gefragt wurde, zuckte ebenso desinteressiert mit den Schultern und ließ den Lehrer den verzweifelten Versuch abhaken. Der Erste Weltkrieg war langweilig. Wozu nochmal alles durchkauen? Ein paar Dokus, so dachte er, und man wisse das Wichtigste. Außerdem ist es eh jedem bekannt, wie er ausging. Nicht gut für Deutschland. Aber wo es Gewinner gibt, muss es eben auch Verlierer geben. Das, so dachte er abfällig, sei doch die wirkliche Grundlage der Kriegsführung.
Der Gedanke verflog mit dem Klingeln, und wich der Vorfreude auf die Pause – gefolgt von der fast genauso großen Freude auf Mathe. Er schob sich vom Stuhl, vorbei an seinen Mitschülern, die längst akzeptiert hatten, dass dieser seltsame Junge, der gut rechnen und logisch denken konnte, aber nie gern viel redete, ein Eigenbrötler war, dem man allerdings nicht zu nahe kommen sollte. Spätestens, als er für alle gut sichtbar von einem großen schwarzen SUV abgeholt wurde, und der Mann vom Beifahrersitz, ein Gorilla von einem Menschen, ihm die Türe aufhielt, wussten alle, dass der komische Junge ein absolutes No-Go für jeden Mobbingversuch war.
Die Einschüchterungsversuche der Familie waren mit der Grund, warum Raphael nie richtige Freunde hatte. Klar, man kann diejenigen als Freunde bezeichnen, denen man regelmäßig die Hausaufgaben zum Abschreiben gibt, aber dies geschah nur auf sein Gutwillen hin und hatte nichts mit freundschaftlicher Gegenseitigkeit zu tun. So konnte es niemanden verwundern, dass er lediglich mit seinen Cousins und Cousinen als Kind gespielt hatte – bis die einen oder anderen wegzogen oder unsympathisch wurden, wie es üblicherweise in der präpubertären Phase so geschieht. Nur Immanuel hatte er wirklich vermisst. Jeden Tag hatten die beiden draußen gespielt, drinnen, an der Konsole, klauten der Oma von nebenan die Gnome oder verkauften gefälschte Spielkarten zum doppelten Preis. Die beiden vertrauten sich gegenseitig blind, wenn es darum ging, ausgefuchste Ausreden für die eine oder andere zerbrochene Vase – und zwar völlig unabhängig voneinander – zu erfinden. Die Väter der beiden Jungen lobten diese Zusammenarbeit, da es den Familienzusammenhalt stärke, während ihre Mütter sie dafür verfluchten und daher der eine oder andere Hausschuh durch das Wohnzimmer flog. Letztendlich führte die Ausdünnung an zusätzlichen familieninternen Spielkameraden dazu, dass sie sich zusehends in Onkel James‘ Garten rumtrieben. Dieser kam einige Jahre vorher nach England, nachdem er diverse Geschäfte so erfolgreich abschloss, dass er mit vierzig Jahren in den Ruhestand gehen durfte. Er trieb sich, ob in Europa oder sonst wo, immer mit irgendwelchen Weibern rum, was keinen seiner Verwandten wirklich störte. Noch nicht einmal, als die beiden Buben zu ihm ungefragt ins Wohnzimmer kamen und die Unterwäsche einer gewissen Sandy, deren Namen er verdächtig laut verkündete, vorfanden. Natürlich erzählten sie es jeweils bei Tisch ihren Eltern. Die Mütter gaben ihnen jedoch lediglich einen Klaps mit dem Hinweis, sich nicht ungefragt in den Wohnzimmern anderer Leute zu schleichen und sich danach zu wundern, welch komische Sachen man vorfinde. Ihre Väter beteuerten dies. Immanuels Vater brummte sogar noch hervor, es sei ja keine Schande, solange er niemandem etwas „spritzt“ und kassierte dafür von seiner Frau eine geübt anmutende Schelle.
Wichtig für Onkel James waren tatsächlich nicht die Frauen, die er eher als Zeitvertrieb als eine Lebensfreude ansah, sondern tatsächlich, wie allen Verwandten, ob nah oder fern, die Kinder. Wohlwissend, dass er ja ohnehin keine familiären Verpflichtungen hatte und sein Eigentum daher nach seinem Tod dem einen oder anderen Verwandten zukommen würde, überließ er den beiden Buben schon früh sein Haus zur freien Verfügung, sowie den Garten, und unter strengen Auflagen sogar die Garage. Er vertraute ihnen. So sagte er einmal zu Raphaels Vater bei einem kleinen Familientreffen, bei dem gerade mal fünfhundert Leute zusammen kamen, dass die Kinder, wenn sie Mist anstellen würden, einfach von seiner Liste der möglichen Erben gestrichen werden würden. Insgeheim jedoch war er hinsichtlich der beiden Buben sentimentaler als im Berufsmilieu, und verfügte in seinem Testament, dass Raphael und Immanuel je eine Hälfte seiner Besitztümer bekamen. Dass er von so ziemlich allem zwei an der Zahl besaß – ein zweites Anwesen stand irgendwo in Mexiko, zwei Jachten teilten sich einen Hafen, und sogar zwei Rolls Roys standen in seiner Garage – erleichterte ihm die Aufteilung erheblich.
Dass das Testament früher als gedacht zutragen kam, kam nicht zuletzt durch seinen exzessiven Lebensstil und einer ungesunden Ernährung zustande. Immerhin hatte der Gute, der trotz seines Ruhestandes nach dem 11. September aus „purer Langeweile“, wie er zu seiner lapidaren Verteidigung vorgab, fünfunddreißig Millionen Dollar innerhalb einer einzigen Woche kassierte, etwas von seiner Rente genießen dürfen.
Vom Tod des lieben Onkel James erfuhr Raphael gleich nach einem Matheunterricht. Sein Vater, der den Stundenplan genauso gut wie die Portfolios jeglicher ihm unterstellten Unternehmen kannte, wusste ob Raphaels Begeisterung für das Fach und wollte ihm somit zumindest etwas Freude haben lassen, bevor dieser von der schlechten Nachricht erfuhr.
Die Trauerrede wurde standardgemäß auf vier Sprachen abgehalten, von denen Raphael drei sehr gut und eine gebrochen sprechen konnte. Das Verstehen war jedoch kein Problem, denn jeder in der Familie wuchs mit fünf Sprachen auf. Zwei Sprachen durch seine Eltern, und ab der ersten Klasse zusätzlicher Unterricht in den zwei weiteren der Familie und selbstverständlich Englisch, die offizielle Sprache für externe Geschäfte. Spanisch lag ihm nicht so gut, was er selbst ziemlich eigenartig fand, da doch Arabisch von allen, inklusive den arabischen Verwandten, als die schwierigste Sprache der Großfamilie angesehen wurde.
Der Leichenschmaus war, vermutlich entsprechend des Testaments, genauso ausgelegt wie die Onkel James‘ Ernährung: Burger ohne Ende, Unmengen an Spiegeleier, Bohnen, Würstchen, Pommes Frittes soweit das Auge reicht, und darüber hinaus so viele Spare Rips, dass man, wie Großonkel Vladislav meinte, eine ganze Panzerdivision mit Ketten aus Rippchen versorgt werden könnte. Es war wohl nicht nur sein mit Bedacht unorthodox gewählter Name, der Onkel James den Spitznamen „der Engländer“ innerhalb des Familienkreises eingebracht hatte. Doch wer den Feind besiegen will, muss ihn auch kennen – und ihn mithilfe seiner Kenntnisse zu imitieren ist eine probate Verhandlungsstrategie. Und er war nun Mal jahrelang in England tätig gewesen. So schlecht man auch über Onkel James reden mochte, sein Erfolg sprach für sich. Die Familie, obgleich er keine Nachfahren produzierte, hatte ihn daher mit einem vorzeitigen Ruhestand gewürdigt. Andernfalls wäre er, so manche Meinungen, wohl zu erfolgreich geworden und wäre auf diversen Statistiken aufgetaucht, eventuell sogar auch in den Medien. Dies war nicht auszudenken, also musste man die Gier und das Talent des exzentrischen Milliardärs zügeln. Die Al-Quaida-Affäre nutzte er trotz des Familienbeschlusses ohne Scham aus, kassierte etwas „Taschengeld“, investierte es über einige Ecken in gott-weiß-was-genau, und starb. Offiziell war es sein Herz, was für manche eine viel zu glaubwürdige Ursache gewesen war. Jedoch lohnte es sich nicht über Tote zu spekulieren, sie waren in jeglicher Hinsicht genau das was sie darstellten: Totes Kapital. Es oblag eines jeden Mitglieds der Familie, seinen Job zu erledigen – das hieß Geld zu machen, Kontrolle auszuüben, Menschen verschwinden zu lassen oder eben das langweilige autarke Tagesgeschäft aufrecht zu erhalten. Manchmal bestand der Job aber auch darin, Nachkommen zu zeugen, sofern man jemand kompatiblen gefunden hatte. Selbst diese schönste Nebensache wurde durch kalte Reglementierung entwürdigt. Die Regeln wurden jedoch so früh eingetrichtert, dass es kaum jemandem auffiel, wie restriktiv diese waren.
Die schnippischen Cousinen, insbesondere Valentina mit ihrem typischen Latina-Gehabe und Veronika, die alte Russentante, wie Immanuel sie nannte, gaben unablässig quiekende Kommentare darüber ab, dass die beiden Buben sich mit Burger vollstopften.
„Ihr vermisst wohl Onkel James, wollt ihn anscheinend bald wiedersehen“, gefolgt von dem hochnäsigen „Also so einen Typen wie euch würd ich nie heiraten.“
Immanuel, der sich bemühte, mit vollem Mund zu kontern, wurde von Raphael abgelöst:
„Valentina, du weißt ganz genau, wir beide sind fein raus was euch hässlichen Kühe angeht, und genau das feiern wir ja grade; das ist unser Bankett, ihr seid sogar herzlich eingeladen!“
Während Immanuel versuchte, vor Lachen die halb durchgekauten Pommes nicht über den Buffettisch zu verteilen, nahm Raphael seiner beleidigten Cousine ihre auf dem Tablett stehende Cola ab, schüttelte sie cool dreinblickend mit verzogenem Lächeln, stellte sie ihr zurück auf das wackelnde Tablett und schritt mit seinem Cousin davon.
Er und Valentina hatten schon immer Zoff. Schon als Kleinkinder, als sie zusammen in den Kindergarten gingen. Immer musste die Betreuerin sie auseinander halten. Doch als einmal ein Junge von der anderen Gruppe ihr das Spielzeug abnahm, kassierte dieser unverzüglich eine gehörige Tracht Prügel von ihrem Cousin. Sie musste ihn sogar, halb weinend ob des Verlustes, halb lachend ob des Sieges, von dem anderen Jungen wegzerren, da Raphael, schon als kleiner Junge äußerst bedacht, diesen hinter dem Gerüst zu Boden schlug, im toten Winkel der Betreuerinnenblicke. Ungehalten von jeglicher Obhut hätte er, so war Valentina sich schon mit vier Jahren sicher, den anderen zu Tode geschlagen.
Doch heute gab es keine äußeren Feinde. Es waren ausschließlich Familienmitglieder anwesend. Freunde hatte man hier nicht. Entweder gab es Verwandte die man mochte, oder die man nicht mochte, aber tolerierte. Wer widersprach, dem erging es… wie genau, wusste niemand. Es war wie Roulette, nur dass statt Zahlen, irgendwelche zufälligen, unfallartigen Todesursachen auf dem Rad standen, wenn man sich dem Familiencodex widersetzte. Seitdem Ur-Großvater Ignacio die Regeln ein für alle Mal festgesetzt, und danach auch rigoros durchgesetzt hatte, war jedem klar, dass die Tradition des kategorischen Zusammenhaltes mittels dieser Säuberung in die Gene eingebrannt worden war. Gene von außerhalb kamen freilich ohnehin nicht hinzu, somit war die natürliche Auslese, was Loyalität anbetrifft, abgeschlossen. Es war so selbstverständlich, dass darüber noch nicht einmal geredet, nicht gemunkelt und höchstwahrscheinlich auch nicht einmal gedacht wurde. Die Unausgesprochene Selbstverständlichkeit ist die beständigste, und von denen gab es in dieser Großfamilie einige.
Die Erinnerungen an Onkel James‘ Beerdigung schwanden mit jedem Schritt Richtung des Klassenraums, da sich Raphael so langsam mental auf den Unterricht vorbereiten musste. Heute ging es um Stochastik, und da dieses Thema gerade im Abitur eine wichtige Rolle spielen würde, wollte er, auch wenn es sich um ein für ihn leichtes Thema handelte, trotzdem nochmal alles ganz genau rekapitulieren und den Unterricht mit mehr Ernst als Freude verfolgen.
An diesem Tag sollte er erfahren, dass er neben einer beträchtlichen, das hieß neunstelligen Summe, auch das Anrecht von seinem Onkel geerbt hatte, eines Tages Mitglied des Familienrats zu werden. Wann genau, konnte jetzt noch nicht gesagt werden. Doch es war sicher. Dies war weitaus wichtiger als all das Geld. Denn mittels seines Verstandes, und das wusste Raphael bereits mit seinen achtzehn Jahren, würde er diese Summe ohnehin noch früher oder später selbst verdienen. So hatte er lediglich einige Jahre als Bonus bekommen.
Während er sich, am gleichen Abend, in den Erker des Arbeitszimmers seines Vaters lehnte und dem Notar zuhörte, was er dem jungen Mann zu sagen hatte, dachte er für einen kurzen Augenblick daran, dass er sich bloß nicht allzu sehr ins Zeug legen dürfte. Denn ob Familienratsmitglied oder nicht – wer gegen die Regeln verstieß, tat es nie wieder.
Und automatisch begann er höflich zu lächeln. Höflich, nicht dankbar. Er wusste, dass Onkel James wohl alles, was er nicht an die Familie vererben musste, zwischen ihm und Immanuel aufteilen würde. Denn die Dualität all seiner Besitztümer war definitiv nicht unbeabsichtigt von dem intriganten Finanzguru, der alles, ausgenommen seine Frauengeschichten, minuziös geplant und organisiert hatte. Doch das Anrecht auf die Mitgliedschaft im Familienrat durfte man nur einmal vererben. Dass Immanuel mit seinem Intellekt und seiner Sozialkompetenz die beste Wahl aus seinen Familienzweig war und damit mit hoher Sicherheit einen Platz am schwarzen Tisch bekam, war Raphael schon lange klar geworden. Ging man also von einer Art Symmetriebesessenheit des lieben verstorbenen Onkels aus, so war es an den Fingern abzuzählen, dass Raphael sein Anrecht auf einen Sitz per Testament bekommen musste.
„Glückwunsch mein Sohn! Das heißt wohl, dass dir einige Aufgaben bevorstehen nach deinem Abitur. Doch ich bin mir sicher, dass jemand wie du es schaffen wird, ohne auch nur einen Zweifel beim Familienrat aufkommen zu lassen. Nicht wahr, Fernando?“
Der Notar, selbstverständlich Mitglied der Familie, dessen Mutter Argentinierin und dessen Vater Russe war, war sich der Floskel bewusst, verarbeitete sie jedoch aus Gewohnheit als eine ernste Frage: „Nun, ich würde zwar nicht alles, aber doch zumindest einen großen Teil darauf verwetten.“
Er trank seinen Martini aus.
„Dein Sohn scheint ein überlegender Mensch zu sein. Wenn jemand wie er schweigt, weiß man, dass man aufpassen sollte, was man sagt. Solche Leute sind im Rat gern gesehen. Das nutzlose Geschwätz soll den Demokratien überlassen werden.“
Zur Feier des Tages rauchten sein Vater und Fernando mit Raphael noch ein, zwei Zigarren im Garten, genossen den warmen Sommerabend im Villenviertel der Stadt und sprachen über entfernte Verwandte, Geschäftsbeziehungen und die bevorstehenden Umbrüche in der Wirtschaft und wie man sie nutzen könnte. Damit versuchten die beiden, ohne viel Zeit zu verlieren, Raphael darauf vorzubereiten, was er einmal werden sollte. Dieser spielte zwar mit, jedoch nur halbherzig. Er war sich dessen schon lange bewusst, und wollte lediglich nicht unhöflich sein, indem er das Angebot einer Männerrunde zur Feier des Tages ablehnte.
So kam es, dass Raphael nach Abschluss seines Abiturs, für das er in trauriger Einsamkeit büffeln musste, da nun weder Cousinen, noch Cousins, noch irgendwelche lebensfreudigen Onkels zugänglich waren, nach Syrien umziehen musste. Was für einen Normalsterblichen ein Gap-Year oder ein sonstiges, großes Abenteuer bedeutete, war für den Vertreter der achten Generation einer einflussreichen Großfamilie wohl kaum ein nennenswerter Katzensprung – wohl eher eine weitere, selbstverständliche Zeile auf seinem als streng geheim gehandhabten, tatsächlichen Lebenslauf.
Wie es gemäß der Reinheitsweisung vorgeschrieben war, die das Ziel hatte, die Inzestrate so gering wie nur möglich zu halten, aber auch keine Fremdkörper in den riesigen Familienstammbaum zu streuen, was seit den neunzehnhundertsiebziger Jahren nun endgültig sein Ende nehmen musste, durfte er eine seiner entfernten Verwandten aus dem arabischen Familienzweig heiraten. Zumindest hatte er zwischen vierzig Cousinen die Auswahl, und musste gerade mal mit dreiundzwanzig weiteren Konkurrenten klar kommen. Wie die restlichen siebzehn Weiber klarkommen würden, dachte er sich, war ihm egal. Familie ist wichtig, doch wichtige Sachen klärte der Familienrat. Es ergab für ihn keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen, da seine Meinung ohnehin kein Gewicht hatte gegenüber den wirklichen Entscheidungsträgern, solange er nicht zu ihnen gehörte. Wozu sich den Kopf zerbrechen? Die schwierigen Aufgaben würden noch früh genug an ihn vergeben werden.
Genauso wie sein Vater sollte er, wie auch vom familieninternen Kinderpsychologen, dem guten alten Onkel Said bestätigt, die Kunst der Finanzpsychologie erlernen. Mathematik lag ihm, vor allem Statistik, und obschon seiner fehlenden Sozialkompetenzen war er durchaus in der Lage, analytisch in die Köpfe anderer Leute zu schauen. Vor allem also, wenn die psychologische Komponente im Bezug auf Zahlen – das hieß Geld – wichtig war, eignete sich Raphael vorzüglich für diese Aufgabe.
Es war also keine Überraschung, dass sein Vater ob dieses Entscheides überglücklich war. Immanuels Vater freilich, ein exzellenter Scharfschütze, war zunächst sehr bestürzt über die Verkündung, sein Sohn möge Politologe werden. Politologe! Ein ehrwürdiger Sesselfurzer sollte sein Sohn werden, der doch so stramm und militärisch erzogen wurde, dass er es keine halbe Stunde in so einem einsackenden Sessel aushalten könnte. Es tröstete dessen Vater jedoch prompt, dass, wie von Immanuel und Raphael erwartet, die Aussicht bestand, der sympathische und selbstdisziplinierte Immanuel könnte einen Posten im Familienrat besetzen. Wenn also Sesselfurzer, dann mit Macht. Das war immerhin ein adäquater Trost.
„Hey, ich bin Jasmin. Arabischer Zweig, meine Mutter ist Argentinierin. Wir hatten uns mal in Helsinki getroffen. Du bist doch Raphael, oder?“, die Stimme klang so rein, so schön wie Musik. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis er dazu kam, eine Antwort von sich zu geben:
„Ähm, ja… genau, Jasmin. Hab dich aber, glaub ich, nur sporadisch gesehen. Du warst da mit den Cousins aus deinem Zweig, auf der anderen Seite der Halle.“
Er räusperte sich und es fiel ihm auf, dass er etwas vergessen hatte:
„Äh ich bin Raphael, Europäischer Zweig, Mutter ist Russin. Deshalb verzeih mir bitte meinen Akzent“, versuchte er sich durch Ablenkung zu retten.
„Ah schon gut, ich spreche alle Sprachen ohne Probleme. Sag mir, welche dir am besten liegt.“
Er hatte es kaum bemerkt, dass er arabisch sprach. Nach nur ein paar Monaten war ihm diese Sprache vertraut gewesen. Er lernte wohl doch schneller als er dachte. Trotzdem einigten sie sich auf Deutsch.
Wenn sie so eine schöne Stimme hat, so ein schönes Lächeln und so eine gute Figur, dann werden wohl andere ein Auge auf sie geworfen haben, dachte er sich. Also, lautete für ihn die Schlussfolgerung, hör auf zu winseln und geh zum Angriff über! Willst ja nicht eine der Dicken abbekommen.
Obgleich er von ihren sanften Gesichtszügen, ihrem gewellten, schwarzen Haar und den dunklen, doch warmen Augen völlig übermannt wurde, zwang er sich Selbstdisziplin auf und forcierte sich zu einer adäquaten Konversation.
Nachdem sie beide zusammen bereits die langweiligen Details ihres Studiengangs besprochen hatten, gab er sich den letzten Ruck. Sie hat ja auch noch Grips in der Birne! Bevor es die anderen bemerken, muss ich sie mir sichern. Hör. Auf. Zu. Winseln. Er atmete tief durch und fragte sie, was sie nach der Vorlesung machen würde.
„Ach, ich bin wohl nicht die einzige die so direkt ist“, war zu seinem Erstaunen die Antwort.
„Wie – wie meinst du?“
„Nun, ich dachte, ich geh mit dir aus. Du gibst aus. Macht dir ja nichts aus, oder? Bist ja einer der Ziehsöhne von Onkel James“, sie beendete den Satz mit einem breiten Grinsen.
„Ach, du kanntest ihn?“, kam aus Reflex heraus. Dann, nach kurzem Nachdenken:
„Warte. Woher weißt du von Immanuel und mir?“
Sie lächelte ihn mit ihren großen, braunen Augen an:
„Jeder Trottel kennt Onkel James. Der Typ hat wahrscheinlich jedes einzelne Familienmitglied schon mal getroffen. Zwei mal. Und dass er dich und Immanuel als seine beiden Jungs sah, warum auch immer, naja…“, sie war sich wohl zunächst nicht sicher, aber dann entschied sie sich doch, es Raphael zu sagen,
„Er hat oft davon geredet, wie gut ihr beide euch am schwarzen Tisch machen würdet.“
Moment, dachte er, will sie etwa nur deshalb was von mir, weil sie weiß, dass ich zum Rat gehören werde? Ist es das wert? Andererseits, kam ihm prompt der Gedanke, ist es ziemlich sicher, dass er an den schwarzen Tisch käme. Damit wäre es auch sicher, dass sie bei ihm bleiben würde. Wer einmal im Rat ist, tritt erst mit seinem Tod aus.
„Und du hast dir ausgerechnet mich ausgesucht statt Immanuel? Magst du Cambridge nicht so sehr?“
„Das Wetter ist beschissen“, sie sprach das ,s‘ ungewohnt betont aus, „Und Immanuel ist hochnäsig. Hübsch, aber hochnäsig.“
Sie schaute ihn an und bemerkte, wie er die Stirn runzelte, was sie zum Lachen brachte.
„Du bist auch hübsch, du Trottel. Nur nicht Hochnäsig. Du scheinst, ähm, bo-den-, ok, ich habe dieses eine Wort vergessen, du weißt schon…“
Es war ihr sichtlich peinlich, etwas nicht zu wissen.
„Du meinst bodenständig?“, fragte er, um ihr auszuhelfen.
„Ja genau. Siehst du? Du fragst. Immanuel hätte es gesagt – und mir unter die Nase gerieben, dass er es auch auf Arabisch wüsste.“
Er musste jetzt auch lachen, und hielt ihr die Tür zum Vorlesungssaal auf.
„Ich bin dann mal bodenständig und überlasse dir den Vortritt, Jasmin.“
Sie grinste wieder über beide Ohren, schritt voran und suchte für sie die hintersten Plätze aus.
Während des zweiten Semesters verbrachten die beiden viel Zeit miteinander und beschlossen, ganz in der Manier ihrer Erziehung, ihre Beziehung zur Produktivitätssteigerung zu nutzen. Zunächst lernten sie beide zusammen für die Prüfungen, wie man es von einem gut funktionierenden Paar erwarten würde, doch dann entschlossen sie sich, dass die Regelstudienzeit wohl zu lange andauern würde und organisierten sich: Während Jasmin die Vorlesungen des dritten Semesters besuchen sollte, übernahm Raphael die des vierten Semesters, sofern diese ganzjährig angeboten wurden. Da es nicht viele waren, nahm er noch einige aus dem sechsten Semester mit. Insgesamt hatte das Paar damit die Notizen von einem ganzen Jahr an dicht gepackter Semester innerhalb der Hälfte der Zeit angehäuft, und mithilfe eines ausgeklügelten Austausch-Systems brachten es beide tatsächlich fertig, alle Klausuren, sofern diese nicht miteinander kollidierten, zu bestehen.
Raphael war sich sicher, dass es mit einer, die weniger Grips als Jasmin hatte, nie im Leben funktioniert hätte. Jedoch hatte dies einen hohen Preis: Während die anderen Familienmitglieder zwar auch nur sporadisch mit anderen Kommilitonen zu tun hatten, aber zumindest noch miteinander Zeit verbrachten, kapselten sich die beiden „Turteltauben“, wie sie schon bald von ihren Cousins und Cousinen genannt wurden, auch von ihren Verwandten ab. Dies führte neben einer sehr einseitigen Ernährung und einem unaufgeräumten Wohnung unter anderem auch dazu, dass die Eltern der beiden sie regelmäßig dazu zwingen mussten, mit ihren verwandten Kommilitonen Zeit zu verbringen, und sei es auch nur zum Austausch von Vorlesungsmitschriften.
Beide bestanden die Prüfungen mit Bravur, und wurden ausgiebig von Professoren, Eltern, und sogar von Großonkel Adalbert persönlich gelobt. Dieser lud die beiden sogar nach Nizza ein, um der jährlichen Hauptsitzung des Schwarzen Tisches beizuwohnen:
„Mir scheint, es obliegt mir die Ehre, Sie beiden“, und er machte eine müde, unkoordinierte Bewegung mit seinem knolligen Zeigefinger,
„Sie beiden vielversprechenden Sprösslinge unseres Blutes zur nächsten Sitzung des Schwarzen Tisches einzuladen. Man wird euch jedwede nötige Information zukommen lassen. Und ziehen Sie sich was Adäquates an; unsereins scheint bisweilen doch sehr aufs Äußere zu achten, solange noch kein Mitspracherecht besteht. Wir wollen doch nicht, dass sich jemand seine Zeit mit dem Echauffieren verschwendet, der doch weitaus Wichtigeres zu tun hat. Nicht wahr, meine Lieben?“
Ob nun der Alte immer so sprach oder sich nur in seiner gewohnt undurchdringlichen Weise über die elitäre Sprache lustig machte, war Raphael nicht ganz klar. Die beiden jungen Absolventen spürten den eindringlichen Blick eines alten Mannes, der nie sprach, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Eines Mannes mit Übergewicht, Arthrose, faltiger Haut, und einem unscheinbar wirkenden, aschgrauen Anzug. Macht muss nicht ausgestrahlt werden, das war die Divise, denn dann würde man leichter entdeckt und bekam neue Feinde am laufenden Band. Obschon die Augen des Alten müde des Lebens zu sein schienen, schauten sie mit schmerzender Eindringlichkeit in die der beiden jungen Hochbegabten. Wenn man von ihm so angeschaut wird, so dachte Raphael, dann wird man entweder bald von niemandem mehr gesehen oder hat eine derart bedeutsame Aufgabe vor sich, dass es ratsam wäre, das Anliegen nie auszusprechen. In diesem Falle, da der Alte persönlich erschien und niemanden vorschickte, schien ein unglaublich gewichtiges Vertrauen auf ihnen zu ruhen, was bedeutete, dass diese Einladung keineswegs eine Einladung war. Es war ein Befehl zum Antritt. Was genau ihnen beiden bevorstand, wussten weder sie, noch ihre Eltern, noch der Rat. Der Familienoberhaupt war ein weiser, kalter, und trotz seines aristokratisch anmutenden Gemüts ein erstaunlich bodenständiger Mann mit einem unerschöpflichen Fundus an Erfahrungen. Dass er bald sterben würde, war jedem klar. Doch was er für die Zeit nach seinem Dahinscheiden für die Familie geplant hatte, wussten nur Gott und dieser mächtige, alte Knacker selbst.
Die Ehre, einer Ratssitzung beizuwohnen, war zwar jedem zuteil gewesen, der sich als ein nützliches Familienmitglied bewies, jedoch nur selten schon nach dem Universitätsabschluss. Raphaels Vater tobte vor Glück, da er selbst erst nach seinen ersten zehn Millionen an der Börse zu einer Ratssitzung eingeladen wurde. Ahmed, Jasmins Vater, ein eklatant erfolgreicher Bauunternehmer, schaffte es schon knapp zwei Jahre nach der Beendigung seines Studiums. Daher teilten beide die große Freude, gingen einen saufen und verschwanden irgendwann von der Absolventenfeier, während ihre Mütter sich stundenlang über die Modegepflogenheiten ihrer Heimatländer unterhielten und dabei abfällige Bemerkungen über den Plebs machten, der es sich nicht leisten konnte, den Kleidungsstil mit etwas Gold oder Diamanten aufzupeppen. Großonkel Adalbert verschwand von der Feier so plötzlich wie er kam, wahrscheinlich, als der Universitätspräsident einigen Politikern zum wiederholten Male den obligatorischen Dank aussprach. Während alle anderen Absolventen die Feier gemütlich ausklingen ließen, so auch die Familienmitglieder, vergnügten Raphael und Jasmin sich in einem Vorlesungssaal. Ihre Mütter ließen sich nichts anmerken, als die beiden mit leicht zerzausten Haaren wiederkamen. Sie erinnerten sich beide noch gut an die Situation, in der man nach jahrelangem Büffeln endlich den Erfolg vor sich sieht und dafür auch noch ausgiebig belohnt wird. Kaum vorzustellen, welche Spannungen herrschen müssten, wenn man gemeinsam als frisches Paar die Selbstdisziplin aufbringen muss, nicht ständig übereinander her zu fallen, sondern konsequent und konzentriert an einem Ziel zu arbeiten, das Jahre entfernt liegt. Die in ihre Jahre gekommenen alten Damen nickten daher teils anerkennend, teils zustimmend ihren Kindern zu, die sich mit verstohlenen, aber glücklichen Blicken wieder an den Tisch setzten, um ihr Baklava zu Ende zu essen.
Die aschblonden Strähnen hingen Raphael leicht verschwitzt die Schläfen runter, während sein typisch stark ausgeprägter Kiefer hastig das Essen zerkaute. Das Hemd, nur noch locker auf dem Körper klebend, fing den einen oder anderen Krümel auf, da er sich ob der Erleichterung und gleichzeitiger Anerkennung nicht mehr um sein Äußeres kümmern wollte. Beschämt ging er jedoch den Blicken seiner Mutter und deren Tratschpartnerin aus dem Weg, kreuzte aber auch immer wieder unwillkürlich grinsend den Blick seiner Angebeteten.
„Hab ich was im Gesicht?“, fragte sie und merkte zu spät, dass er die Frage ernst meinte und sie deshalb musterte.
„Das war ein Witz! Ich hab‘ doch einen Spiegel dabei.“
„Darf ich dich nicht anschauen?“, fragte er und nahm einen Schluck Rosé.
„Satt wirst du wohl nie“, sagte sie nuschelnd, wohl darauf bedacht, dass ihre Mütter nichts mitbekommen durften.
„Hm nein“, sagte er, immer noch außer Atem, „Deshalb denke ich, dass wir mal heiraten sollten.“
Bevor sie den offensichtlichen Kommentar ausbringen konnte, korrigierte er seine Aussage:
„Dass wir etwas schneller heiraten sollten. Dank Onkel James wird das wohl kein Problem für uns sein, das Ganze noch vor dem Beginn unser eigentlichen Arbeit zu organisieren.“
Das leuchtete ihr ein. Dann wären die ganzen anstrengenden Gespräche, die unzähligen Salven des fingierten Lächelns auf der Hochzeitsfeier und nicht zuletzt die rein organisatorische Bürde einer Hochzeit passé, sobald sie sich beide der Arbeit zuwandten.
„Okay“, sagte sie nachdenkend, und fragte mit erstaunlicher Gelassenheit, wo denn die Hochzeit stattfinden solle, denn ihr persönlich wäre es egal.
Das mochte Raphael an ihr. Sie war pragmatisch. Kein „Schicki-Micki“, wie Onkel James zu sagen pflegte, auch wenn ein Mann mit seinem Frauengeschmack doch lieber keine Ratschläge zu diesem Thema hätte geben sollen. Jasmin war zur Hochleistung erzogen worden, war es gewohnt, Sachen nüchtern und objektiv zu betrachten. Dabei verlor sie allerdings nie ihre Menschlichkeit, sondern wusste, wann sie gut daran tat, Emotionen zu zeigen und sich vom Instinkt der menschlichen Einfühlsamkeit leiten zu lassen. So zum Beispiel bei ihrem zukünftigen Ehemann. Dadurch, dass sich die beiden jahrelang bereits gemeinsam gut koordiniert durch das Studium geschwungen haben, waren sie ein eingespieltes Team, und kannten die Stärken und Schwächen des anderen. Dass sie nicht zuletzt aus rein praktischen Gründen schon zum dritten Semester zusammengezogen waren, war dabei tatsächlich nur ein Nebeneffekt ihrer Zielstrebigkeit. Beide wussten, dass sie nur gemeinsam den Erfolg haben könnten, der ihrer Intelligenz gerecht wurde. Somit gestatteten sie ihrer Libido, wenn auch portioniert, vor allem in den Klausurphasen, ihre Spielchen zu treiben. Andernfalls hätte ihre von Kindheit an eingeprügelte Selbstdisziplin sie dazu veranlasst, sich höchstens als zeitweilige Sexpartner zu sehen. Doch so passte es ihnen beiden in die Planschublade, dass sie ein Paar wurden. Ein nicht nur nach außen hin eingespieltes, passendes, zeitweilig auch romantisches und gewitztes Paar.
Er strich ihr durch ihre gewellten Locken, legte die Hand um ihre linke Hüfte, beugte sich vor und wisperte: „Ich würde vorschlagen, Schatz, irgendwo, wo es warm ist. Du weißt warum.“
Und blinzelte ihr zu, als er wieder in seinen Stuhl zurück sank.
„Ah stimmt, weil die Gäste dann weniger Gepäck mitnehmen müssen. Weniger Kleider und so“, erwiderte sie mit einem antwortenden Blinzeln. Jasmins Mutter kam nicht umher, leicht zu grinsen, da sie das Gespräch heimlich belauscht hatte und tat so, als hätte sie es wegen eines vorbeilaufenden Normalsterblichen gemacht, der sich keinen maßgeschneiderten Anzug leisten konnte.
„Marina“, sagte sie, um vom Thema endgültig abzulenken, „Ich glaube es wäre an der Zeit, dass wir zwei alte Damen uns mal Richtung Hotel verziehen. Ich habe gehört, sie haben dort einen vorzüglichen Chardonnay.“
Raphaels Mutter willigte ein und schien sich sichtlich angestrengt davon abzuhalten, auf die beiden Turteltauben zu schauen. Mehr als nötig sollte man seine gelungene Arbeit nicht begutachten, und außerdem hatte Lucrezia Recht. Dafür, dass sie in einem muslimischen Land waren, gab es, wenn auch erst auf Geheiß des Familienrates, erstaunlich guten Alkohol im Hotel.
„So, doswidanya Schatz, Lucrezia und ich gehen ins Hotel. Hier ist es uns inzwischen doch zu bunt. Und laut. Wir werden wohl alt.“
„Ok Mama, kommt gut heim und stolpere nicht über Papa, wenn du ins Zimmer gehst“, antwortete Raphael bewusst laut, in der Hoffnung, dieser peinliche Kommentar würde seine Mutter noch mehr dazu drängen, zu gehen.
Nachdem sich beide Mütter verabschiedet hatten, verbrachten Raphael und Jasmin noch einige Stunden damit, ihre anstehende Hochzeit zunächst sehr allgemein, dann jedoch immer genauer zu planen. Zeitgleich stießen die beiden Mütter darauf an, dass ihr Plan in Erfüllung ging. Tatsächlich hatten sich ihre Kinder nicht nur gut verstanden, sondern wurden zu einem Vorbildpärchen, welche den beiden Familienzweigen viel Geld, Einfluss und Macht einbringen würden. Nicht jeder konnte es, wie die Eltern von Onkel James zu ihrer Zeit, verkraften, dass ihre Nachkommenschaft aussterben würde. Die beiden weinsüchtigen alten Damen jedenfalls nicht. Somit war ihre erste Pflicht getan, und sie konnten sich entspannt dem Lebensabend zuwenden und zusehen, wie ihre Kinder wiederum ihre Pflicht erfüllten, und den Wohlstand der Familie entscheidend mehrten.
3
Der dunkelgrüne Einband war schon an manchen Stellen völlig zerrieben, und es schien sich nicht mehr zu lohnen, mit dem Buch behutsam um zugehen. Jedoch hielt er die Seiten weitestgehend angewinkelt in den Händen, und bemühte sich damit, abgeschrägt die alte und schon stellenweise viel zu blasse Schrift zu lesen. Dieses Exemplar war auf Russisch, und damit kein Problem für ihn. Hin und wieder kratzte er sich an seinem Hinterkopf, der, an den Seiten kahl rasiert, einen „Jarhead“ vermuten ließ, was durch die ausgebildeten Schultern und die durchtrainierte Brust bestärkt wurde. Selbst der maßgeschneiderte Smoking schien an einigen Stellen zu platzen, doch das mochte Immanuel so. Er wusste, dass er nicht nur vor den Frauen stark wirken musste. Es war eine Zeit, in der es von größter Wichtigkeit war, Stärke zu zeigen. Seit dem Großonkel Adalbert verstorben war, ging es drunter und drüber und niemand wusste genau, was zu tun war. So war es nun mal, wenn eine Organisation, ein Land, eine Kultur auf einige wenige wichtige Personen angewiesen war. Schieden sie dahin, auf natürliche oder sonstige Art und Weise, so blieb mit viel zu großer Schnelligkeit ein viel zu großes Vakuum übrig, das sich entweder kaum oder aber schnell wieder füllte. In jedem Fall kam nichts Gutes dabei heraus. Füllte sich das Machtvakuum langsam, las Immanuel in seinem alten Buch, so führte dies zu einer Ohnmacht, welche in Zeiten des Umbruchs letale Züge annehmen konnte. Füllte sich das Vakuum jedoch mit allzu hoher Schnelligkeit, so schuf dies erneutes Chaos, wie bei den Römischen Cäsaren. Die restliche Passage kannte er bereits halb auswendig und blätterte daher weiter. Die Grundlagen hatte er als Schüler, später als Student und auch als Doktorand so oft durchgekaut, dass es unwahrscheinlich war, noch etwas Neues, Verwertbares zu finden. Eventuell, so dachte er, wäre ein erneuter Blick in die Historie wirksam. Zumindest für einige Argumente seiner Rede.
Der Warteraum vor dem Großen Saal des Schwarzen Tisches glich dem Flur eines königlichen Palastes. Obschon das Gebäude äußerlich so schlicht und unscheinbar wie nur möglich gehalten wurde – graue Fassaden, welche sich scheinbar beschämt unter riesigen Tannen versteckten –, wurden im Inneren, hinter mehreren Sicherheitsposten, keine Kosten für eine ehrwürdig anmutende Ausstattung gescheut. Dunkelrote Wände, verziert mit golden schimmernden Stuckaturen, künstlerisch verzierten Lampenhaltern und Gemälden, von denen jedes einzelne wohl ungefähr so viele Dollar kostete wie drei Villen in diesem Viertel, Marmorböden mit eingelassenem Obsidian, edlem Granit, sowie die zwar düsteren, aber dennoch Wohlstand ausstrahlenden Regale, gefüllt mit allerhand Bücher, jedes einzelne entweder aufwendig verziert oder mit Bedacht in nüchternen Farben gebunden. All das war Immanuel so vertraut wie die Tatsache, dass jeder der Soldaten, die alle zehn Meter Wache standen, jedes Mal mit verinnerlichten Bewegungen stramm stehend salutierten, wenn er an ihnen vorbei stampfte. Es gab nun wichtigere Dinge zu beachten. Wie zum Beispiel die Vorbildhaftigkeit der deutschen Urfamilie, einem entfernten Nebenzweig der Fuggers, welche vor einigen Jahrhunderten nach Russland auswanderte und sich dort mit einem russischen Aristokratenstammbaum zusammenschloss, insgeheim natürlich, um sich gegenseitig im Rohstoffund Immobilienhandel auszuhelfen. Es war der erste Spross eines Deutschen und einer Russin, das Familienoberhaupt Alexander, der es wagte, die zaristische Ordnung dafür auszunutzen, Großgrundbesitzer mehr oder weniger legal zu erpressen und mittels nicht unbedingt moralisch vertretbarer Mittel zu mehr Land zu kommen, welches dann gerodet, mittels der Gewinne aus dem Holzverkauf bebaut und schließlich verpachtet wurde.
Diese expansive, jedoch schleichende Taktik hielt unvermindert an, bis ihnen der Kommunismus einen Strich durch die Rechnung machte. Um nun weiterhin Geld fließen zu lassen, wurden die Familienmitglieder zu Denunzianten ausgebildet, kamen in höhere Armeeposten und konnten dadurch zumindest teilweise die Kontrolle über die Ländereien behalten. Letztendlich war es jedoch Oberhaupt Gregor, der die richtige Lösung fand. Nachdem das Osmanische Reich zerfallen und sich Chaos breit zu machen wagte, nutzte er die Situation aus und schloss mit dem Nachfahren einer arabischen Großfamilie einen Pakt. Dieser Pakt half nicht nur der Sowjetunion im zweiten Weltkrieg, eine neutrale Zone im Süden aufrecht zu erhalten, sondern auch die Rohstoffe an sich, welche im Nahen Osten schlummerten, zumindest in dieser Zeit für die Familie zu sichern. Letztendlich vermengten sich die Blutlinien auch hier, und da war erst einmal Schluss mit zusätzlichen Aufnahmen in den Kreis des schwarzen Tisches.
Der Schwarze Tisch, nachdem der Zusammenschluss aus Rat und Oberhaupt benannt wurde, bestand aus einer riesigen, aus Obsidian bestehenden Platte, welche man auf der Suche nach neuen Ländereien im fernen Osten auf der russischen Vulkaninsel Kamtschatka gefunden hatte und seitdem stets mit größter Vorsicht immer dorthin gebracht werden musste, wo die aktuell geringste Gefahr schwebte. Den Rest der Passage kannte Immanuel und blätterte daher um.
Der teuer erkaufte Weltfrieden, wie er im Buch aufmerksam weiter las, wurde von einer aufgehenden schwarzen Sonne bedroht. Diese Formulierung war eher als Witz gedacht, denn natürlich spekulierte man darauf, dass die deutsche Expansion unter Hitler eine Menge Land entvölkern würde, was natürlich eine recht vorteilhafte Entwicklung für die Preise der Ländereien versprach. Auch wenn dieser Schwachkopf von österreichischem Inzestprodukt, so dachte Immanuel, den Preis mangels notwendiger Finanzierungsfähigkeiten anheben musste. Aber die Pille schluckte man, angesichts des eigentlichen Plans, der beinhaltete, dass die deutsche Expansion ein jähes Ende nehmen sollte.
Denn die wirtschaftlich-militärische Unterstützung der Amerikaner verhalf den Sowjets, die Wende an der Ostfront herbei zu führen und ein gewisser Marshall sollte mit seinem militärischen Sturkopf-Gehabe eine entscheidende Rolle im weiteren Verlauf spielen, während die anderen Alliierten vom Westen her vorstießen und dem Reich den Garaus machten. Jedenfalls tat man gut daran, die sowjetischen Generäle gut zu behandeln, denn diese ermöglichten den Erhalt der Besitzurkunden, sogar unter der Fuchtel des Kommunismus, dem man im Austausch dafür mittels Informationsbeschaffung über einen Herrn Fuchs die Baupläne der Atombombe zukommen ließ.
Damit eröffnete sich nun die eigentliche, moderne Familientradition: Informationshandel. Dieser half dann auch, die familieneigenen Postenbesetzer innerhalb der NSDAP sicher nach Argentinien zu verschiffen, welche mittels traditionsprobater Verhandlungstechnik die Gunst eines ansässigen Großgrundbesitzers erkauften. Die Drogenbarone Kolumbiens, und später die mexikanischen Kartelle freilich, stellten neben dem reinen informativen Kapital, welches gerade für die Amerikaner einige gute Summen wert war, auch einen lukrativen, doppelspielerisch finanziellen Reiz dar. Die geographisch latente Nähe Argentiniens zu den tropischen Gebieten, in denen sowohl die Kokapflanze als auch Marihuana prächtig gedeihen, gab Anlass zur letzten „genetischen Expansion“ der Großfamilie. Danach wurde jedoch festgelegt, dass keine weiteren äußeren Elemente in die Familie aufgenommen werden durften, da man sonst eine Dissoziation ähnlich des Schicksals des Römischen Reiches befürchtete, und das mit Recht. Es war ein fast schon instabiler Kern, und es wurde daher notwendig, die Reihen zu schließen, bevor es zur Fission kam, da diese sicherlich zu einer Katastrophe geführt hätte. Deshalb schien es für Ignacio gerade recht, dass es einige unlautere Subjekte gab, die die Loyalität gegenüber der Familie eher als eine Richtlinie als ein Gesetz sahen. Durch die von ihm durchgeführten Säuberungen verringerte sich die Anzahl der Familienmitglieder, was eine stabile Lage schuf und eine gute Basis für zukünftige Geschäfte bildete. Eines dieser Geschäfte war das Ende der Sowjetunion, welche…
Die stetig lauter werdenden Schritte hörten abrupt auf. Immanuel erschrak nicht, sondern schaute einfach nur entnervt nach oben, da er unnötige Unterbrechungen nicht ausstehen konnte.
„Grüß dich, Immanuel. Oder soll ich dich ‚ehrwürdiges Familienoberhaupt Immanuel – ‘ “





























