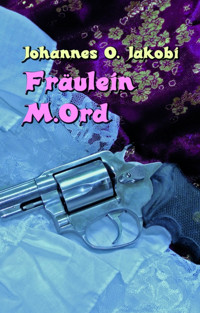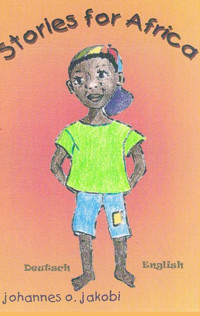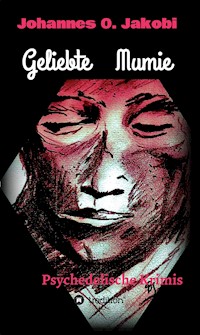4,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Until the lion learns to write, every story will always glorify the hunter." African Proverb Die Geschichten dieses Lesebuchs sind keine Ablichtung der Big Five oder der Machtkämpfe zwischen Jägern und Gejagten, sondern eine Reise in das Innere der Menschen verschiedenster Ethnien. Die Erzählungen geben dieser Seite eine Stimme. Immer steht im Mittelpunkt das Einzelschicksal mit seiner persönlichen Dynamik und seinen positiven wie auch negativen Wechselbeziehungen zur sozialen Umwelt. Im Kern sind alle Geschichten auf wahre Begebenheiten bezogen, werden dann jedoch in eine Symbolik eingebunden und so gestaltet, dass sowohl das sehr Spezifische eines einzelnen Ereignisses wie auch das Allgemeine, bestimmt durch Tradition, Kultur, Geschichte und Gegenwart, ineinander verwoben werden. Es ist keine fröhliche, geschönte Postkartenidylle, eher ein Reiseführer in die Labyrinthe der afrikanischen Seele. Gespeist werden deren Verzerrungen und Zerrissenheit aus den Erfahrungen einer Vergangenheit, die einst glaubte, niemals mehr eine Zukunft haben zu können. Ob es tatsächlich für Afrika eine Zukunft geben wird, bleibt ungewiss. Zumindest aber hat man inzwischen so etwas wie eine Gegenwart. Aus dieser Gegenwart möchte der Autor berichten, möglichst objektiv und korrekt, wertneutral. Persönliche Teilhabe indes bedeutet keineswegs eine Parteinahme, denn das würde gleichzeitig eine Ausgrenzung der vielen anderen Gruppen und Gruppierungen beinhalten. Der Verfasser ist zufällig mit heller Haut geboren, gehört nicht zu den deutschen, englischen oder afrikaansen Namibiern, auch nicht zu den Zulu, Xhosa, Ovambo, Herero, Damara, Nama, Baster, San und ihren vielfältigen Unterstämmen. Sein vorrangiges Ziel war es, möglichst alle zu verstehen. Aber immer handelt es sich einzig um Annäherungswerte, niemals um vollständige Bilder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Brigitte, durch die ich in die Lage versetzt wurde, als „begleitender Ehemann“, vier Jahre lang Gesellschaftliches, Politisches und Mystisches in Afrika zu beobachten und zu analysieren.
Mein Dank gilt auch den beiden kongenialen Übersetzerinnen, Frau Dr. Monika Franz für die englischen Versionen und Frau Guddy Marais für die Übersetzung ins Afrikaans.
© 2021 Johannes O. Jakobi
Umschlag, Illustration: Brigitte K. Jakobi
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-37318-1
Hardcover:
978-3-347-37319-8
e-Book:
978-3-347-37320-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
HOMAGE TO AFRICA
WENN DER FAHLE MOND STEIGT
WHEN THE PALE MOON RISES
KLEPTOMANIA
STAHLSCHIENE
BLAU BLUEHTEE DER DACARANDA
DER GESANG DER WILDEN WELLENSITTICHE
SONG OF THE ROBINS
MARIA - MAGDALENA
DUMPIES
DUMPIES
NUR EIN PAAR GOLDENE SCHUHE
IM ZEICHEN DES TOKOLOSHE
THE SIGN OF THE TOKOLOSHE
REGENDIAMANTEN
Afrikaans: Reëndiamante
GRETE
GRIET
EIN HUND NAMENS HITLER
DREI KUESSE FUER NAMIBIA
THREE KISSES FOR NAMIBIA
WARM GEHT DER WIND IM SEPTEMBERFRUEHLING
DER LANGE TOD DER HIBISKUSBLUETE
THE LONG DEATH OF THE HIBISCUS BLOOM
Afrikaans: DIE LANG DOOD VAN DIE HIBISKUSBLOM
ABSCHIED VON PAPA
SEINE GELIEBTE AUS LEHM
DIE ENDLOSE HOCHZEIT DER ISANGOMA
IM HAUS DER NACHTKATZE
V.S.D.B. VERY SPECIAL DEEP BLACK
NACHTSONNE
Afrikaans: NAGSON
GLOSSAR
ZUM BESSEREN VERSTAENDNIS
„Until the lion learns to write, every story will always glorify the hunter.“ African Proverb
„Bis der Löwe (endlich) gelernt hat zu schreiben,wird jede Geschichte den Jäger bejubeln.“ Afrikanisches Sprichwort
Die Geschichten dieses Lesebuchs sind keine Ablichtung der Big Five oder der Machtkämpfe zwischen Jägern und Gejagten, sondern eine Reise in das Innere der Menschen verschiedenster Ethnien. Die Erzählungen geben dieser Seite eine Stimme.
Dabei soll ohne Wertung und auch ohne Interpretation es dem Leser überlassen sein, sich sein eigenes Urteil zu bilden.
Das von mir beschriebene Afrika besitzt nicht nur zwei, sondern viele Gesichter: lachende und ernste, liebevolle und brutale, komische und tragische, geradlinige und verwirrende. Dabei spielt das Phänomen Zeit eine besondere Rolle; sie ist in jedem Fall anders als alles, an was die westliche Welt gewöhnt ist. Vielleicht vergleichbar mit der Traumzeit der australischen Aborigines. Ebenso steht es mit dem Tod; er ist und bleibt allgemein gegenwärtig. Man mag sich darüber ängstigen oder gar entsetzen, doch für die betroffenen Menschen bedeutet er nicht das Ende des Lebens, sondern nur ein Ereignis, dem sich jeder zu stellen hat.
Vieles läuft hier parallel zueinander: wie beispielsweise christliche Religion und gleichzeitig traditioneller Ahnenkult. Afrika ist nicht etwa ein Melting Pot, sondern, wie es der schwarze Philosoph Ndasuunye Shikongeni ausdrückt, eine Society Pan, bei der alles Gesellschaftliche säuberlich getrennt bleibt. Dafür steht Kalunga ka Nangombe, der Gott der Rinder, der Cattle God.
HOMAGE TO AFRICA
Africa,
you have a different sun
- glistening, scorching remorselessly;
you have so different waters
- floating smoothly, Streaming wildly;
you have a different wind
- drying, swirling dreadfully;
you have so different spaces
- opening widely, extending endlessly;
you have a different day
- enduring, waiting timelessly;
you have such different colours
- shining brightly, blackening eternally;
Proud Africa of awe and mystery
Yours should be rainbow harmony.
Johannes O. Jakobi
(1st published in: Meanderina Paths. An Anthology Of African Verse. Poetry Institute of Africa. Scottburgh KwaZulu-Natal, Republic of South Africa 2001)
WENN DER FAHLE MOND STEIGT
Heute war bereits der zweite Tag, an dem es in Strömen regnete. Die langen Monate der Trockenheit und Dürre schienen wie weggewischt. Oktoberregen in dieser Menge war so selten wie eine kostbare Frucht, und genau so wurde er dankbar und mit großer Freude empfangen.
Auch das Leben auf der Farm hatte sich verändert, neu ergrünt und frisch gewaschen. So sehnsüchtig der Regen jedoch erwartet worden war, so viel gab es jetzt zusätzlich zu tun. Schnell musste gehandelt werden, denn mit dem Regen kam auch sofort ein scharfer Kälteeinbruch. Wer da nicht rechtzeitig das empfindliche Vieh, und besonders die Jungtiere, in die wärmende Sicherheit des Stalles brachte, dem drohte ernsthafter Schaden durch erfrierende Tiere. Zudem musste darauf geachtet werden, dass Beester nicht ertranken, denn die Wassermassen wälzten sich in großer Geschwindigkeit durch die trockenen Riviere, dabei alles weg- und mitreißend, was nicht genügend gesichert war.
Schwerstarbeit hatte der Farmer verrichten müssen, sich keine Pause gönnen dürfen, war selbst mitunter in Gefahr, weggeschwemmt zu werden, wenn er versucht hatte, die Rinder vom reißenden Fluss wegzuhalten und in sicher gelegene Abzäunungen zu treiben. Zwar witterte das Vieh sehr wohl die Gefahr, aber der Geruch des frischen, fallenden Wassers war zu verlockend.
Lange schon war die Dunkelheit hereingebrochen, und die Nacht war rabenschwarz mit Strömen von Regen im wolkenverhangenen Himmel. Aber nun hatte er endlich alles geschafft, und so müde er auch war, so glücklich fühlte er sich. Drinnen im Haus hatte der Farmer seine Petroleumlampe angezündet, sich ein karges Abendbrot bereitet und es mit einem wahren Wolfshunger heruntergeschlungen. Satt und zufrieden zündete er sich die erste Zigarette des Tages an, denn zum Rauchen hatte heute die Zeit einfach nicht gereicht. Und danach würde er sofort schlafen gehen, denn er würde noch früher als sonst aus den Federn müssen, um das Kleinvieh in den Ställen zu versorgen, nach den Kälbern zu sehen, die Milchkühe zu melken und sich zu vergewissern, dass die Rinder draußen auf dem Farmland sich nicht aus Dummheit in Schwierigkeiten gebracht hatten. Die überschüssige Milch, die die Kälber nicht brauchten, würde er erst nach dem Regen verbuttern können.
Während er noch so saß und rauchte, vermeinte er, eine Art Klopfen an der Tür vernommen zu haben. Erst glaubte er an eine Sinnestäuschung. Vielleicht war es auch nur der ewig wehende, jetzt heftig peitschende Wind, der am Schloss gerüttelt hatte, oder das Strömen des Regens, der auf das Dach des Hauses trommelte und schlug. Aber das Geräusch an der Tür wiederholte sich, doch war es weniger ein Klopfen, vielmehr schien es, als zögen scharfe Nägelkrallen über das nasse Holz. Seltsamerweise hatte keiner seiner Hunde angeschlagen, was äußerst ungewöhnlich war, denn allesamt waren es wilde Burschen, die eher Händel suchten, als einem guten Kampf auszuweichen. Sicher hatten sie sich vor den fallenden Wassermassen irgendwohin verkrochen. Vorsichtshalber machte er sein Gewehr schussbereit, denn hier draußen war das Leben nicht ungefährlich, und speziell des Nachts konnte man nie sicher sein, ob sich nicht vier- oder gar zweibeiniges Raubgesindel herumtrieb. Nur der Schnellere, Klügere, Kaltblütigere hatte in diesem harten Land eine Überlebenschance.
Als sich an der Tür erneut dieses krallenartige Klopfgeräusch vernehmen ließ, schob er ganz behutsam mit dem Lauf des Gewehrs den schweren Eisenriegel beiseite, tat sogleich einen langen Schritt zurück, bereit zu schießen, auf wen oder was auch immer, das sich dort draußen bemerkbar gemacht hatte.
Langsam öffnete sich die Tür, als wisse derjenige, der draußen wartete, dass ein zu schnelles Eindringen tödlich enden konnte. Als endlich die Tür weit genug geöffnet war, sah er gegen die dunkle Nässe nur einen sich schwach abhebenden roten Fleck, der zögerte, ob er auch hereinkommen dürfe. Der Farmer trat einen weiteren Schritt zurück, bevor er kurz nickte. Als der Fleck in den Lichtkegel der Petroleumlampe kam und sich erhellte, überraschte es ihn doch, dass es sich um eine Frau handelte. Sie war völlig durchnässt und fror ganz offensichtlich und sie war schwarz. Deshalb hatte er sie gegen die Dunkelheit der Nacht nicht erkennen können.
Sie war jung, jedenfalls wesentlich jünger als er, vielleicht Anfang zwanzig, mit ebenmäßigen Gesichtszügen, ihre Haut glatt und schimmernd von Nässe wie fein bearbeitetes Holz. Der rote Fleck entpuppte sich als ein mehrfach um ihren Körper gewundenes Tuch aus dunkelrotem, jetzt fast schwärzlichem Stoff. Ihre Handflächen wiesen nach oben als Zeichen, dass sie nichts Böses im Sinn hatte und vor allem keine Waffen trug.
Schweigend ging er um sie herum, spähte kurz hinaus, ohne dass sich einer seiner Hunde zeigte. Dann schloss er die Tür, umrundete sie von der anderen Seite, dabei Abstand haltend und das Gewehr noch immer im Anschlag an seiner Hüfte. Er deutete auf einen Stuhl, der am besten von der Lampe ausgeleuchtet war, und sie setzte sich stumm wie auf einen Befehl.
Er stand nur so da, sein Gewehr in der Hand und wusste nicht, was er tun sollte. So blieb er einfach stehen, ohne reden zu wollen, ohne reden zu können, und starrte sie an. Ihr Blick traf den seinigen, und er las daraus den Wunsch, die Bitte, hierbleiben zu dürfen. Etwas in ihm sträubte sich dagegen, er brach den Blickkontakt ab, aber bei diesem Wetter konnte er sie nicht wieder fortschicken, sie würde in der Kälte sterben wie ein unachtsames Kalb. Außerdem war er einfach zu müde, sie noch irgendwohin zu fahren. Und wohin denn auch? Aber wo sollte sie schlafen? Sein Haus reichte gerade für ihn, außerdem war da nur seine eigene Schlafkammer. Also wo? Als er wieder zu ihr hinblickte, war sie im Stuhl zusammengesunken vor Erschöpfung und Kälte. Ja, Kälte. Sie musste doch frieren in ihrem tropfnassen Wickeltuch; sie brauchte dringend Wärme. Und erst jetzt bemerkte er, dass er noch immer sein Gewehr auf sie gerichtet hielt. Halb ärgerlich auf sich selbst, stellte er es weg und bedeutete ihr, die nassen Sachen auszuziehen.
Sie stand auf und wickelte sich aus ihrem Tuch, ohne falsche Scham und ohne aufdringliche Koketterie: Sie war nackt! Erst später wusste er, dass sie niemals etwas unter ihrem Tuch trug. Schweigend und sehr ernsthaft sah sie ihn an. Erst später wusste er, dass sie niemals sprach. Ohne jedes Wort trat sie zu ihm, legte ihre Arme um ihn und löschte die Petroleumlampe. Erst später, viel zu spät, wusste er mit aller Gewissheit, dass sie nur für ihn gekommen war.
Mitten in der Nacht erwachte er. Die düsteren Regenwolken waren vom Wind aufgerissen worden. Es hatte zu regnen aufgehört, und der Himmel klarte auf. Wie eine schmale silberne Sichel stand der Mond und schickte sein schwaches Licht durch das Fenster in die Schlafkammer.
Seinen Oberkörper auf den Arm gestützt und halb aufgerichtet, betrachtete er sie, wie sie neben ihm lag, genau so, wie sie in vielen zukünftigen Nächten neben ihm liegen würde: auf dem Bauch mit angewinkelten Schenkeln in der unschuldigen Haltung eines Kindes, ihre kleinen Fäuste fest unter ihr Kinn gepresst, als wollte sie etwas greifen und nie wieder loslassen. Als das spärliche Licht des Mondes über ihren nackten Rücken wanderte, vermeinte er, eine ganze Reihe fahler, gelblicher Flecke auf der Ebenholzschwärze zu erkennen. Er war sich aber keineswegs sicher und hielt es für ein Gaukelspiel von Licht und Schatten. Sanft strich er mit seinen harten, derben Händen über ihre warme Glätte. Ganz behutsam fuhr er mit seinen Fingerspitzen über diese Farbspielflecke, spürte eine etwas andere Wärme, vor der seine Fingerspitzen unmerklich zurückzuckten. Sie stöhnte im Schlaf, erbebte leicht unter der Kühle seiner Fingerkuppen, schwebte aus dem Tiefschlaf in eine Art Halbschlaf empor, drehte leicht ihren Körper zu ihm hin, öffnete die kleinen, geballten Schlafhände und ließ ihre ungewöhnlich sehnigen Finger einzeln hervortreten wie eine Katze, die vor Wonne ihre Krallen spreizt.
Mit ihrer Ankunft veränderte sich das Leben auf der Farm und für den Farmer. Überall war ihre unaufdringliche Fraulichkeit zu spüren, und sie war sich nicht zu schade, noch früher als er aufzustehen und ihm das Frühstück zu bereiten. In allem, was sie tat, strahlte sie eine ganz eigentümliche Dynamik aus, allein mit Tieren konnte sie nicht umgehen, und sie machte auch keinen Versuch, sich ihnen zu nähern. Die wilden, raubeinigen Hunde hielten einen scheuen Abstand zu ihr, was ihr nur recht zu sein schien. In den folgenden Nächten lernte er sie immer besser kennen, wenngleich mit zunehmendem Mond eine ihm unerklärliche Unruhe in ihr erwachte. In der Nacht, bevor der Mond seine volle Rundung zeigte, war sie verschwunden.
Erst nach Tagen war sie wieder da, völlig entspannt im Schlaf in ihrer unschuldigen Kinderhaltung, die kleinen Fäuste fest unter das Kinn gepresst. Obwohl er glaubte, sie schon genau zu kennen, war ihm doch, als sei auf ihrem Rücken ein neuer fahler Fleck aufgetaucht, den er vordem noch nicht mit seinen Fingerspitzen in seiner anderen Wärme ertastet hatte.
Als sie zum dritten Mal verschwunden war, fühlte er, dass er sie verloren hatte. Intensiver als die Male vorher war ihre innere Unruhe, ihre Rastlosigkeit fast körperlich zu spüren gewesen. Sie hatte im Schlaf eine eigentümlich gespannte Haltung eingenommen, hatte die Schenkel nicht rechtwinklig wie sonst, sondern, fast wie zum Sprunge bereit, unter ihrem Bauch fest angezogen. Er fühlte, dass er sie niemals wieder in ihrer unschuldigen Kinderhaltung sehen, niemals mehr mit geschlossenen Augen die warme Glätte ihres Rückens liebkosen werden würde. Zu groß war dieses Mal ihre Unruhe geworden. Niemals wieder würde sie zu ihm zurückkehren. Und ein tiefes Schluchzen entrang sich der Brust des Farmers …
Doch sie kehrte zu ihm zurück. Aber bei dieser letzten Rückkehr war sie fest entschlossen, ihn zu töten. Sie musste es einfach tun, weil der fahle Mond wieder steigen würde.
Obwohl die Tür zu dem Haus mit einem starken Eisenriegel gesichert war, würde sie doch wissen, wie hineinzukommen war. Geräuschlos würde sie durch den Gang zu seiner Schlafkammer schleichen, ihre Pupillen stark geweitet, sodass sie scharf sehen konnte. Ganz nahe würde sie an den friedlich Schlafenden herangehen, seinen Körper riechen und ihre Nasenflügel würden sich vor Gier weiten. Dort, wo seine Schultern in den Hals übergingen, dorthinein würde sie ihre blitzenden Fänge schlagen, ihn mit ihrem Gewicht unten halten und mit Krallenhänden seinen Rücken zerfetzen. Schaum würde auf ihre Lippen treten, während sie erbarmungslos und lustvoll zugleich ihr Morden zu Ende führen würde. Gleich würde der volle Mond sein fahles Licht über ihren nackten Körper fluten lassen. Seine kalten Strahlen würden ihre Haut treffen und einen weiteren Fleck dort einbrennen. Für jeden Mord, den sie begehen musste, ein weiterer fahler, gelblicher Brandfleck.
Bereits der erste Strahl, der sie traf, ließ ihre Hände sich zusammenkrampfen und ihre Nägel scharf hervortreten. Ihre Schultern durchschüttelte es, ihre Beine zuckten wie zum rechten Absprung. Nun war er voll da, ihr fahler Mond. Und seine Strahlen brannten wie nie zuvor. Sie war bereit!
Da regte sich etwas in ihr, begann, von innen heraus zu brennen. Verwirrt warf sie sich herum, schlug nach ihrer Brust, weil dort das Brennen immer heißer wurde. Und sie setzte sich zur Wehr, kämpfte mit ihrem eigenen Ich gegen die Eiseskälte der Strahlen des fahlen Mondes. Ihr Leib wand sich, zwischen der Anziehungskraft des fordernden Mondes und ihren wahren Gefühlen hin- und hergerissen, bäumte sich auf, sprang in die Luft, krachte zu Boden, krallte sich in die dunkle Erde, zerfetzte die Grasnarbe, riss tiefe, lange Furchen, zuckte unkontrollierbar, verkrampfte sich, brach erschöpft in sich zusammen; tat ein paar Sprünge zum Haus hin, wendete und attackierte den fahlen Mond, ihre Hände krallenartig ausgestreckt, den Mund weit aufgerissen mit fletschenden Zähnen. Sie verbiss sich in die eigenen Hände, tobte gegen ihren Körper und seine Mordgier, stemmte in wilder Angst die Beine heftig in die Erde, während ihre Arme nach dem Farmhaus griffen, sodass sie wie ein weit überspannter Bogen zerbrach, zerbarst, sich selbst zerstörte.
Am Fenster der Schlafkammer stand der Farmer mit dem Gewehr auf der Brüstung und beobachtete sie. Unheimlich war ihm zumute, und er fühlte erstmals in seinem Leben eine elementare Angst. Dennoch blickte er gebannt auf die vom vollen Mondlicht fast taghell ausgeleuchtete Szenerie. Näherte sie sich dem Haus in weiten Sprüngen, nahm er sofort das Gewehr hoch, seine Hände zitterten dabei. Dann ließ er es wieder sinken, wenn sie erneut den Mond angriff, ihr nackter Körper schweißüberströmt, keuchend und heulend, in bleiches Mondlicht getaucht.
Nachdem der Mond seine volle Größe erreicht hatte und wie ein gewaltiger Kriegsgott alles beherrschte, kämpfte sie ihren letzten Kampf. Unter Aufbietung aller Kräfte krallte sie sich in die herbe Rinde des uralten Kameldornbaumes, und dort hielt sie die eiserne Umklammerung. So lange, bis der Mond unmerklich an Größe, Gewalt, Leuchtkraft und tödlicher Anziehung eingebüßt, an Fahlheit verloren und sich von seinem Scheitelpunkt langsam wieder hinabgesenkt hatte, um zu vergehen.
Ihre Arme fielen vom Baume ab, ihre Beine knickten kraftlos unter ihr weg und ihr Stöhnen war bis in die Schlafkammer zu vernehmen, wo der Farmer völlig mesmerisiert am Fenster stand. Sie sank zu Boden, lag dort eine ganze Ewigkeit von lautlosem Weinen umhüllt, ehe sie sich auf ihre Knie aufrichtete. Dabei reckte sich ihr langer, geschmeidiger Körper dem verblassenden, untergehenden Mond entgegen, voll von Demut und Dankbarkeit, sich selbst besiegt und überwunden zu haben: eine schmale, zerbrechliche Silhouette vor der sinkenden Scheibe des fahlen Mondes. Wie unendlich dankbar war sie doch.
Als die Kugel ihren Kopf durchschlug und sie gespenstisch langsam in sich zusammenfiel, entrang sich der Brust des Farmers ein tiefes Schluchzen.
WHEN THE PALE MOON RISES
It was already the second day that it was pouring with rain. The long months of drought had been swept away. October rains as heavy as these were as rare as some exquisite fruit and were accepted with the same gratitude and joy.
Life on the farm had changed too, the rain had freshly sluiced trees and shrubs and painted them green once more. But the longed for blessing had also caused a lot of extra work. It had to be done quickly, because with the rain the cold had come. The animals, especially the young ones, had to be brought in to find shelter and warmth, otherwise the farmer would experience a serious loss of stock. Also, they had to be protected from drowning in the floods that came roaring down the dry river-bed and took with them everything that could not resist the onslaught.
The farmer had had to work extremely hard without stopping even for a minute, constantly in danger of being swept away himself when he toiled to move his cattle away from the river to the kraal on higher ground. The animals sensed the danger, but the smell of the fresh, flowing water seemed to overpower them.
Long after dark, with rain still coming down in buckets, he had completed his task. He was deadly tired, but he felt satisfied and happy. Inside the house he had lit the parafine lamp and wolfed down a frugal supper. A feeling of well-being seeped through him, and he lit the first cigarette of the day; the hectic activities had not given him time for one before. He would go straight to bed afterwards, for another strenuous day lay ahead. He would have to get up early to tend the animals in the barn, see to the milking of the cows and check on the cattle to make sure that their stupidity had not got them into more trouble. The churning of butter from the surplus milk would have to wait till after the rains.
As he sat smoking, he imagined hearing some sort of knock on the door. At first, he thought he had made a mistake: it could have been the wind rattling the lock of the door or the rain pounding the roof. However, the sound was repeated, and now he realized that it was a scratching sound, rather than knocking, a sound as if sharp nails scraped over wood. Strangely enough the dogs did not bark, all the more strange as they were all wild chaps, who loved a good fight. Now they had crept away and were hiding somewhere. He cocked his rifle. Life was dangerous out here and one never knew if four- or even two- legged enemies were lurking in the night. One’s chances of survival in this hard country depended on one’s wits and resourcefulness.
The scraping-knocking sound came again. With the muzzle of the gun he flicked the latch of the door open and immediately jumped back, ready to shoot whatever or who ever was outside. Hesitantly the door opened as if the person on the other side knew that a too sudden confrontation could lead to death. When the door had swung open he could only discern a dim red spot against the black wetness. The apparition seemed unsure what to do and after having taken another step back he invited it in with a nod. The light of the lamp revealed a woman. She was wet like a soaked kitten, and she was black. That is why he was unable to recognize her in the dark.
She was young, much younger than he was. Probably in her early twenties, with a beautiful face, a smooth skin glistening with the wet like burnished copper. She had a red scarf wrapped around her body, and it was dark with soaked up water. She offered the palms of her hands as a sign of peace, that she was not carrying arms. Without a word he walked around her, then looked outside once more, but none of the dogs appeared. He locked the door, circled her again with the rifle at the ready, keeping his distance, and then motioned her to the chair which was directly in the light of the lamp. She sat down as if obeying a command.
He remained standing with his gun, at a loss as to what to do. He just stood, silent because he had no words. Their eyes met, and he understood that she needed to stay. Something in him balked at the idea — he looked away, but knew that he could not send her out in this weather — she would die like an errant calf. He was too tired to drive her anywhere ; besides, there was nowhere to go. But where was she supposed to sleep? His house was just big enough for him and there was only his own tiny bed-room. So where must he put her? He looked at her again and saw that she was about to succumb to exhaustion and cold. Yes, of course, the cold! She must be freezing in her dripping shawl, she needed warmth above all. Only now he realized that his gun was still pointing at her. Annoyed at himself, he put it away and gestured to her to take off the wet cloth.
She got up and unwrapped it without self-consciousness and without any flirtatiousness. She was naked. Only later he knew that she never wore anything underneath her wrap. Silently she regarded him, very seriously; she went up to him, put her arms around him and extinguished the lamp. Only later he knew that she needed no words, and he knew with certainty that she had only come for him.
He woke up in the middle of the night. The rain had ceased, and the clouds tore open. The narrow silver crescent moon shone through the narrow window of his bed-room.
He pushed himself up on his arm and looked at her as she slept beside him like she would do for many nights to come: on her stomach, her thighs pulled up in the innocent posture of a child, pressing her tiny fists to her chin as if she were holding something she never wanted to release. When the light of the moon touched her back, he imagined he saw a number of pale yellowish spots on the ebony blackness of her skin. He could not be sure, it might be a trick of the light. His hard calloused hand softly stroked the soft warm limbs. Gently his fingertips moved over the imagined spots, and he felt a different warmth, a warmth that made him cringe. She sighed in her sleep, shivered slightly under the touch of his cool fingertips and from the depth of sleep floated up into semiconsciousness. She half turned to him and opened her fists and stretched out her sinewy fingers one by one like a cat that stretched her claws in utter content.
Her arrival changed life on the farm and for the farmer. Her feminine touch unobtrusively made itself felt; in the mornings she got up even earlier than he did to prepare his breakfast and attend to the daily chores in her strangely dynamic way. The animals, however, kept aloof, she had no way with them. The boisterous dogs shyly kept their distance, and she did not seem to mind. The intimacy of the following nights enchanted him, but his troubled mind registered an increasing restlessness in her as the moon grew. The night before it reached its completion, she disappeared.
Days later she was back, completely relaxed in her sleep, back to the innocent posture of a child with the fists under her chin. He thought that he knew her well, but he still imagined that a new spot had appeared on her back, one that had not before passed its warmth to his probing fingertips.
When she had disappeared for the third time, he was sure that he had lost her. Her inner tension had been almost tangible. Her posture in sleep had become strangely tense, her thighs drawn up as if in readiness to leap. He knew that he would never see the innocence of the child’s sleep again, would never again stroke that smooth skin. She would not come back. A terrible sadness took hold of him.
But she did come back, and she knew that she would have to kill him this time. They were at the mercy of the waxing moon.
The front door was secured with an iron latch, but she would know how to enter the house. Noiselessly she would enter his bedroom, the apertures of her pupils widely extended to ensure perfect vision. She would creep up closely, smell him with wide open nostrils and sink her gleaming fangs into his neck just where it joined the shoulders: her weight would pin him down, and she would rip open his back with her clawing hands. Foam on her fangs would crown this orgy of killing. The rays of the moon would touch her naked body and burn another spot into her skin. For every victim another spot.
Even the first ray that hit her caused her fingers to curl and show the claws. Her shoulders shook, and her legs tingled in anticipation of the attack. The power of the moon had fully gripped her, she was ready.
At this a strange sensation arose within her, started to burn. In utter confusion she turned, threw herself down and lashed out at this new pain. Her whole being was torn between this burning and the ice-cold demands of the rays of the fading moon. Her writhing body was torn by two forces, the demands of the moon and the craving of her heart. She reared up to her tormentor and crashed to the ground, her fierceness tore at the grass and its roots, and she stretched out her arms in an effort to embrace the house. She raged against her murderous body, almost destroying herself in this maddening fury.
The farmer watched her from the bed-room window with the gun resting on the window-sill. It was a sinister spectacle and for the first time in his life he felt sheer, unadulterated fear The scene mesmerized him, he could not tear himself away. Whenever she approached the house he lifted the gun with shaking hands and dropped it again when she turned to the moon, attacking it with her naked body, glistening with sweat, howling and yelping.
As the moon reached its full grandeur, reigning supreme like a god of war, she fought her last battle. Rallying the last vestiges of her strength, she gripped hold of the bark of an old camel-thorn tree and held on to it in a desperate embrace. She clung there until the mood had passed its zenith, started to lose its deadly power, its sovereignty and its glory, until it started to fade away.
Then she relaxed her grip, her legs folded underneath her, and she uttered a deep groan which could be heard as far as the bedroom window, where the farmer stood, enchanted. She sank to the ground where she remained for a long time, cloaked in tears, before she pushed herself up unto her knees. She bowed to the waning moon, deeply grateful that she had overcome herself and her deadly powers. Likewise, she formed a slim silhouette against the fading disc, exuding nothing but gratitude.
When the bullet smashed her head and made her body collapse in eerie slow motion, the farmer wept in despair.
(Translation: Dr Monika Franz)
KLEPTOMNAIA
In den Gängen zwischen den Regalen drängen sich die Menschen. Rush-hour im Kaufhaus Low Price & Co.; Stimmengewirr, Lautsprecherdurchsagen, Musik, die dazu animieren sollte, noch mehr in den Schiebewagen zu legen, als tatsächlich benötigt wird; taghelle Neonbeleuchtung, Auffüllerinnen, die eiligst die Lücken im Warenangebot wieder schließen; Campingartikel, Hartwaren, Phono, Kuchentheke, Salatbar, Fleischerei; klinisch weiße Gummistiefel, pinkfarbene Blusen und Hemden, vielfüßige Bedienungen. Dunkelblaue Uniformen, Schlagstöcke an Gürteln, Handschellen, Funkgeräte, blank gewichste Lederstiefel: Wachpersonal.
Kaum hatte die nette, alte Dame, die offenkundig noch ziemlich unentschieden vor dem Regal stand, das Päckchen Mausefallen entdeckt, als sie es auch schon mit bewundernswerter Fingerfertigkeit blitzgeschwind in ihrer geräumigen Handtasche verschwinden ließ. Ähnlich flink waren auch ihre Äuglein, die in dem rosigen Gesicht, das noch kaum Falten und Runzeln aufwies, veilchenblau blitzten.
Dem flüchtigen Beobachter konnte sie nur eine harmlose alte Dame scheinen, wenngleich sie keineswegs wie eine dieser Omas angezogen war: knöchellanger, schmal geschnittener Rock mit aufspringenden Kellerfalten in einem zarten Cremeton, dazu in der gleichen Farbe eine Batistbluse mit gebauschten Ärmeln und doppeltem Spitzenkragen, der über der Brust mit einem als Silberbrosche gefassten Amethysten zusammengehalten wurde. In Creme selbstverständlich auch die Ballerinas, in denen ihre zierlichen, sorgfältig pedikürten Füße steckten. Dezent also alles, wenngleich nicht mehr unbedingt neu und topaktuell, aber liebevoll gehegt, gepflegt und gebügelt. Unter ihrem kleinen, topfartigen Hut - selbstverständlich passend in Creme – lugten üppige, weiße Haare hervor, kunstvoll in einen altmodischen Dutt geflochten. Vereinzelte, noch dunkle Haarsträhnen täuschten über ihr wahres Alter, nicht Sechsundsechzig, nicht Zweiundsiebzig, sondern kurz vor dem Achtzigsten. Einen Stock brauche sie nicht, pflegte sie selbstbewusst zu sagen und spannte dabei ihren mageren Körper wie eine kleine Stahlfeder. Was dem ansonsten arglosen Beobachter jedoch zu denken geben musste, das waren die beiden scharfen Kontrapunkte in ihrer Kleidung. Von einem violetten, bestickten Seidengürtel, der ihre knabenhafte Taille keck umspannte, wurde der schmale Rock gehalten; lässig und cool über die Schulter geworfen, trug sie einen ebenso bestickten Schal in der gleichen auffälligen Farbe, als wollte sie damit ein ganz spezielles Zeichen setzen.
Celeste Freifrau von Blentheim, um die es sich hier handelte, war eine energiegeladene, stadtbekannte Persönlichkeit, von adligem Elternhause aus Pommern stammend, in Namibia geboren, gepflegt, kultiviert, eloquent, mit vorzüglichen Manieren, in besten Verhältnissen lebend. Geldsorgen waren ihr unbekannt. Von Hause aus ohnehin begütert, hatte sie zudem noch reich und standesgemäß geheiratet: Diamanten und andere seltene Steine. Dennoch keine Spur von Hochmut. Im Gegenteil! Offen, freundlich und verständnisvoll, hilfsbereit, großzügig und freigiebig, unermüdliche Spendensammlerin, Mäzenatin der feinen Künste, Engel der Ärmsten der Armen in der Schwarzen-Stadt Katutura. Kein Weg war ihr zu lang, keine Mühe zu groß, kein Geldbetrag, der gespendet wurde, zu gering. Forsch und enorm durchsetzungsfähig blieb sie dennoch stets von Kopf bis Fuß eine Dame. Nichts vermochte sie aus der Fassung zu bringen, außerordentlich beherrscht war alles an ihr. Einfach kein Tadel.
Nur - Ladendiebstähle waren ihre heimliche Leidenschaft. „Mopsen“ nannte sie es verharmlosend. Tatsächlich mopste sie ja auch ausschließlich die ausgefallensten und verrücktesten Sachen. Dinge, die sie überhaupt nicht brauchte: Mausefallen, wie gerade erst beobachtet, Gummiringe, Mottenkugeln, kleine, rote Feuerwehrautos, Rasierklingen. Skurril wäre wohl die beste Beschreibung dieser Mops-Manie. Eigenschaften besonders nützlicher Art, das „Mopsen“ fast professionell schon zu betreiben, besaß Celeste überdies reichlich. Ausgestattet mit einem hellwachen Verstand, hatte sie ihn in dieser Kunst zu einer treffsicheren Listigkeit ausgefeilt, wusste deshalb mit traumwandlerischer Sicherheit, in welchem Laden, zu welcher Zeit, bei welchem Artikel es sich „lohnte“ und schlug dann blitzartig mit der Entschlossenheit einer Wildkatze zu. Unübertroffen dabei war wohl ihre Fingerfertigkeit, die durch jahrzehntelange Übungen auf dem Klavier zur Virtuosität ausgereift war.
Nach dem geglückten Mopsen der Mausefalle verschwendete Celeste nicht den leisesten Gedanken daran, sich etwa verstohlen umzublicken, ob sie denn auch niemand beobachtet hatte. Zu sicher war sie sich ihrer geheimen Künste, und völlig gelassen trippelte sie weiter, jetzt nur noch geleitet von ihren Raubinstinkten. Ein Päckchen Gummiringe gesellte sich zur Mausefalle, ein kleines, rotes Feuerwehrauto aus Plastik; die Einkaufstasche füllte sich zusehends.
Noch hier diese Mottenkugeln und … Abrupt stoppte ein harter Griff am Arm, eine Eisenklammer am Handgelenk den erfolgreichen Diebeszug. Ein Buschmann, heute zum ersten Mal als Wachmann tätig, war Celeste, der raubenden Katze, geduldig auf ihrer Fährte gefolgt. Durch seine Kindheit im Busch an absolute Reglosigkeit und schlafgetarnte Mordabsichten gewöhnt, die sich dann urplötzlich in ein blitzartiges Zuschlagen und Töten ohne jede Vorwarnung verwandeln, hatte der Buschmann Celestes Technik mit wissenden Augen beobachtet, bis er sie mitten im Sprung überrascht hatte.
Celeste stöhnte verhalten unter seinem harten Griff.
„Laat dadelik los!“ fauchte sie auf Afrikaans.
Doch der Buschmann dachte gar nicht daran, sie sofort loszulassen. Für ihn bedeutete dieser Fang den Beweis seiner Qualitäten als neuer Wachmann und damit die sichere Daueranstellung bei Low Price & Co.
„Wenn du mich schon nicht loslassen willst, dann halte mich wenigstens so, dass die Leute nichts merken. Hier kennt mich doch jeder. Und drücke nicht so fest, du brichst mir sonst noch das Handgelenk, und dann ist es aus mit dem Klavierspielen.“
Aber daran, Celeste lockerer zu lassen, dachte der misstrauische Buschmann selbstverständlich nicht, da sich, seiner ihn stets leitenden Erfahrung nach, kein Wildtier dann die Chance zur Flucht oder zum erneuten Angriff entgehen lassen würde. Immerhin drehte er jetzt doch seinen Körper so zu ihr, dass die Gefangennahme für niemanden mehr erkenntlich werden konnte. Und eigentlich konnte Celeste froh sein, nicht seinen Schlagstock gekostet zu haben, obwohl sie ihn wirklich verdient gehabt hätte. So trippelte sie neben ihrem Bewacher her, und langsam legte sich der Schock der peinlichen Überraschung und Überwältigung.
Was würde Emilie, ihre beste Freundin dazu sagen? Sie war die Einzige, die von Celestes „Hobby“ wusste, weil diese ihr es einst unter dem Siegel der Verschwiegenheit gebeichtet hatte. Natürlich würde sie sagen, dass sie das immer gewusst habe, dass es einmal so kommen und Celeste in Schimpf und Schande öffentlich hingerichtet werden würde. Aber Emilie hatte, als sie starb, Celestes Geheimnis mit ins Grab genommen, somit würde ihr jetzt diese Schmach ihrer Freundin erspart bleiben. Celeste pflegte zweimal pro Woche zu ihr ans Grab zu gehen, um dort ihre geräumige Einkaufstasche zu leeren, die vielen kleinen Diebesgüter zu präsentieren und der schweigenden Freundin immer wieder stolz zu versichern, dass noch kein Wachmann geboren sei, der ihrer hohen Kunst des Mopsens gewachsen wäre.
Allein der Buschmann, mit seinen in der erbarmungslosen Schule der Wildnis erworbenen Fähigkeiten, hatte der ausgefeilten Technik des „Mopsens“ Einhalt geboten; dies nötigte Celeste einen gewaltigen Respekt ab. Deshalb kreisten ihre Gedanken, als sie gemeinsam auf dem Weg in die dem Publikum verschlossenen, hinteren Räumlichkeiten des Kaufhauses waren, bereits um eine Belohnung für den Buschmann, statt sich um etwaige negative Konsequenzen für sich selbst Sorgen zu machen. Weder war sie geknickt noch verängstigt, zweifelte auch nicht an ihrer eigenen diebischen Virtuosität, dazu war sie viel zu selbstbewusst. Denn nicht etwa einer dieser Bier saufenden Dummköpfe hatte sie ertappt, sondern ein echtes Wildtier, eines, wie sie selbst, hatte, sie zur Strecke gebracht. Celeste hätte den Buschmann am liebsten küssen mögen; die Sache begann, wirklich spannend zu werden.
Celeste blieb allein in einer Art Zelle zurück, deren einziges, winziges Fenster noch zusätzlich mit schweren, eisernen Gitterstäben gesichert war, während sich der Buschmann mit ihrem Personalausweis und dem Diebesgut zur Geschäftsleitung begeben hatte.
Natürlich war der Geschäftsführer hocherfreut über den erfolgreichen Fang, lobte den Buschmann, der sich bescheiden mehr als einen Meter von dem wuchtigen Schreibtisch entfernt hielt. Doch, als der Geschäftsführer den Namen auf dem Ausweispapier las, erbleichte er, saß schweigend und unschlüssig, bis er plötzlich wütend aufsprang und den völlig verständnislosen Buschmann hart und barsch anfuhr:
„Celeste von Blentheim! Weißt du, wer das ist? Weißt du überhaupt, was du da angerichtet hast? Bist du von Sinnen? Willst du uns alle in Teufels Küche bringen? Und dann hast du sie noch eingesperrt! Sie wird uns wegen Freiheitsberaubung verklagen! Bist du toll? Wir sind erledigt! Ich bin erledigt! Aber, was sage ich immer: Du kriegst zwar den Kaffir aus dem Busch, aber nicht den Busch aus dem Kaffir! Oh, diese dummen Schwarzen bringen mich noch um!“
Der Buschmann verstand die Welt nicht mehr, hörte und überhörte die wirklich unverschämte Beleidigung, stand nur da, wartend, erschreckt, unwissend.
„Du bist entlassen! Du taugst nichts! Du kannst gehen!“
Schweigend und ergeben wollte er sich entfernen.
„Warte! Hier, gib ihr den Ausweis zurück und sag’ ihr, dass sie gehen kann. Alles war nur ein Missverständnis, und wir entschuldigen uns dafür.“
Wortlos gehorchte der Buschmann; niemals würde er die Welt dieser Weißen verstehen.
Celeste war bitter enttäuscht.
„Was glaubt ihr denn, wer ich bin! Bin ich irgendwer? Nein! Celeste von Blentheim, die bin ich! Bin ich es nicht wert, von euch, wie es sich gehört, bestraft zu werden? Brauche ich eine Sonderbehandlung? Habe ich Schonung nötig? Nein, brauche ich nicht! Ich will keine Extrawurst gebraten bekommen!“
Im Gesicht des Buschmanns war die absolute Verständnislosigkeit zu lesen. Celeste merkte es:
„Nicht dich meine ich, sondern sie, diese feige Bande von billigen Krämerseelen. Mein seliger Mann hat immerhin mit den härtesten und seltensten Steinen der Welt - mit Diamanten - gehandelt, nicht mit Mausefallen, Gummiringen und Plastikautos. Kleinkrämer! Pah! Pöbel, Plebs! Na ja, aber lassen wir das, du, Buschmann, hast deine Sache ja gut gemacht.“
Mit diesen Worten entnahm Celeste ihrer Geldbörse einen nagelneuen Hundertdollarschein, blickte sinnend darauf und reichte ihn dem verblüfften Buschmann:
„Hier, der ist für dich. Als Belohnung, weil du mich so schön gefangen hast.“
Mit diesen Worten verließ sie den ungastlichen kleinen, vergitterten Raum.
Natürlich nahm der Buschmann den Schein, doch das, was sich innerhalb der letzten Minuten hier abgespielt hatte, ging weit über sein Verständnis und Vorstellungsvermögen. Er schloss die Tür und folgte ihr unbemerkt.
Etwas außerhalb Windhoeks wohnend, war Celeste bereits zu Hause, als der Buschmann immer noch ihrer Spur folgte. Selbst auf fester Erde konnte er an den leicht unebenen Reifenabdrücken erkennen, wo ihr Auto gefahren war, und rannte, den Blick auf den Boden geheftet, in weiten Sprüngen. Auf Asphalt aber wurde es schwierig. Besonders an den Straßenabzweigungen musste er deshalb stehen bleiben und mit seiner Nase die warme Gummiwitterung der Reifen immer wieder neu aufnehmen. Mit Mühen zwar, doch er erspürte das Auto, fand Celestes Haus. Dann kehrte er langsam um, doch er würde wiederkommen. Dieser Weg war jetzt für immer in seinem Spurengedächtnis gespeichert.
Einige Tage später rief eine Stimme an Celestes Haustür erst leise, dann etwas lauter:
„Hallo! Hallo, Missis! Hallo, Missis!“
Celeste lugte hinter der Gardine hervor, erkannte den Buschmann, der sie so geschickt gefangen hatte, öffnete die Tür, etwas ängstlich und aus kluger Vorsicht nur einen Spaltbreit, und fragte, was er denn hier wolle und wie er sie gefunden habe.
Den Buschmann verwunderte die zweite Frage, weil das Aufspüren von Tieren und lebensnotwendigen Pflanzen für ihn die natürlichste Sache der Welt war. Also lächelte er nur und hielt eine kleine Plastiktüte hoch, sodass Celeste diese sehen konnte.
„Was ist das? Was willst du damit?“
„Die ist für dich, Missis.“
„Für mich?“
Ziemlich misstrauisch jetzt nahm Celeste die kleine Tüte in Empfang, schloss aber vorsichtshalber die Tür ganz. Kaum traute sie ihren Augen, als sie daraus nacheinander ein Päckchen Mausefallen, Gummiringe, ein kleines, rotes Feuerwehrauto aus Plastik und Mottenkugeln hervorzog. ‘Warum brachte ihr der Buschmann dieses Zeug?’
Celeste öffnete die Tür nicht wieder, sondern rief von drinnen: NL@„Warum bringst du mir das?“
Von draußen antwortete der Buschmann:
„Weil Missis die Sachen doch haben wollte!“
Von drinnen schallte es zurück:
„Ich wollte sie gar nicht haben!“
Draußen war Stille, dann die Frage:
„Warum wolltest du sie denn dann stehlen, Missis?“
‘Herrgott, gute Frage’, dachte Celeste drinnen. ‘Warum? Sie wusste es ja selbst nicht. Also, was sollte sie diesem Buschmann denn jetzt sagen?’
Statt zu antworten, ging sie zum Angriff über:
„Woher hast du die Sachen? Hast du sie auch gestohlen?“
„Nein, Missis, ich habe sie gekauft.“
„Gekauft? Für wen?“
„Für dich, Missis, ich wollte sie dir schenken, weil du sie so gerne haben wolltest.“
Hinter der geschlossenen Tür blieb es still; Celeste war wie vom Donner gerührt.
‘Jemand wollte ihr etwas schenken! Ihr! Dieser Buschmann wollte ihr etwas schenken! Gekauft von seinem Geld, nicht gestohlen! Weil sie diese Dinge gerne hatte haben, weil sie sie deshalb hatte stehlen wollen!
Noch niemals im Leben war ihr etwas geschenkt worden, was sie wirklich gerne hatte haben wollen. Und dieser Buschmann mit seiner einfachen, aber geradlinigen Logik hatte folgerichtig geschlossen, dass sie das, was sie unter Gefahr hatte stehlen wollen, auch wirklich gerne gehabt hätte.
Da musste erst ein Buschmann, der von den Weißen wie auch von den Schwarzen Meistverachtete, kommen, um ihr klar werden zu lassen, warum sie stahl, warum sie so kleptomanisch klaute. Weil sie sich nach der Liebe und dem echten Verständnis von jemandem gesehnt hatte, der nicht bloß das verschenkte, was er egoistischerweise wollte, sondern genau das, wonach sie sich wirklich sehnte. Ihr Mann hatte ihr große, teure Brillanten geschenkt, aber nicht seine Liebe. Jetzt bekam sie Mausefallen, weil sie diese Mausefallen eben wirklich haben wollte!’
Celeste fing an zu weinen, leise, von kleinen Schluchzern begleitet, besann sich dann des wartenden Buschmannes draußen, überwand ihre erneut aufsteigende Skepsis aber und öffnete die Haustür weit und einladend. Doch niemand stand mehr draußen. Und so sehr sie auch Ausschau hielt, nach allen Seiten spähend, dann mit dem Auto, in weiten Bögen die nähere Umgebung absuchend: umsonst! Der Buschmann blieb verschwunden.
Zwei Tage später fand sich eine zerknirschte und keineswegs mehr so selbstbewusste Celeste von Blentheim am Grabe ihrer treuen Freundin Emilie ein. Celeste hatte ihr bereits mit stockender Stimme die Vorgänge gebeichtet und kam zum Schluss:
„Weißt du, Emmi, und das Schlimmste für mich ist, dass er durch meine Schuld auch noch seine Arbeit verloren hat. Sofort, nachdem er weg war, habe ich mich im Kaufhaus nach ihm erkundigt. Fortgejagt haben sie ihn wie einen Hund, nur weil er seine Arbeit ordentlich gemacht hat! Ach was, ordentlich. Er hat mich gefangen. Mich! Er hatte Instinkt, besaß den Blick des Jägers, sein Griff war eine Eisenklammer. Hier, sieh! (Sie zeigte ihr bläulich angeschwollenes rechtes Armgelenk). Und, Emmi, er hat mir etwas geschenkt, etwas, was ich haben wollte! Ja, ich weiß, die 100 Dollar, die ich ihm gegeben hatte, aber da war er schon ohne Arbeit und hätte es für andere Sachen dringender gebrauchen können. Und wozu hätte er mir von dem geschenkten Geld etwas kaufen sollen? Oh, nein, Emilie, sag’ nicht, er hätte auf mehr spekuliert! Wäre er dann weggelaufen? Ja, es war richtig, ihn vor der Haustür stehen zu lassen. Machen wir das denn nicht schon immer? Lassen wir die Schwarzen nicht ständig draußen warten? Ja, weil wir unsere Erfahrungen mit ihnen haben. Ja, ich weiß. Aber sind unsere Erfahrungen nicht eigentlich nur das logische Spiegelbild unserer ewigen Vorurteile und Ängste? Aus der Erfahrung, dass Schwarze verlogen, faul und diebisch seien, keinen Verstand hätten, keine Verantwortung kennten, kein Herz besäßen? Nein, nein, Emmi, wir haben es uns zu leicht gemacht, wir wussten schon immer besser, was wir überhaupt nicht wussten. Ich selbst wusste nicht, warum ich diesen Zwang zum Mopsen hatte; er hat es mir gesagt, nein, falsch, gezeigt. Aber ich schwöre dir, Emilie, ich werde ihn suchen und wiederfinden. Dieser Buschmann war für mich wesentlich!“