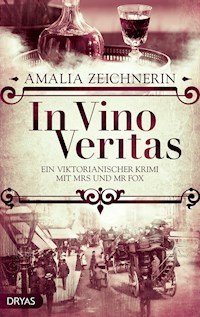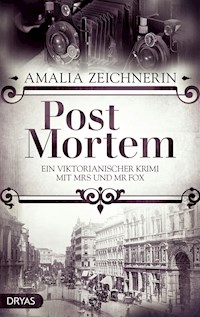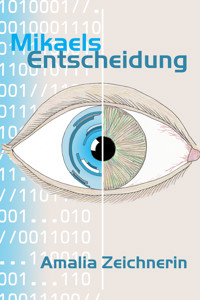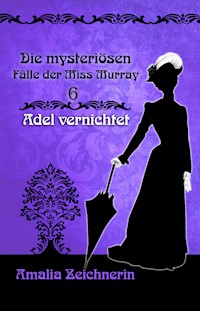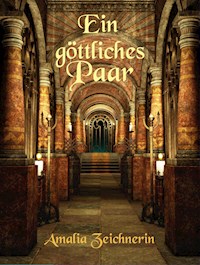
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Unfall während eines Gewitters zwingt den jungen Tarys aus Ithyrios dazu, in einem Tempel Zuflucht zu suchen. Dort lernt er Eli kennen. Sier zählt zu den Semilx – Leute, die jenseits der Geschlechterzuordnungen von „Mann” und „Frau” sind. Eli und Tarys fühlen sich zueinander hingezogen und wollen sich wiedersehen. Doch ihrem gemeinsamen Glück steht mehr als ein Problem im Weg ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table of Contents
Titelei
Inhaltswarnungen
Landkarte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Epilog
Danksagung
Impressum
Ein göttliches Paar
© Amalia Zeichnerin 2020
Inhaltswarnungen zu diesem Roman
Andeutungen von Queerfeindlichkeit in Bezug auf eine genderqueere, intergeschlechtliche Person, explizite Sexszenen
Kapitel 1
Der Regen prasselte auf die dampfende Erde, von der Schwüle des Tages war an diesem Abend nichts mehr übrig geblieben. Schlagartig wurde die Straße von einem grellen Blitz erhellt und nur wenige Augenblicke später hämmerte Deons Donnerhall durch die Luft. Eines der Pferde wieherte panisch. Verzweifelt umklammerte Tarys die rutschigen Zügel. Wagen und Kutschbock waren zwar überdacht, doch durch den stürmischen Wind prasselte der Regen seitlich auf ihn ein. Hoffentlich war der furchteinflößende Gott ihm gnädig und würde seinen nächsten Blitz nicht in den Wagen schleudern! Das Gefährt geriet durch das panische Tempo der Pferde ins Schlingern.
„Ruhig”, versuchte Tarys die Tiere zu beruhigen, doch es half nichts, sie flohen vor dem Gewitter, die Landstraße entlang, die von dem dichten Wald gesäumt war. Tarys zerrte an den Zügeln, um ihre Geschwindigkeit zu drosseln, doch sie preschten einfach weiter vorwärts.
Im nächsten Moment fuhr ein Poltern durch die Unterseite des Wagens; selbst durch das Getöse von Wind und Regen hörte Tarys ein lautes Knacken und das kreischende Geräusch der Holzräder, die mit Metall beschlagen waren.
Der Wagen schlitterte ein Stück weit quer über die Straße, Tarys wurde auf seinem Sitz herumgeworfen und fiel fast herunter. Sein Herz raste. Endlich kam das Gefährt zum Stehen, zwang auch die Tiere zum Anhalten. Die braune Stute wieherte erneut und beide Pferde scharrten mit den Hufen.
Tarys sprang vom Kutschbock. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis er völlig vom Regen durchnässt war. Das Unheil, das ihn ereilt hatte, zeigte sich, als er die Achsen des Wagens in der Dunkelheit betastete. Die vordere war entzwei gebrochen. Bei den Göttern…
Beruhigend strich er der durchnässten Stute über die Mähne. „Ruhig, ruhig … ist ja gut”. Sie schnaubte. Die beiden armen Tiere waren völlig durcheinander. Und er selbst auch.
Tarys schaute auf die Straße hinter dem Wagen. Ein weiterer Blitz machte die Umgebung taghell und er sah den kleinen Felsen am Wegrand. In der Dunkelheit, die durch die schweren Gewitterwolken entstanden war, musste er ihn übersehen haben. Sein Vater würde toben und fluchen, wenn er von dem Schaden erfuhr. Und wie sollte Tarys die Tuchwaren aus der Weberei nun in das Handelshaus seiner Familie schaffen?
Bis nach Serdicia waren es mit Sicherheit noch zehn Meilen oder mehr. Wenn er ritt, war er in etwa drei Stunden zu Hause. Aber dieses Wetter war zu gefährlich. Außerdem würde er sich den Tod holen, wenn er stundenlang in dieser Nässe und Kälte unterwegs war; auch den Pferden würde es schaden.
Nachdenklich betrachtete er die dunklen Bäume. Vorhin hatte die Straße einen Weg gekreuzt, der in den Wald führte. Vom Hörensagen aus einer Taverne wusste er, dass es irgendwo dort einen Tempel des göttlichen Paares gab. Diese beiden Gottheiten hießen Amandor und Psiderin. Im Tempel lebte und arbeitete zum einen deren Priesterschaft, zum anderen feierten die Gläubigen Zeremonien und Feste in jenen heiligen Hallen.
Er selbst hatte mit dem göttlichen Paar nichts zu schaffen, denn seine Familie diente schon seit Generationen traditionellerweise dem Gott des Handels. Aber vielleicht konnte er diesen Tempel finden und um Zuflucht für die Nacht bitten? Sicherlich gab es dort auch einen Stall, dann könnte er die Pferde trocken reiben und unterstellen. Morgen, wenn sich das Gewitter verzogen hatte, würde er in die Stadt reiten und sich von seinem Vater eine Standpauke gefallen lassen.
Der Alte war schon immer streng gewesen. Tarys war ihm als Kind zu „weich” erschienen, damals hatte er all das aus ihm mit einem Stock herausgeprügelt, wieder und wieder. Er hatte ihm das Spielen mit den Mädchen aus der Nachbarschaft verboten. Unnachgiebig und hart war sein Vater gewesen, viel härter als gegenüber seinem älteren Bruder, der als Kind ein Wildfang gewesen war. Verdammt, diese Angst von damals saß ihm heute noch manchmal in Nacken, wenn er seinen Vater ansah.
Tarys verscheuchte die hässlichen Gedanken und warf einen Blick in den Wagen. Die Kisten und Taschen waren trocken geblieben, das Dach schien also weiterhin wasserdicht. Allerdings war der Wagen so vollgestellt, dass Tarys den kurzen Gedanken wieder aufgab, darin zu übernachten. Er würde sich nicht einmal ansatzweise ausstrecken können und es kam nicht in Frage, das kostbare Gut dem Regen preiszugeben. Auch war der Wagen zu tief, um etwas darunter zu stellen.
Tarys schickte ein Stoßgebet zu Mercantirsis, dass der Wagen nicht bis zum nächsten Tag geplündert wurde. Aber bei einem solchem Wetter wagten sich gewiss nicht mal Räuberbanden ins Freie. Wenn er noch vor dem Morgengrauen wieder aufbrach, würde gewiss alles gutgehen. Aber so ganz wollte er es lieber nicht drauf ankommen lassen, deshalb nahm er die Beutel mit den teuersten Stoffen aus dem Wagen. Eines der Pferde würde als Packpferd dienen müssen, dann würde es gehen. Er spannte die Pferde aus, und belud das kräftigere der beiden Tiere mit den breiten Stoffbeuteln. Sie würden durchnässen, aber das ließ sich nicht ändern. Daheim würde er die Stoffe aufhängen und trocknen können.
Die Tasche mit dem Geld verstaute Tarys in einer der Satteltaschen und schwang sich auf die braune Stute. Dann ritt er an das andere Pferd heran und griff nach dessen Zügeln, so dass er es daran mit sich führen konnte.
Das Blätterdach des Waldes schützte ein wenig vor dem Regen, aber das half Tarys nicht viel, weil er ohnehin schon völlig durchnässt war. Außerdem war es hier so dunkel, dass er Schwierigkeiten hatte, dem breiten Pfad zu folgen. Aber immerhin dienten ihm die schwarzen Silhouetten der Bäume halbwegs als Anhaltspunkt. Seine Tunika klebte ihm eisig kalt am Leib. Tarys spürte die Wärme des Pferdes an seinen Beinen, aber das war nur ein schwacher Trost.
Wieder krachte Donnerhall tosend durch den Wald und das zweite Pferd schnaubte, riss sich aber glücklicherweise nicht aus seinem Griff los.
Er zitterte vor Kälte, während er weiterritt. Endlich sah er Licht in der Ferne, das diffus durch den Regenschleier drang. Mittlerweile war er so durchgefroren, dass es ihm völlig gleichgültig war, ob da vorn eine kleine Hütte, ein Tempel oder ein Palast zu finden war.
Ein weiterer Blitz aus der Hand Deons beleuchtete ein breites Gebäude auf der Lichtung, die sich vor ihm auftat, mit einem Giebeldach und Säulen vor dem Eingang. Aus mehreren Fenstern schien Licht, doch falls auch Geräusche herausdrangen, so wurden sie vom Regen und fernen Donner verschluckt. Das musste jener Tempel sein.
Tarys ritt direkt bis vor die breite Treppe am Eingang, kletterte schwerfällig vom Pferd und befestigte die Zügel der beiden an einem Baum in der Nähe des Eingangs. Danach stieg er die wenigen Stufen hinauf und trat zwischen den hohen Säulen hindurch. Am Tor pochte er gegen das massive Holz.
Er musste eine Weile warten, dann öffnete ihm eine junge Frau, deren lockiges Haar ihr bis auf die Hüfte fiel.
„Bei Amandors Liebe!”, rief sie aus. „Ihr seid ja völlig durchnässt. Kommt herein. Ihr seid spät dran.”
„Verzeiht, ich verstehe nicht ganz. Was meint Ihr mit spät? Mein Wagen ist auf der Landstraße liegen geblieben und ich wollte um ein Obdach für die Nacht bitten, damit ich nicht im Gewitter heimreiten muss. Und wenn es möglich ist, würde ich meine Pferde und einige Beutel gern in eurem Stall unterbringen, falls Ihr einen habt.”
„Oh. Ich dachte, ihr seid einer der Gäste auf unserer heutigen Feier. Aber wenn das so ist … ja, wir haben einen Stall. Wartet bitte kurz hier. Ich meine, kommt herein. Ich werde unsere Hohepriesterin fragen. Ich bin gleich wieder da.”
Ohne auf eine Antwort von ihm zu warten, drehte sie sich um und durchquerte die kleine Eingangshalle, die von mehreren Fackeln beleuchtet wurde. Aus dem Tempel drangen leise Musik und Gesang. Tarys fuhr sich über die nasse Stirn. Das hatte ihm gerade noch gefehlt, in eine Feierlichkeit hereinzuplatzen, zu der er gar nicht eingeladen war!
Tarys setzte sich auf eine kleine hölzerne Bank, die in der Nähe des Eingangstores stand. Die Nässe und Kälte kroch über seinen ganzen Körper.
„Darf ich bekannt machen?”, hörte er plötzlich die Stimme der jungen Frau. Tarys sprang von der Bank auf. Sie stand auf der Torschwelle. „Das hier ist Gilia, unsere Hohepriesterin. Und mein Name ist Sydia.”
Überrascht musterte er die Hohepriesterin. Es war eine Pumilia, wie sich die Kleinwüchsigen selbst nannten.
Tarys besann sich auf seine gute Erziehung und deutete eine Verbeugung an. Dabei stellte er sich ebenfalls vor.
Die Hohepriesterin hatte glänzendes honigblondes Haar, das sie zu einer kunstvollen Frisur aufgesteckt hatte. Sie trug ein lavendelfarbenes, fließendes Gewand, das ihre üppigen Rundungen sanft umschmeichelte und an den Säumen mit zarten weißen Fäden bestickt war. An ihren Handgelenken klingelten dünne, silberne Armreifen.
„Sydia hat mir von eurer Notlage erzählt, Tarys. Natürlich könnt ihr eure Pferde in unserem Stall unterstellen und dort versorgen. Es dürfte allerdings etwas eng sein, da wir hier eine Feier haben und zahlreiche Gäste, von denen mehrere mit Pferden oder mit Wagen angereist sind. Die Gefährte stehen alle hinter dem Tempel. Deshalb haben wir auch keine Gästezimmer frei. Aber ich werde mit den Priestern sprechen. Sicherlich ist in einem der Zimmer noch etwas Platz für ein Feldbett, wenn es euch nichts ausmacht. Und dann sage ich dem Tempeldiener Bescheid, er wird euch euer Quartier zeigen.”
„Danke, das ist sehr freundlich von euch. Wie kann ich mich dafür erkenntlich zeigen?”
„Wir freuen uns über eine Spende”, sagte sie mit einem Lächeln. „Ihr seid nicht zufällig ein Anhänger des göttlichen Paares?”
Er hob entschuldigend eine Hand. „Meine Familie huldigt eher Mercantirsis, dem Gott des Handels.”
„Nach Eurer Familie habe ich nicht gefragt”, erwiderte sie, ohne dass ihr Lächeln verschwand. Sie wandte sich an die andere Frau. „Sydia, würdest du den Tempeldiener bitten, für unseren Gast frische Kleidung leihweise herauszusuchen? Und wie steht es mit Hunger und Durst?”
Tarys bedankte sich ein weiteres Mal.
Die Pumilia nickte ihm zu. „Wenn Ihr mögt, schließt euch danach gern unserer Feier an. Auch wenn Ihr kein Anhänger des göttlichen Paares seid – vielleicht wird es … euren Horizont erweitern.”
„Ich werde es mir überlegen”, versprach er.