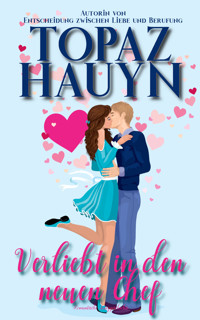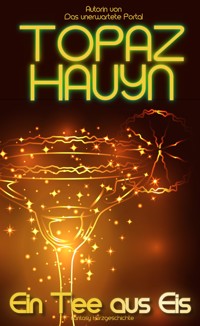5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wo wohnt denn der große, böse Wolf?«, fragte Cariona. »Oder gibt es schlimmere Gefahren, die dich so früh aus dem Bett in den Wald treiben?« »Du bist im Wald. Das reicht vollkommen«, sagte ihr Nachbar. Cariona muss in Steinbach das alte Haus ihrer Großmutter aufräumen. Es soll vermietet werden. Mitten im Semester. Mit einem Griesgram von Nachbar, der ihr Vorschriften macht. Steven will seinen Job als Sandstreuer endlich kündigen. Aber die Kündigung wird wieder abgelehnt. Zusätzlich kommt die süße Enkeltochter seiner alten Nachbarin zurück. Und sein bester Freund will ihn verkuppeln. Das ist das Letzte, was Steven will. Bis Steven nach einer verführerischen Nacht verschwindet. Cariona macht sich auf die Suche und stolpert mitten hinein in ein Netz aus Familiengeheimnissen, Magie und Verrat. Dürfen Cariona und Steven ein Paar werden, oder scheitert ihre Liebe genauso wie die der vorherigen Generation?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ein Herz für die Träume
Ein Herz für die Träume
Ein Herz für die TräumeStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaStevenCarionaLeseprobe: BrennnesselfluchWeitere BücherFantasyRomanceScience FictionSpannung / KrimiGegenwartImpressumEin Herz für die Träume
»Steinbach« stand auf dem Ortsschild, an dem der Bus vorbeifuhr. Ein Dorf an das Cariona sich nur sehr ungern erinnerte. Das Dorf in dem ihre Großmutter gelebt hatte. Die einzige schöne Erinnerung daran waren die Besuche bei ihr. Steven, der verrückte Nachbarsjunge, der sie immer mit Sand beworfen hatte, der war weniger schön.
Cariona hielt ihre orange-rot karrierte Handtasche fest zwischen ihren Händen und schaute von der Rückbank aus durch den gesamten Bus. Der Ort lag immer noch am Ende der Welt. Sie war allein mit der Busfahrerin. Trotzdem war die Luft im Bus schlecht und muffig. Ausdünstungen von verschwitzten Sitzen mischten sich mit dem Schweißgeruch längst ausgestiegener Fahrgäste. Zum Glück kam bald die Haltestelle »Rathaus« und sie würde aussteigen können. Aussteigen und herausfinden ob dieser Steven weggezogen war. Und falls nicht, dann hatte er inzwischen hoffentlich Manieren gelernt und hörte auf mit Sand um sich zu werfen.
Cariona blinzelte bevor sie wieder aus dem Fenster sah. Statt ihre Großmutter zu besuchen, kam sie heute hier her, um ihr Haus auszuräumen. Letzte Woche war sie gestorben. Die Beerdigung würde in zwei Wochen sein, zum Monatsende. Und zum Monatsende sollte das Haus leer sein, damit es vermietet werden konnte. So hatte sie es in ihrem Testament verfügt. Wer auch immer freiwillig nach Steinbach zog, um ein altes Haus zu mieten?
Als Kind, erinnerte Cariona sich, hatte sie das schiefe Dach und die verwinkelten Treppen geliebt. Überall gab es Verstecke. Heute, als junge Frau, die gerade im letzten Semester ihres Wirtschaftsstudiums steckte und eigentlich lernen sollte, war es ein verbautes, altes Haus ohne Isolierung. Dem modernen Standard entsprach es in keinem Fall, soweit sie sich erinnerte.
Der Bus fuhr am Bäcker und an dem kleinen Supermarkt vorbei, die sich das Erdgeschoss eines Hauses teilten. Um die nächste Ecke kam das Rathaus in Sicht. Ein altes Gebäude aus roten Steinen. Groß und stolz. Eine Erinnerung an eine Zeit, als Steinbach wichtig gewesen war. Als die Steine aus dem Steinbruch noch zum Bauen gefragt waren und die Steinbrecher gut davon leben konnten. Heute wollte vermutlich keiner mehr Geld für rote, nicht isolierende Steinfassaden ausgeben. Entsprechend war das Dorf vergessen worden.
Wenigstens fuhr der Bus abends hin und morgens wieder von hier zurück in die nächste Stadt.
Der Bus bremste. Es schüttelte Cariona durch.
»Endstation«, rief die Fahrerin und öffnete die Türen.
Cariona hievte ihren vollen Wanderrucksack auf den Rücken. Kleider, Essen, Lernmaterial. Sie hatte vorsichtshalber alles eingepackt, was sie vielleicht brauchen würde.
Internet und Laptop waren alles schön und gut, aber sie wusste nicht, ob sie hier Strom und Internet hatte. Die alten Häuser und die teilweise über die Dächer gespannten Stromleitungen sahen nicht vertrauenerweckend aus. Gut, dass sie vorgesorgt und alle Bücher, die sie für die Prüfung lernen musste, mit eingepackt.
»Danke. Einen schönen Abend«, sagte Cariona und stieg die drei Stufen aus dem Bus hinunter auf die Straße.
Sie atmete tief ein. Es roch nach kühlem Stein.
Sie ging einen Schritt vor auf den Gehweg. Hinter ihr schloss sich zischend die Bustüre. Von hier draußen, im Abendschatten der Häuser aus rotem, handgehauenen Stein, erschien ihr der Bus wie ein futuristisches Fahrzeug. Wie ein Zeitreisegefährt.
Die Räder rollten an und der Bus fuhr davon.
Cariona stand auf dem Gehweg im Schatten des Rathauses. Der rote Stein erschien im Schatten fast schwarz. Ein Windstoß wehte die Straße herunter.
Sie schauderte in ihrer dünnen Jacke. Schnee lag, jetzt im November, noch keiner, aber in diesem Dorf war es deutlich kühler als in der Stadt.
Sie schwang ihre Handtasche über eine Schulter, die schon schwer mit dem Rucksack beladen war. Zügig überquerte sie die Straße, bis sie auf der anderen Seite im letzten Sonnenlicht des Tages stand. Das Haus hier sah schon freundlicher aus. Sie tastete nach dem dicken Schlüssel zu Großmutters Haus. Er steckte sicher verschlossen in der Seitentasche ihrer Handtasche.
»Guten Abend«, sagte eine angenehme Männerstimme hinter ihr.
Cariona drehte sich um und schaute in zwei fröhlich funkelnde, schwarze Augen, und ein lächelndes, glatt rasiertes Gesicht.
»Ich bin Bürgermeister Markus Maier. Herzlich willkommen in Steinbach. Suchen Sie den Weg zu unserem Gasthof?«, fragte Herr Maier.
Cariona schüttelte die angebotene Hand. Der Bürgermeister klang nett und sah, mit seiner Jeans und dem weißen Hemd gut aus. Er war älter als sie selbst, aber vielleicht hatte er einen Sohn, der genauso gut aussah und in ihrem Alter war? Sie könnte Abwechslung gebrauchen.
»Ich bin Cariona Wild. Das ist nett von Ihnen, Herr Maier, aber nein. Ich werde im Waldweg fünf wohnen«, sagte Cariona. »Begrüßen Sie alle Busfahrer persönlich?«
Herr Maier lachte laut und fröhlich.
»Nein, Frau Wild. Nur Sie und alle die mit den Bewohnern verwandt sind. Ihre Großmutter hat oft von Ihnen gesprochen.« Er schaute ihr in die Augen. »Mein aufrichtiges Beileid zu Ihrem Verlust.«
Cariona sah auf das Kopfsteinpflaster. Sie wollte lieber nicht noch häufiger daran erinnert werden.
»Wenn Sie etwas brauchen, melden Sie sich im Rathaus. Ich werde tun was ich kann. Tagsüber am Besuchereingang, abends und am Wochenende an meiner privaten Haustüre hinter dem Haus«, sagte Herr Maier und weiß mit seiner Hand auf das rote Rathaus.
Cariona nickte und biss sich auf die Lippen. Nach einem Sohn zu fragen, um zu flirten, war sicher nicht was der hilfsbereite Bürgermeister meinte.
»Danke«, sagte sie. »Ich muss los.«
Herr Maier winkte sie in die richtige Richtung und ging zurück über die Straße.
Cariona drehte sich um und stapfte die Hauptstraße hinunter, bis sie die Abzweigung mit dem Schild »Waldweg« fand.
Puh. Sie hatte es geschafft, sich zu verabschieden, ohne sich zu blamieren.
Sie bog ab und stapfte langsam weiter. Der Rucksack drückte auf ihre Schultern. Vielleicht hätte sie doch etwas weniger einpacken sollen.
Die Häuser wurden kleiner, sahen aber bewohnt und die Vorgärten gepflegt aus. Vorhänge hingen in den Fenstern. In einem sah sie eine Vase mit Blumen. Immerhin war die Nachbarschaft belebt und nicht komplett ausgestorben. Das bedeutete, es bestand die realistische Möglichkeit, dass jemand das Haus ihrer Großmutter würde mieten wollen.
Endlich erreichte sie die Hausnummer fünf. Am Zaun auf dem Gehweg blieb sie stehen und richtete sich auf.
Im Dämmerlicht sah alles grau, schwarz und schattig aus. Aber für eine genaue Betrachtung hatte sie die nächsten zwei Wochen Zeit. Erst einmal brauchte sie ein Bett und einen Platz, um noch eine Stunde zu lernen.
Cariona öffnete den Klettverschluss an der Seitentasche ihrer Handtasche und zog den dicken Schlüssel heraus. Das Haustürschloss würde sie auf jeden Fall ersetzen. Keiner benutzte heute mehr solche unsicheren Schlüssel. Sie ging über den geschotterten Weg im Vorgarten.
Sie steckte den Schlüssel ihn ins Schloss und drehte ihn ganz leicht herum. Die Tür ging ohne Quietschen auf und auch der Klick auf den Lichtschalter funktionierte. Eine runde Deckenlampe beleuchtete den Flur, von dem eine Treppe nach oben führte.
Cariona lächelte, schloss die Haustüre hinter sich, stellte ihren schweren Rucksack an der Garderobe an die Wand und machte sich mit ihrer Handtasche über der Schulter auf den Weg durch das Haus.
Die Küche im Erdgeschoss war aufgeräumt. Genauso wie das Wohnzimmer, in dem sogar die Blumen aus der Vase genommen worden waren. Ob der Bestatter hier aufgeräumt hatte? Sie konnte es sich nicht vorstellen. Auch das Badezimmer im ersten Stock war geputzt und das Bett im Schlafzimmer frisch gemacht. So als wäre Ihre Großmutter gerade mit Putzen fertig geworden.
Cariona schauderte. Sie musste das Schloss an der Haustüre austauschen. Und das an der Terrassentüre im Wohnzimmer, die in den Garten hinausführte. Sie stieg die schmale Stiege hinauf unters Dach. Die zwei kleinen Zimmer sahen genauso aufgeräumt aus, wie das restliche Haus. Sogar die Bettdecke war mit dem grün-weiß-gestreiften Bezug überzogen, den sie als Kind hier immer bekommen hatte.
Cariona strich darüber. Er war kühl, wie das ganze Haus. Sie drehte den Heizkörper unter dem Fenster auf und lauschte auf das Rauschen von Wasser. Kein Glucksen. Der Heizkörper war kürzlich entlüftet worden, kürzer als zwei Wochen. Als Kind hatte Cariona abends im Bett gesessen und zugesehen, wie ihre Großmutter den Heizkörper entlüftet hatte. Jeden Abend.
Sie beugte sich über die Bettdecke und schnupperte. Es roch nach frischer Luft. Nicht abgestanden, wie sie erwartet hätte.
Cariona schluckte.
Irgendjemand kümmerte sich um das Haus. Irgendjemand, der wusste, dass sie kam.
Sie rannte die Treppen zurück zur Garderobe, zog ihr Telefon aus der Handtasche und wählte die Nummer ihrer Mutter.
»Wild?«, sagte die Stimme ihres Vaters am anderen Ende.
»Papa! Wer hat noch einen Schlüssel zu Großmutters Haus?«, fragte Cariona und sparte sich jede Begrüßung.
Ihr Vater hatte, statt selbst zu kommen, sie beauftragt. Da hätte er ihr solche Details sagen können.
»Niemand, Schätzchen«, sagte ihr Vater. »Der Bürgermeister, wie hieß er noch gleich?«
»Maier.«
»Genau. Maier.« Ihr Vater lachte. »Er hat mir Mamas Schlüsselbund und Geldbeutel geschickt, nachdem der Bestatter sie abgeholt hat.«
Cariona rieb sich die Stirn. Der Bürgermeister also. Vielleicht hatte er eine Kopie gemacht? Das Dorf schien ihm wichtig zu sein, und er hatte gewusst, dass sie kam.
»Papa, hast du Herr Maier gesagt, dass ich komme?«, fragte Cariona.
»Natürlich, Kind«, sagte ihr Vater, »glaubst du ich lasse dich allein am Ende der Welt herumlaufen?«
Fast hätte sie ihm abgenommen, dass er sich um sie sorgte.
»Du lässt mich allein durch die Großstadt laufen und dort studieren. Tu nicht so als wäre es hier gefährlicher als dort«, sagte Cariona.
Ihr Vater antwortete nicht.
Das Schweigen zog sich in die Länge.
Gänsehaut kroch Cariona über den Rücken und die Arme.
»Gute Nacht, Papa«, sagte Cariona und legte auf. Sie presste die Lippen aufeinander. Sie würde sich nicht von Papas Schweigen Angst machen lassen. Irgendwer hatte einen Schlüssel und diesen Jemand würde sie ausschließen. Gleich morgen. Heute Nacht würden es Stühle unter den Türklinken tun. Sie legte das Telefon zurück in ihre Handtasche und stieg die Treppen in den Keller hinunter. Dort gab es noch eine Tür vom Waschraum hinaus zum Wäscheplatz.
Nachdem Cariona die belegten Brote aus ihrer Vesperdose gegessen und sich für das Bett fertig gemacht hatte, saß sie, auf der frisch bezogenen Bettdecke und hielt ihr Smartphone in der Hand. Das Licht in der kleinen Dachkammer brannte und sie hatte sogar schon etwas gelernt. Nicht so viel wie sie wollte, aber sie war müde und das beredete Schweigen ihres Vaters störte ihre Konzentration.
Cariona reckte beide Arme in die Höhe und gähnte. Dann ließ sie sich auf den Rücken fallen. Der Saum ihres flauschigen Nachthemdes flog hoch und fiel zurück auf die Bettdecke. Sie hob ihr Telefon hoch und tippte auf das Hörersymbol neben Lara Omina.
»Hallo Cariona. Und? Steht das Haus noch? Hast du fließendes Wasser in deiner Wildnis?«, fragte Laras fröhliche Stimme aus dem Lautsprecher.
Cariona lächelte. Lara war einfach die beste Freundin, die sie sich wünschen konnte.
»Alles Bestens. Fließendes Wasser, Strom und ein netter Bürgermeister«, sagte Cariona und erzählte von der langen Fahrt. »Und dazu jemand, der das Haus instand hält und Papa der den Bürgermeister als Kindermädchen beauftragt, weil es hier ach so gefährlich ist.«
Lara kicherte. Gemeinsam malten sie sich die Gefahren aus. Dunkle Straßen und Straßenbanden. Niemals, dafür war der Ort zu klein, zu verschlafen und zu abgelegen. Die Krawallmacher zog es in die Großstadt. Dorthin wo sie eine Bühne, ein Publikum und eine Kneipe fanden. Dann besprachen Sie den Inhalt der Vorlesung, die Cariona heute verpasst hatte.
»Ciao, Cariona, ich muss los«, sagte Lara schließlich und legte auf.
Cariona blieb auf dem Rücken liegen und betrachtete die Bretter an der schiefen Decke. Dann drehte sie sich zur Seite, legte das Smartphone auf das Nachttischschränkchen und zog sich die Bettdecke über die Schultern. Das Telefonat hatte gut getan. Sie fühlte sich leichter.
Auf die Tanzparty, zu der Lara ging, hätte sie jetzt auch Lust. Andererseits, sie hatte hier genug Arbeit. Ein One-Night-Stand würde nur ablenken. Und in zwei Wochen konnte sie mit Lara wieder zusammen auf die abendliche Jagd nach ihrem Vergnügen gehen.
Cariona knipste das Licht aus.
Im Dunkeln knarzte das Holz und der Wind blies um die Fenster.
Hoffentlich musste sie nicht erst renovieren, eine Isolierung und doppelt verglaste Fenster einbauen, bevor sie das Haus vermieten konnte.
Steven
Steven Steinhardt steuerte auf das Sandwerk zu. Der leere, dicht gewebte Sandsack baumelte von der hinteren Ecke der Wolke. Die letzten Körnchen Traumsand waren verteilt. Für heute. Es blieb nur noch das tägliche Gespräch mit seinem Vorgesetzten Herr Mahlstein, dem Leiter der Traumsandwerke, dass er hinter sich bringen musste. Bericht erstatten nannte der das. Nerven sägen passte aus Stevens Sicht besser.
Die weiß und schwach rot glitzernden Berge aus fein gemahlenem Traumsand leuchteten ihm im Mondlicht entgegen. Manche leuchteten fast so hell, wie der runde Mond selbst, andere glommen nur schwach vor sich hin und wurden erst in der Nähe sichtbar. Der Nachthimmel war dunkel. Sterne leuchteten. Von der Sonne keine Spur. Sie war vor Stunden untergegangen und es würde noch Stunden dauern, bis sie wieder aufging. Bis dahin hatte er seine Wolke längst verlassen und lag in seinem Bett. Ob der Sonnenaufgang auch nur halb so schön war, wie der Sonnenuntergang, den er fast jeden Tag sah? Wie wohl die grünen Wiesen bei Tageslicht von hier oben aussahen? Sie sollten ein wunderschön warmes Grün als Farbe haben. Als Fußgänger kannte er sie, als Sandmann am Nachthimmel waren sie immer schwarz. Wie ein Ozean ohne Insel zum Landen. Die Schmetterlinge des Tages waren bunter und schöner, als die dicken, trägen Flatterlinge die mit ihrem Gebrumm die Stille der Nacht musikalisch untermalten. Sicherlich sahen sie aus der Luft noch schöner aus, als vom Boden.
Die kühle Novemberluft strich durch Stevens Haare und blies ihm ins Gesicht. Die weiß glitzernden Sandberge ragten groß und größer vor ihm auf.
Steven steuerte seine Wolke tiefer und landete auf dem freien Platz vor dem Hauptgebäudewürfel.
Das Mahlwerk stand hinter den Sandbergen auf der anderen Seite des Geländes. Trotzdem hörte er das Tag und Nacht laufende Mahlwerk mit diesem unterschwelligen, knochendurchdringenden Knirschen der Steine darin. Steinig trockene Luft hüllte ihn ein. Unter seinen Stiefeln knirschte der Sand bei jedem Schritt. Sogar auf dem Teppichboden hinter der Eingangstüre des Würfels, lag so viel Sand, dass er weiter unter seinen Stiefeln knirschte. Die Luft im Würfel war mit Steinstaub erfüllt. Genau wie draußen. Die Fenster standen immer offen.
Steven blieb im Eingangsbereich stehen. Er streckte sich bis sein Knochen im Rücken leise knackten, kreiste das Gewicht des Sandsackes aus seinen Schultern und warf den, jetzt, leeren Sack an einen Haken an der Wand.
Heute Abend konnte er ihn gefüllt abholen. Wie jeden Abend.
Eine Türklinke klickte. Die Türe knirschte über den Sand auf dem Boden. Herr Mahlstein stand in der Tür. Sein weißes Hemd faltenfrei und sein Blaumann darüber ohne einen einzigen Sand- oder Schmutzfleck. Wie immer unerklärlich für Steven. Seine eigenen Kleider waren sandig, an manchen Stellen hatte rieb der Sand schneller Löcher hinein, als er neue Kleider kaufen, oder sie flicken konnte.
»Schön, dass du auch hier bist Steven«, sagte Herr Mahlstein. »Du kommst jeden Abend später zurück. Hier sind schon wieder vier Beschwerden darüber, dass du die Träume zu spät am Abend vorbeigebracht hast.«
Steven ging auf Herr Mahlstein zu, dieser trat zur Seite. Steven ging an ihm vorbei, durch Luft, die noch trockener war als alles darum herum. Dann ließ er sich im hellgelb beleuchteten Büro in den dunkelgrünen Besuchersessel fallen. Noch ein Möbelstück, dass vom Steinstaub verschont blieb. Seine Füße stellte er gegen das Brett des Schreibtisches und kratzte feine Spuren, mit den Sandkörnern die daran hingen, hinein. Die Stelle war bereits ganz hell und hob sich vom dunklen Braun des restlichen Tisches ab.
»Nimm meine Kündigung an, dann bin ich weg«, sagte Steven.
Was kümmerten ihn die Beschwerden? Er hatte den Sand verteilt, so wie es in seinem Vertrag stand. Wenn Herr Mahlstein sich weigerte Stevens Kündigung anzunehmen, dann waren die Beschwerden sein Problem.
Ein helles Knirschen übertönte das Kreischen der zerbrechenden Steine im Mahlwerk.
Steven sah auf.
Herr Mahlstein, mit seinem grauen, sorgfältig geschnittenen Backenbart, stand neben ihm. Er knirschte mit den Zähnen. Das verhieß nie etwas Gutes.
»Sie wollen meine Kündigung immer noch nicht akzeptieren?«, fragte Steven und wischte sich demonstrativ ein Sandkorn von seiner Jacke. Seiner blauen, viel zu kurzen Jacke. Eine Uniform wie sie von der Gewerkschaft vorgeschrieben wurde. Lächerlich.
Herr Mahlstein schritt um den Schreibtisch herum. Dahinter blieb er stehen und raschelte mit einigen Blättern. Schob sie zusammen, bis alles sauber geordnet aufeinander lag. Er schob sie zur Seite, zog einen anderen Stapel zu sich her, schüttelte den Kopf, blätterte und hielt schließlich ein Blatt hoch.
»Hier. Bringen Sie mir Ihren Nachfolger Herr Steinhardt und Sie können gehen.« Herr Mahlstein hielt Steven das Blatt hin, sodass er es nicht lesen konnte.
Er konnte gehen? Den Job endlich loswerden?
Steven sprang auf und riss das Blatt zu sich herüber. Schnell, bevor Herr Steinhardt es sich anders überlegte, begann er zu lesen.
»Anforderungen an den neuen Sandmann«, stand oben auf dem Blatt. Darunter folgte eine lange Liste mit Fertigkeiten die erwartet wurden.
»Das erfüllt niemand«, sagte Steven und knüllte das Blatt zusammen, bereit es durch das offene Fenster hinauszuwerfen. »Sie wollen mich hereinlegen.«
»Dann nehmen Sie die Kündigung zurück und bleiben mir erhalten? Wunderbar«, Herr Mahlstein nahm ein anderes Blatt in die Hand und riss es zweimal mittig durch, bevor er es in den Mülleimer hinter seinem Tisch warf. Er rieb sich die großen Hände und lehnte sich lächelnd zurück. »Ich wusste doch, dass ich vernünftig mit Ihnen reden kann, Herr Steinhardt. Zurück zu den Beschwerden.«
Steven hörte nicht mehr zu. Das Reißen des Papiers hallte in seinen Ohren nach. Auf keinen Fall zog er seine Kündigung zurück! Vernünftig mit ihm reden nannte der Eigentümer der Traumsandwerke diese Liste? Das war eine Knebelliste. Wer in aller Welt konnte schon auf einer Wolke fliegen? Außer ihm, dem Sandmann und seinen Kollegen? Und wer kannte die Straßen in ganz Europa auswendig, inklusive aller daran wohnenden Menschen und der Träume, die sie jede Nacht bekamen? Außer ihm, dem für Europa zuständigen Sandmann? Und Herr Mahlstein wusste das.
Grummelnd steckte Steven das zerknüllte Papier in die Außentasche seiner zu kurzen Jacke und stapfte aus dem Büro.
»Moment, ich bin noch nicht fertig«, rief Herr Mahlstein hinter ihm her.
Steven grinste. Über seine Schulter rief er zurück: »Ich werde die Stellenausschreibung in den Zeitungen und online Stellenbörsen veröffentlichen lassen.«
Er verharrte im Schritt einen Moment. Als kein weiterer Einspruch von Herrn Mahlstein das mahlende Knirschen der Mühle durchbrach, ging er weiter. Hinaus aus dem Gebäude, vom Gelände aus den Waldweg entlang, neben dem leise ein Bächlein entlang gluckste. Steven sog die Luft tief in seine Lungen. Die feuchte, kühle Waldluft atmete sich so viel angenehmer, als die trockene, sandige Luft in der Steinmühle.
Der Vollmond war hell genug, dass der geschotterte Weg davon beleuchtet wurde. Aber selbst bei Vollmond hätte er seinen Weg gefunden. Schließlich arbeitete er seit fünf Jahren als Sandmann. Fünf Jahre und vier Monate. Seit seinem zwanzigsten Geburtstag an dem er die, viel zu kleine, blaue Uniform und das weiße Hemd bekommen hatte, und den Vertrag, der ihn, als Sohn seiner Eltern zur Erfüllung verpflichtete. Der Tag, an dem seine Eltern ausgewandert waren, um in Amerika als Sandmann und Sandfrau zu arbeiten. Er hatte nicht einmal eine Adresse. Dafür bekam er jedes Jahr zu seinem Geburtstag eine Postkarte mit einem anderen Tourismusmotiv. Allesamt von Felsen, die sich außerdem für Traumsand eigneten, die die Touristen wegen ihrer leuchtenden Farben anstarrten. Nie war eine Adresse darauf, nie eine Nachricht. Trotzdem hingen sie alle an der Wand im Wohnzimmer des Diensthäuschens, in dem er immer schon wohnte. Die einzige Ausnahme war sein letzter Geburtstag. Da hatte er zwei Postkarten bekommen. Eine Tourismuskarte mit Felsmotiv und eine mit einem zerbrochenen Ring. Irgendein amerikanisches Gebäck, dick mit Schokolade und bunten Streuseln verziert.
Steven kickte einen Schotterstein ins Gebüsch und lauschte, bis das Rascheln der getroffenen Blätter aufhörte.
Wem konnte, wem wollte er diesen Job aufbürden? Seinem Freund Alim nicht. Als Sohn vom Bürgermeister war er praktisch selbst schon Bürgermeister und wurde gebraucht. Er stopfte seine Hände in die Hosentaschen und stapfte weiter. Zwischen seinen Fingerspitzen knirschte Sand, der sich trotz Waschen nie wirklich aus den Kanten der Taschen holen ließ, und der Zettel mit der Stellenbeschreibung raschelte in seiner rechten Tasche.
Steve zog ihn heraus. Nicht, dass er ihn lesen konnte in der Dunkelheit. Ob die Zeitung so eine Stellenanzeige überhaupt drucken würde? Vielleicht zum ersten April und der war noch über vier Monate in der Zukunft. Schließlich wusste jeder im Ort, dass die Sandwerke Sand für die Bauwirtschaft herstellten.
Er stopfte den Zettel zurück in die Tasche und kickte den nächsten Stein mit seinem Stiefel davon. Niemand würde diese Stellenanzeige ernst nehmen. Eher kamen ein paar Reporter auf der Suche nach einer guten Geschichte vorbei. Dann würde er noch irgendetwas erfinden müssen. Schließlich stand in seinem Arbeitsvertrag, dass er über seine Aufgabe nicht mit Unwissenden reden durfte.
Irgendwo schrie ein Käuzchen. Steven blieb kurz stehen und lauschte. Ein Uhu antwortete. Ob das Käuzchen wohl die Nacht überlebte? Steven stampfte laut auf den geschotterten Weg, kickte Steine mit seinen Stiefeln vor sich her. Irgendjemand musste das Käuzchen schließlich warnen. Niemand hatte ihn gewarnt, vor dieser Aufgabe. Hoffentlich entkam das Käuzchen.
Endlich kamen die ersten Straßenlaternen des Waldweges in Steinbach in Sicht. Gleich war er Zuhause und konnte in der Dienstwohnung im Waldweg sieben ins Bett fallen.
Wenn er jemanden finden würde, dem er seinen Job aufbürden könnte. Wie sollte er dieser Person davon erzählen? Es so machen wie seine Eltern? Uniform übergeben, gratulieren und schnell das Weite suchen?
Er erinnerte sich noch gut daran, wie Herr Mahlstein ihn damals, in der ersten Nacht, abgeholt hatte. Wie Herr Mahlstein seine Eltern gesucht und nicht gefunden hatte. Dafür hatte Herr Mahlstein dann ihn mitgenommen, ihn, der diese Uniform hatte.
Steven ging unter dem Lichtschein der ersten Straßenlaterne durch. Etwas raschelte.
Er lauschte. Alle sollten schlafen.
Er blieb stehen und sah auf.
An seiner Haustüre lehnte ein Schatten.
Alim!
Nur Alim wartete mitten in der Nacht vor seiner Türe auf ihn.
Steven schaute die Straße hinunter und versuchte in den Schatten zwischen den Straßenlaternen zu sehen.
Es waren keine Sirenen zu hören. Alles sah friedlich aus und war ruhig. Offenbar gab es heute keinen Streit zwischen Alim und seinem Vater.
Steven ging langsamer und schaute noch einmal die Straße hinunter. In der Nummer fünf brannte ein Licht im Dachgeschossfenster. Was war da los? Frau Wild räumte doch sonst nicht mitten in der Nacht auf.
»Steven. Endlich!«, sagte Alim und trat einen Schritt vor.
Moment.
Steven runzelte die Stirn.
Frau Wild war vor zwei Wochen gestorben. Er hatte es von Alim gehört. Wohnte jetzt ein Geist in dem Haus?
»Jetzt steh nicht so rum! Schließ die Tür auf!«
Nein, sicher nicht, entschied Steven. Geister brauchten kein elektrisches Licht.
Wer war dann in dem Haus?
Steven kniff die Augen zusammen und machte sie wieder auf.
Das Licht war aus.
Er presste seine Lippen zusammen.
Jetzt sah er schon Lichter wo keine waren.
»Steeeeven!«, rief Alim und kam einen Schritt näher.
Wer immer in Frau Wilds Haus war, war nicht Stevens Problem, oder?