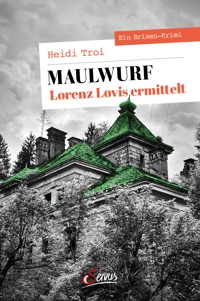3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Empire-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Grau kriecht die Regenwand über den Berg auf mich zu. Nicht lang, dann wird sie mich erreicht haben. Mich, der sich hinter einem Fichtenstamm verbirgt. Lauert. Auf mein nächstes Opfer. Mein ... letztes Opfer. Sie.
Vera, Redakteurin einer Grazer Tageszeitung und dort für die "Literarischen Seiten" zuständig, wird auf einen Dichter aufmerksam, dessen Gedichte von einer großen Schuld sprechen und davon, wie schmerzhaft er die Ausgrenzung durch seine Mitmenschen erlebt. Vera will mehr über ihn wissen und macht sich auf die Reise zu ihm.
Doch was sie in dem kleinen Dorf erfährt, in dem der Einsiedler lebt, lässt das Grauen in ihr wachsen.
Jedes Jahr stirbt eine Frau in diesem Dorf. Jedes Jahr am selben Tag. Und jede dieser Frauen hatte engeren Kontakt zu Veras Dichter, der als Einsiedler hoch über dem Dorf auf dem Berg lebt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Heidi Troi
Ein letztes Opfer
Über die Autorin:
Heidi Troi lebt und schreibt in Südtirol. Wenn sie nicht gerade mit Kindern und Jugendlichen Theater macht, schreibt sie – und zwar am liebsten Krimis und Kinderbücher, wobei sie sich da nicht gern in Schubladen stecken lässt. Wenn Heidi Troi ihre ganzen Leidenschaften genügend Zeit dazu lassen, ist sie gern in den Südtiroler Bergen unterwegs – nicht selten auch in dem Tal, welches das Vorbild für den Schauplatz des Krimis »Marterlmord« war.
Buchbeschreibung:
Grau kriecht die Regenwand über den Berg auf mich zu. Nicht lang, dann wird sie mich erreicht haben. Mich, der sich hinter einem Fichtenstamm verbirgt. Lauert. Auf mein nächstes Opfer. Mein ... letztes Opfer. Sie.
Vera, Redakteurin einer Grazer Tageszeitung und dort für die "Literarischen Seiten" zuständig, wird auf einen Dichter aufmerksam, dessen Gedichte von einer großen Schuld sprechen und davon, wie schmerzhaft er die Ausgrenzung durch seine Mitmenschen erlebt. Vera will mehr über ihn wissen und macht sich auf die Reise zu ihm.
Doch was sie in dem kleinen Dorf erfährt, in dem der Einsiedler lebt, lässt das Grauen in ihr wachsen.
Jedes Jahr stirbt eine Frau in diesem Dorf. Jedes Jahr am selben Tag. Und jede dieser Frauen hatte engeren Kontakt zu Veras Dichter, der als Einsiedler hoch über dem Dorf auf dem Berg lebt …
Heidi Troi
Ein letztes Opfer
Thriller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© März 2023 Empire-Verlag
Empire-Verlag OG, Lofer 416, 5090 Lofer
Lektorat: Antje Backwinkel https://buchwinkelei.de/lektorat/
Korrektorat: Heidemarie Rabe
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –
nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Cover: Chris Gilcher
http://buchcoverdesign.de/
Illustrationen: Adobe Stock ID 225540618, Adobe Stock ID 132848439, Adobe Stock ID 124573637 und freepik.com.
Auf nassen Michaelistag ein nasser Herbst folgen mag.
Bauernregel
Prolog
Fahles Grau kriecht über den Berg auf mich zu. Bald wird die Regenwand mich erreicht haben. Mich, der sich hinter einem Fichtenstamm verbirgt. Lauert. Auf mein nächstes Opfer. Mein … letztes Opfer. Sie.
Ich habe die perfekte Stelle ausgesucht. Unter mir fällt der Hang steil ab, im Felsen klaffen tiefe Spalten und es geht gut hundert Meter in den Abgrund. Ein schneller Tod. Der Aufprall, dann wird es vorbei sein.
Man sagt, im Sturz ziehen die Bilder deines Lebens an deinem inneren Auge vorbei. Ob auch Bilder von mir sie in den Tod begleiten?
Ich habe lange mit mir gehadert. Will ich sie für meine Rache verwenden? Sie, die so unschuldig ist?
Das waren die anderen auch, flüstert das Stimmchen in meinem Kopf. Das Los ist auf sie gefallen. Die Götter haben sie erwählt. Ich muss. Muss. Muss!
Die Regenwand erreicht den Felsvorsprung. Schwere Tropfen platzen auf den Kies der Almstraße, dann höre ich ein anderes Geräusch: Schritte. Fünf, vier, drei … Jetzt sehe ich sie, sie hat die Jacke schützend über ihr Haar gezogen. Es kraust sich in feuchter Luft und das stört sie mehr als die Nässe, wie ich weiß.
Sie schaut sich um, über ihre Schulter, angstvoll und ahnt, was ihr bevorsteht. Ruhe legt sich über mich, erwartungsvoll, und ich weiß, was zu tun ist. Sie kennt die Spielregeln. Sie hat in das Spiel eingewilligt. Jetzt bin ich dran.
25. August, vormittags, Redaktion »Wochenblatt«
»Post für dich.« Anna ließ einen Stapel Briefe auf Veras Schreibtisch fallen. »Viel Spaß mit deinen armen Poeten!«
Vera löste ihren Blick vom Bildschirm und betrachtete die zahlreichen Kuverts. Es waren etwa vierzig, und sie wusste, was sie beinhalteten. Seit das Wochenblatt vor einigen Monaten auf Veras Betreiben eine neue Rubrik eingeführt hatte, die jungen Autoren eine erste Publikationsmöglichkeit bieten sollte, wurde sie von Zuschriften überschwemmt. Wobei die wenigsten ihre Texte analog schickten, in ihrem E-Mail-Postfach trafen innerhalb eines Tages dreimal so viele Nachrichten mit dem Betreff »Literarische Seiten« ein und Veras Aufgabe war es, die Texte zu sichten und zu sortieren.
»Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen«, hatte Heinz Wurzer, der Chefredakteur, gewitzelt, als er ihr das erste Mal »ihr« Päckchen überreicht hatte. Vera seufzte. Von dem Projekt, das sie anfangs so begeistert hatte, fühlte sie sich mittlerweile überfordert. Da die Zeitschrift den Autorinnen und Autoren auch noch ein kleines Honorar für die Veröffentlichung ihres Textes versprach, dachte jeder, dass hier leichtes Geld zu verdienen war. Doch das stimmte so nicht. Unter vielleicht hundert Texten fand sich einer, der es wert war, veröffentlicht zu werden. Einige darüber hinaus hatten durchaus Potenzial mit einem professionellen Lektorat, aber das war nicht Veras Aufgabe. Sie konnte nur annehmen, was geeignet war, und dafür hatte sie bei steigender Anzahl der Zuschriften immer weniger Zeit.
Seufzend riss sie den ersten Umschlag auf. Ein Blatt fiel ihr entgegen, das mit einer kindlichen Handschrift vollgekritzelt war. Auf den unteren Rand war eine Blümchenwiese gezeichnet. Ein Kärtchen lag dabei, das Vera überflog. Lehrerin … hochbegabt … Schulaufsatz, las sie und legte diesen zu den anderen der Kategorie: Gedichte und Geschichten von Schulkindern. Davon hatten sich bereits einige angesammelt, geschickt von ehrgeizigen Müttern, die für ihre Kinder nichts Geringeres als den Literaturnobelpreis im Sinn hatten. Für Veras Rubrik waren sie jedoch definitiv ungeeignet.
Sie öffnete das nächste Kuvert und war froh, dass es sich diesmal um einen maschinengeschriebenen Text handelte beziehungsweise um den Durchschlag eines maschinengeschriebenen Textes, was ein Kopfschütteln bei Vera auslöste. Gab es wirklich noch Menschen, die auf einer Schreibmaschine tippten? Mit Blaupapier?! Sie überflog den Text, fand diverse Rechtschreibfehler und legte das Blatt auf einen zweiten Stapel der Kategorie: fehlerhafte Texte.
Anna kam vorbei, stellte Veras Lieblingstasse vor sie hin, aus der ein verführerischer Duft nach frisch aufgebrühtem Kaffee hochstieg, und schnappte sich den Text des Grundschulkindes. »Ist doch süß«, sagte sie.
»Hm, aber süß ist nicht gefragt«, erwiderte Vera missmutig, während sie den Brieföffner in das nächste Kuvert rammte. »Das ist keine Kinderrubrik, wir suchen talentierte Autoren.«
»Aber Talent hat die Kleine.« Anna grinste, schob den Stapel Kuverts zur Seite und ließ sich mit einer Pobacke auf Veras Schreibtisch nieder. »Hör mal, wie niedlich: Im Wald steh’n die Bäume. Als ob ich träume, steh ich da. Die Rehe verhalten sich still, der Igel kann tun, was er will. Kindlicher Naturalismus, würde ich sagen. Oh, es wird noch besser. Hör mal: Doch da, ein Schuss! Die Tiere flieh’n! Alle irgendwo anders hin. Jetzt wird es spannend. Vielleicht ein Krimi?«
Anna lachte, und Vera konnte nicht anders, als in ihr Lachen einzustimmen. »Das arme Kind. Es hat da sicher sein ganzes Herzblut reingesteckt und du machst dich darüber lustig.«
»Jetzt mal ernsthaft!« Anna wedelte mit dem Blatt. »Wie viele solcher Sendungen von Kindern sind dabei?«
»Viele!«, gab Vera zu.
»Dann wäre es doch eine gute Idee, in einer Ausgabe Kindertexte zu veröffentlichen.«
»Ja, vielleicht.« Vera fand den Vorschlag alles andere als gut. Es gab massenweise schreibende Kinder und noch mehr übereifrige Mütter. Nein, sie wollte, dass ihre Rubrik ernst genommen wurde. Sie wollte unbekannten Autoren eine Öffentlichkeit verschaffen und zeigen, dass es auch in Österreich Menschen gab, die literarisch etwas draufhatten.
Sie öffnete den nächsten Umschlag und ihr Herzschlag beschleunigte sich.
Er hatte wieder einen Text eingesendet.
Er … das war ein Dichter namens Wilhelm Schneider, der Vera alle paar Wochen einen Text schickte, seitdem sie diese Rubrik betreute. Es waren düstere Texte, die von der schwarzen Seele der Menschen sprachen, von Schuld und Sühne, die etwas in ihr zum Klingen brachten. Bislang hatte sie keinen dieser Texte veröffentlicht. Irgendwie war ihr, als seien diese schönen Worte nur für sie geschrieben worden. Für sie allein. Es widerstrebte ihr, sie mit der Welt da draußen zu teilen. Sie womöglich zerreißen zu lassen von den Hyänen, die sich als Literaturkritiker aufspielten, ohne selbst auch nur einen geraden Satz zustande zu bringen. Doch das war nicht gerecht. Nicht dem Dichter gegenüber und nicht der Welt, die sich mit den Themen auseinandersetzen musste, denen Wilhelm Schneider seine Zeit und sein Talent gewidmet hatte.
Widerstrebend hielt sie ihrer Kollegin das Blatt hin. »Was hältst du von dem hier?«
»Zeig mal!« Anna ließ ihre Augen über die Zeilen wandern. Dann nickte sie. »Klingt gut. Düster, aber gut.«
»Nicht wahr?« Vera nahm das Blatt wieder an sich, legte es auf den Tisch und strich liebevoll darüber. Dieser Text klang nicht nur gut. Er war gut. Er war … einzigartig.
Ohne es zu wollen, vertiefte sie sich in die düsteren Beschreibungen. Beim Lesen bildeten ihre Lippen die Worte nach und in ihrem Kopf entstand ein Bild, das sie packte und nicht mehr losließ. Es war wie ein Sog, dem sie nichts entgegenzusetzen hatte. Vera nahm kaum noch wahr, dass Anna von ihrem Schreibtisch rutschte und sich entfernte. Die Geräusche in der Redaktion verhallten, und Vera tauchte ganz ein in die düstere Welt, die in ihrem Kopf entstand.
Michaels Fluch
Dunkel. Grabesgrau.
Im Schatten unter Michaels Schwingen: er.
Eingekesselt von zischelnden Zungen.
Sie schwingen die Forken.
Blicke stechen auf ihn ein.
Auf ihn, der die Schuld trägt.
Der Tod hängt in der Luft.
Und näher rücken sie. Und näher.
Mit ausgestreckten Fingern zeigen sie auf ihn.
»Du bist schuld. Du. Du. Du.«
»Nein!«, sagt er.
Und sie weichen zurück.
Nicht.
Und er …
… wacht auf. Das erlöste Lächeln auf seinem Gesicht erstirbt.
Ein Traum.
Und noch ein Traum.
Schwarz wabert die Schuld aus dem offenen Grab.
Die Anklage giftiger Qualm.
Schwarz und stumm.
Und ungreifbar.
Füße scharren im Kies.
Auf gespannten Schirmen trommelt der Regen.
Und er …
… steht unbeschirmt.
Und Regentränenbäche verwaschen seine Sicht.
Und keine Hand legt sich auf seine Schulter.
Und Michael besiegt den Drachen nicht.
Und die Zeigefinger sind unsichtbar.
Und kein »Nein!«, mit dem er …
… aus diesem Traum erwachen kann.
Die Wirklichkeit ist regentropfengrau.
Vera ließ das Blatt sinken. Ihre Gedanken waren längst nicht mehr bei dem Text, sondern bei ihrem Vater, der zu Hause gesessen hatte bei heruntergelassenen Rollläden im Dämmerdunkel, das dem Dunkel in seiner Seele entsprach. Der sich kaum gerührt hatte, nicht gegessen, nicht getrunken, nur mit steinerner Miene in die Ecke des kahlen Raums gestarrt hatte.
Erst jetzt verstand Vera, was im Kopf ihres Vaters vor sich ging, dass auch ihn zischelnde Zungen und die ausgestreckten Finger verfolgten, dass auch er den Kampf gegen seine Drachen verloren hatte, an ihnen zerbrochen war …
Wilhelm Schneider hatte in Worte gefasst, was Veras Vater nicht auszudrücken vermocht hatte und ihr damit zu verstehen geholfen, warum er dagesessen, mit niemandem gesprochen hatte, wie in einem Traum gefangen, aus dem er nie mehr erwachte.
Und das war der Grund, warum Vera diesen Dichter als den ihren empfand, seine Worte als intim, an sie gerichtet und nicht für die kalte Welt da draußen bestimmt. Er und ihr Vater wurden in ihrem Kopf zu einer Person, verschmolzen zu einem gebeugten, schuldgeplagten Menschen, der unter dem Urteil der Öffentlichkeit zerbrechen würde. Und plötzlich erwachte in ihr der Wunsch, zumindest diesen Menschen zu retten, diesen Dichter, da für ihren Vater jede Rettung zu spät kam.
»Geht es dir gut, Vera? Du bist ganz blass!« Annas Stimme holte sie aus ihren Gedanken.
»Ja, alles okay. Ich bin … mir ist ein bisschen schwindelig. Ich gehe kurz raus, frische Luft schnappen. Wenn was ist …«
»… ich halte die Stellung.« Anna lächelte ihr besorgt zu und Vera machte, dass sie aus der Redaktion kam.
Draußen wurde sie von einer Windböe empfangen, die ihr unangenehm in die Haare fuhr. Ein kalter Wind, der in ihre Wangen biss und den Herbst erahnen ließ. Vera schob die Kapuze ihres Hoodies über den Kopf und stapfte los. Einfach irgendwohin, weg von der Redaktion, fort von ihren Gedanken. Ohne den Blick zu heben, eilte sie durch die Gassen, bis sie vor dem Friedhof stand. Natürlich hatte ihr Weg sie hierhergeführt. Ihr Unterbewusstsein hatte gewusst, was sie brauchte.
Vera lenkte ihre Schritte durch das Portal, ihre Füße kannten den Weg zur letzten Ruhestätte ihrer Mutter. Elise Profanter stand auf dem Grabstein. Der Name ihres Vaters fehlte. Er lag nicht hier.
Vera spürte, wie sich in ihrer Kehle ein Kloß bildete, als sie sich an die Zeit nach dem Tod ihrer Mutter erinnerte. An den Vater, der mehr tot als lebendig vor sich hingestarrt hatte, an die Leere in ihrem Elternhaus. An jene Leere in ihrem Herzen, die sie auch heute noch begleitete.
Hatte die Mutter bis dahin ihren Vater noch manchmal aus seinen Träumen reißen können, gab es nach ihrem Tod niemanden, der das schaffte. Veras Versuche, zu ihm durchzudringen, blieben erfolglos. Er hatte seinen Kampf verloren.
»Hi, Mami. Hi, Papi.« Vera kniete sich ins feuchte Gras. »Wie geht es euch?« Auch wenn ihr Vater nicht hier begraben worden war, fühlte sie sich ihren Eltern an diesem Ort so nah, dass sie zu beiden sprach. »Mir geht es … gut. Wirklich! Meine Literarischen Seiten laufen, täglich kommen mehr Zuschriften und … heute habe ich wieder einen Text von diesem Dichter bekommen. Du weißt schon, Papi, der Wilhelm Schneider, von dem ich dir erzählt habe. Seine Texte würden dir gefallen … na ja, vielleicht ist ›gefallen‹ das falsche Wort, aber ich glaube, sie würden dir helfen, über das zu sprechen, was dich …«, ins Grab gebracht hat, wollte sie den Satz beenden, aber es ging ihr nicht über die Lippen. »Magst du den Text hören?«
Vera zog das Blatt aus ihrer Jackentasche, legte es sich auf die Knie, strich es sorgfältig glatt. Dann las sie ihrem Vater den Text vor. Langsam. Wort für Wort, Satz für Satz. Sie sah ihn vor ihrem geistigen Auge, wie er auf seinem Sessel saß, den Blick starr in die Ecke gerichtet, und stellte sich vor, wie die Worte in seine Ohren drangen, von dort in sein Hirn … wie sie ihn erreichten. Wie die graue Maske von seinem Gesicht abfiel, Leben in seine Augen zurückkehrte und er den Blick auf Vera richtete. Wie Tränen sich an seinen Lidern sammelten und dann überflossen, seine Wangen hinab.
Mit dem letzten Wort verblasste das Bild ihres Vaters.
Vera blieb kniend vor dem Grab.
»Was mache ich nun damit?«
Sie wartete vergeblich auf eine Antwort, doch in Vera manifestierte sich langsam ein Gedanke: Ihrem Vater konnte sie nicht mehr helfen, aber dem Dichter … vielleicht. Er wollte gehört werden. Warum sonst hatte er seinen Text an die Redaktion geschickt? Vielleicht war es ein Hilfeschrei. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, nach jemandem, der mit ihm sprach, der ihn zu verstehen versuchte, ihn von seiner Schuld lossprach? Vera schluckte. Konnte sie diejenige sein, die Wilhelm Schneider im Kampf gegen seine Drachen beistand?
Und plötzlich reifte ein Entschluss in ihr. Sie musste mit ihm sprechen, musste wissen, was er getan hatte, um sich von der Gesellschaft ausgeschlossen, geächtet zu fühlen. In seinem Text schwang Reue mit. Er würde es nicht abstreiten, wenn er tatsächlich Schuld auf sich geladen hatte. Vera konnte herauslesen, dass er sich das Gespräch wünschte, sich rechtfertigen wollte. Ja, Wilhelm Schneider wollte gehört werden. Und dazu konnte sie ihm verhelfen – mit ihrem Bericht im Wochenblatt, einem Porträt.
Vera sprang auf. Das Blatt mit dem Gedicht wie eine wehende Fahne vor sich herschwenkend rannte sie über den Friedhof zurück in die Redaktion.
Die Frage »Geht es dir besser?« ihrer Freundin tat sie mit einem schnellen Kopfnicken ab und stürmte an ihr vorbei auf das Büro des Chefredakteurs zu. Die aufmerksamen Blicke der Kollegen folgten ihr.
Heinz Wurzer verfügte als Einziger in der Redaktion über einen geschlossenen Raum. Als Vera ihn betrat, schob er sich seine Brille mit dem dicken schwarzen Rand hoch auf die Glatze. »Was gibt’s?«
»Ich habe meinen Auswahltext für die nächste Ausgabe der Literarischen Seiten getroffen.«
»Gut, dann stell ihn uns doch bei der Redaktionssitzung vor.«
»Ich möchte den Text nicht nur abdrucken, ich will …«
»Okay?« Wurzer ließ das Wort wie eine Frage klingen. Er wollte also wissen, warum Vera es für nötig befand, ihn persönlich zu konsultieren. Normalerweise redigierte sie den eingesendeten Text, Wurzer überflog ihn dann noch einmal, bevor die Zeitung in Druck ging. Nicht mehr und nicht weniger. Aber heute war es anders, heute wollte sie dem ausgesuchten Autor Gehör verschaffen.
»Er ist … etwas Besonderes«, erklärte sie und legte das Blatt mit Wilhelm Schneiders Gedicht auf den Tisch.
Wurzer schob sich die Brille zurück auf seine Nase und las. Eine Weile herrschte Stille, dann hielt er Vera das Blatt wieder hin. »Passabel. Kann rein.«
»Du verstehst nicht«, blieb sie beharrlich.
»Nein?«
»Der Autor … Er muss sprechen können über das, was er getan hat.«
»Aha! Macht er das nicht mit diesem Text?«
»Das ist zu wenig.«
Wurzer schob die Brille erneut auf seine Glatze, zog die Augenbrauen hoch, was die Brille zurück an ihren Platz auf seiner Nase fallen ließ. »Zu wenig?«
»Ich will ein Porträt über ihn machen. Wilhelm Schneider hat mehr zu sagen als diese paar Zeilen.«
Der Chefredakteur musterte Vera eingehend, dann zog er das Blatt noch einmal zu sich und vertiefte sich in die Zeilen. »Hm …« Er kratzte seinen unbehaarten Schädel. »Woher willst du das wissen? Kunst ist das Abstrahieren der Wirklichkeit, sie hat die Aufgabe …«
»Ich weiß es einfach«, sagte Vera schnell, bevor Wurzer in einen seiner endlos langen Monologe verfallen konnte.
»Aha!«, wiederholte Wurzer, nahm die Brille vom Kopf und putzte sie umständlich mit seiner Krawatte.
»Bitte, Heinz! Ich … ich spüre, dass es da eine Geschichte hinter diesem Text gibt. Vielleicht sogar einen Skandal«, versuchte Vera den Chefredakteur zu locken.
»Lass mich drüber nachdenken.« Wurzer tippte mit dem Zeigefinger auf das Blatt und schob es ihr über den Schreibtisch wieder zu. »Schick mir eine Kopie davon. Ich gebe dir Bescheid.«
Vera atmete innerlich auf. Seine Bereitschaft, darüber nachzudenken, war schon die halbe Miete. Er würde sein Einverständnis geben. »Danke, Heinz«, sagte sie und verließ das Büro. In Gedanken entwarf sie bereits eine E-Mail, die Wilhelm Schneider darüber informieren sollte, dass sein Gedicht in der nächsten Ausgabe erscheinen würde.
Als sie wieder an ihrem Schreibtisch saß, musste sie jedoch feststellen, dass der Autor keine E-Mail-Adresse angegeben hatte. Nicht mal eine Telefonnummer. Einzig die Postanschrift stand als Absender auf dem Briefumschlag: Wilhelm Schneider, Einödhof, Rabenstein.
»Und wie erreiche ich dich jetzt, du Genie?«, fragte Vera und seufzte. Sollte sie ihr Vorhaben doch aufgeben oder … Sie zögerte.
»Die kommen alle weg?« Anna griff nach den beiden aussortierten Stapeln. »Ich bin gerade auf dem Weg ins Archiv.« Sie deutete auf den Brief, der immer noch in Veras Hand auf sein Urteil wartete. »Den auch?«
»Nein, den behalte ich.« Innerhalb einer Sekunde traf Vera die Entscheidung. Sie würde den Dichter anschreiben. Per Post. Und dann würde sie auf seine Antwort warten, die hoffentlich positiv ausfiel. Warum auch nicht? Jeder aufstrebende Dichter würde doch diese Gelegenheit nutzen, durch ein Porträt etwas mehr Bekanntheit zu erlangen. Oder?
»Natürlich!«, murmelte Vera, streckte lächelnd ihre Finger und begann, den Brief an Wilhelm Schneider in Rabenstein zu tippen.
25. August, abends Graz, Veras Wohnung, Fröbelpark
»Komm schon, es ist nur ein Wochenende!« Jakob strich zärtlich über Veras gefurchte Stirn.
Sie saßen aneinandergekuschelt auf dem Sofa. Draußen verschwamm alles in einem tristen Grau, seit dem Mittag nieselte es und immer wieder hörte Vera Autos durch Pfützen fahren. Es herrschte bereits Herbstwetter, obwohl es erst Ende August war. Nasskalt und grau. Deshalb hatten es sich die beiden in Veras kleiner Wohnung gemütlich gemacht. Leise Klaviermusik kam aus dem Lautsprecher und eine Kerze spendete warmes Licht.
Nur das Gesprächsthema passte nicht zu der romantischen Stimmung. Jakob versuchte wie in den letzten Tagen schon öfter, Vera zu einem gemeinsamen Wochenendtrip mit seinem besten Freund Phil und dessen neuester Flamme zu bewegen.
»Weißt du, wie lang ein Wochenende sein kann? Ich mag Philipp nicht und seine blöde Freundin noch weniger. Wie heißt sie gleich noch mal? June? Wer heißt bei uns denn bitte June?!«
»Für den Namen kann sie doch nichts.«
»Aber fürs Blödsein kann sie was«, erwiderte Vera pampig.
»Was bist du heute kratzbürstig Ich denke, dafür muss ich dich bestrafen.« Jakob nahm seinen Arm von Veras Schulter und kitzelte sie.
Sie wollte nicht, musste aber lachen.
»Ha! Schon besser!«
»Glaub nur nicht, dass du mich so rumbekommst.«
»Nein? Aber so!« Jakob verstärkte seine Bemühungen und bald lagen sie beide außer Atem auf dem Boden. »Meine kleine Kratzbürste.« Verliebt sah Jakob seiner Freundin ins Gesicht, hörte auf, sie zu kitzeln und streichelte ihre Brüste. »Wenn du nur nicht so heiß wärst.«
»Was wäre dann?«
»Dann wäre ich nicht so süchtig nach dir.«
Vera seufzte zufrieden. »Gut, dass ich so heiß bin.«
»Ja … Gut …« Jakobs Hand fuhr unter ihre dünne Bluse. »Dann sage ich Phil für das Wochenende zu?«
»Nein!« Vera erstarrte und wollte Jakob von sich schieben, doch er verstand ihre Bemühungen falsch.
»Ich liebe es, wenn du Nein sagst!« Sein Mund senkte sich auf ihre Brust, die er inzwischen freigelegt hatte, und saugte sich daran fest.
»Nein … Ich … Jakob, hör zu! Ich will nicht mit Phil und dieser June ein ganzes Wochenende verbringen. Das …« Vera keuchte, als sich seine Finger unter den Bund ihrer Jeans schoben. »Ich … Jake …« Und dann sagte sie gar nichts mehr, denn all ihr Denken wich den Empfindungen, die seine Berührungen bei ihr auslösten.
Draußen war es bereits dunkel, als ihrer beider Verlangen gestillt war.
»Ich liebe dich, Vera«, flüsterte Jakob ihr ins Ohr.
»Und ich liebe dich.« Vera küsste ihn auf die Nasenspitze. »Und deswegen lasse ich dich, Phil und June dieses Wellnesswochenende machen. Aber ich komme nicht mit.«
»Nicht mal, wenn wir dort den ganzen Tag solchen Sex haben können?«
»Nicht mal dann«, sagte Vera. »Aber ich werde kein Drama machen, wenn du allein fährst.«
»Versprochen?«
»Versprochen.«
»Und was mache ich, wenn Phil und June Sex haben?«
»Keine Ahnung … du wirst kreativ?« Neckisch biss Vera ihm ins Ohrläppchen.
»Hm, vielleicht gibt es kreative Damen in diesem Wellnesshotel«, überlegte Jakob laut und zwinkerte frech.
»Du wagst es nicht!«
»Nein?«
»Nein.«
»Sonst?«
»Sonst komme ich und hole dich.« Mit einem Knurren stürzte sich Vera auf ihren Freund und alles begann von vorn.
Es war Mitternacht, als sie in die Küche gingen, um das versäumte Abendessen nachzuholen. Vera saß auf einem der beiden Barhocker, hatte das Kinn in die Hände gestützt und sah Jakob dabei zu, wie er mit geschickten Händen Tomaten für seinen Spezial-Sugo würfelte, während das Wasser für die Pasta bereits kochte.
»Ich habe heute übrigens wieder so ein Gedicht bekommen. Für die Literarischen Seiten, du weißt schon.«
»Wie? Du meinst, dieser verrückte Dichter hat dir wieder geschrieben?«
Natürlich hatte Vera ihm von den Gedichten erzählt. Einmal hatte sie sogar eines mit nach Hause genommen und ihm vorgelesen. Danach war sie enttäuscht gewesen, denn Jakob hatte der Text nichts gesagt. Er war kein besonders feinsinniger Mensch – außer es ging ums Kochen. Trotzdem brachte er immerhin genügend Interesse auf, dass er ihr zuhörte, wenn sie davon erzählte, und dafür liebte sie ihn.
»Ich weiß, dass dir nicht gefällt, was er schreibt, aber …«
»Das stimmt nicht. Mir gefallen nur grundsätzlich keine Gedichte, vor allem wenn sie so düster sind. Buchstaben im Allgemeinen sind nicht meine Welt, außer es handelt sich um deine vier.« Jakob wich glucksend Veras Schlag aus. »Vielleicht fragst du ihn mal, ob er ein Gedicht über deinen Hintern schreibt. Das gefällt mir dann hundertprozentig. Obwohl … ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich will, dass irgendwer Gedichte über deinen hübschen Hintern schreibt. Das wäre dann wohl noch schräger als diese Reime über den Tod.«
»Ach, da bin ich aber froh.«
»Ich könnte eventuell selbst was darüber dichten. Warte mal, das kriege ich aus dem Stegreif hin. Also … Meine Freundin hat einen sexy Arsch, ich esse gern Barsch. Das würde sie zwar verneinen, aber irgendwie muss es sich reimen. Ihr Hintern ist fest und rund und … und!« Er lachte und fing ihre Fäuste ab, als Vera sich auf ihn stürzte. »Wenn ich dir das Gedicht schicke, druckst du es dann auch in deinen Literarischen Seiten ab?«
»Spinner!« Vera ließ sich zurück auf den Barhocker fallen und das Lachen verschwand aus ihrem Gesicht. »Es war wieder düster. Und traurig. Und es hat mich berührt.« Sie überlegte, wie sie Jakob beschreiben sollte, was dieses Gedicht in ihr auslöste. »Es war … Also der Schreiber muss irgendwie Schuld auf sich geladen haben und ich glaube, niemand hört ihm zu, wenn er darüber sprechen möchte. Weißt du, was ich meine? Dem Opfer hört jeder zu, aber … vielleicht ist der Täter auch ein Opfer … irgendwie.« Sie verstummte.
»Das klingt nach dir. Aber weißt du, nicht jeder, der Schuld auf sich geladen hat, ist wie dein Vater.«
Jakob war einer der wenigen Menschen, mit denen Vera die Geschichte ihres Vaters geteilt hatte. Und sie hatte es seitdem keine Sekunde lang bereut. Jakob war einfühlsam und tröstete sie, wenn es notwendig war, akzeptierte ihre Trauerphasen, in denen nicht einmal er sie erreichen konnte, und er war einfach für sie da, wenn sie ihn brauchte.
Ihr Vater hatte vor ein paar Jahren ein Kind überfahren. Er trug keine Schuld, was die Polizei später bestätigte. Das Kind, ein fünfjähriger Junge, war zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße gerannt – direkt vor den Wagen ihres Vaters. Er hatte keine Chance gehabt. Der Junge war noch am Unfallort verstorben und die Schuld an seinem Tod hatte Veras Vater zerfressen wie ein Krebsgeschwür. Lange Zeit hatten weder Vera noch ihre Mutter gemerkt, was mit Gerd Profanter geschehen war. Er hatte sein Leben gelebt wie immer, war zur Arbeit gegangen, hatte seine Pflichten erfüllt, alles mit einem Lächeln. Doch etwas hatte gefehlt und dann war er immer öfter abgedriftet, weg von seiner Familie in eine Welt, die für niemanden zugänglich war, nicht einmal für seine Ehefrau.
Anfangs hatte Veras Mutter ihn noch unterstützt, hatte ihm Trost zugesprochen, war mit ihm zur Therapie gegangen. Dann hatte sich ein Tumor in ihrer Bauchspeicheldrüse eingenistet. Als man ihn erkannt hatte, war es schon zu spät gewesen. Nach nur drei Monaten war sie ihrer Krankheit erlegen und Veras Vater immer tiefer in Depressionen versunken.
»Es tut mir leid.« Jakob legte das Messer ab und umarmte Vera. »Entschuldige, Schatz.«
»Es gibt nichts zu entschuldigen.«
»Es macht dich traurig.«
»Damit muss ich leben.« Vera schmiegte sich in seine Arme. Sie war froh, dass sie Jakob hatte, der wusste, wann sie Trost brauchte, der sie verstand, auch ohne Worte.
Ihr Magen knurrte hörbar.
»Oh! Jetzt sehen wir lieber zu, dass da was reinkommt, sonst frisst du mich am Ende auf.«
»Das könnte ich.« Vera grinste ihren Freund frech an. »Ich hab dich nämlich zum Fressen gern.«
»Äh! Iss lieber meine Mitternachtsnudeln, die sind bekömmlicher. Und dann ab ins Bett.« Jakob löste sich aus der Umarmung und setzte ihr einen schnellen Kuss auf die Nasenspitze, bevor er wieder zu seinen Tomaten ging. »Erzähl mir mehr von deinem Dichteropfer.«
»Also erstens: Er ist kein Opfer. Oder doch … Na ja, vielleicht ist er ein Opfer, aber nicht so, wie du es darstellst. Er ist sensibel, würde ich sagen. Und traurig und … ach, er wohnt auf einem Einödhof und ist nur per Post zu erreichen. Stell dir mal vor: So was gibt es noch.« Vera kicherte. »Wahrscheinlich kann ich von Glück reden, wenn mein Brief bei ihm ankommt und ich nicht über Rauchzeichen mit ihm kommunizieren muss. Jedenfalls … ich darf höchstwahrscheinlich ein Porträt über ihn machen, und dazu müsste ich dann wohl zu ihm in die Einöde fahren. Es sei denn, der Mann besitzt doch ein Telefon. Aber selbst wenn, ich würde diesen Wilhelm Schneider gern vor Ort interviewen. Vielleicht fahre ich nach Rabenstein, während du mit Phil und June bei diesem Wellnesswochenende bist.«
Jakob sah hoch. Seine Miene wirkte mürrisch.
»Was ist?«
»Fahr mit mir zu diesem Wellnesswochenende, bitte!«
»Das hatten wir doch schon.«
»Nein. Ich meinte: allein. Lass uns zusammen in irgendein Wellnesshotel fahren. Ohne Phil und June. Nur wir beide.«
»Aber Phil …«
»Der hat seine blöde June. Ich will nicht von dir getrennt sein.«
Vera hob die Hand und wedelte energisch mit ihrem rechten Zeigefinger. »Nein, Jake! Ich möchte, dass du fährst. Ich werde nicht die Klette sein, die sich an dich hängt, wenn du mit deinen Freunden etwas unternehmen willst, oder noch schlimmer: die dir verbietet, etwas mit deinen Freunden zu unternehmen. Und du wirst das auch nicht, so hatten wir es vereinbart.«
Jakob ließ den Kopf sinken. »Hm, das stimmt.«
»Na also!« Und damit beließen sie es für diesen Abend, doch das Thema sollte schon bald erneut auftauchen wie ein lästiger Pickel.
1. September, abends, Carabinieri-Station Rabenstein
»Schon wieder dieser Regen!«, beschwerte sich Alfred Lantschner und schaute genervt aus dem Fenster. »Man sollte meinen, in diesem Tal hört der Regen nie auf.«
»Hm.« Seine Kollegin und Vorgesetzte Marescialla Gabriella Sanna, kurz Gabi, runzelte die Stirn und hackte auf ihrer Tastatur herum. Ob bewusst oder unbewusst, sie verstärkte damit das Prasseln, das die Regentropfen auf dem Blech vor dem Fenster der Wachstube verursachten. »Was ist los mit dir?«
»Nichts. Nur dass mir der Regen auf die Nerven geht und es wieder September ist.«
»Hm.«
»Aber vor allem der Regen.« Gedankenverloren trommelte Lantschner mit seinen Fingern auf der Schreibtischplatte. »Anderswo scheint wahrscheinlich die Sonne.«
»Wahrscheinlich«, murmelte seine Kollegin und klapperte weiter auf der Computertastatur – synchron zu den Regentropfen auf dem Fensterbrett.
»Meinst, es passiert wieder?«
Gabi wusste natürlich, wovon Alfred Lantschner sprach. Er tat es nicht zum ersten Mal.
»Ich hoffe nicht.«
»Und wenn doch?«
»Mal doch den Teufel nicht an die Wand!«
»Ich mal gar nix. Aber du wirst zugeben müssen, dass der Gedanke nicht ganz aus der Luft gegriffen ist.«
»Nein.«
»Und was, wenn’s wieder passiert?«
Gabi seufzte. »Dann haben wir halt wieder die Bagage am Hals.«
Von Alfred kam ein unbestimmtes Geräusch des Widerwillens. Dreimal war die Scientifica bereits samt Staatsanwalt und einem Massenaufgebot an fremden Beamten in Rabenstein angerückt. Dreimal in den vergangenen drei Jahren. Immer am selben Tag. In der kleinen Wachstube waren sie sich gegenseitig auf die Zehen getreten und Alfred hatte die Blicke der Wichtigtuer aushalten müssen, mit denen sie ihn von oben herab taxiert hatten.
»Hat auch nichts gebracht.«
»Nein.« Wieder seufzte Gabi. Dann nahm sie ihr Klappern wieder auf. »Vielleicht passiert auch gar nichts.«
»Vielleicht.« Aber irgendwo in seinem Inneren hatte Lantschner diese Ahnung, dieses dunkle, unheimliche Gefühl, das wie eine Wolke über ihm schwebte. Über ihnen allen! Der kleinen Carabinieri-Station und über dem Dorf, das weitab vom hektischen Leben in den Haupttälern lag und normalerweise eine Oase der Ruhe war. Ein Idyll aus Häuschen im Tiroler Stil mit Holzbalkonen und Geranien, die in leuchtendem Rot von den Fenstern lachten. Alfred hatte sich spontan verliebt, als er hierher versetzt worden war. Er liebte das Dorf mit seinen paar Häusern, die in schmucken Reihen links und rechts an der Landesstraße Spalier standen. Er liebte es, wie sein Nachbar morgens pünktlich um sieben Uhr seine Kühe aus dem Stall trieb, die bimmelnd und muhend zur eingezäunten Weide am Ende des Dorfes trotteten, ohne dass ein Autofahrer dadurch in Stress geriet. Im Gegenteil – so manch einer stieg aus seinem Wagen und half, die Rindviecher auf ihre Weide zu treiben. Alfred liebte den Blick auf die Berge, die sich wie mächtige Riesen zu beiden Seiten des Dorfes erhoben. Was er aber am meisten liebte, war die Tatsache, dass jeder Stein, jeder Baum, alles hier ihn an seine Frau erinnerte. Seine Frau, die nicht mehr da war seit jenem September vor einem Jahr. Und jetzt näherte sich dieser Tag, an dem das Schicksal erneut seine grausame Erfüllung finden würde.
Doch keiner dieser Gedanken drang über Alfred Lantschners Lippen. Stattdessen sagte er: »Ich hasse den Regen. Er macht mich verrückt, Gabi. Total verrückt!«
»Ich weiß.« Seine Vorgesetzte schaltete den Computer aus und trat zu ihm ans Fenster. »Wenigstens haben wir gleich Feierabend.«
»Davon hört der Regen auch nicht auf.«
Gabi seufzte zum dritten Mal. »Weißt du, wie du dich anhörst? Wie meine …«
»… Schwiegermutter? Die Zirmer-Kattl und ich haben nichts gemein.«
»Mehr als du denkst. Das ständige Jammern über Sachen, die man nicht ändern kann. Das Wetter, ihr Rheuma, dem Ajax sein Bellen, wenn die Glocken läuten und das Schlimmste …«
»… eine Schwiegertochter, die mit ’ner Knarre durch die Gegend läuft«, vollendete Alfred die Aufzählung der Umstände, die der Dorfratsche Katharina Unterberger das Leben schwer machten.
»Genau.« Gabi lachte. »Und dass ihr Goldsohn eine Marescialla geheiratet hat.« Auch daraus machte Katharina Unterberger keinen Hehl. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit zog sie über ihre Schwiegertochter her, doch die ließ sich davon nicht unterkriegen. »Es regnet. Na und? Nach jedem Regen scheint auch wieder die Sonne. Also hör auf, Trübsal zu blasen!« Gabi stimmte irgendein Volkslied an, von denen sie einen schier unerschöpflichen Vorrat auf Lager hatte.
Alfred hielt sich die Ohren zu. »Schon gut! Schon gut! Ich höre ja auf.« Er sah auf die Uhr. Es war zehn vor sechs. Zehn Minuten bis Feierabend. Er wollte sich gerade seinem Schreibtisch zuwenden, um den Computer herunterzufahren, da erblickte er eine Gestalt, die durch den Regen die Straße entlang auf das Dorf zukam. »Da kommt er.«
Gabi sagte kein Wort. Zusammen mit Alfred beobachtete sie den Mann, der mit gesenktem Kopf durch den Regen stapfte, die Schultern hochgezogen und die Hände tief in den Hosentaschen vergraben. Langsam, schwerfällig, als läge die Last der Welt auf seinen Schultern. Und dann, als er auf der Höhe der Carabinieri-Station war, wandte er den Kopf zum Fenster und blickte Alfred an. Mit seinen eisgrauen Augen schaute er Alfred Lantschner direkt ins Gesicht, der erschrocken zurückwich und weiter über den Regen schimpfte.
1. September, zwanzig Minuten zuvor, Rabenstein, Hauptstraße 5
Max lehnte an seiner Wursttheke und starrte hinaus auf die Straße. Kein Mensch wagte sich bei diesem Sauwetter vor die Tür. Er überlegte, den Laden zu schließen. Ohne Kunden kein Umsatz – so einfach war die Rechnung.
Dieser verdammte Regen, der gefühlt seit Jahren andauerte, machte ihm das Geschäft kaputt. Max wusste, dass das nicht stimmte. Der Sommer war gerade vorbei, mit den höchsten Temperaturen seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Demzufolge musste erst kürzlich die Sonne geschienen haben, doch für ihn regnete es seit einer Ewigkeit. Besser gesagt seit zwei Jahren, elf Monaten und zwei Tagen. Damals hatte er weggewollt aus diesem Kaff und studieren. Die Aufnahmeprüfung für seine Ausbildung zum Physiotherapeuten hatte er bestanden, die Anzahlung für seine zukünftige Studentenbude getätigt und dann – drei Tage, bevor er hatte aufbrechen wollen –, war die Mutter gefunden worden. Tot.
Es war klar gewesen, dass er zu Hause blieb, dem Studium adieu sagte, den Dorfladen übernahm und die Obhut für seine zwei jüngeren Brüder gleich mit, die damals im schlimmsten Alter waren und aus welchem Grund auch immer ihm die Schuld am Tod der Mutter gaben. Keiner hatte jemals wieder ein Wort über das Studium verloren. Niemand hatte sich um ihn gekümmert, ihm geholfen, seine Träume zu verwirklichen. Seine Träume, die eine Wohnung mit Eva beinhaltet hatten, die trotzdem studieren gegangen war und heute – wie man so hörte – zusammen mit ihrem neuen Freund seinen Traum von einer Gemeinschaftspraxis verwirklichte.
Resigniert schaute Max aus dem Fenster des Dorfladens. Im Regen lief ein Mann. Mit schweren Schritten stapfte er die Straße entlang ohne Schirm, den Kragen seines Mantels hochgeklappt.
Max erkannte den Mann und überlegte erneut, den Laden dichtzumachen, diesmal aus einem anderen Grund.
Daher blieb Max an der Wursttheke stehen und erwartete mit verschränkten Armen und finsterem Blick seinen Kunden.
»Max?«
»Schneider?«
»Hab schon gedacht, du hast vielleicht zu.«
»Ich hab bis 19 Uhr offen. Täglich außer Sonntag.«
»Bist ein fleißiger junger Mann.«
Max presste die Lippen aufeinander. Durch Schneiders Lob fühlte er sich besudelt. »Was wünschen Sie?«, fragte er betont höflich.
»Ich such mein Zeug selber zusammen. Ein Stück Speck kannst mir abschneiden und von dem Kräuterkäse nehm ich einen Laib.«
»Hab ich nicht mehr.«
»Was hast denn?«
»Einen halben.«
»Dann nehm ich den halben.«
Während der Diskussion streifte Schneider durch die Gänge des Dorfladens und klaubte Dosen, Nudeln, Reis und Gemüse in den Einkaufskorb. Max säbelte ein daumendickes Stück von der Speckseite und wickelte es in Papier. Dann stellte er sich hinter die Kasse. »Haben Sie's?«
»Immer so ungeduldig.«
Wenn du den Mörder deiner Mutter bedienen müsstest, wärst du auch nicht scheißfreundlich, dachte Max und tippte schweigend die Preise in die Kasse.
»Scheißwetter!«, sagte Schneider.
Max nickte nur.
»Kommt sonst wer einkaufen?«
»Macht zweiundvierzig neunzig.«
Schneider schob einen Fünfziger über den Tresen. »Behalt den Rest.«
Doch Max zählte das Wechselgeld penibel ab und knallte es Schneider hin. »Ich brauche keine Almosen!«
1. September, abends, Rabenstein, auf der Straße zum Einödhof
Mit hochgeklapptem Kragen stapfte er durch den verdammten Regen. Der alte Jägerrucksack aus Lodenstoff drückte auf seine Schultern. Er war voller Lebensmittel wie auch die beiden schweren Taschen, die er auf beide Hände verteilt hatte. Der Vorrat sollte für die nächsten zwei Wochen reichen. Zwei Wochen, in denen er nicht mehr ins Tal musste und sich verkriechen konnte auf dem Hof seiner Schwester, der jetzt ihm gehörte.
Die Berggipfel waren von Wolken verhangen, das Tal lag in einem trüben Grau, das nichts mit der Postkartenidylle zu tun hatte, die Touristen anlocken sollte. Kein strahlend blauer Himmel über dem Wald, dahinter schneebedeckte Gipfel. Grün, Blau, Weiß – ein Ideal, das nicht der Wahrheit entsprach. Natürlich gab es Sonnentage, nur nicht für ihn. Ihm war, als hinge ständig eine schwarze Wolke über ihm. Über ihm und allen, die er liebte.
Sein Atem ging schnell. Die Last war zu groß. Das monotone Keuchen mischte sich in das Flüstern des Regens. Sonst war nichts zu hören. Kein Vogel gab einen Laut von sich. Der Lärm der über die Landstraße rauschenden Autos im Tal wurde vom Nebel geschluckt, der wie ein mächtiges Ungetüm über Wiesen und Felder kroch, die Latschenkiefern schluckte, den Forstweg. Und er selbst musste mitten hinein in diesen Nebel. Den Berg hinauf bis dahin, wo der Einödhof lag, weit weg von jeder anderen menschlichen Behausung.
Für einen Wanderer, der sich in der Gegend nicht auskannte, wäre es nicht ratsam gewesen, bei diesem Wetter in die Berge aufzubrechen. Doch er war kein Wanderer und nicht unkundig. Er kannte die Wegmarken, wusste, wo die Straße unvermutete Kurven machte, wo der Hang abschüssig war.
Gerade eben kam er an einer solchen Stelle vorbei und ein Schauder lief über seinen Rücken, der nichts mit dem nasskalten Wetter zu tun hatte. Er vermied es, nach unten zu schauen über die Felsen, die der Nebel noch nicht geschluckt hatte, hinab zu dem kleinen Vorsprung weit unten, wo vor drei Jahren seine Schwester tot aufgefunden worden war. Ein Unfall, so hieß es. Zumindest hatten das die Nachforschungen der Polizei ergeben. Er wusste es besser, denn er hatte Gerlinde gefunden. Er hatte nach ihr gesucht, als sie nicht zur versprochenen Zeit nach Hause gekommen war. Mehrere Stunden lang hatte er nach ihr gerufen, war auf diesem Forstweg Richtung Tal gerannt, an ihr vorbei.
Da hatte sie vielleicht noch gelebt …
Erst auf dem Weg zurück zum Hof hatte er immer wieder in den Abgrund geblickt. Sicherheitshalber. Obwohl er nicht wirklich daran geglaubt hatte, dass Gerlinde irgendwo dort hinabgestürzt war. Dafür kannte sie den Weg zu gut.
Aber dann hatte er sie gesehen. Ihre leuchtend rote Jacke war ihm ins Auge gesprungen. Dann, mit ein paar Sekunden Verzögerung, hatte er ihre seltsam verdrehten Gliedmaßen registriert. Kopflos war er den Abhang hinuntergeklettert, dabei selbst beinahe seiner Schwester hinterhergestürzt, nur um festzustellen, dass sie nicht mehr atmete. Trotzdem hatte er versucht, sie wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Ihr Körper war gebrochen, ihr Blick ebenfalls.
Mit grimmiger Miene stapfte er weiter, packte die schweren Taschen fester und passierte den großen Felsen am Forstweg. Von dort nahm er die Abkürzung durch den Wald, obwohl die Strecke steil war und er auf den nassen Wurzeln ausrutschen konnte. Während er keuchend aufstieg, ließ er den Besuch im Dorf in seiner Erinnerung ablaufen wie einen Film.
Die Straße war menschenleer gewesen, wie er es vorhergesehen hatte. Er bevorzugte es, bei strömendem Regen ins Dorf zu gehen. Noch mehr hätte er es bevorzugt, überhaupt nicht ins Dorf zu müssen, denn er hasste die Blicke der Bewohner, ihre Gedanken, die allzu deutlich in ihre Gesichter geschrieben standen. Doch manchmal ließ es sich eben nicht vermeiden, und dann ging er bei Regen, wenn die Straßen leer und die gierigen Blicke hinter den Spitzengardinen verborgen waren.
Bei Regen glich Rabenstein einem Geisterdorf. Kein Mensch war auf der Straße gewesen und doch hatte er ihre Blicke gespürt. Den Hass, die Vorwürfe … an der Carabinieri-Station überdeutlich … in den dunklen Augen des Dorfpolizisten, in der ablehnenden Haltung des Ladenbesitzers. In ihren Augen wäre immer er der Schuldige – egal, was die Nachforschungen ergaben, wie stichhaltig seine Alibis auch waren.
Er wusste, warum der junge Max ihn hasste, wieso Alfred Lantschner ihn mit Argusaugen beobachtete, er und alle anderen in Rabenstein. Denn er, Wilhelm Schneider, hatte große Schuld auf sich geladen. Auch wenn er nicht getan hatte, was ihm vorgeworfen wurde, trug er die Schuld. Er allein.
5. September, vormittags, Redaktion »Wochenblatt«
»Post für dich!«, sang Anna schadenfroh und stellte einen Karton voller Briefumschläge vor Vera ab. »So viele Literaten gibt es in unserem Land.«
»Und alle glauben, wir haben nur auf sie gewartet.« Vera seufzte. Dass dieses Projekt solche Ausmaße annehmen würde, hatte sie nicht geahnt. Und vor allem nicht damit gerechnet, wie aggressiv die Menschen reagierten, wenn ihre literarischen Ergüsse abgelehnt wurden. Man hatte ihr Vetternwirtschaft unterstellt, mangelnden Sachverstand oder dass sie die Texte nach dem Geschmack der Massen auswählte. Ihr gut gemeintes Projekt entwickelte sich zu Veras persönlichem Albtraum. Außerdem regnete es schon wieder. Oder immer noch. Je nachdem, wie man es sehen wollte. Während in anderen Jahren der September oft ein wochenlanges Hoch mit Sonnenschein und warmer Luft bescherte, konnte man ihn in diesem nicht anders als ungemütlich beschreiben. Das Wetter drückte Vera aufs Gemüt. Und nicht nur ihr.
»Aber über einen Brief wirst du dich freuen.«
»Werde ich das?« Vera sah ihre Freundin skeptisch an.
»Wirst du.«
Veras Laune besserte sich abrupt. Sie verstand, was Anna meinte. »Er hat geantwortet?«
»Hat er.« Anna fischte einen Briefumschlag, der ganz zuoberst lag, aus dem Karton und wedelte damit herum.
»Gib her!« Vera griff ungeduldig nach dem Kuvert, öffnete es und ließ ihre Augen über das Blatt wandern. Der Brief war handgeschrieben, in engen, schnörkellosen Lettern, die sich nach rechts neigten. Er enthielt nur ein paar Zeilen, die Vera im Handumdrehen begeisterten.
Werte Frau Profanter, ich fühle mich von Ihrem Vorschlag geehrt. Um das Interview zu machen, müssten Sie aber schon zu mir nach Rabenstein kommen. Ich verlasse den Einödhof nie und leider habe ich auch schlechte Nachrichten, was die Telefonverbindung angeht. Ich bin nicht im Besitz eines solchen Geräts. Auch über einen Internetanschluss verfüge ich nicht.
»Der letzte Steinzeitmensch auf Erden«, stellte Anna fest, die den Brief ebenfalls gelesen hatte.
Vera musste ihr beipflichten. Gab es tatsächlich noch Menschen, die nur per Post erreichbar waren? Oder nahm sie der Herr womöglich auf den Arm?
»Wenn sein Gedicht nur nicht so gut wäre.« Vera schnitt eine verzweifelte Grimasse. Sie hätte Wilhelm Schneider auch einfach absagen und sich den Aufwand sparen können.