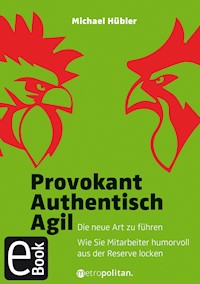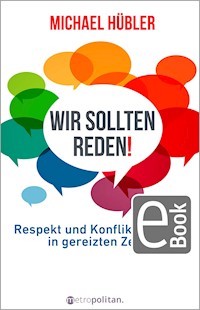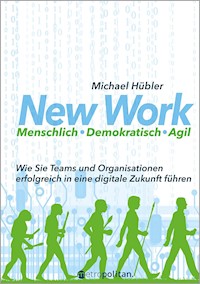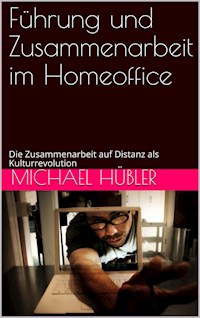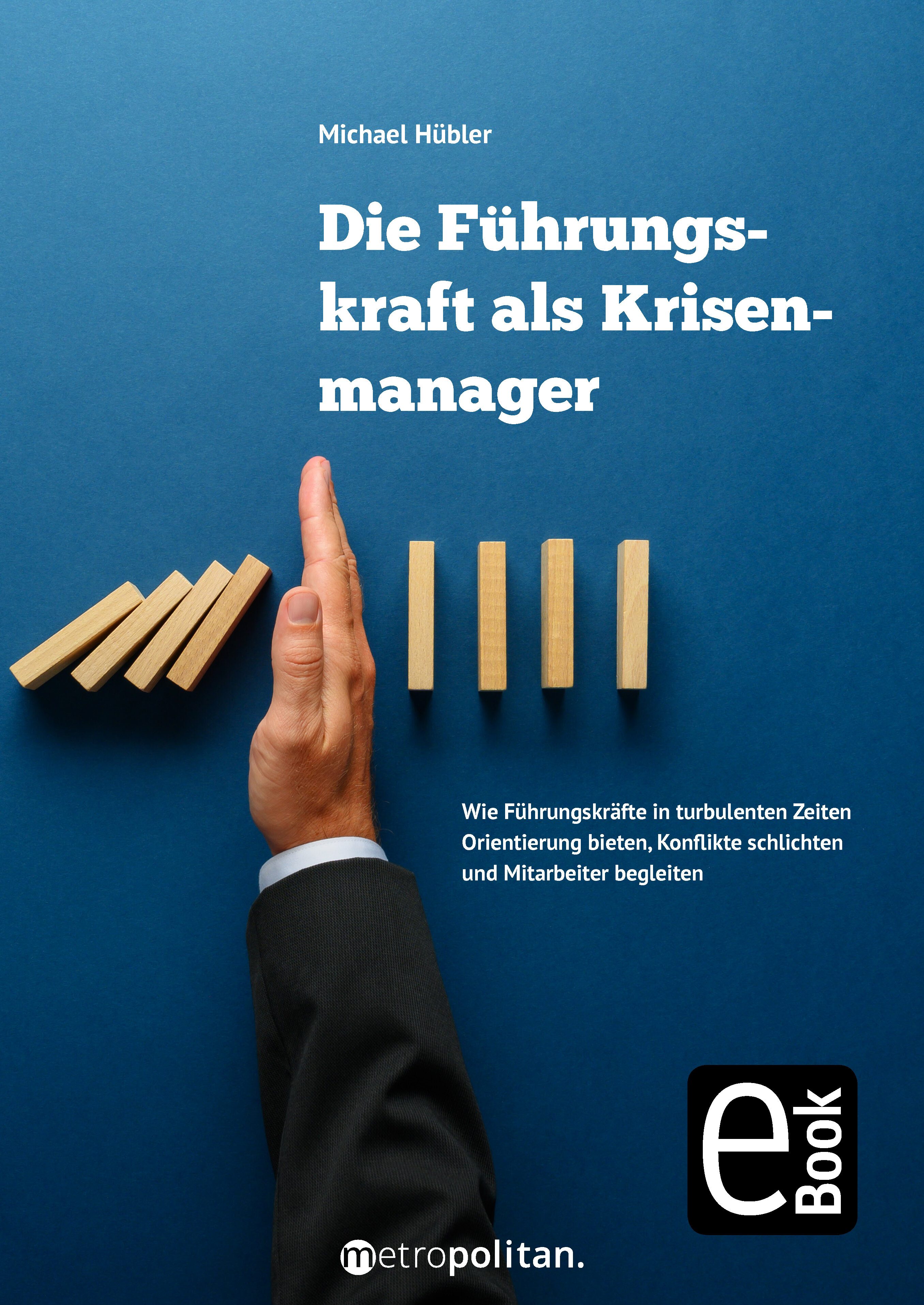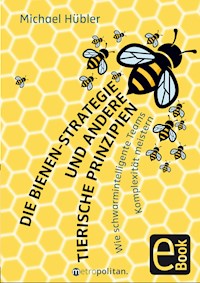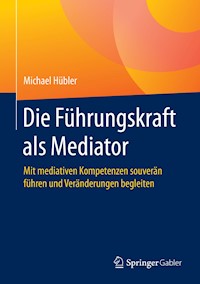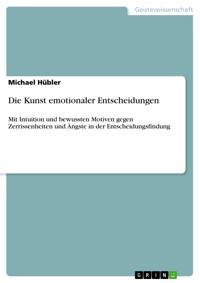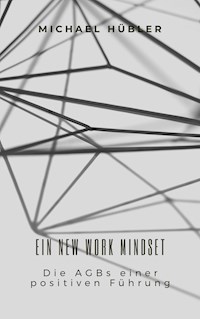
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine positive Führung ermutigt Mitarbeiter:innen, eigene Wege zu gehen, beispielsweise im Homeoffice. Eine positive Führung zielt jedoch auch darauf ab, in der Zusammenarbeit nicht nur Stress zu vermeiden oder Konflikte zu bereinigen, sondern bereits prophylaktisch eine positive Atmosphäre zu kreieren, die die Mitarbeiter:innen beispielsweise im Großraumbüro zu kreativen Höchstleistungen anspornt – nicht obwohl, sondern weil sie Spaß in der Arbeit haben. Eine positive Führung bietet damit die ideale Basis-Geisteshaltung für New Work-Konzepte. Die New Work AGBs setzen sich damit aus den drei zentralen Bausteinen einer positiven Führung zusammen: Der Schaffung einer positiven Atmosphäre, der Förderung von Gestaltungslust bei den Mitarbeiter:innen sowie der Unterstützung von Bindungen und Beziehungen im Team.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ein Vorwort: New Work ist großartig, aber ...
1 Hintergründe und Ursprünge einer positiven Führung
2 Positive Führung als Gebot der Stunde
3 Die AGBs eines positiven New Work-Mindsets
Literatur
Ein New Work Mindset
Die AGBs einer positiven Führung
Inhaltsverzeichnis
Ein Vorwort: New Work ist großartig, aber ...
Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche. Das agile Denken schaffte es in den letzten Jahren aus den Bereichen des Projektmanagement und der IT bis tief hinein in deutsche Verwaltungs- und Amtsstuben. Die Orientierung am Kunden ist allgegenwärtig. Und heutzutage ist damit jede:r gemeint: Bürger:innen ebenso wie Patient:innen.
Im Schlepptau agiler Denkweisen oder parallel dazu kam es in den letzten Jahren zu zwei großen strukturellen New Work-Bewegungen: Das Homeoffice sollte eigentlich bereits vor Corona seinen Siegeszug antreten. Im Kern des Homeoffice steht der Autonomie-Gedanke und damit auch ein Stück weit Selbstverwirklichung der Mitarbeiter:innen. Auf der anderen Seite stehen Großraumkonzepte, die den zweiten Kern einer neu verstandenen, glücklich machenden Arbeit ins Visier nehmen: Die Begegnung und Kreativität Arbeitsplatz. Beide New Work-Konzepte sprechen unterschiedlich motivierte Mitarbeiter:innen an. Die einen wollen lieber selbstverantwortlich agieren, um sich lebendiger und zufriedener zu fühlen. Das Homeoffice kommt zudem ihrer persönlichen Lebensbalance entgegen. Die anderen arbeiten, um sich mit anderen zu treffen und sich auszutauschen. Sie erleben in der sozialen Begegnung eine Erfüllung ihres Daseins.
Über Agilität und New Work wurde in den letzten Jahren schon viel geschrieben. Ich stieß jedoch in Beratungen, Coachings und Seminaren immer wieder auf ein Thema, das mich seit Jahren nicht in Ruhe lässt. Während sich die Ursprungsfirmen für New Work-Konzepte leicht tun, diese umzusetzen, die ihre Mitarbeiter:innen scheinbar von selbst mitziehen, sind vorhandene Konzepte nicht ohne Weiteres auf andere Bereiche übertragbar. Was im Silicon Valley funktioniert, erntet in einer deutschen Großversicherung skeptische bis verachtende Blicke. Es wird vermutet, dass wieder einmal eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Und viele Konzepte werden leider nicht bis an ihr logisches Ende durchdacht. So scheitern manche gut gemeinten Großraumprojekte bereits daran, dass sich die Mitarbeiter:innen von nun an beobachtet fühlen. Nur weil es zwischen den Menschen keine trennenden Wände mehr gibt, heißt dies noch lange nicht, dass sie sich nun offener austauschen. Im Gegenteil: Trennende Wände schaffen häufig die Sicherheit, die es braucht, um sich vertrauensvoll zu unterhalten. Und mit der Autonomie im Homeoffice ist es auch nicht weit her, wenn die Führungskraft kontrolliert, wann ich mich ein- und auslogge.
Ist das nun ein Argument gegen Homeoffice und Großraumbüros? Natürlich nicht! Wir sollten jedoch immer auf den Kontext achten. Auf der Basis einer ermutigenden und vertrauensvollen Kultur erfüllen beide Konzepte ihr volles Potential. Auf der Basis von Skepsis und Egoismus sind sie das schlimmste, was Mitarbeiter:innen in der Arbeit erleben können.
Es liegt wie so oft nicht an der Struktur, die durchaus helfen kann, sondern an den Haltungen, Überzeugungen oder neudeutsch dem Mindset des Managements, der Führung und dem gesamten Unternehmen: Kann ich meinen Leuten vertrauen oder wollen die einfach nur ihre Zeit absitzen?
Während es bei hochmotivierten Mitarbeiter:innen offensichtlich ausreicht, ihnen mit Hilfe von Frameworks einen guten Rahmen zu bieten, braucht es in eher traditionellen Unternehmen ein Umdenken in der Führung, um einen neuen Geist der Zusammenarbeit und Verantwortung zu etablieren. Frameworks wie Scrum oder die Objectives & Key Results (kurz OKR) bieten einerseits einen Rahmen, in dem freie Entscheidungen möglich und gefordert sind, sind jedoch andererseits nicht so frei, dass die Freiheit zum Chaos führt. In Scrum beispielsweise finden tägliche 15-minütige Kurzmeetings als Statusabfrage des aktuellen Arbeitsstands der Mitarbeiter:innen statt. In der Managementmethode OKR finden ebenso regelmäßige Treffen zum Abgleich des Entwicklungsstands einer Aufgabe statt. Die Ziele werden von jedem Mitarbeiter selbst gesetzt, sind jedoch transparent und damit zur Diskussion frei gegeben. Damit ist die Freiheit in der täglichen Arbeit gewährleistet, bei gleichzeitigem regelmäßigen Abgleich und dem entsprechenden sozialen Druck durch die Kolleg:innen.1
Mit so viel Freiheit sind, zumindest vorübergehend, Menschen überfordert, die dies bisher nicht erlebt haben. Der spontane Impuls, gegen Agilitäts- und New Work-Konzepte zu opponieren, kommt also vielleicht nicht aus dem Gedanken heraus, dass neue Konzepte auch nur alter Wein in neuen Schläuchen sind – was zugegeben durchaus der Fall sein kann. Sondern vielmehr aus dem unbewussten Empfinden der Überforderung.
An dieser Stelle treten die Erkenntnisse der positiven Psychologie in ihrer Übertragung auf Führung auf den Plan. Eine positive Führung zielt auf die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter:innen ab, damit diese langfristig bessere Leistungen erbringen, produktiver sind und das Unternehmen erfolgreicher ist. Im Rahmen einer positiven Führung werden positive Emotionen angestrebt und Rahmenbedingungen gestaltet, um diese zu verstärken. Eine positiv eingestellte Führungskraft ist sowohl an der Weiterentwicklung der Mitarbeiter:innen als auch am Arbeitsergebnis interessiert. Positive Führungskräfte gestalten folglich Atmosphären, in denen sich sowohl die Mitarbeiter:innen individuell als auch erfolgreich zusammenarbeitende Teams entwickeln. Eine Fähigkeit, die in normalen Zeiten zu produktiven Höchstleistungen führt und in Krisenzeiten wichtig ist, um den Ängsten von Mitarbeiter:innen entgegen zu wirken.
Konkret werden mit einer positiven Führung Mitarbeiter:innen ermutigt, eigene Wege zu gehen, beispielsweise im Homeoffice. Eine positive Führung zielt jedoch auch darauf ab, in der Zusammenarbeit nicht nur Stress zu vermeiden oder Konflikte zu bereinigen, sondern bereits prophylaktisch eine positive Atmosphäre zu kreieren, die die Mitarbeiter:innen beispielsweise im Großraumbüro zu kreativen Höchstleistungen anspornt – nicht obwohl, sondern weil sie Spaß in der Arbeit haben. Wir können daher eine positive Führung als Basis-Geisteshaltung für New Work-Konzepte betrachten.
Die Ansätze einer positiven Führung lassen sich dabei organisatorisch auf verschiedenen Ebenen betrachten. Auf der individuellen Ebene beschäftigt sich eine positive Führung mit der Frage, wie es machbar ist, dass sich Mitarbeiter:innen mit Freude engagieren und ihrer Arbeit einen gestalterischen Stempel aufdrücken. Auf der Team-Ebene beschäftigt sich eine positive Führung mit der Frage wie eine gegenseitige Unterstützung am besten möglich ist. Auf der Organisationsebene schließlich stellt sich die Frage, wie ein solches Mindset der autonomen Verantwortung und des wertschätzenden Miteinanders in die Kultur der Organisation übergeht. Diese drei Ansätze finden Sie im Filetstück dieses eBooks als AGBs eines New Work-Mindsets auf der Basis der Erkenntnisse einer positiven Führung wieder:
Das A steht für die positive Atmosphäre sowohl in einem Team als auch im gesamten Unternehmen. Es geht dabei nicht um Helau und Alaf, sondern darum, dass auf der Basis einer freundlich-wertschätzenden Stimmung mehr Wachstum stattfindet und auch kritische Themen leichter angesprochen werden. Dass dem tatsächlich so ist, zeigen mittlerweile eine Vielzahl an Studien. Wenn Sie so wollen, bietet eine neue Arbeit auf der Basis der positiven Psychologie einen knallhart bezifferbaren Return of Investment.Das G steht für die Gestaltungslust und die Frage nach den Faktoren, die es Mitarbeiter:innen erleichtern, motiviert und engagiert über sich hinauszuwachsen.Und das B steht für sowohl tragende als auch kreative Bindungen und Beziehungen im TeamDiese drei Eckpfeiler der AGBs, leicht zu merken als ‚Allgemeine Geschäftsbedingungen‘ der Führung und des Managements, helfen Ihnen, ein New Work-Gebäude zu errichten, dass tatsächlich Bestand hat.
Vgl. Hübler (2020), S. 57ff↩
1 Hintergründe und Ursprünge einer positiven Führung
Beginnen wir, bevor wir zur Theorie kommen, mit einigen Beispielen einer positiven Führung im Alltag:
Ein positive Führungskraft geht mit einem seltenen Fehler seines produktivsten Mitarbeiters verständnisvoll um. Sie geht davon aus, dass Fehler nicht absichtlich passieren, sondern aufgrund von Ablenkungen, Stress oder Zeitdruck. Vermutlich gibt es eine Ursache, der man gemeinsam auf den Grund gehen kann, ohne dass der Mitarbeiter in eine Verteidigungshaltung kommen muss.Ein positive Führungskraft räumt seinen Mitarbeiter:innen möglichst viel Entscheidungsfreiheit ein. Weg vom Delegationsstil, hin zu „Ich stelle Leitlinien zur Verfügung und biete Rahmenbedingungen, die meinen Mitarbeiter:innen helfen, ihr Bestes zu geben".Ein positive Führungskraft ermutigt ihre Teammitglieder, sich eigenständig um fachliche Weiterbildungen und persönliche Entwicklungen zu kümmern.Ein positive Führungskraft unterstützt ihre Mitarbeiter:innen wann immer es ihr zeitlich und inhaltlich möglich ist. Sie räumt Hindernisse im Stile eines Supportive Leaders aus dem Weg und schützt ein Projektteam wie ein Scrum-Master vor den Übergriffen von Kunden oder dem Management."Wer sich mit den Kompetenzdefiziten seiner Leute abplagt anstatt sich auf Stärken zu konzentrieren, ist für eine Führungsaufgabe ungeeignet". Dieser Satz stammt sinngemäß von Peter Drucker, einem der bekanntesten US-amerikanischen Ökonomen. Drucker gilt als Pionier der modernen Managementlehre. Der Ansatz einer positiven Führung entwickelte sich allerdings erst viel später aus den Grundannahmen der positiven Psychologie, die sich bereits in der betriebswirtschaftlichen Praxis bewährt hatten.
Das Fundament der positiven Führung ist dabei das psychische Kapital der Mitarbeiter:1
Der Kerngedanke des psychologischen Kapitals liegt im Aufbau von Haltungen und tragenden Beziehungen durch Praktiken wie Dankbarkeit, Fürsorge, Anteilnahme, gegenseitige Unterstützung, Inspiration, Sinngebung, Respekt oder Nachsicht bei Fehlern, die entweder einen mildernden Effekt im Umgang mit Krisen haben, der sich in Resilienz, Geduld, Achtsamkeit und Zuversicht niederschlägt, oder in normalen Zeiten einen stärkenden Effekt haben, um mutig, optimistisch und kreativ in die Zukunft zu blicken sowie die Selbstwirksamkeitserwartung einzelner Personen oder eines Teams zu erhöhen.2
Der Mensch braucht den Blick in die Zukunft. Er strebt gerne Ziele an, weil ihn die Abwesenheit von Zielen depressiv macht. Die Selbstwirksamkeitserwartung hilft ihm, an sich selbst und die Zielerreichung aus eigener Kraft zu glauben. Optimismus äußert sich durch eine positive Erwartung an die Zukunft, nicht nur die eigene, sowie die Selbstattribuierung von Erfolgen. Widerstandsfähigkeit und Resilienz bezeichnen die Fähigkeit trotz widriger Umstände hoffnungsvoll zu bleiben. Kurzum: Wer sich Ziele setzt, daran glaubt, das er diese aus eigener Kraft erreichen kann, daran glaubt, dass dies die Welt ein wenig besser macht und Hindernisse produktiv nutzen kann, lässt sich als glücklicher und zufriedener Mensch bezeichnen. Dies zu ermöglichen ist das Wesen einer positiven Führung. Nicht aus Sozialromantik und Selbstzweck. Sondern weil sie erkannt hat, dass zufriedene Menschen sich kompetenter fühlen und gerne arbeiten. Eine klassische Win-Win-Situation.
Als Gründungsvater der neueren positiven Psychologie gilt Martin Seligman, einer der weltweit renommiertesten Universitätsprofessoren. Nachdem Abraham Maslow – der Urheber der Maslowschen Bedürfnispyramide – bereits in den 50er Jahren von einer positiven Psychologie sprach, griff Seligman den Begriff in den 90-Jahren wieder auf. Seligman wurde im Jahr 1998 zum Präsidenten der American Psychological Association gewählt. In seiner Antrittsrede kritisierte er, dass die akademische Psychologie sich beinahe ausschließlich mit dem Leiden von Menschen beschäftigt.3
Dazu passt die Geschichte vom schwarzen Punkt: Eines Tages verteilte ein Professor ein Aufgabenblatt in seiner Klasse. Auf dem Test standen jedoch keine Fragen. Zu sehen war lediglich einer schwarzer Punkt in der Mitte der Seite. Der Professor erläuterte: Ich bitte Sie, aufzuschreiben, was Sie dort sehen. Die Schüler waren verwirrt, legten jedoch mit ihrer Arbeit los. Am Ende der Stunde sammelte er die Antworten ein und begann sie laut vorzulesen. Alle Schüler hatten ausnahmslos den schwarzen Punkt beschrieben – seine Position in der Mitte des Blattes, seine Lage im Raum, sein Größenverhältnis zum Papier, etc. Der Professor lächelte und meinte: "Ich wollte Ihnen eine Aufgabe zum Nachdenken geben. Niemand hat etwas über den weißen Teil des Papiers geschrieben. Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt. Das gleiche geschieht in unserem Leben. Wir haben ein weißes Papier erhalten, um es zu nutzen und zu genießen. Wir aber konzentrieren uns lieber auf die dunklen Flecken. Darauf, was nicht ins Bild passt. Das, was abweicht von der Norm. Die gesundheitlichen Probleme, der Mangel an Geld, die komplizierte Beziehung zu einem Freund, eine enttäuschte Liebe, usw. Die dunklen Flecken sind sehr klein im Vergleich zu allem, was wir in unserem Leben haben. Sie sind jedoch diejenigen, die uns über Gebühr beschäftigen und damit wertvolle Energie kosten. Wir sollten die schwarzen Punkte wahrnehmen,unsere Aufmerksamkeit jedoch stärker auf das gesamte weiße Papier und damit auf die Möglichkeiten und glücklichen Momente in unserem Leben richten".
Ganz im Sinne dieser Geschichte rief Seligman dazu auf, das Gelingende, die Stärken, die Lebenszufriedenheit, überdurchschnittliche Leistungen oder die Resilienz eines Menschen wissenschaftlich fundiert zu erforschen. Damit war die Positive Psychologie geboren. Ausgehend von Seligmans Initiative hat sich dieser Ansatz heute auf viele angrenzende Bereiche wie Pädagogik, Medizin oder Wirtschaft ausgebreitet. Der Fokus ist dabei stets derselbe: Das Gelingen erforschen ist gewinnbringender als sich mit den Schwächen abzumühen.
In den USA tut man sich mit einem derart positiven Ansatz relativ leicht. Man mag über den Ausspruch Donald Trumps "Making America great again" schmunzeln. Doch dieses "Great" ist tief im Selbstverständnis der Amerikaner verwurzelt. In Deutschland hingegen schien es lange Zeit ein schwieriges Unterfangen zu sein, eine solche positive Sichtweise einzunehmen. Hier lautete die Devise oftmals: Er reicht schon, seinen Job zu machen. Mehr kannst du nicht verlangen. Und dass sich die Leute "great" fühlen, muss auch nicht unbedingt sein.
Natürlich birgt der "Making America great again"-Ansatz auch die Gefahr des Größenwahns in sich, wie wir aktuell – heute ist der 07.01.2021 – am Sturm auf das Kapitol in den USA erkennen. Dennoch kann es nicht schaden, sich in manchen Momenten durchaus ein wenig großartig fühlen zu dürfen, wenn wir im Team etwas Großartiges geleistet haben.
In der Corona-Krise zeigt sich, wie schwer wir uns gerade in Umbruchsituationen damit tun, positive Aspekte zu sehen. Wer in die Medien blickt, wird überflutet von Nachrichten über drohende Insolvenzen, Stellenabbau, egoistische Demonstrant:innen, die Inflationsgefahr und natürlich Corona, Corona, Corona. Krisenstimmung, wo wir auch hinsehen. Etwas positiv zu sehen bedeutet nicht blauäugig zu sein. Dennoch wissen wir alle, dass keine Veränderung nur schlecht ist, sondern immer auch Chancen mit sich bringt. In Zeiten des Umbruchs gehen manche bankrott, während neue Start-ups gegründet werden. Aus meiner kleinen Welt als Trainer weiß ich, wie anstrengend und nervig virtuelle Trainings sind, weil sich viele meiner Themen – beispielsweise Körpersprache oder Konfliktmanagement – kaum in die digitale Welt übertragen lassen. Gleichzeitig zwingen mich Online-Trainings zu einer detaillierteren Strukturierung meiner Seminare und einer höheren Genauigkeit von Gruppenaufgabenbeschreibungen. Ein Effekt, der meinen Seminaren nicht nur in der digitalen Form zugute kommt. Zudem hatte ich von Mitte Januar bis Mitte Februar ein Achtsamkeitstraining, das es in der Präsenzversion niemals gegeben hätte. Jeden Freitag um 10.00 Uhr gab es einen kurzen Online-Input inklusive Diskussion und anschließend eine Woche Zeit, mittels Reflexionen und Übungen das Gelernte selbständig zu vertiefen, mit großen Erfolg. Manchmal ist der Zwang, etwas Neues auszuprobieren nicht das Schlechteste. Wir müssen nur unseren Blick für das Gute im Anstrengenden schärfen.
Vgl. Ebner, S. 51f↩
Vgl. Rose, S. 83f↩
Vgl. Ebner, S. 45↩
2 Positive Führung als Gebot der Stunde
Warum ist eine positive Führung gerade jetzt so wichtig? VUCA-Welt (volatil, uncertain, complex, ambiguous), hohe Fluktuation, schlechtes Betriebsklima, Kontroll- und Überwachungswahn, Überforderung und Isolation im Homeoffice, fehlende Abgrenzungen im Großraumbüro, Informationsüberfluss, Angst vor Algorithmen, Angst vor Arbeitslosigkeit, Misstrauen, Globalisierungsdruck, Agilitätsdruck bis hin zu einer Krise wie Corona. Wir leben in einer Welt dauerhafter Überforderungen. Ausnahmesituationen scheinen mittlerweile der Normalzustand zu sein.