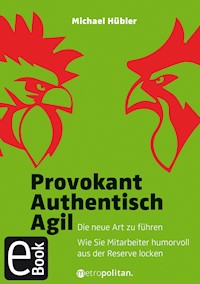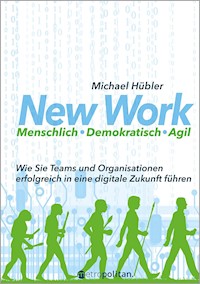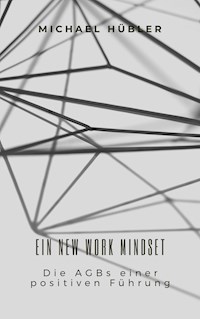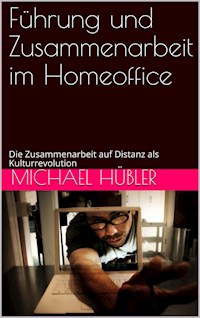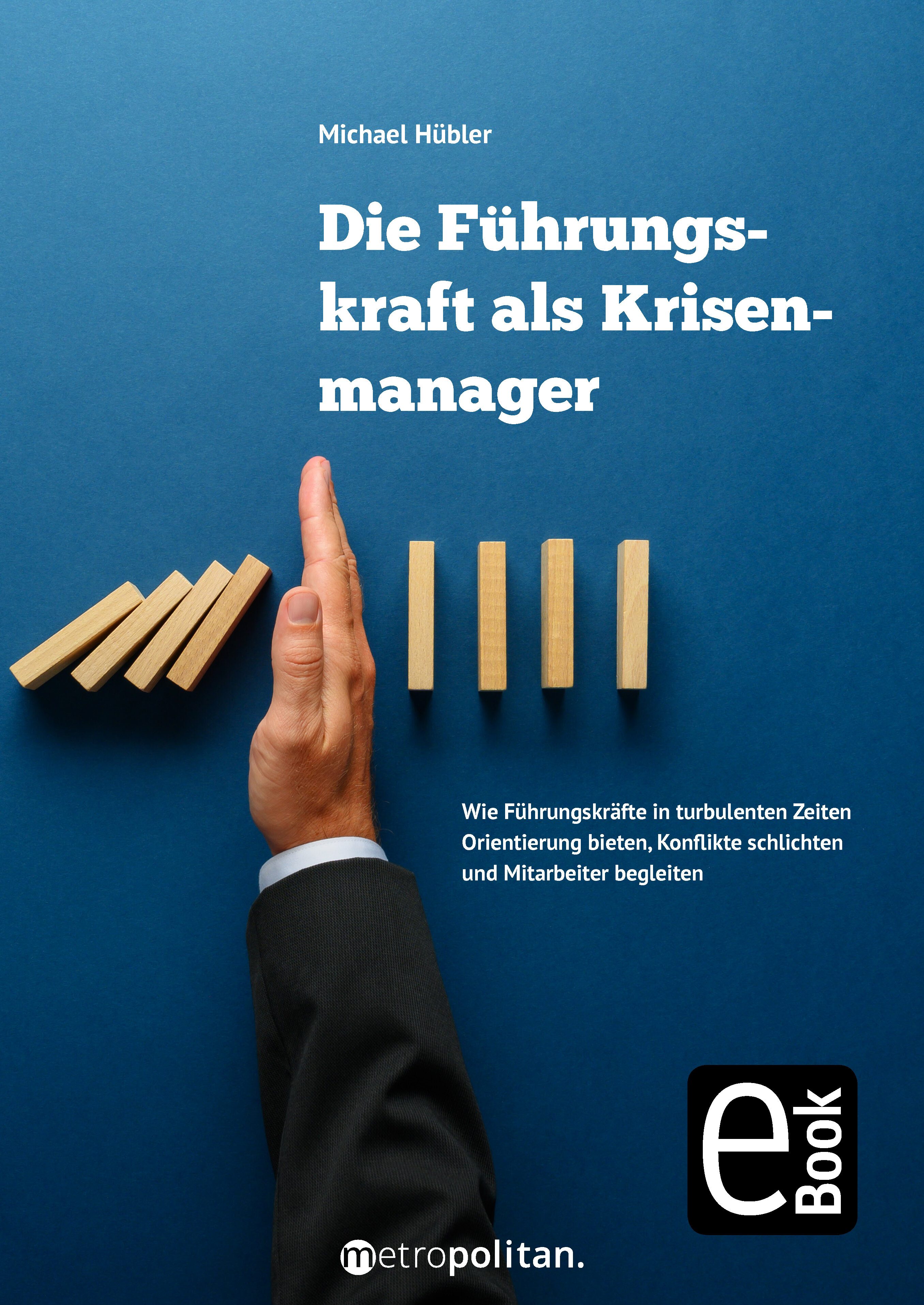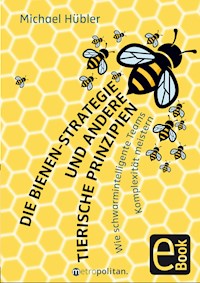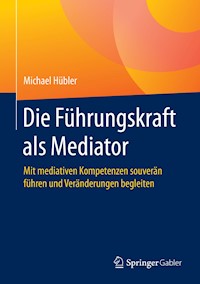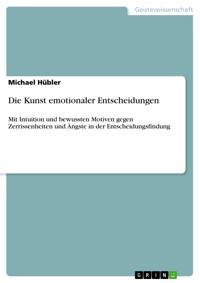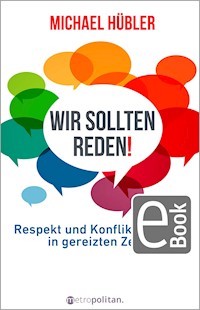
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metropolitan
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wir Meinungsverschiedenheiten aushalten und Konflikte meistern
Unsere Gesellschaft ist polarisiert, zerstritten – oder sogar gespalten. Streitgespräche und Debatten über die Corona-Maßnahmen, kulturelle Veränderungen oder auch den Klimawandel werden erbittert und mit wenig Toleranz geführt. Der raue Ton im Internet verschärft die allgemeine Gereiztheit.
Warum sind wir so überempfindlich geworden und haben ständig das Gefühl, uns positionieren oder abgrenzen zu müssen? Wie kommen wir einander wieder näher? Die Antwort ist eigentlich einfach: zuhören, aushalten,verstehen, reden. Doch die Voraussetzung dafür ist, die eigenen Werte und Erwartungen zu kennen,sich im Klaren darüber zu sein, was einen ärgert und warum.
Wir sollten reden! beschäftigt sich mit der persönlichen Konfliktfähigkeit und den eigenen Prägungen. Es zeigt, wie wir mit Aggressionen und Vorurteilen umgehen können, in Konflikten neue Zugänge finden und welche Rahmenbedingungen konfliktlösungsförderlich sind. Mithilfe von Reflexionsfragen lassen sich die Lösungsansätze auf individuelle Situationen übertragen. Ziel ist es, bei Auseinandersetzungen die Ruhe zu bewahren, Andersdenkenden offen und ehrlich zu begegnen und vor allem wieder respektvoll zu streiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Wie wir Meinungsverschiedenheiten aushalten und Konflikte meistern
Unsere Gesellschaft ist polarisiert, zerstritten – oder sogar gespalten. Streitgespräche und Debatten über die Corona-Maßnahmen, kulturelle Veränderungen oder auch den Klimawandel werden erbittert und mit wenig Toleranz geführt. Der raue Ton im Internet verschärft die allgemeine Gereiztheit.
Warum sind wir so überempfindlich geworden und haben ständig das Gefühl, uns positionieren oder abgrenzen zu müssen? Wie kommen wir einander wieder näher? Die Antwort ist eigentlich einfach: zuhören, aushalten,verstehen, reden. Doch die Voraussetzung dafür ist, die eigenen Werte und Erwartungen zu kennen,sich im Klaren darüber zu sein, was einen ärgert und warum.
Wir sollten reden! beschäftigt sich mit der persönlichen Konfliktfähigkeit und den eigenen Prägungen. Es zeigt, wie wir mit Aggressionen und Vorurteilen umgehen können, in Konflikten neue Zugänge finden und welche Rahmenbedingungen konfliktlösungsförderlich sind. Mithilfe von Reflexionsfragen lassen sich die Lösungsansätze auf individuelle Situationen übertragen. Ziel ist es, bei Auseinandersetzungen die Ruhe zu bewahren, Andersdenkenden offen und ehrlich zu begegnen und vor allem wieder respektvoll zu streiten.
Autor
Michael Hübler ist Mediator, Berater, Moderator und Coach für Führungskräfte und Personalentwickler. Als Führungscoach und Konfliktmanagementtrainer zeigt er, wie wertvoll der Schritt von einer „Heilen-Welt-Philosophie“ zu einer transparenten, agil-mutigen Führung ist.
Schnellübersicht
Vorwort
Teil A: Innenschau
Teil B: Auf der Bühne
Anhang: Reflexionen
Literatur
Wir müssen nicht reden – aber wir sollten
Es gibt aufgrund der Fülle von Büchern zum Thema „Konflikte lösen“ kaum einen Grund, ein weiteres zu schreiben. Wir wissen eigentlich, wie wir miteinander umgehen sollten. Wir haben gelernt, empathisch zu sein – zumindest rein theoretisch – und unsere Mitmenschen zu verstehen. Rhetorik- und Konfliktmanagementkurse gibt es an jeder Volkshochschule. Dort können wir nicht nur lernen überzeugend zu reden und logisch zu argumentieren, sondern oft sogar dialogisch zu kommunizieren. Und dennoch zeigt sich in der Corona-Krise und mehr noch in der Diskussion über die sogenannte Cancel Culture, dass all diese Kompetenzen, insbesondere beim Austausch in der virtuellen Welt, abhandenkommen. Was bis vor Kurzem nur eine Randgruppe Unbelehrbarer betraf, weitet sich auf einen Großteil der Bevölkerung aus: die Unfähigkeit, respektvoll zu streiten. Es scheint, als wäre Konfliktmanagement eine Fähigkeit für gute Zeiten, die unter großem Stress in einen Dornröschenschlaf fällt. Die verbale Eskalation im Internet befeuert unaufhaltsam den Zerfall einer zivilisierten Streitkultur.
Religiöse Zugehörigkeit oder politische Präferenzen waren in der Vergangenheit beispielsweise weitgehend Privatsache. Heutzutage scheinen viele bislang persönliche Themen – von der Kindererziehung bis zum Essverhalten – politisch aufgeladen oder mit einer zutiefst moralischen Überzeugung verbunden zu sein, was unsere Diskussionen verschärft. Sind wir in einer Zeit stetiger Umbrüche gezwungen, uns öffentlich zu positionieren? Sind klare Statements ein Mittel der Selbstvergewisserung oder ein Zeichen dafür, dass wir alle zu Narzissten geworden sind?
Die Corona-Krise werden wir überwinden. Doch die Gräben, die entstanden sind, werden uns noch eine Weile beschäftigen. In manchen Zeitungsartikeln war die Rede davon, dass die Meinung zu Corona beste Freundinnen zu Feindinnen machte. Wollen wir es dabei belassen? Zudem wird es neue Krisen geben. Bereits vor Corona gab es den ein oder anderen gesellschaftlichen Aufreger, der die Menschen spaltete. Denken wir an Stuttgart 21 oder den Brexit.
Die Debatte um die Cancel Culture bleibt uns ebenso erhalten. Auch mit moralischen Positionierungen zu allem, was auf -ismus endet, werden wir uns wohl weiter die Ohren vollblasen. Die Meinungen Andersdenkender abzuwerten und sich nicht mit seinem Gegenüber auseinanderzusetzen, ist leicht. Der Begriff „Cancel Culture“ ist daher treffend gewählt. Ich lösche etwas aus meinem Sichtfeld. Ein begrenzter Blickwinkel kann jedoch niemals das gesamte Bild erfassen. Als Befürworter der Schwarmintelligenz glaube ich fest daran, dass mehr Augen mehr sehen und mehr Gehirne zu besseren Erkenntnissen kommen.
An Corona oder der Cancel Culture kommen wir in einem Buch über Konflikte heute also kaum vorbei. Deshalb beziehe ich mich an manchen Stellen auf diese kulturellen Phänomene. Mir geht es in diesem Buch jedoch um mehr. Die Streitigkeiten um Corona oder die Cancel Culture zeigen uns, wie weit die Menschen voneinander entfernt sind. Offensichtlich leben wir schon lange in unseren kulturellen Filterblasen und bekamen bislang kaum etwas voneinander mit. Die Diskussionen um die Anti-Corona-Maßnahmen zwangen uns, uns mit anderen Blasen auseinanderzusetzen. Das Internet konfrontiert uns unaufhörlich mit unangenehmen Verhaltens- und unverständlichen Denkweisen, welche uns gefühlt nötigen, uns dagegen zu positionieren. Woran liegt das? An der Angst davor, welchen gesellschaftlichen Schaden solche Haltungen anrichten können? Oder positionieren wir uns, um uns unserer Identität zu vergewissern?
Wir alle werden unterschiedlich geprägt. Wir sind Individuen, was bedeutet, dass jeder Mensch anders auf eine Situation blickt. Der eine macht einen Witz, der andere fühlt sich angegriffen. Die eine betrachtet es als sportlichen Wettbewerb, einer Konkurrentin einen Auftrag vor der Nase wegzuschnappen, für die Konkurrentin ist es ein klarer Fall von Unkollegialität, noch dazu unter Frauen.
Dieses Buch beschäftigt sich mit den persönlichen und sozialen Prägungen. Warum wir manchmal wie eine „Reiz-Reaktionsmaschine“ überreagieren, wenn wir angetriggert werden, und wie diese Trigger aussehen. Es zeigt, wie wir mit Mikroaggressionen und passiver Aggressivität umgehen können, wie wir in Konflikten ruhig und entspannt bleiben und was uns mit unseren Konfliktpartnerinnen verbindet. Es legt dar, mit welchen Haltungen wir in Konflikten neue Zugänge finden, wie wir uns klug selbst offenbaren können und welche Rahmenbedingungen konfliktlösungsförderlich sind.
Mithilfe von Reflexionsfragen können Sie dieses Wissen anhand eines persönlichen Konflikts vertiefen. Die 27 Reflexionsblöcke finden Sie am Ende des Buches noch einmal gesammelt, um einen Konflikt komplett durchspielen zu können, ohne viel zu blättern.
Es geht in diesem Buch also weniger um das direkte miteinander Streiten. Es handelt sich vielmehr um die Auseinandersetzung mit der persönlichen Konfliktfähigkeit. Denn wer sich selbst darüber im Klaren ist, was ihn ärgert, welche Werte ihm wichtig sind und was er von seinem Gegenüber erwartet, tut sich auch leichter, offen und ehrlich zu streiten.
„Wir müssen reden“ ist in Büchern zum Thema „Streitkultur“ oder auf Plakaten von Demonstranten zu lesen. Das ist falsch. Wir müssen nicht. Aber wir sollten! Meistens lohnt es sich, besonders im privaten Umfeld, den Kontakt zu suchen und zumindest den Versuch zu unternehmen, sich gegenseitig zu verstehen und sich einander wieder zu nähern – vielleicht sogar mehr als jemals zuvor.
Michael Hübler
Ein Buch muss meines Erachtens in der heutigen Zeit zwei Aspekte berücksichtigen, was seine Form betrifft. Zum einen sollte es gut lesbar sein, zum anderen sollte die Gleichberechtigung der Geschlechter zum Ausdruck kommen. Jedes Schriftwerk spiegelt nicht nur die Realität wider, sondern schafft auch neue Wirklichkeiten. Ich habe mich daher dafür entschieden, soweit es möglich und gut lesbar ist, bei Personenbeschreibungen die weibliche Mehrzahl zu verwenden, die in aller Regel die männliche beinhaltet. In den wenigen Fällen, in denen dies nicht funktioniert, nutze ich das generische Maskulinum. In Beispielen variiere ich zwischen der weiblichen und männlichen Form.
Teil A: Innenschau
1. Die Geschichte hinter den Geschichten
2. Persönlichkeit, Identität und soziale Prägungen
3. Grenzverletzungen und Moralvorstellungen
4. Impulsivität und vorschnelle Bewertungen
1. Die Geschichte hinter den Geschichten
Das erste Kapitel dient dem Blick in die Vergangenheit. Was bringen Sie an Erfahrungen mit? Und was können wir aus den Erfahrungen anderer Menschen lernen? Gerade in Konflikten, in denen sich sowohl die emotionale Präsenz unseres Gegenübers aufdrängt, als auch wir selbst von Gefühlen mitgerissen werden, ist es wichtig, sich zu verdeutlichen, woher wir und unser Gegenüber kommen, um zu verstehen, was uns bewegt.
1.1 Meine eigene Geschichte
In meiner Kindheit prägten mich zwei Maxime:
Mach dich unabhängig und kümmere dich um dich selbst.
2.Achte darauf, was andere Menschen über dich denken.
Die erste Maxime lässt sich eher meinem Vater und die zweite meiner Mutter zuordnen.
Meine Eltern machten sich in jungen Jahren selbstständig. Sie mieteten in den 1970er-Jahren einen kleinen Laden, in dem sie Haushaltswaren, später auch Porzellan verkauften. Das Geschäft war mühsam. Doch irgendwie schafften sie es, sich mit diesen beiden Maximen bis zur Rente über Wasser zu halten. Die erste Maxime war der Antrieb, auch bei Rückschlägen weiterzumachen. Sie führte auch dazu, nach einigen Jahren in einen größeren Laden umzuziehen und das Angebot zu erweitern. Meine Eltern erzählen stolz, dass der Name Hübler in der Kleinstadt, aus der ich komme, in der älteren Generation immer noch bekannt sei. Im Sinne von: „Frag doch mal bei Hübler nach, vielleicht haben die das im Sortiment oder können es bestellen."
Mit der zweiten Maxime lässt sich eine gute Balance zur ersten herstellen. Immerhin geht es bei einem Geschäft nicht nur darum, die eigene Freiheit und Unabhängigkeit von einem Arbeitgeber zu genießen, sondern auch darum, sich immer wieder zu fragen, was Kunden brauchen, wie ich bei Kunden ankomme und wie ein langfristiges Geschäftspartner- und Kundenverhältnis zustande kommt.
Mit diesen Prägungen im Gepäck machte ich mich auf, meine eigene Geschichte zu schreiben. Eine Geschichte über ein Studium, gescheiterte Beziehungen, ein mehr oder weniger wildes WG-Leben, die Begegnung mit meiner Frau, chaotische Reiseabenteuer, die ersten Jobs, die Geburt unserer Kinder und natürlich die ersten Versuche meiner Seminartätigkeit sowie die durchaus glorreichen Momente eines Trainers, Coaches, Mediators und Autors und damit der Beweis, dass sich all die Mühen lohnen.
Zwei Medianden, die wieder gemeinsam lachen können. Die Aussage einer Seminarteilnehmerin, dass ich einfach klasse sei. Ein Teilnehmer, der meint, meine Seminare wären etwas ganz Besonderes. Der Duft des ersten ausgepackten druckfrischen Buches und die ersten Rezensionen dazu. Menschen, die meine Bücher zu Hause als Gesamtausgabe stehen haben. Aber ebenso – als erdendes Gegenelement – die Bitte eines Teilnehmers an den Auftraggeber, nie wieder mit diesem Trainer zusammenzuarbeiten.
Die Arbeit eines Trainers und Mediators kann extreme Höhen und Tiefen haben. Vermutlich wurde ich vor allem deshalb Mediator und Experte für Konfliktmanagement, weil bei uns zu Hause kaum gestritten wurde. Das war zwar harmonisch, jedoch klärte jeder von uns Konflikte nur mit sich selbst. Ich persönlich streite immer noch nicht gerne. Dennoch ist es wichtig, Probleme gemeinsam zu lösen, um Beziehungen weiterzuentwickeln.
Wie wir agieren – auch das lässt sich aus persönlichen Geschichten lernen –, hat viel weniger mit unserem Gegenüber zu tun als mit den Erlebnissen und Erfahrungen in unserer Vergangenheit. Dennoch ist unsere Persönlichkeit nicht in Stein gemeiselt. Mit jeder neuen Erfahrung haben wir die Möglichkeit, uns ein Stückchen zu verändern.
Wer prägte Sie (Großeltern, Eltern, Geschwister, Lehrerinnen, Freunde, …)?
Welche Ereignisse prägten Sie?
Mit welchen im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen außergewöhnlichen Situationen wurden Sie konfrontiert?
Wann und wo stießen Sie an Grenzen und Hindernisse?
Schafften Sie es, nicht aufzugeben und weiterzumachen? Wenn ja, wie?
Was lernten Sie daraus?
Gab es an einem bestimmten Punkt in Ihrem Leben ein Überdenken des bisherigen Lebens, ein Umdenken, eine innere Rebellion?
Was war nach diesem Wendepunkt anders in Ihrem Leben?
Wofür wünschen Sie sich von anderen Menschen Respekt bezüglich Ihrer Geschichte?
1.2 Respekt für die Geschichte anderer
Neulich sah ich ein Video, in dem eine Frau von etwa 40 Jahren Stationen ihrer Vergangenheit im Kurzdurchlauf erzählte:
Mit elf Jahren lernte sie, dass „Jungs nun mal so sind“. Damals schubste sie ein Junge in der Klasse, sodass sie zu Boden fiel. Sie hatte keine ernsthaften Blessuren. Aber der Satz der Lehrerin, dass „Jungs nun mal so sind“, prägte sich ihr ein.
Mit 14 griff ihr zum ersten Mal ein Junge unter den Rock. Damals lernte sie, dass Mädchen selbst schuld sind, wenn sie einen Rock anziehen.
Mit 16 wurde sie auf einer Tanzfläche von einem Jungen befummelt. Sie stellte ihn zur Rede. Er leugnete den Übergriff und tanzte weiter. Ihr Abend war damit vorbei. Sie ging heim. Er blieb. Damals lernte sie, dass sie klein beizugeben hat, weil sie das schwächere Geschlecht ist.
Die Geschichte endet damit, dass die Frau all das nun nicht mehr hinnehmen will. Sie will auf den Partys bleiben. Sie will übergriffige Männer in die Schranken weisen. Sie will den Platz in der Gesellschaft erobern, der ihr zusteht.
Im Mai 2020 wurde die Kurzdokumentation Männerwelten – Belästigung von Frauen von Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Sophie Passmann, Palina Rojinski, Jeanine Michaelsen, Visa Vie, Stefanie Giesinger, Katrin Bauerfeind und Collien Ulmen-Fernandes veröffentlicht.1 Darin wird überdeutlich, in welcher Welt viele Frauen leben, die Männer so niemals erfahren.
Es heißt oft, wir würden in „einer Welt“ leben. Das stimmt jedoch nicht. Wir leben in vielen Welten. Jeder nimmt die Welt aufgrund seiner Erfahrungen anders wahr. Deshalb ist auch Wahrheit außerhalb einer wissenschaftlichen Laborsituation ein fragwürdiger Begriff. Eine Frau, die nachts alleine unterwegs ist, zuckt vielleicht zusammen, wenn die Laternen ausfallen. Sie nimmt die Situation als bedrohlich wahr. Als Mann kenne ich diese Erfahrung nicht.
In meinen jungen Jahren gab es im Zuge der Grunge-Musik-Welle sogenannte Riot-Grrrls-Bands. Gruppen, die ausschließlich aus Frauen bestanden. Manchmal habe ich das Gefühl, wir waren in den 90ern bereits so weit wie heute. Jedenfalls gab es von einer Band namens L7, die ich damals live erleben durfte, einen Song namens Can I run?. In dem Song geht es darum, ob ich als Frau die richtigen Schuhe anhabe, wenn ich nachts unterwegs bin. Und damit ist kein Glitzer gemeint. Als Mann mache ich mir nur Gedanken darüber, ob meine Schuhe drücken könnten und ob sie optisch zu meiner Hose passen. Ich mache mir Gedanken darüber, ob meine Schuhe als Status-Symbol herhalten. Brown shoes can't make it, sang Frank Zappa ironisch in den 1970ern. Aber sonst?
Mit solchen Gedanken verändert sich auch das Explorierverhalten von Männern und Frauen. Ich verschwende in der Regel keinen Gedanken daran, in einer fremden Stadt nachts überfallen zu werden, wenn es nicht gerade Mexico City ist. Frauen kontrollieren, ob das Pfefferspray noch in ihrer Tasche ist. Und würde ich mir als Vater Sorgen machen, wenn ich große Jungs hätte und die spät nachts nach Hause kämen? Vermutlich nicht.
Wie werden Frauen durch solche Erfahrungen geprägt?
Wohlgemerkt: Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt. Er oder sie bringt Prägungen aus dem Elternhaus mit und führt ein Leben, das in der Zusammenstellung der Stationen mit keinem anderen vergleichbar ist. Dennoch gleichen sich einzelne Lebensstationen unterschiedlicher Menschen. Andernfalls könnten wir uns gar nicht miteinander unterhalten und gegebenenfalls solidarisieren.
Wir sollten uns für die Geschichten anderer Menschen interessieren, um diese zunächst nachvollziehen zu können und dann ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Die Geschichten eines Menschen sind seine historische DNA, aus der heraus er denkt, fühlt, plant, handelt, kommuniziert und reagiert.
Eine Frau, die das erlebt, was ich oben schilderte, hält sich vielleicht in Konfliktsituationen mit Männern zurück, ordnet sich unter und wird perfiderweise genau dadurch erneut zum Opfer: „Mit der kann Mann es ja machen.“ Mir geht es hier jedoch nicht darum, die Entstehung von Opferrollen oder gar Missbrauch zu analysieren. Aus solchen negativen Erfahrungen ergeben sich jedoch Prägungen, die auch in vermeintlich normalen Alltagssituationen wirken: Da ist die Frau, die vermeintlich überreagiert, wenn ich ihr als Mann ein Kompliment mache. Da ist die Frau, die zurückzuckt, wenn ich ihr in den Mantel helfen will. Da ist die Frau, die sich kämpferisch für ihre Interessen einsetzt, obwohl ich der Meinung bin, gegen mich gäbe es nichts zu kämpfen. Aber das ist schließlich nur meine Meinung, meine Sichtweise, meine Wahrheit.
Bleibe ich allein bei meiner Wahrnehmung der Situation, sehe ich eine Amazone vor mir, deren verbale Pfeile auf mich zielen. Ich fühle mich zu Unrecht beschuldigt, weil ich ihr nichts Böses wollte. Setze ich mich jedoch mit ihrer Geschichte auseinander und versuche die Welt aus ihren Augen zu betrachten, habe ich höchst wahrscheinlich Verständnis für ihre Reaktion.
Doch nicht jede Geschichte vermittelt uns Respekt für unser Gegenüber. Ein Mensch, der in seiner Opferhaltung verharrt, wird kaum Respekt bekommen. Auch für jemanden, der es immer leicht hatte, vielleicht weil seine Eltern privilegiert waren, bringen wir kaum Verständnis auf, wenn er uns aggressiv angeht. Einem Menschen, der vieles erleiden musste, sich vielleicht jahrelang zurückhielt, seine Lektionen lernte und diese schließlich in Handlungen umsetzte, zollen wir meist gerne unsere Anerkennung.
Die Zutaten einer Lebensgeschichte, für die wir Respekt aufbringen und wegen der wir uns trotz aller Meinungsverschiedenheiten neugierig auf einen Menschen einlassen, lauten Leid und Kampf. Hingegen sind wir auf Menschen, denen aufgrund ihrer Intelligenz, ihres Glücks oder Geldes beinahe alles zufällt, schnell neidisch. Ein Mensch sollte in unseren Augen Ausdauer und Ehrgeiz haben, clever sein und den Kampf gegen Widrigkeiten unverzagt aufnehmen.
Auch darin könnte der Schlüssel zu Menschen liegen, die wir sympathisch finden. Sie packen den Stier bei den Hörnern. Sie geben nicht auf und nutzen ihre Chancen. Sie stehen immer wieder auf, egal wie oft sie zu Boden gehen.
Wenn Sie an die Geschichte(n) anderer Menschen denken: Wofür zollen Sie anderen Menschen Respekt?
Vgl. Joko & Klaas: Männerwelten – Belästigung von Frauen unter: www.youtube.com/watch?v=uc0P2k7zIb4
2. Persönlichkeit, Identität und soziale Prägungen
In diesem Kapitel werden wir nach der offenen Auseinandersetzung mit persönlichen Erfahrungen ein wenig Struktur in die Beschäftigung mit Ihrer Persönlichkeit und Identität bringen. Wir schauen uns dazu das spirituelle System des kabbalistischen Lebensbaums sowie das wissenschaftlich gut erforschte System der Big Five an. Des Weiteren werfen wir einen Blick auf soziale Prägungen, Bedürfnisse und die mentalen Modelle, die daraus entstehen und mit denen wir auf die Welt blicken.
2.1 Der Lebensbaum der Kabbala als philosophischer Wegweiser
Um zu wissen, wer wir sind, und gleichzeitig zu klären, was uns und unsere Identität ausmacht, ist es hilfreich, diejenigen zu fragen, die sich mit unserer Seele beschäftigen. Damit sind wir – für ein Buch über Konflikte nicht ganz unüblich, wenn wir an die Friedensforschung denken – im Bereich der Religion gelandet.
Vor etwa zehn Jahren stieß ich zum ersten Mal auf die Kabbala und den Lebensbaum aus der jüdischen Mystik. Also Obacht! Jetzt wird es esoterisch. Vielleicht zog mich die Kabbala damals an, weil in mir ein paar Milliliter jüdisches Blut fließen, großmütterlicherseits. Meine Oma verstarb, als ich noch ein Kind war. Mir fiel jedoch viel später wieder ein, als ich längst einiges zum Thema „Kabbala und jüdische Bräuche“ gelesen hatte, dass meine Großmutter Steine auf den Grabstein meines Großvaters legte, ein jüdischer Brauch zur Ehrung der Toten.
Die Kabbala gilt manchen Menschen als Geheimlehre. Das hat weitgehend mit einer Zahlenmystik zu tun, die ich entweder nicht verstehe oder bei der ich nicht mitgehen mag. Der Lebensbaum jedoch, aus der nordischen Mythologie auch als Yggdrasil bekannt, bietet anhand von zehn Ansatzpunkten und damit verbundenen persönlichen Fragen eine gute Orientierung auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit.
Der Lebensbaum ist ein Diagramm, das aus drei Bereichen besteht. Ganz unten befindet sich unsere Identität, in der Mitte unsere Persönlichkeit und ganz oben unser Höheres Selbst. Die drei Bereiche werden wiederum in Unterbereiche gegliedert.2 Zur Verdeutlichung können Sie sich einen Tannenbaum mit neun schillernden Kugeln und einer Krone vorstellen.
Unsere Identität
Auf den vier Kugeln im untersten Bereich des Baumes stehen die Begriffe „Bedürfnisse“, „Wahrnehmung“, „Handlungen“ und „Identität“. Diesen Begriffen können wir uns durch Fragen nähern:
Welche Bedürfnisse sind mir in meinem Leben besonders wichtig? Ist mir meine persönliche Freiheit wichtiger, als die Sicherheit, zu einer Gruppe zu gehören, in der ich anerkannt bin? Wie wichtig ist es mir geliebt zu werden oder selbst zu lieben? Welche Bedeutung hat kreative Selbstverwirklichung in meinem Leben? Wie wichtig sind mir Herausforderungen und Abenteuer? Wie wichtig ist es für mich, Prozesse und Projekte, an denen ich beteiligt bin, gestaltend mitzubestimmen? Wie sehr brauche ich Widerstände?3 Grundsätzlich hat jeder Mensch die gleichen Bedürfnisse. Allerdings variieren diese von Situation zu Situation und sind in ihrer Ausprägung unterschiedlich. Gerade in Konflikten und Krisen tendieren wir dazu, uns um besonders wichtige Bedürfnisse zu kümmern, während weniger wichtige Bedürfnisse hintangestellt werden. So kann ein Mensch, dem grundsätzlich ein Austausch auf Augenhöhe wichtig ist, dieses Bedürfnis verdrängen, um die Harmonie zu einem dominant auftretenden Gegenüber nicht zu gefährden. Oder ein ansonsten umgänglicher Mensch verdrängt sein Bedürfnis nach Anerkennung, um sein Gestaltungsbedürfnis und seinen Drang nach persönlicher Freiheit auszuleben. Ich werde später noch detaillierter auf Bedürfnisse eingehen.
2.Welche Wahrnehmung habe ich aufgrund meiner Bedürfnisse? Wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen? Das Bedürfnis nach Kommunikation auf Augenhöhe beispielsweise wächst, wenn wir das Gefühl haben, genau dieses Bedürfnis wird im Austausch mit einem Gegenüber nicht erfüllt. Plötzlich fallen uns immer mehr kleine und große Beispiele seiner dominanten Art auf, die wir zuvor gar nicht bemerkt hatten. Und je mehr wir von seiner negativen Seite wahrnehmen, desto drängender wird unser Bedürfnis.
3.Aus unserer Wahrnehmung und unseren Bedürfnissen folgen konkrete Handlungen. Wir gehen zum Beispiel auf die Barrikaden, streiten mit anderen um unseren Teil vom Kuchen oder ziehen uns frustriert zurück. Mit jeder Handlung versuchen wir nicht nur, unserer Wahrnehmung entsprechend tätig zu werden und unsere Bedürfnisse zu erfüllen, wir festigen damit gleichzeitig unsere innere und äußere Identität. Schließlich wollen wir innerlich konsistent bleiben.
4.Aus dem Zusammenwirken dieser drei Bereiche entsteht die eigene Identität. Der Identitätsbegriff wird in der Literatur unterschiedlich verwendet. In der Kabbala steht er für das Image oder Bild, das ich nach außen präsentiere, je nachdem was ich mir wünsche, was andere in mir erkennen sollen. Vielleicht hätte ich gerne, dass andere Menschen mich allgemein oder auch in Konfliktgesprächen für klug halten oder für besonnen, dass sie sehen, dass ich auf der richtigen Seite stehe oder mich nicht für dumm verkaufen lasse.
Unsere Persönlichkeit
Im Bereich der Persönlichkeit nähern wir uns unserem Wesenskern an. Während wir bei der Beschäftigung mit unserer Identität irgendwann damit beginnen, uns um uns selbst zu drehen, können wir hier neue Erkenntnisse über uns und unsere Mitmenschen gewinnen. Auch auf dieser Baum-Ebene hängen wieder Kugeln, auf denen steht: Stärke, Güte und persönlicher Wesenskern:
Woraus beziehe ich meine Stärke oder Kraft? Die Antworten können sehr unterschiedlich ausfallen: Über die Verbundenheit mit anderen Menschen, indem ich Abstand zu einer konfliktbehafteten Thematik halte oder indem ich Gartenarbeit betreibe. Zur Stärke gehört auch die Eigenschaft Geduld. Womit sollte ich geduldig sein und was sollte ich aushalten? Vielleicht muss ich es aushalten, dass andere Menschen anderer Meinung sind, dass sich meine Bedürfnisse nicht immer sofort erfüllen lassen und vielleicht sogar, dass ich in einer Welt lebe, die sich mir vorübergehend nicht mehr erschließt.
2.Auf der nächsten Kugel steht die Frage, was ich meinem Umfeld gütig geben kann und möchte. Wie kann ich anderen Menschen Hoffnung geben und sie solidarisch unterstützen? Wie kann ich das Auseinanderdriften von Freunden oder Arbeitskolleginnen durch Konflikte verhindern?
3.Die beiden Persönlichkeitsaspekte der gebenden Güte und geduldigen Stärke sollten in einer guten Balance liegen, wenn Sie Konflikte gut meistern wollen. Die Güte hilft Ihnen, auch mal geduldig ein Auge zuzudrücken und nicht alles, was Ihr Gegenüber sagt, auf die Goldwaage zu legen. Die Stärke hilft Ihnen, nicht alles zu erdulden, sondern selbstbewusst für die eigenen Belange zu kämpfen. Damit kommen wir zur letzten der drei Kugeln, dem persönlichen Wesenskern: Was macht mich als Mensch im Wesentlichen aus? Vielleicht sind es tatsächlich Geduld und Ausgeglichenheit, vielleicht auch Zähigkeit, Neugier oder Humor?
Dieses Ich, dieser Wesenskern meiner Persönlichkeit, sollte mit meiner Identität abgeglichen werden, um mir darüber klar zu werden, ob ich das, was ich anderen von mir präsentiere, auch innerlich spüre und mich damit stimmig präsentieren kann. Ob ich also mit mir selbst im Reinen bin. Meine Persönlichkeit und Identität sind folglich eng miteinander verbunden. Kein Wunder, dass sie oft als synonyme Begriffe verwendet werden.
Unser Höheres Selbst
Im obersten Bereich des Baumes beschäftigen wir uns mit Erkenntnissen und Weisheiten, die über aktuelle Konflikte und Krisen hinausgehen:
Als Erstes stelle ich mir die Frage, welche persönlichen Erkenntnisse ich aus meinen bisherigen Krisen und Konflikten gezogen habe. Vielleicht stehe ich in Gruppenkonflikten grundsätzlich gerne auf der Seite der Mehrheit oder auf der Seite der Minderheit. Vielleicht flüchte ich vor einer knalligen Auseinandersetzung. Vielleicht sitze ich Konflikte am liebsten aus. Vielleicht gebe ich den Ton an, um mich sicher zu fühlen. Oder ich versuche, kritische Situationen mit Humor zu entspannen.
2.Aus diesen Erkenntnissen lassen sich persönliche Weisheiten ziehen. Vielleicht besteht meine wahre Herausforderung im Umgang mit meinen Mitmenschen nicht darin, andere von meiner Meinung zu überzeugen, sondern Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und zu akzeptieren, dass jeder Mensch aus seinen Erfahrungen heraus so handelt, wie er handelt. Vielleicht besteht eine Weisheit darin, durch diese Duldung von Ansichten eine neue Nähe zu einem Konfliktpartner zu schaffen. Vielleicht geht es auch darum, nicht jeden Konflikt lösen zu können und stattdessen zu lernen, mit Unklarheiten und Meinungsverschiedenheiten zu leben.
3.Als letzter Punkt, der Krone in der Kabbala, stellt sich die Frage, was uns alle miteinander verbindet. Welche Verbindungen ergeben sich durch eine Krise oder einen Konflikt? Was ist allen Menschen wichtig? Niemand will sich beleidigen oder bedrohen lassen. Wir wollen alle gehört, wahr- und ernstgenommen werden. Wir sind alle auf der Suche nach einem Sinn im Leben.
Was macht Sie als Menschen aus? Welches Wissen, welche Weisheiten, welche Kraft und welche Güte?
2.2 Soziale und individuelle Identitäten
Der Unterschied zwischen Identität und Image
Die Trennung zwischen einer äußeren und inneren Identität geht auf Martin Luther zurück. Während sich die katholische Kirche an einem äußeren Bild von Gott orientierte, das einher ging mit einer vielfältigen Ikonenmalerei, die heutzutage noch in der griechisch-orthodoxen Kirche zu sehen ist, betonte Martin Luther den inneren Kontakt zu Gott. Der Mensch sollte im Hier und Jetzt seine Erfüllung finden, ein gottgefälliges Leben führen und nicht auf ein Heil im Jenseits hoffen. Damit wurde das teilweise paradoxe Missverhältnis zwischen einem sündhaften Leben auf der einen Seite und Ablassgebeten auf der anderen Seite aufgehoben. Der Mensch sollte nun im Rahmen einer innerweltlichen Askese jederzeit gottgefällig leben.4
Die äußere Folge dieser Trennung war der Bildersturm in den Kirchen. Als innere Folge wurde der Kampf gegen das Böse von der Äußerlichkeit – die der Katholizismus letztlich von der Vielgötterei der Griechen und Römer geerbt und mit Gott, Jesus, dem Heiligen Geist, Maria und natürlich Luzifer neben einer Vielzahl an Heiligen auf eine überschaubare Anzahl von Götzen reduziert hatte – in das Innenleben jedes einzelnen Menschen gebannt. Diese Verschiebung ins Innere führte nicht nur zur innerweltlichen Askese, sondern auf psychologischer Seite auch zur stetigen Selbstoptimierung. Konnte der Mensch früher auf die Erfüllung im Jenseits hoffen, muss er nun mithilfe seiner perfekten Identität die persönliche Erfüllung im Diesseits finden.
Während der Industrialisierung zogen die Menschen massenweise vom Dorf in die Stadt. Hier mussten sie sich als Individuen neu definieren. Bauern wurden zu Arbeitern und suchten sich neue Verbindungen und Zugehörigkeiten. Sie mussten lernen, sich gut darzustellen, um als vertrauenswürdig zu gelten. Das neue Sein bestimmte das Bewusstsein.
Heute treibt die digitale Welt die Entkoppelung zwischen dem, was mich bislang als Person ausmachte, und dem, was ich von mir präsentiere, auf die Spitze: Aufgehübschte Instagram-Biografien kämpfen um das knappe Gut der Aufmerksamkeit. Mit perfekt geplanten Abenteuerurlauben lässt sich vorzüglich online prahlen. Und ohne ein Auslandspraktikum scheint der im Netz präsentierte Lebenslauf kaum etwas wert zu sein. Nichts gegen Abenteuerurlaube und spannende Praktika. Aber sind sie wirklich ein Teil unserer Identität, die – wie wir gesehen haben – eng mit unserem Wesenskern verbunden sein sollte? Oder handelt es sich eher um ein gesellschaftliches Muss, ein perfektes Bild in der Öffentlichkeit abzugeben, auch wenn es mit mir selbst nur wenig zu tun hat?
Die Kabarettistin Lisa Eckhart sagte in einem Interview einmal: „Man muss eine Rolle spielen, um eine Rolle zu spielen.“ Der Mensch ist also gezwungen, sich aufgrund der Befreiung von traditionellen Zugehörigkeiten seine eigene Identität zu schaffen, um sich von anderen abzugrenzen und neue Verbindungen aufzubauen. Damit sind große Chancen verbunden. Ich kann unabhängig von meiner Herkunft selbst entscheiden, was ich werden will und von mir zeigen möchte. Gleichzeitig erhöht sich jedoch der Druck auf jeden einzelnen Menschen, genau dies für sich zu entscheiden.5
Identität und Respekt
Sokrates nannte die Einforderung von Respekt für die eigene Leistung im Sinne einer Aufopferung für die Gesellschaft Thymia. Für eine selektive Gruppe von Menschen, damals die Aristokraten, die als Krieger für ihr Land mehr riskierten als andere, galt der Begriff „Megalothymia“.6
Übertragen auf unsere Zeit gibt es ebenso Gruppen von Menschen, die täglich mehr riskieren als andere und denen dafür Respekt gezollt werden sollte. Während uns in normalen Zeiten dazu spontan die Feuerwehr oder Polizei einfällt, traten in Corona-Zeiten insbesondere Berufe im Kranken- und Pflegesektor, aber auch Wissenschaftlerinnen, Landwirte oder allgemein Versorgungsdienstleisterinnen in den Vordergrund. Die berufliche Identität dieser systemrelevanten Berufe wurde medial gewürdigt. Gleichzeitig traten vermeintlich systemirrelevante Berufe in den Hintergrund. Gastwirte, Freiberuflerinnen oder Künstlerinnen gerieten teilweise sogar in Existenznöte und fragten sich, wie ihre Rolle in der Gesellschaft aussah. Bei diesen Menschen könnten die Pandemie und der gesellschaftliche Umgang mit ihnen in der Krise zu einem heftigen Biografiebruch geführt haben. Wie sieht es aus mit der Würde und Identität dieser Menschen?
Gesellschaftliche und individuelle Identität
Führen wir uns vor Augen, dass der Identitätsbegriff sowohl das Innenleben eines Menschen als auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe beschreibt – ich bin ebenso ein Mensch mit bestimmten Eigenschaften wie eine Künstlerin oder eine Krankenpflegerin –, lassen sich höhere und tiefere Identitätsschichten unterscheiden. Wer sich nur auf die höheren Schichten beruft und seine Identität ausschließlich auf die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, Nation oder Ethnie bezieht, ist offenbar nicht in der Lage oder willens, sich mit der tieferen Schicht seiner Identität auseinanderzusetzen.
In der Extremversion dieser Tiefendimension und damit identitären Loslösung von sozialen Gruppierungen sehen wir Friedrich Nietzsches Zarathustra. Diese fiktive Figur ist der Prototyp eines Menschen, der nach höheren Werten sucht, ohne sich an anderen zu orientieren. Zarathustra zieht sich in die Berge zurück, um zu sich selbst zu finden. Damit entfremdet er sich jedoch von der Menschheit. Als er von seinem Berg wieder hinabsteigt, scheitert er daran, seine Werte mit anderen zu teilen. Was ihm fernab der Menschheit so klar erschien, muss mit den anderen Menschen erst verhandelt werden.
Dahinter steht die Urfrage der Philosophie, Psychologie und Pädagogik, ob der Mensch von Grund auf gut ist und erst durch die Gesellschaft verdorben wird oder ob er von Grund auf böse ist und von der Gesellschaft erzogen werden muss. Es ist wohl von beidem etwas wahr. Hätte jeder Mensch ausschließlich individuelle Moralvorstellungen, hätten wir vielleicht eine Art unverfälschte Identität. Wir brauchen jedoch den Austausch mit anderen und damit zwangsläufig die Verwässerung unserer hohen Ideale. Anders formuliert: Wir müssen uns als Individuum mit den Werten anderer Individuen auseinandersetzen, um gesellschaftsfähig zu bleiben.7
Wird die Suche nach einer individuellen oder gruppenzugehörigen Identität jedoch zur Obsession, birgt sie Sprengstoff in sich. Der Mensch ist heute nicht nur frei, sich seinen Lebensstil auszusuchen, um glücklich und erfolgreich zu werden. Er steht auch unter dem Druck des Scheiterns und fürchtet die Scham, wenn er es nicht schafft. Damit gehen Konflikte der Abgrenzung und Verteidigung einher. In einer Gesellschaft, in der es zur Pflicht wird, eine ureigene Identität zu verkörpern, fühlt sich der Mensch schneller angegriffen.8 Dabei nimmt die zwanghafte Suche nach Individualität zuweilen paradoxe Züge an. Oder wie meine jüngere Tochter sagt: „Die Kinder in meiner Klasse wollen unterschiedlich aussehen.“ Dabei folgen sie letztlich doch alle den gleichen Moden.
Der moderne Mensch hier im Westen pendelt also zwischen einer beinahe schon zwanghaften Individualität und einer Sehnsucht nach Anerkennung durch wenigestens eine Gruppe. Sobald er Teil einer solchen Gruppe wird, kämpft er in einem Konflikt nicht nur für seine eigenen Interessen, sondern immer auch für die Interessen seiner sozialen Gruppe. Er braucht andere Menschen, mit denen er sich identifizieren kann, aber auch um seine Rechte im Rahmen von Gewerkschaften oder Bürgerbewegungen durchzusetzen, wie beispielsweise der Black-Lives-Matter- oder metoo-Bewegung.9
Damit ergeben sich für die moderne Identität zwei Konfliktherde: Die komplette Orientierung an einer sozialen Gruppe verschließt individuelle Freiräume in Diskussionen. Die Loslösung von sozialen Verbindungen führt zu Narzissmus und Überheblichkeit. Beide Extremformen sind insbesondere im Internet konfliktfördernd, da der Mensch mit all seinen Facetten hier entweder hinter seiner Gruppenzugehörigkeit verschwindet – ich diskutiere nur noch als Klimawandelskeptiker oder -befürworter – oder er lässt sich als Narzisst gar nicht erst auf eine Diskussion ein.
Dabei kann eine vielseitige Identität, die weder hinter sozialen Gruppierungen verschwindet, noch sich von ihnen entfremdet, eine Grundlage für spannende Diskussionen sein. So wie Monokulturen in der Landwirtschaft langfristig die genetische Vielfalt zerstören, zerstört einseitiges Denken die Kreativität einer Gemeinschaft.10 Wir legen mittlerweile viel Wert auf Diversität. Dennoch schaffen wir es nicht, den Gedanken der Diversität so zu leben, dass wir die Konflikte zwischen unterschiedlichen Identitätsinteressen nicht nur akzeptieren, sondern auch anerkennend betrachten, um daraus eine lebendige Gesellschaft zu gestalten.
Uns macht nicht nur das aus, was wir als unseren Wesenskern bezeichnen, sondern auch das, was wir nach außen hin zeigen und wofür wir uns einsetzen:
Worin besteht Ihre gesellschaftliche und worin Ihre individuelle Identität?
Was hoffen Sie, als Teil einer Gruppe zu erreichen?
Wann sollten Sie sich stärker vor sozialen Vereinnahmungen abgrenzen, um mehr als Mensch und nicht nur als Teil einer Gruppe wahrgenommen zu werden?
Gibt es Aspekte Ihrer Identität – beruflich oder privat – für die Sie sich gesellschaftlichen Respekt oder zumindest Toleranz wünschen?