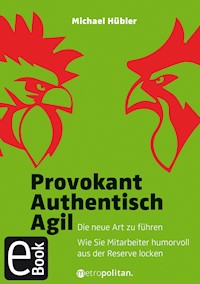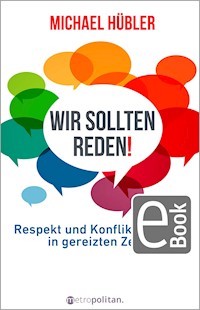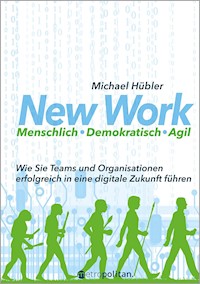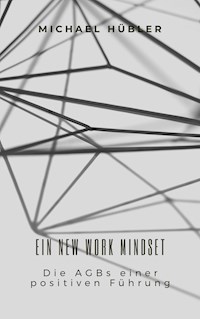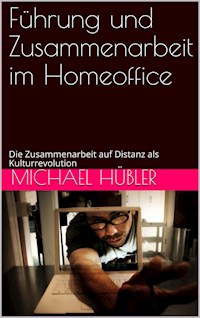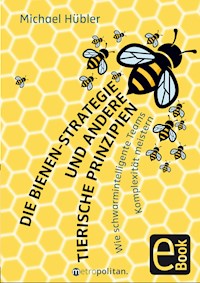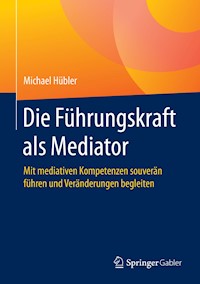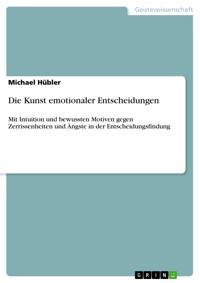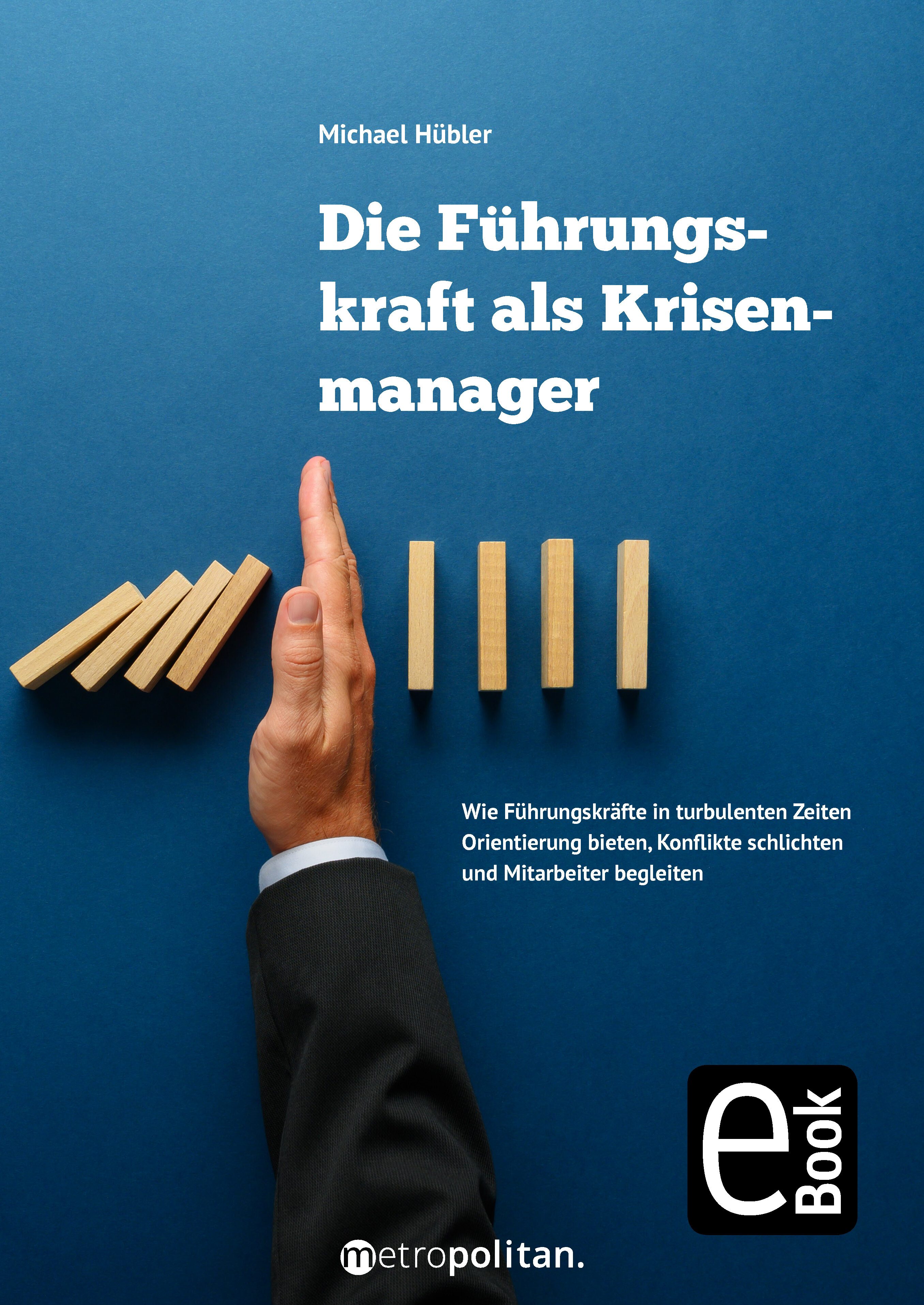
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metropolitan
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Führung auf Distanz
Führungskräfte sind in der derzeitigen Krise mehr denn je gefordert. Während die großen Entscheidungen von anderen getroffen werden, besteht ihre Aufgabe darin „den Laden zusammenzuhalten“. Ähnlich wie Politiker oft weit weg von ihren Bürgern sind, ist auch das Management oftmals weit weg von den Mitarbeitern. Führungskräfte jedoch sollten nah dran sein an ihren Leuten. In der aktuellen Situation einer Führung auf Distanz ist dies besonders schwer. In der Anfangsphase geht es dabei vor allem darum, Mitarbeitern ein gutes Vorbild zu sein und ihnen Stabilität, Sicherheit und Orientierung zu bieten.
Darüber hinaus werden im Verlauf einer Krise noch ganz andere Rollen einer Führungskraft benötigt:
- Die Führungskraft als Coach steht besonders unsicheren Mitarbeitern in die Krise wohlwollend und vorwurfsfrei bei.
- Die Führungskraft als Dolmetscher übersetzt die Nachrichten aus Politik und Management und deren Bedeutung für die Mitarbeiter.
- Die Führungskraft als Talentscout nutzt die Krise als reales Assessment-Center.
- Und die Führungskraft als Mediator ist insbesondere dann gefragt, wenn die erste Phase der Krise überstanden ist und der Ärger zwischen den Mitarbeitern über den persönlichen Umgang mit der Krise wieder Raum bekommt.
Auf was Führungskräfte dabei jeweils achten sollten, zeigt das vorliegende E-Book Die Führungskraft als Krisenmanager.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Führung auf Distanz
Führungskräfte sind in der derzeitigen Krise mehr denn je gefordert. Während die großen Entscheidungen von anderen getroffen werden, besteht ihre Aufgabe darin „den Laden zusammenzuhalten“. Ähnlich wie Politiker oft weit weg von ihren Bürgern sind, ist auch das Management oftmals weit weg von den Mitarbeitern. Führungskräfte jedoch sollten nah dran sein an ihren Leuten. In der aktuellen Situation einer Führung auf Distanz ist dies besonders schwer. In der Anfangsphase geht es dabei vor allem darum, Mitarbeitern ein gutes Vorbild zu sein und ihnen Stabilität, Sicherheit und Orientierung zu bieten.
Darüber hinaus werden im Verlauf einer Krise noch ganz andere Rollen einer Führungskraft benötigt:
Die Führungskraft als Coach steht besonders unsicheren Mitarbeitern in die Krise wohlwollend und vorwurfsfrei bei.Die Führungskraft als Dolmetscher übersetzt die Nachrichten aus Politik und Management und deren Bedeutung für die Mitarbeiter.Die Führungskraft als Talentscout nutzt die Krise als reales Assessment-Center.Und die Führungskraft als Mediator ist insbesondere dann gefragt, wenn die erste Phase der Krise überstanden ist und der Ärger zwischen den Mitarbeitern über den persönlichen Umgang mit der Krise wieder Raum bekommt.Auf was Führungskräfte dabei jeweils achten sollten, zeigt das vorliegende E-Book Die Führungskraft als Krisenmanager.
Autor
Michael Hübler ist Mediator, Berater, Moderator und Coach für Führungskräfte und Personalentwickler. Als Führungscoach und Konfliktmanagementtrainer zeigt er, wie wertvoll der Schritt von einer „Heilen-Welt-Philosophie“ zu einer transparenten, agil-mutigen Führung ist.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Krise? Welche Krise?
2. Die Führungskraft als Vorbild in turbulenten Zeiten
3. Zwischenstopp 1: Führung braucht Glaubhaftigkeit
4. Autorität kommt niemals aus der Mode
5. Zwischenstopp 2: Respekt als sozialer Kitt
6. Die Führungskraft als Dolmetscher
7. Die Führungskraft als Talentscout
8. Die Führungskraft als Coach
9. Die Führungskraft als Mediator
10. Fazit
11. Literaturverzeichnis
Vorwort zur aktuellen Lage
Ende März 2020. Die Corona-Krise hat Deutschland fest im Griff. Als Berater, Trainer und Mediator fallen auch bei mir einige Aufträge weg. Das große C zwingt mich ebenso wie viele andere aus meiner Branche zum Umdenken. Einiges lässt sich auf E-Learning umstellen, bei anderen Themen ist das schwerer. Zudem erscheinen mir manche meiner Themen plötzlich nichtig, während andere Themen erst recht relevant wurden. Beispielsweise das Thema „Führung auf Distanz – Wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind“. Die Anfragen zu diesem Thema sind jedoch nicht tagesfüllend.
Nachdem ein paar restliche Aufträge abgearbeitet, letzte Rechnungen gestellt waren und sich auch bei mir der erste Schock legte, kamen die Ideen in der Kreatise.1 Eine davon führte zu diesem E-Book. Ein kleiner Teil dieses Werks war bereits fertig, ein anderer Teil wurde auf der Basis bereits vorhandener Bücher auf seine wesentlichen Bestandteile reduziert, wo notwendig auf die Krise zugespitzt oder erweitert. Der Rest, der größte Teil, entstand im schreibenden Fieberwahn. Ich schrieb noch nie in so kurzer Zeit so viel. Jeder Tag brachte neue Veränderungen und Erkenntnisse zum Umgang mit Krisen, von denen viele in das vorliegende E-Book einflossen. Immerhin sind wir alle quasi Mitarbeiter des Unternehmens Deutschland, Europa oder sogar der gesamten Welt.
Freilich lassen sich nicht alle Schlüsse aus Ablauf und politischem Management der Covid-19-Krise auf den Umgang von Firmen mit Krisen übertragen. Dennoch zeigt uns diese Situation, wie drastisch Veränderungen sein können, was eine solche Extremsituation mit Menschen macht und was wir bzw. Führungskräfte daraus lernen können. Nüchtern betrachtet ist die Corona-Krise ein riesiges ungeplantes Experiment. Es wäre schade, bei aller Dramatik, hieraus keine Schlüsse zu ziehen.
Als Experte für Führungsthemen liegt mein Fokus auf Führungskräften, die sich – wie so oft – auch in der Krise mitten im Auge des Sturms befinden. Da es aktuell nur wenig Handreichungen gibt, muss hier jeder seinen Weg selbst finden. Derzeit befinden sich viele Führungskräfte ebenso im Suchmodus wie die halbe Republik. Wir alle betreten hier Neuland, manche mehr, manche noch viel mehr. Dennoch können wir dabei auf viele alte Erfahrungen und, wenn Sie so wollen, Führungshaltungen zurückgreifen. In diesem Sinne soll Ihnen dieses Buch nicht nur in der aktuellen Zeit, sondern grundsätzlich in Krisen helfen, als Führungskraft stabil zu bleiben und damit auch Ihren Mitarbeitern Stabilität zu vermitteln.
Was also können Führungskräfte tun? Wie sollten sie sich positionieren? Wie sollten sie auftreten, um ihren Mitarbeitern in der Krise eine sichere Orientierung zu bieten und gemeinsam mit ihnen diese schwierigen Zeiten zu meistern? Antworten auf diese Fragen finden Sie in diesem E-Book.
Michael Hübler
Ein Mischwort aus Krise und Kreativität.
1. Krise? Welche Krise?
1.1 Ein typischer Krisenablauf
1.2 Herausforderungen in der Krise
1.3 Aufgaben einer Führungskraft in der Krise
1.4 Rollen einer Führungskraft in der Krise
1.1 Ein typischer Krisenablauf
Bevor wir zu Ihnen als Führungskraft kommen, schauen wir uns zunächst an, was typisch für Krisen ist. Jede Krise folgt in groben Zügen einem klaren Ablaufplan, der sich grob mit dem klassischen Veränderungsmodell nach Richard K. Streich deckt:2
Zuerst kommt die Konfrontation mit einer neuen Wahrheit. Während sich betriebliche Reaktionen, beispielsweise Umstrukturierungen aufgrund von Veränderungen in der Umwelt, manchmal Zeit lassen, oftmals auch zu viel, kommen Krisen – eine plötzliche Pleite, ein wegfallender Lieferant oder ein Brandfall – so plötzlich, dass nur noch der Schock bleibt. Und dennoch muss so schnell wie möglich reagiert werden.
2.Mit Schocksituationen geht jeder anders um. Ein Schock macht den Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit offensichtlich. Manche verdrängen das Offensichtliche, sofern es geht. Hier kommt es darauf an, wer in der Verantwortung steht und wer nicht. Andere wettern dagegen an: Warum jetzt? Warum wir? Warum so heftig? Wieder andere sehen bereits die Apokalypse am Himmel: Werden wir da jemals wieder herauskommen?
3.Als Nächstes folgt die rationale Einsicht: Es muss ja weitergehen. Der Geist zwingt den noch unwilligen Körper zur Handlung. In normalen Veränderungen entsteht relativ schnell ein Masterplan zum Umgang mit der schwierigen Situation, möglichst mittels eines positiven, negativen und realistischen Szenarios. Führungskräfte, die in der Arbeit mit Szenarien geschult sind, begleiten ihre Leute dabei, das Erreichen positiver Szenarios zu fördern, negative zu verhindern und die realen zur Erdung des Teams zu nutzen. Haben wir es jedoch mit einer Krise zu tun, die wie ein Schock über uns kam und die niemand im Unternehmen zuvor in dieser Dimension erlebt hatte, fallen Prognosen schwerer. Hier wird häufig von sogenannten schwarzen Schwänen gesprochen. Nur weil noch niemand einen schwarzen Schwan gesehen hat, bedeutet das nicht, dass es keinen gibt. Auch dann ist es wichtig, Szenarien aufzustellen. Sie dauern jedoch, insbesondere wenn die Entwicklung in Wellen abläuft, länger als normal. Die spanische Grippe beispielsweise verlief in drei Wellen und dauerte insgesamt ein Dreivierteljahr.
Übertragen wir das Bild und die Dramatik einer solchen Pan- oder Epidemie auf Firmenkrisen, ist es auch hier sinnvoll, sich von Welle zu Welle zu hangeln und aus jeder Welle für die nächste zu lernen. Letztlich bedeutet das nichts anderes, als einen Projektplan aus mehreren Phasen – den Wellen – aufzustellen und nach jeder Phase Erkenntnisse für die nächste Phase zu gewinnen. Auch hier ist es wenig hilfreich, von einer Krise über die nächsten Jahre zu sprechen. Hier versagt die Vorstellungskraft des menschlichen Geistes, zumal die meisten Menschen mehr oder weniger ihre Zeit bis zu ihrem nächsten Urlaub planen. Ein Hangeln von Welle zu Welle kommt dem menschlichen Denken wesentlich näher. Drei bis vier Monate sind überschaubar und lösen überschaubare Ängste aus.
Informationslage
Auf welche Informationen bezogen wir uns?
Reichten die Informationen aus oder fehlten welche?
Welche Informationen wollten wir nicht wahrhaben?
Welche Schlüsse zogen wir aus den vorhandenen Informationen?
Austausch, Zusammenarbeit und Konflikte
Was veränderte die Krise an unserem Umgang miteinander?
Wie gingen wir mit Problemen, Hindernissen, Konflikten oder unerwarteten Wendungen um?
Wie sollten wir in der nächsten Welle miteinander umgehen?
Kompetenzen und Lerneffekte
Welche Kompetenzen wurden durch die Krise erweitert?
Welche Kompetenzen fehlten oder fehlen noch immer?
Welche Fortbildungen zur Erweiterung der Kompetenzen wären sinnvoll?
Was haben wir sonst noch aus der Krise gelernt?
Welche Erkenntnisse sind besonders wichtig für die nächste Welle?
Welche Erkenntnisse waren erwartbar, welche überraschend?
Für wen sind diese Erkenntnisse (besonders) wichtig?
Welche Empfehlungen ergeben sich daraus? Welche Schlüsse ziehen wir daraus?
Nun kommt die Phase der emotionalen Akzeptanz. Diese kann bereits nach der ersten Welle stattfinden. Ist die erste Welle geschafft, sind die Menschen für die zweite Welle gewappnet. Auch hier liegt eine Übertragung auf Firmen näher, als wir zuerst annehmen. Auch in Firmenkrisen erscheinen Veränderungen in Wellen: Die erste Welle wird deutlich unangenehmer wahrgenommen als alle weiteren. Nach und nach greift jedoch der Gewöhnungseffekt. Die Menschen wissen: Ein Zurück gibt es so oder so nicht. Der Blick muss sich nach vorne richten. Zudem wird es meistens nicht so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Wenn doch, gewöhnen wir uns auch daran.
5.Anschließend folgen die ersten Erkenntnisse innerhalb der Lernphase. Auch hier zeigt sich, dass der persönliche Umgang mit Krisen bereits nach der ersten großen Welle eintritt. Manche halten die Unsicherheiten, was die Zukunft betrifft, aus. Anderen fällt es schwer. Auf persönlicher Ebene werden Erkenntnisse zu Kompetenzen – noch wackelig, aber immerhin.
Persönlicher Umgang mit der Krise
Wie geht jeder selbst mit der Krise, den Unsicherheiten und Hiobsbotschaften um?
Wie wird mit Gerüchten umgegangen?
Wer tendiert dazu, wütend zu werden und wer würde sich am liebsten verkriechen?
Wer wartet ab und wer wird aktionistisch?
Wem geht es zu schnell und wem zu langsam?
Wer ist loyal, wer zu kritisch und wer zu unkritisch?
Wer ruft nach einem Macher, der in der Krise den Ton angibt und damit Sicherheit suggeriert? Wer weigert sich, Machern zu folgen? Wer lässt sich auf schwarmintelligente Prozesse ein?
Gestaltung der Zukunft
Wie stellen wir uns die Zukunft vor?
Welche Werte wurden wichtiger, welche unwichtiger? Haben sich Prioritäten verschoben? Wenn ja, wie?
Wie verändert die Krise unseren Blick auf unsere Kollegen, Führungskräfte und Manager?
Wie verändert sie unseren Blick auf die Welt?
Wie wird die Krise unsere Zusammenarbeit verändern?
Was haben wir (wirklich) daraus gelernt?
Worin bestand der tiefere Sinn hinter der Krise (sofern es einen gibt)?
In welcher Phase welche Fragen zum Einsatz kommen sollten, ist schwer zu sagen. Grundsätzlich gilt: Zu Beginn der Aufarbeitung sind eher die sachlich-fachlichen Fragen sinnvoll, später die emotionalen. Dennoch kann es Pendelbewegungen geben.
Schließlich folgt die Integrationsphase. Der persönliche Umgang wird zu einem allgemeinen Umgang. Kompetenzen zur Bewältigung der Krise werden verallgemeinert. Das Wissen um die Erfahrungen des Meisterns der ersten Wellen verleiht Resilienz. Nun geht es darum, die neuen Erfahrungen, Erkenntnisse und das Wissen in den Alltag zu integrieren.
Umsetzung der Erfahrungen, Erkenntnisse und des Wissens
Welche konkreten Schlüsse zieht jeder für sich und seinen Arbeitsalltag sowie im Ausblick auf die nächste Krise?
Wie wollen wir zukünftig mit Gerüchten umgehen?
Wie viel Akzeptanz haben wir für den unterschiedlichen Umgang mit Krisen?
Wie lässt sich diese Akzeptanz konkret fördern, beispielsweise mit ehrlichen Selbstoffenbarungen der eigenen Ängste?
Wie schaffen wir es, die diverse Mischung aus unterschiedlichen Charakteren (schnell, langsam, loyal, kritisch ...) produktiv zu nutzen?
In welchen Situationen ist ein Macher sinnvoll und in welchen nicht?
Wie wollen wir unsere neuen Prioritäten und Werte in Taten verwandeln? Müssen dazu Abläufe oder Strukturen verändert werden? Wenn ja, welche und wie?
Sollten wir den Sinn der Krise noch genauer herausarbeiten?
Wie wollen wir in Zukunft miteinander umgehen und zusammenarbeiten? Wovon sollten wir mehr machen, wovon weniger?
vgl. https://organisationsberatung.net/change-management-modelle-im-vergleich – abgerufen am 01.03.2020
1.2 Herausforderungen in der Krise
Krisen, so heißt es häufig, sind ein Charaktertest. Tatsächlich fördern Krisen das Beste und Schlechteste im Menschen. Wer sich in Zeiten der Corona-Krise im Netz tummelt, beispielsweise auf Facebook oder Twitter, weiß, was mit dem Schlechtesten gemeint ist. Die Menschen katastrophisieren, lassen sich von aus dem Kontext gerissenen Zahlen hypnotisieren, laufen medialen Wanderpredigern hinterher, extrapolieren Einzelschicksale zu Massenphänomenen und gehen sich gemeinsam virtuell an die Gurgel. Aus Angst wird Wut. Aus einer normalen Diskussion wird schnell ein Kampf. Aus einer Meinung ein Angriff und nach dem Gegenangriff wird die Freundschaft gekündigt. Schlechte Zeiten für Senskeptiker.3 Auf der anderen Seite wachsen auch die Solidarität und die Kreativität: Liefer- und Einkaufsdienste oder ehrenamtliche Konfliktberatungen per Telefon werden ins Leben gerufen, gemeinschaftlich werden Behelfsmasken genäht. Der Mensch ist eben beides: des Menschen Wolf und des Menschen Freund.