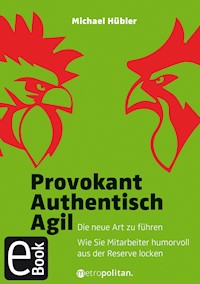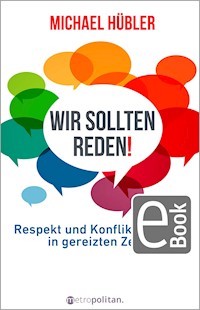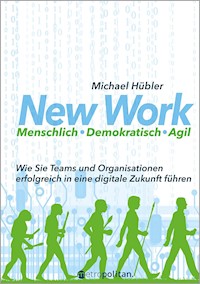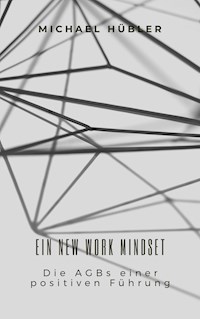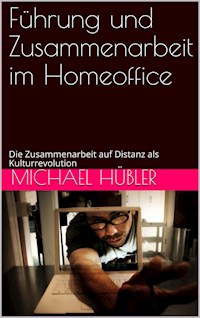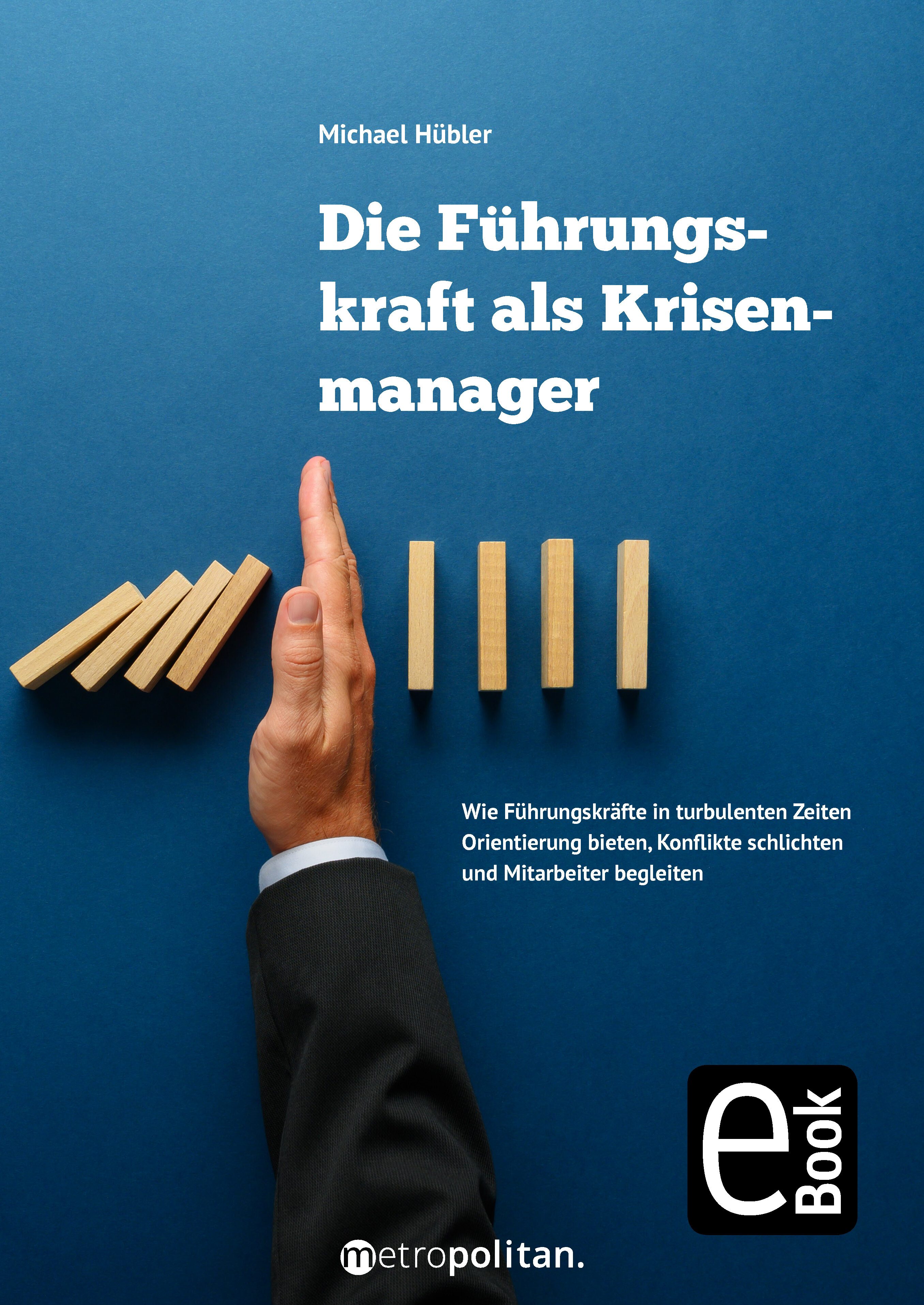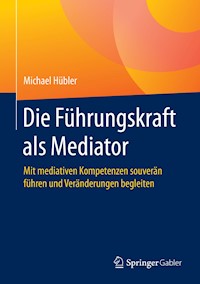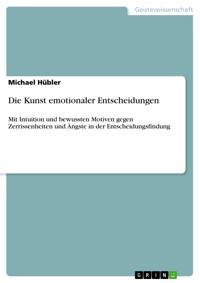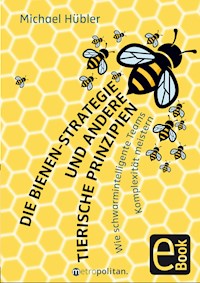
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metropolitan
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Menschlichkeit lernen von Bienen, Ameisen und Co.
Je weiter der technische Fortschritt voranschreitet, desto drängender stellt sich die Frage nach dem Rest an Menschlichkeit in unserer Arbeitswelt. Ausgerechnet unsere Umwelt, mit ihren tierischen und pflanzlichen Angehörigen, hält zahlreiche Beispiele für die Suche nach unseren Stabilitätswurzeln bereit.
Die innere Verbundenheit von Symbiosen und Schwärmen umrankt etwas Magisches. Von außen kaum erkennbar oder sogar chaotisch, werden sie von einem unsichtbaren Band zusammengehalten. Damit die Verbindung zueinander bestehen bleibt, reicht den Tieren und Pflanzen, im Gegensatz zu uns Menschen, die fortwährende Anpassung durch Variation und Selektion. Ist die Herrscherin etwa nicht präsent, bricht Chaos im Schwarm aus. Ansonsten glänzt sie durch königliche Zurückhaltung.
Dabei stechen besonders Bienen als Beispiel für intelligentes Schwarmverhalten hervor. Mit ihrem Schwänzeltanz verfügen die kleinen Sympathieträger – ähnlich wie wir Menschen – über ein Symbol- und Sprachsystem. Mit diesem leiten sie Informationen weiter und treffen basisdemokratische Entscheidungen. Auch die Rolle der Königin als zentrale Führungskraft im Bienenschwarm eröffnet uns spannende Erkenntnisse.
Die Reflexion über Aufbau und Funktionsweisen eines Bienenschwarms bietet einen idealen Ausgangspunkt zur Übertragung tierischer Prinzipien auf schwarmintelligente Teams und solche, die es werden sollten, um schnell, autonom und kompetent mit komplexen Aufgaben umzugehen. Die Tier- und Pflanzenwelt hat jedoch neben der Bienen-Strategie noch wesentlich mehr Beispiele für ein perfektes und oft überraschendes Co-Working zu bieten, aus denen Führungskräfte und Teams eine Menge lernen können – zumal jedes Team vor anderen menschlichen Herausforderungen steht.
Im neuen Werk von Autor Michael Hübler Die Bienen-Strategie und andere tierische Prinzipien schreibt er über genau diese Themen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Menschlichkeit lernen von Bienen, Ameisen und Co.
Je weiter der technische Fortschritt voranschreitet, desto drängender stellt sich die Frage nach dem Rest an Menschlichkeit in unserer Arbeitswelt. Ausgerechnet unsere Umwelt, mit ihren tierischen und pflanzlichen Angehörigen, hält zahlreiche Beispiele für die Suche nach unseren Stabilitätswurzeln bereit.
Die innere Verbundenheit von Symbiosen und Schwärmen umrankt etwas Magisches. Von außen kaum erkennbar oder sogar chaotisch, werden sie von einem unsichtbaren Band zusammengehalten. Damit die Verbindung zueinander bestehen bleibt, reicht den Tieren und Pflanzen, im Gegensatz zu uns Menschen, die fortwährende Anpassung durch Variation und Selektion. Ist die Herrscherin etwa nicht präsent, bricht Chaos im Schwarm aus. Ansonsten glänzt sie durch königliche Zurückhaltung.
Dabei stechen besonders Bienen als Beispiel für intelligentes Schwarmverhalten hervor. Mit ihrem Schwänzeltanz verfügen die kleinen Sympathieträger – ähnlich wie wir Menschen – über ein Symbol- und Sprachsystem. Mit diesem leiten sie Informationen weiter und treffen basisdemokratische Entscheidungen. Auch die Rolle der Königin als zentrale Führungskraft im Bienenschwarm eröffnet uns spannende Erkenntnisse.
Die Reflexion über Aufbau und Funktionsweisen eines Bienenschwarms bietet einen idealen Ausgangspunkt zur Übertragung tierischer Prinzipien auf schwarmintelligente Teams und solche, die es werden sollten, um schnell, autonom und kompetent mit komplexen Aufgaben umzugehen. Die Tier- und Pflanzenwelt hat jedoch neben der Bienen-Strategie noch wesentlich mehr Beispiele für ein perfektes und oft überraschendes Co-Working zu bieten, aus denen Führungskräfte und Teams eine Menge lernen können – zumal jedes Team vor anderen menschlichen Herausforderungen steht.
Im neuen Werk von Autor Michael Hübler Die Bienen-Strategie und andere tierische Prinzipien schreibt er über genau diese Themen.
Autor
Michael Hübler, ist Mediator, Berater, Moderator und Coach für Führungskräfte und Personalentwickler. Als Führungscoach und Konfliktmanagementtrainer zeigt er, wie wertvoll der Schritt von einer „Heilen-Welt-Philosophie“ zu einer transparenten, agil-mutigen Führung ist.
Schnellübersicht
Vorwort
1. AUF DEM WEG ZUM KOMPLEXITÄT MEISTERNDEN LEISTUNGSTEAM
2. DIE VIER ECKPFEILER SCHWARMINTELLIGENTER TEAMLEITUNG
3. TEAMPROBLEME UND UNBEWUSSTE REGELN
4. KOMPLEXITÄTS REDUKTION DURCH SYMBIOSEN UND SCHWARMPRINZIPIEN
5. STATUSTEAMS ZWISCHEN KONKURRENZKAMPF UND SYMBIOSE
6. VOM HARMONIKERCLUB ZUR PERFEKTEN ZUSAMMENARBEIT
7. VOM CHAOTISCHEN AMEISENHAUFEN ZUM PERFEKT ORGANISIERTEN BIENENSCHWARM
8. TIERISCHE PRINZIPIEN ZUR STABILISIERUNG UND SYNCHRONISIERUNG IN EINER AGILEN WELT
9. IN FÜNF PHASEN ZUM KOMPLEXITÄTSMEISTERNDEN SCHWARM
Anhang
Zum aktuellen Stand unserer Arbeitswelt: Projekte, Prinzipien und die Tierwelt
Der homo proicere
Kühe könnten statt Gras und Heu auch Getreide zu sich nehmen. Eine solche Umstellung und damit die Gewöhnung braucht jedoch Zeit, da sich zunächst neue Mikroben im Darm der Tiere ansiedeln müssen, um die neue Nahrung verarbeiten zu können. Eine zu schnelle Umstellung könnte tödlich enden.1
Dass die Gewöhnung an ein neues Teammitglied ebenso Zeit braucht, wie grundsätzlich jede Veränderung, sollte selbstverständlich sein. In der Realität sieht es jedoch anders aus. Denken wir nur an unsere eigenen beruflichen Partnerschaften und Kooperationen – da sollte es immer ganz schnell gehen. Der omnipräsente Zeitdruck gibt den Takt vor und bietet wenig Raum für einen sanften Einstieg. Willkommen in einer ruhelosen Gegenwart, in der wir von Projekt zu Projekt hetzen!
Das Wort „Projekt“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „das vorwärts Geworfene oder Ausgestreckte“. „Homo proicere“ bedeutet damit der „vorwärts geworfene Mensch“ – der Mensch, der kaum noch im Jetzt lebt, sondern sich stattdessen von Projekt zu Projekt, von Job zu Job, von Aufgabe zu Aufgabe hangelt, ohne fortlaufende Kontinuität und erst recht ohne aufgearbeitete Fehler.
Modernes Arbeiten läuft in spontanen, kurzfristig zusammengewürfelten Leistungsteams ab, die sich nach Projektende wieder trennen, bevor erneut gewürfelt wird. Dieser stetige Prozess erfordert eine neue Art Mensch und Mitarbeitertypus, der sich flexibel und adaptiv auf Veränderungen einstellt. Kein Wunder, dass moderne Unternehmen einen Mitarbeiterdurchlauf von bis zu 40 Prozent haben. Dafür gibt es in Traditionsunternehmen die eine oder andere Leiche in der Registratur.
Sollen Mitarbeiter in einer agilen und volatilen Welt stetige Veränderungen mitmachen, und zwar mit Freude, braucht es mehr als nur ein paar aufmunternde Worte und Hauruck-Reden. Die Verunsicherung, im nächsten Projekt außen vor oder in der nächsten Reorganisationsrunde nicht mehr dabei zu sein, weil andere kompetenter sind, die Umstände es nicht erlauben, alle mitzunehmen oder die digitale Dunkelverarbeitung einen Teil der Aufgaben übernimmt, steckt für einige Mitarbeiter tief. Möglicherweise hat das beliebte Akronym für Team – Toll, ein anderer machts – hier seinen Ursprung: Warum soll ich mich bemühen, wenn es am Ende doch wieder anders kommt? Für die eigene Psychohygiene ist diese aktive Befehlsverweigerung gesünder, als später das Nachsehen zu haben. Kein Wunder, dass wir die Teams, die wir kennen, nicht immer in bester Erinnerung haben: Top-down der Befehl, Aufgaben demokratisch gemeinsam zu meistern, der Umgang im Team mit frontalem Weichspülcharakter und hinter der Bühne laufen Machtspiele ab, bis einer heult.
Das Denken in Projekten und kurz getakteten Zeitabschnitten lässt die Schere in Unternehmen größer werden: zwischen denen, die noch mitkommen und den anderen, zwischen Menschen mit und ohne Familie, zwischen denen, die mit Feuereifer dabei sind, und denen, die nicht alles mitmachen wollen, vielleicht aus der Erfahrung, dass nicht jeder Plan zu einem erfolgreichen Ziel führt.
Als wir noch weniger flexibel und mobil sein mussten, hatten wir unsere festen Standorte, einen Beruf, der uns ein Leben lang begleitete und Kollegen, die wir jahrein, jahraus zum Plausch auf dem Gang trafen. Auch wenn wir manchen Gesichtern lieber aus dem Weg gegangen wären, verlieh dies dem Leben eine gewisse Kontinuität. In vielen Firmen gab es zudem Betriebsfeste, -ausflüge und regelmäßige Stammtische, um Bindungen an das Unternehmen sowie in der Belegschaft zusätzlich zu festigen. Statt dieser natürlichen Bindungsmaßnahmen finden Teambildungen heute im Freizeitpark statt. Hinzu kommt ein stetiger Arbeitsplatzwechsel, sofern die Menschen überhaupt noch einen Arbeitsplatz haben. Flexibilität über alles!
Mit jedem Wechsel gehen jedoch Bindungen verloren. Auf der Haben-Seite steht: Wir können alles tun, was wir wollen. Auf der Soll-Seite steht hingegen: Wir müssen es auch. Pack die Gelegenheit beim Schopf! Nutze deine Chance! Betrachte deine Aufgaben als Herausforderung! Vielleicht sogar als Abenteuer! – Hand hoch, wer von Ihnen diese Lippenbekenntnisse aus dem Mund mancher Chefs noch ernstnimmt.
Damit wird der Wechsel zu einem Muss in unserer modernen Arbeitswelt. Tiefe langjährige Bindungen geraten zu oberflächlichen, digitalen Netzwerken und Kontakten. Oder werden gar nicht erst gepflegt, da wir wissen, dass sie ohnehin nicht von Dauer sind. Brauchen wir sie doch einmal, lassen sie sich sicherlich notdürftig reparieren. Damit wird der Mensch selbst zu einem Konsum- und Wegwerfgut, „plastic people“, wie Frank Zappa einst sang.
Die modernen Teambildungsmaßnahmen mit ihren Extremen liefern dazu ein profundes Spiegelbild2: Hochseilgarten, Ballonfahrten, Paintball, Escape- oder Parapark, Floßbau und Rafting, Geocaching, Theater und Improtheater, Biathlon-Fun-Challenges, Jonglieren lernen im Zirkus, Action-Painting-Workshops, Lassowerfen, Gokartfahren und Bogenschießen. Die Methoden sind dabei weniger das Problem als die Effekthascherei. Es gilt das Prinzip „Viel hilft viel“. Denn wer schon von einem einfachen Freibadbesuch gelangweilt ist, sollte eine Teambildungsmaßnahme geboten bekommen, die sich gewaschen hat. Natürlich können Teammitglieder lernen, sich aufeinander einzulassen, wenn sie beim Klettern gemeinsam im Seil hingen oder sich in Improtheaterübungen auf die kreativen Einfälle ihres Spielpartners stützten. Große und kleine Risiken erfordern ein gegenseitiges Vertrauen, das vermutlich auch in beruflichen Alltagssituationen greifen wird. Werden Teambildungsmaßnahmen jedoch ohne den Aspekt der Bindung durchgeführt, geht es wieder nur um Leistung, Hierarchie und Vergleiche: Wer jongliert länger? Wer führt sein Lama am souveränsten? Wer rast mit seinem Gokart riskanter durch die Kurven? Wer trifft zielgenauer beim Paintball? Wer ist wagemutiger? Wer kombiniert am schnellsten im Escapepark? Schneller, höher, weiter, riskanter. Die Reflexion möglicher Bindungen und resilienten sozialen Vertrauens ginge tiefer und würde mindestens so lange dauern wie die Durchführung der Maßnahme. Das erfordert Zeit und Geduld, die nur selten vorhanden ist. Zudem scheint hier eine weitere Maxime hinzuzukommen: Was teuer ist, hat einen Wert an sich und muss nicht mehr aufgearbeitet werden. Wie wäre es stattdessen mit: Einfach ist das neue nachhaltig?
Gefestigt, gewappnet, flexibel
Die großen Herausforderungen von morgen werden nicht durch möglichst extravagante Teambildungsmaßnahmen gelöst, sondern dadurch, welche Geschichten die Kollegen und Kolleginnen gemeinsam erlebt haben und wie diese Erlebnisse sie miteinander verbinden.
Wenn wir an die symbiotischen Verbindungen einzelner Tiere oder das Zusammenspiel ganzer Schwärme denken, werden auch diese durch eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Erlebnisse geprägt. Symbiotische Partnerschaften wuchsen an ihren evolutionären Höhen und Tiefen oder zogen zumindest die Konsequenzen aus ihren Erfahrungen. Schwärme überwinden gemeinsam Hindernisse und lernen daraus. In einem rauen Umfeld lassen sich Herausforderungen nur gemeinsam meistern.
In einer Welt, die sich zumindest immer komplexer anfühlt, liefert uns der Blick auf das Reich der Tiere und Kleinstzellen, die seit Jahrmillionen miteinander auskommen und sich stetig evolutionär weiterentwickeln, spannende Zusammenhänge und Lösungsansätze. Für eine Übertragung auf die Zusammenarbeit in Teams und den Umgang mit einer komplexen Umwelt bieten sich zwei zentrale Prinzipien an:
Symbiosen zeigen, wie eine enge Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehr Partnern auf höchst effektive Weise ablaufen kann.
2.Schwärme zeigen, wie die Perspektiven vieler so berücksichtigt werden, dass hochkomplexe Aufgaben im Zusammenspiel aller Teammitglieder elegant gemeistert werden.
Eine 1 zu 1-Übertragung dieser Prinzipien auf Organisationsprobleme und Teamsituationen wäre naiv. Tiere lassen sich von ihren Instinkten leiten, die ihnen einflüstern, wann sie am besten mit anderen kooperieren sollten, um zu überleben. Menschen hingegen nutzen ihren freien Willen, um unterschiedlichen Motiven und Bedürfnissen nachzugehen.
Die Vergleiche in diesem Buch, seien es Bienenschwärme oder Ameisenstraßen, Vogelschwärme oder die Symbiosen von Bäumen mit Orchideen und Pilzen, verdeutlichen organische Entwicklungen, die auch für Teams aus sozialen Aspekten und funktionalen Gründen erstrebenswert sind.
Der evolutionäre Erfolg oder zumindest Lernerfolg von Symbiosen und Schwärmen vermittelt uns Haltungen und Prinzipien als Orientierung für unser Leben und in diesem Buch insbesondere für das Zusammenspiel im Team. Haltungen und Prinzipien gehen dabei affektlogisch nach demselben Muster vor wie Religionen3: Sie entlasten unser Gehirn, weil sie uns sicher sein lassen, dass wir nichts falsch machen, solange wir nach diesen Prinzipien vorgehen. Während streng-religiöse Menschen sagen „Alles wird gut, wenn du an Gott glaubst“, glaube ich beispielsweise daran, dass es in der Regel gut ist, im Team fair für seine Überzeugungen zu kämpfen, um zu klären, wer welcher Meinung ist und um diese Sichtweisen kämpferisch auszutesten. Ähnlich wie es diverse Tierbabys im heimischen Nest tun, bevor sie mit der rauen Wirklichkeit außerhalb des kuscheligen Heims konfrontiert werden.
Während Tierbabys ihre Kräfte schulen, indem sie ihre Artgenossen aus dem Nest schubsen, führt eine solche Klärungsphase bei Teams zur Stabilisierung der Meinungen, bevor die einzelnen Teammitglieder außer Haus gehen. Die Alternativen zu diesem offenen, fairen und ehrlichen Schlagabtausch lauten:
Wenn es nicht erlaubt ist, sich offen auszutauschen, wird nach der Teamsitzung hinter vorgehaltener Hand gelästert.
oder:
Die Teammitglieder machen es mit sich selbst aus, drücken sich vor dem nächsten Meeting oder werden krank.
Der Begriff religio bedeutet im Ursprung mit allem verbunden zu sein.4 Ob wir ein derartiges Sicherheitsgefühl mit tierischen Prinzipien erreichen, bleibt fraglich. Die Kontexte, in denen wir Menschen leben, sind aufgrund unserer kulturellen Regeln komplizierter als im Tierreich. Während beispielsweise bei Delfinen die Entführung fremder Weibchen zwecks Paarung gang und gäbe ist5, gibt es bei uns Menschen gute kulturelle Gründe gegen solche Fortpflanzungsstrategien.
Vielleicht schaffen wir es jedoch, uns durch den Rückgriff auf die Tier- und Pflanzenwelt ein wenig verbundener mit der Welt im Gesamten zu fühlen. Da die Regeln zum Umgang zwischen Tier und Tier oder Tier und Pflanze seit Jahrtausenden immer wieder von der Natur auf ihre Gültigkeit geprüft wurde und ihr Bestand damit mehr als sicher gelten darf, können wir zumindest einiges daraus lernen. Gleichzeitig verschafft eine Einigung auf gemeinsame Prinzipien tatsächlich so etwas wie eine religio, die Verbundenheit im Team. Klare Prinzipien als Minimum der gegenseitigen Einigkeit, bei einem Maximum an Handlungsfreiheit.
Führung von morgen
Zur Vermittlung dieser Stabilität und Flexibilität gleichermaßen kommen wir nicht umhin, eine neue Art Führung6 zu etablieren, die
mehr Wert auf einen dialogischen Austausch legt, anstatt hierarchische Anweisungen zu geben.
einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, in dem Geschichten ebenso ihren Platz finden wie die Arbeit mit Metaphern, Bildern und die Ansprache von Emotionen.
den Mitarbeitern den Sinn ihrer Arbeit wiedergibt, was insbesondere in komplexen Zeiten Not tut. Ein Aspekt, der gerade über die Vermittlung organisch-evolutionärer Prinzipien, Geschichten und Metaphern funktioniert, da sie einen natürlichen, warmen Gegenpol zur kühlen Digitalisierung bieten.
Diversity in Unternehmen fördert, was insbesondere den Einbezug von Widerständen betrifft.
Ich stoße in Unternehmen regelmäßig auf Unverständnis bis Genervtheit, was den Begriff der Diversität angeht. Die allgegenwärtige Floskelitis zu Diversity, Agilität oder Digitalisierung macht es nicht besser. Wie wäre es, würden wir den Begriff der Diversity ganz im Sinne dieses Buches gegen Artenvielfalt austauschen? Klänge es nicht viel freundlicher, zu einem Nörgler zu sagen: „Du bist schon eine besondere Art. Besonders, aber im Sinne der Artenvielfalt schützenswert.“
Agile Bienen, clever und nachhaltig
Als Stellvertreter der Komplexitätsreduktion in der Tier- und Pflanzenwelt nehmen die Bienen eine besondere Symbolkraft ein. Die kleinen fliegenden Honigbomber gelten bei uns als besonders fleißig. Sie werden deshalb gerne als Symbol für agile Vorgehensweisen herangezogen. Dass Bienen nicht nur fleißig, sondern auch clever sind, zeigt ein vertiefter Blick in die Suche nach einem neuen Standort.
Suchen wilde Honigbienen einen Standort, können sie es sich nicht leisten, den erstbesten zu nehmen. Ebenso wenig können sie es riskieren, sich von der Meinung einer Person abhängig zu machen, ihrer Königin. Die ideale neue Behausung sollte schon wind- und wettergeschützt und für verschiedene Jahreszeiten geeignet sein. Und die Ein- und Ausgänge müssen auch passen. Eine große Zahl an Bienen fliegt deshalb los, um mögliche Stammplätze zu untersuchen. Kommen sie zurück, führen sie ihre Erkenntnisse mittels eines Tanzes auf, als freundliche Art Wettkampf um die Aufmerksamkeit der zuhause Verbliebenen. Anschließend überprüfen weitere Bienen die Standorte der interessantesten Tänze, bis sich nach und nach ein bestimmter Platz herauskristallisiert.7
Damit möchte ich Ihnen nicht nahelegen, Ihrem Team künftig Ihre Meinung in einem Tanz vorzuführen oder die anderen Mitglieder dazu aufzufordern – obwohl? Wir sollten uns allerdings regelmäßig überlegen, wo unsere Agilität uns als Einzelperson, Team oder Organisation hinführt und ob dies langfristig clever ist. Oder ob es nicht manchmal energiesparendere, sinnvollere oder menschlichere Wege gibt.
Laut Biologen sind Bienen die intelligentesten Lebewesen im Reich der Insekten. Sie verfügen über besondere sensorische Fähigkeiten, können bei schneller Geschwindigkeit immer noch gut in die Ferne sehen und sich dadurch ideal in ihrer Umwelt verorten. Sie verfügen zudem über ausgefeilte motorische Fähigkeiten, was sich unter anderem im erwähnten, sogenannten Schwänzeltanz zeigt. Bienen sind außerdem fähig, nicht nur komplexe Vorgänge in ihrem Umfeld wahrzunehmen, sondern auch nach einer entsprechenden Konditionierung Bilder von Monet und Picasso zu unterscheiden. Sind die impressionistischen und kubistischen Muster im Gehirn der Biene verankert, steuern die konditionierten Bienen die hinter einem Bild versteckten Futterquellen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an, als es der Zufall erlauben würde.8 Damit ist bewiesen, dass Bienen aus ihren Wahrnehmungen und Mustererkennungen, die ganz ähnlich auch in der Natur wiederzufinden sind, lernen, um sie im richtigen Moment abzurufen. Bienen verfügen also über ein reichhaltiges Erinnerungsvermögen und ähnlich uns Menschen ein episodisches Langzeitgedächtnis, das abspeichert, zu welcher Tageszeit welche Blüten in welcher Fülle wo zu finden sind.9 Dabei spielt ein Belohnungssystem, das unserem Nucleus accumbens gleicht, eine wichtige Rolle. Ist der Nektar von bestimmten Blüten besonders lecker, werden diese Blüten mithilfe ihres Belohnungssystems besonders gut erinnert.10
Außerdem schaffen es Bienen mittels basisdemokratischer Entscheidungsfindungen, soziale Ordnung in ihrem Staat herzustellen und aufrechtzuerhalten. Dazu gehen Bienen ähnlich wie der Mensch planerisch vor. Während Hummeln Blüten wahllos ansteuern, selektieren Bienen: Sie fliegen gezielt einzelne Blumen an, um diese nacheinander abzuernten. Der Begriff dazu lautet blütenstetig. Die Methode der Wahl für dieses fokussierte Vorgehen und die Planungsfähigkeit der Honigbienen ist auch hier die Kommunikation über den Schwänzeltanz. Während bei Hummeln jede Hummel auf sich alleine gestellt ist, verständigen sich Bienen und gehen damit gezielter und planerischer vor.11 Ob Tanz oder Sprache: Bienen nutzen eine dem Menschen ähnliche Verständigung, um wichtige Informationen für Beutezüge und Arterhaltung auszutauschen.12
Kleine Tiere sind oft mächtiger als wir annehmen, insbesondere wenn sie sich in gut organisierten Schwärmen zusammenfinden. Ähnlich wie in Stanislaw Lems Waffensysteme des 21. Jahrhunderts kleine Drohnen jede Flugabwehr unterwandern, um sich erst vor Ort zur perfekten Bombe zusammenzustellen, sind auch Bienen fähig, die größten Feinde in die Flucht zu schlagen. Während Elefanten mit Gewehren kaum beizukommen ist, schaffen es die kleinen Bienen, die Dickhäuter durch gezielte Attacken in die weichen Teile unterhalb des Auges sowie im Rüssel von Plantagen fernzuhalten.13
Die Struktur der Bienenvölker in der Organisationsbildung sowie ihre verblüffende Ähnlichkeit zum Menschen legen es nahe, von Bienen für die Führung eines sich weitgehend selbststeuernden Teams zu lernen. Bienen sind kein chaotischer, unorganisierter Haufen, auch wenn dies im ersten Moment so aussehen könnte, wenn sie als Schwarm beobachtet werden. Das liegt nicht zuletzt an ihrer Königin, die, solange sie fit ist, durch ihren Stamm ein königliches Duftsekret wehen lässt, das ihren Arbeiterinnen und Drohnen signalisiert: „Alles ist gut. Ich lege am Tag 1.500 Eier und halte das auch noch eine Weile durch.“ Sobald der Duft jedoch nachlässt, die alte Königin also schwächelt oder der Platz in der Wabe aufgrund der Entwicklung des Volkes zu klein wird, wird das Volk nervös und der Ruf nach einer neuen, jungen Königin laut.14 Passiert es, dass mehrere Königinnen schlüpfen, können sie sich entweder bekriegen oder eine nimmt Reißaus und beginnt ebenfalls mit einem Stab an Arbeiterinnen auszuschwärmen, um einen neuen Nistplatz zu suchen. Der Begriff des Schwarms hängt also genau genommen mit dem Akt des Ausschwärmens und damit der Suche nach neuen Abenteuern und Projekten zusammen.15
Auch wenn das Leben in einem Bienenschwarm bis auf die zusammenhaltende Wirkung der königlichen Düfte und der nachhaltigen Produktion von Eiern kaum von der Königin gelenkt wird – selbst in den Entscheidungen, wo der Schwarm seine neue Heimstatt aufbaut, spielt die Königin keine Sonderrolle –, geht es dennoch beim tatsächlichen Aufbruch des Schwarms nicht ohne sie. Führung wird im Zuge der Schwarmintelligenz und agiler Teams also nicht obsolet. Führung dient auch in unserer Zeit immer noch als Garant in Krisen und als Stabilisator in Reorganisationsprozessen.
Symbiosen, Schwärme und andere tierische Prinzipien
So interessant der Blick in die Welt der Bienen erscheint, ist er doch limitiert. Nachdem ich – stets auf der Suche nach neuen Metaphern und biologischen Vergleichen – eine Vielzahl von Büchern gewälzt habe, wurde ich förmlich erschlagen von den Möglichkeiten, die Prinzipien im Tier- und Pflanzenreich auf menschliche Beziehungen, Tandems und Teams zu übertragen. Aus einer ursprünglich wilden, zusammenhanglosen Sammlung von Beispielen entstand nach und nach – insbesondere in Kapitel 4 bis 6 – ein gut geordnetes System mit vielen kleinen Metaphern, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, einzeln oder im Set verwenden können.
Manche Metaphern stehen für sich, insbesondere bei einfachen Symbiosen:
Der Bienenwolf aus der Familie der Grabwespen nutzt ein antibiotisches Serum aus Bakterien, um seine Larven vor dem Befall mit Schimmelpilzen zu schützen.16
Übertragen auf Teams lautet hier die Frage: Womit schützen wir uns vor Chaos und Krisen?
Andere Beispiele, insbesondere die Betrachtung von Schwärmen, bestehen aus vielen Teilmetaphern und ergeben erst im Gesamtkontext einen sauber übertragbaren Sinn.
Droht einer Ameisenkolonie der Ausbruch einer Infektionskrankheit, beschränken sie ihre gegenseitigen Kontakte, um die Ausbreitung des Erregers einzudämmen und ihre Königin zu schützen. Die Arbeiten der Ameisen gehen weiter, lediglich die Kontakte untereinander werden reduziert.17
Eine Übertragung auf Teams ist entsprechend umfassender:
Welche Bedrohungen lassen ein Team wachsen und welche zerstören es?
Unter welchen Bedingungen ist es sinnvoll, einen Teil des Teams in Quarantäne zu setzen?
Wie genau soll die Quarantäne aussehen?
Wie lange soll sie dauern?
Wovon ist die Dauer abhängig?
Wie kann die Quarantäne wieder aufgelöst werden?
Zum Umgang mit diesem Buch
Das Buch ist grob in drei Teile unterteilt. Im ersten Teil, den Kapiteln 1 bis 4, finden Sie Grundlagen zur Bildung schwarmintelligenter, agiler Teams. Die zentralen Fragen in diesen Kapiteln lauten:
Wann sind schwarmintelligente Vorgehensweisen angezeigt und wofür brauchen wir einzelne Helden?
Wie viel oder wie wenig Führung brauchen schwarmintelligente Teams?
Wie lassen sich Teams mittels geteilter Verantwortung und dem Respekt voreinander zusammenschweißen?
Welche Regeln herrschen in Teams vor? Welche davon sind hinderlich für Schwärme, welche hilfreich?
Wie fließen Informationen schnell und zuverlässig durch das Team?
Wie werden schwarmintelligente Entscheidungen getroffen?
Im zweiten Teil, den Kapiteln 5 bis 8, dem Herzstück des Buchs, widme ich mich den Prinzipien schwarmintelligenter Teams. Ungeduldige springen gleich zu Kapitel 8 mit einer Zusammenfassung der Prinzipien. Sie kennen dann zwar nicht deren Hintergründe, können sich diese aber auch nach und nach erlesen. Ich empfehle Ihnen ohnehin, das Buch nicht in einem Rutsch durchzulesen, sondern sich in regelmäßigen Abständen ein paar Geschichten zu Gemüte zu führen und darüber zu sinnieren.
Der dritte Teil schließlich, das Kapitel 9, widmet sich den Methoden zur Bildung eines symbiotisch-schwarmintelligenten Teams unter Berücksichtigung der vorgestellten tierischen Prinzipien.
Michael Hübler
Vgl. Kegel, S. 224 ff.
2Vgl. Stehr, Ich geb‘ dir die Kugel, Spiegel Online, 23. 02. 2012
3Vgl. Ciompi/Endert, S. 147 f.
4Vgl. Ciompi/Endert, S. 148
5Vgl. www.welt.de/lifestyle/article5563345/Tuemmler-tun-es-auch-mit-einem-Abflussrohr.html – aufgerufen am 05. 06. 2019
6Vgl. Marte et al., in: Chlopczyk, S. 145 ff.
7Vgl. Miller, S. 50 ff.
8Vgl. Tautz/Steen, S. 123
9Vgl. ebd., S. 121
10Vgl. Menzel/Eckoldt, S. 192 ff.
11Vgl. ebd., S. 21
12Vgl. ebd., S. 54 f.
13Vgl. Mingo, S. 21 f.
14Vgl. Seeley, S. 32 und 45 f.
15Vgl. ebd., S. 49 ff.
16Vgl. Offenberger, S. 107 f.
17Vgl. Wie Ameisen sich aktiv vor Infektionskrankheiten schützen, Die Welt Online, 26. 11. 2018.
1. AUF DEM WEG ZUM KOMPLEXITÄT MEISTERNDEN LEISTUNGSTEAM
1.1 Warum wir in einer agilen Welt schwarmintelligente Teams brauchen
1.2 Expertenmeinung versus Gruppenintelligenz
1.3 Heldenmythos und Heldenteams
1.4 Warum Teams Geschichten brauchen
1.1 Warum wir in einer agilen Welt schwarmintelligente Teams brauchen
Im Kontext einer agilen Welt kommen wir nicht umhin, die Intelligenz der gesamten Gruppe zu nutzen, um mit komplexen Aufgabenstellungen umzugehen. Der einzelne Mensch ist zwar fähig, mittels seiner Sinne Risiken abzuwägen und damit Fehler vorwegzunehmen. Werden Systeme und Aufgaben jedoch komplexer, ist er und damit auch das System, schnell überfordert. Offensichtlich war es der Evolution wichtiger, den Menschen am Leben zu halten, weshalb er lernte, wesentliche Fakten intuitiv, schnell und sicher zu erkennen. Die Wahrnehmung komplexer Zusammenhänge blieb dabei als weniger wichtig auf der Strecke.18 Auch die weitgehende Entkopplung unseres für Planungen zuständigen Neocortex von unseren erfahrungsbasierten Sinnen spielt in diesem Zusammenhang eine gewichtige Rolle, hilft uns dies doch in die Zukunft zu denken, unabhängig davon, wie riskant unsere geplanten Handlungen sein könnten.19 Erst dadurch konnten komplexe Gebilde mit entsprechend unkalkulierbaren Folgen wie Atomkraftwerke entstehen, die zwar niemand versichern möchte, deren Risiken jedoch paradoxerweise durch eine Null-Fehler-Toleranz beim Menschen aufgefangen werden sollen – bei gleichzeitiger Ignoranz der Intuitionsfähigkeit des Mitarbeiters.
Wollen wir nicht zurück in die Zeiten der großen Männer und Frauen, die Entscheidungen gemäß der Big Men-Theorie über die Köpfe ihrer Herde hinweg treffen, ist die Schwarmintelligenz eines Teams der beste Weg, um mit Komplexität umzugehen. In Unternehmen waren es zahllose Chefs mit traditionellem Hierarchieverständnis nach dem Motto: „Meine Mitarbeiter kommen mit einem Problem zu mir und gehen mit meiner Meinung.“ Der eine oder andere Choleriker war auch dabei. In der Politik waren dies Franz Josef Strauß oder Margaret Thatcher. Heute tauchen mit Trump, LePen, Orban, Putin, Erdogan, den entsprechenden Gruppierungen der Identitären oder der AfD allerorten Figuren und Parteien auf, die frustrierten Menschen in einer schnellen und unübersichtlich gewordenen Welt den Weg zeigen, während sie diejenigen, die komplexe Zusammenhänge erklären könnten, für arrogant halten. In manchen Situationen oder geschichtlichen Phasen scheint dies tatsächlich nötig zu sein und auch zu funktionieren. Man kann zu einer Person wie Emmanuel Macron stehen, wie man will. Er mag in manchen Situationen übertrieben ehrgeizig oder überheblich wirken. Zumindest zeigt er mit seinem provokanten Auftreten und Äußerungen – „Die Demonstranten sollen lieber arbeiten gehen“ oder „Deutschland ist als Partner wichtig, zur Not geht es auch ohne“ –, dass er sein Land nicht nur verwalten, sondern etwas bewegen will und dazu einen Masterplan hat. Gleichzeitig zeigt er in klein-großen Gesten wie der Händedruck-Aktion mit Donald Trump, dass er es ernst meint. Solche Machtdemonstrationen müssen jedoch beseelt und mit politischem Augenmaß sowie Diplomatie verbunden sein, um von einer Autokratie zu gemeinschaftlichen Aktionen überzuleiten. Genau dies scheint bei den aktuellen Gelbwesten-Demonstrationen sein Grundproblem zu sein: der Weg vom Alleinherrscher zum Demokraten.
Gleiches gilt auf Teamebene. Wer sich mit kreativen Prozessen in Teams und vor allem den Übergängen zu langfristig selbstermächtigten Teams beschäftigt, weiß, dass dies kein Selbstläufer ist. Für demokratische Prinzipien offene Führungskräfte können ein trauriges Lied davon singen, wie schwer es ist, Mitarbeiter aus ihrer nicht ganz selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszuführen. Warum sollten sie nach so vielen Jahren auf einmal selber denken und den Unternehmer im Unternehmen spielen, am besten bei gleichbleibendem Lohn?
Die Hinderungsgründe dazu sind mannigfaltig. Auch wenn persönliche Gründe sicherlich eine Rolle spielen, sollte der erste Ansatzpunkt systemischer Natur sein: Wer gestaltet und neue Wege ausprobiert, macht Fehler. Sind die neuen Freiheiten nur Lippenbekenntnisse einer Führungskraft, die bekräftigt, dass es ok ist, Fehler zu machen, sich selbst jedoch am liebsten dreimal absichert, ist es kein Wunder, dass Mitarbeiter kaum Verantwortung übernehmen. Was soll ein Mitarbeiter denken, wenn es heißt: „Probier‘ etwas Neues aus. Wenn es schief geht, nicht so schlimm. Wir lernen daraus“, die Fehler im Nachhinein jedoch zum Karriereknick führen. Erhält der Mitarbeiter keine Hilfestellung zur Orientierung, wann Fehler in Ordnung sind und wann nicht, wird er nach wie vor auf Nummer Sicher gehen.
Folglich braucht es Experimentierräume zum Begehen neuer Wege, die zur Not von einer Big Person nach außen verteidigt werden. Sie zeigen dem Mitarbeiter, wann Fehler gewollt und wann sie fehl am Platz sind. Sie unterscheiden zwischen Training und Ernstfall. Wie ein Flugkapitän Hunderte von Fehlern im Flugsimulator vorwegnimmt, damit sie im Ernstfall unterbleiben, sollten in jedem Einzel- und Teamgespräch mögliche Fehler mental durchdacht oder systemisch getestet werden. In begrenzten Maßen können Prototypen sogar an kleinen Zielgruppen getestet werden, um in einer komplexen Welt Erfahrungen mit begrenzt schlimmen Folgen auszuprobieren. Dazu braucht es jedoch auf dem Weg zur selbstermächtigten, selbstorganisierten, schwarmintelligenten Gruppe in aller Regel eine starke Person, die dies ermöglicht, ihrem Team oder ihrer Gruppe den Rücken stärkt und sie vor Angriffen von außen schützt.
Vgl. Osten, S. 34 ff.
19Vgl. ebd., S. 16
1.2 Expertenmeinung versus Gruppenintelligenz
Der Hype um agile Vorgehensweisen drang in den letzten Jahren in alle Bereiche vor. Dabei wehren sich manche Mitarbeiter vehement gegen die Veränderungen, die stetige Anpassungsprozesse mit sich bringen. Dass sie mit dieser Weigerung ab und an durchaus recht haben, zeigt die folgende Auseinandersetzung damit, wann Agilität sinnvoll ist und wann nicht:
Routinetätigkeiten und -abläufe sind für stetige Anpassungsprozesse schlichtweg nicht geschaffen. Adaptionsprozesse würden nur zu einem Chaos führen.
Es gibt Tätigkeiten und Abläufe, bei denen es cleverer ist, Experten zu fragen statt Kunden. Der Kunde hat zwar oft kreative Ideen, ist jedoch auch momentgetrieben und irrational preisorientiert, ohne an langfristige Effekte seines Kaufverhaltens zu denken.
Am prädestiniertesten für Schwarmintelligenz und Agilität sind komplexe, undurchsichtige Situationen, die zuerst geklärt werden müssen.
Chaotische Situationen hingegen können durch eine agile Führung zu Panik führen. In diesen Situationen braucht es eine klare Lenkung, um die Kontrolle über die Situation zurück zu gewinnen.
Stellen Sie sich zur Verdeutlichtung vor, Sie machen sich auf eine Schiffsreise:
Das Schiff wird beladen. Dazu gibt es klare Listen, Vorgaben und logische Abläufe.
Für die Reise braucht es Experten im Team, die navigieren, steuern, kochen können usw. Niemand würde ernsthaft auf die Idee kommen, den Koch zum Kapitän zu machen. Und ob der Kapitän kochen kann, ist ebenso fraglich.
Strandet das Schiff auf einer Insel, tritt eine Situation ein, in der es nicht mehr darum geht, zu navigieren, das heißt in der auch die Experten überfragt sind, ist es sinnvoll, alle Crewmitglieder vom Offizier bis zum Ausguck nach ihrer Meinung zur Erkundung der Insel zu befragen.
Gerät das Schiff dagegen in einen Sturm, muss der Kapitän in Absprache mit dem Steuermann klare Ansagen machen und Befehle erteilen, damit kein Chaos an Deck ausbricht.
Bringt eine Gruppe alle Erfahrungen und Sichtweisen ihrer Mitglieder ein, ist sie potenziell kreativer als Einzelpersonen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Weisheit einer Gruppe gegenüber Experten jederzeit überlegen ist. Zum einen sollte gewährleistet sein, dass auch tatsächlich eine Vielfalt besteht. Eine Gruppe von 50 Führungskräften in einem Vortrag mag nach einer großen Diversität klingen. Kommen diese jedoch alle aus einem Bereich, zum Beispiel dem Vertrieb oder der Personalabteilung, denken alle 50 sehr ähnlich. Erst recht, wenn alle dieselbe Ausbildung genossen haben und bereits seit vielen Jahren im Unternehmen arbeiten, liebevoll Firmenkinder genannt. Sollten drei oder vier Personen als Quereinsteiger in diesem Kreis anders ticken, gehen diese „Outlaws“ schnell in der Menge unter, als flüsterte diese lautlos: „Pass‘ dich an, wenn du hier überleben willst.“ Die Vielfalt im Denken muss also nicht nur vorhanden, sondern auch erlaubt sein, um ihre Trümpfe auszuspielen. Denn zur Not frisst die Firmenkultur die Abweichler spätestens zum Mittagessen.
Ist das gegeben, kann es immer noch sein, dass eine Expertenmeinung mehr wert ist. Sollten Sie jemals in die Bredouille kommen, während einer Fahrt mit mir und meinesgleichen eine Panne zu haben, sollten Sie lieber nicht auf die Idee kommen, einen kreativen Querschnitt der Meinungen der Insassen zur Frage nach der Reparatur zu bilden. Ich bin Geisteswissenschaftler und in technischen Fragen mit zwei rechten Gehirnhälften gesegnet: Die Ideen könnten amüsant sein, hilfreich vermutlich nicht. Stattdessen sollten Sie in die Runde fragen, ob ein Mechaniker anwesend ist – in schlimmeren Fällen wäre ein Arzt sinnvoll. Wenn nein, sollten Sie auf jeden Fall den nächsten Pannendienst anvisieren.
Ganz anders sieht die Lage aus, wenn Sie das Schicksal einer Autopanne in einem fremden Land ereilt. Dann könnte es durchaus hilfreich sein, die Gruppe zu fragen, welche Ideen sie zur Lösung des Problems hat, sofern sich kein Mechaniker unter Ihren Begleitern befindet. Selbst ich kam in jungen Jahren auf die Idee, die Kordel meines Armeerucksacks zu opfern, um einen durchgerosteten Auspuff wieder hochzubinden und so das Auto ohne weitere Vorfälle zurück zum heimischen Automechaniker des Vertrauens zu befördern.
Wie gut Experten in der Lage sind, ein Problem zu lösen (oder auch nicht), zeigt sich am Beispiel von Schachspielern. Wird einem Profischachspieler eine Konstellation mitten in einem laufenden Schachspiel präsentiert, kann er die wahrscheinlichsten vorherigen und nachfolgenden Züge ergänzen und über Taktiken und Strategien referieren. Werden die Figuren willkürlich auf dem Brett platziert, kann er nichts damit anfangen. Es erscheint ihm unmöglich, die Situation einzuordnen und logische Schlüsse zu ziehen.20
Bei berechenbaren Konsequenzen sind Experten für Analysen am richtigen Platz. In unübersichtlichen Kontexten ist es sinniger, auf die Einschätzung einer größeren Gruppe zu vertrauen. Selbst bei Krankheiten gilt: drei Ärzte, fünf Meinungen. Laut Studien liegt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ärzte dieselbe Diagnose stellen, bei 50 Prozent – was zugegebenermaßen nicht immer viel ausmacht. Meine Mutter brachte die Empfehlung von Ärzten einmal mit folgenden Worten auf den Punkt: „Entweder sieben Tage Bettruhe oder eine Woche zu Hause bleiben. Ein Aspirin dazu oder auch nicht. Dann wird es schon wieder.“ Bei Alltagsdiagnosen wäre ein ständiges Ärzte-Hopping ohnehin zu zeitraubend. Bei lebensverändernden Krankheiten gilt jedoch die Prämisse der mindestens zweiten Meinung, zumal viele Experten selbst unter einer ganz eigenen Krankheit leiden: Selbstüberschätzung.21
1.2.1 Wann Schwarmintelligenz angebracht ist
Befinden wir uns in einer unklaren Situation, ist Schwarmintelligenz Gold wert: Woran liegt es, dass unser direkter Konkurrent schneller liefert als wir? Woran liegt es, dass unsere Mitarbeiter unser Angebot an demokratischeren Strukturen ablehnen? Was hindert sie daran, mehr zu gestalten? Warum nur reagieren die Mitarbeiter mit Panikattacken und Wutkaskaden, wenn sie das Wort „Change“ hören und was können wir dagegen tun?
Alles, was mit dem Engagement der Mitarbeiter oder deren Umgang mit Kunden zu tun hat, damit diese zufrieden mit dem Service sind, befindet sich nun mal im menschelnd-unkalkulierbaren Bereich und lässt sich eher schätzen als messen.
Das Management tut zwar so, als ließe sich beinahe alles mit einer Balanced Scorecard messen. Wirklich messen lassen sich die Konsequenzen unserer Aktionen jedoch nur im Labor. Stickstoff plus Wasserstoff ergibt Ammoniak. Hänge ich an einen Kraftmesser 100 Gramm, kann ich die entsprechenden Newton ablesen. Doch was passiert, wenn sich Stickstoff und Wasserstoff in freier Wildbahn mit der Luft vermischen? Was passiert, wenn wir unsere Kraftmessung nicht auf der Erde, sondern auf dem Mond durchführen? Streng genommen brauchen wir für jede Managemententscheidung den Bezug zum Kontext. Dieser ist jedoch häufig so komplex, dass es bei vagen Vermutungen bleibt. Während wir im Labor Konsequenzen vorhersagen und anschließend überprüfen, ist es in der realen Welt sinnvoller, sich mögliche Handlungsoptionen auszudenken und deren prognostische Erfolgswahrscheinlichkeiten von einer möglichst diversen Gruppe bewerten zu lassen.
Ein zweiter typischer Fall für Team- und Schwarmintelligenz ist die Beteiligung verschiedener Gruppen innerhalb eines Projekts oder Prozesses.22 Es mag banal klingen, dass bei der Frage nach der Erhöhung der Effizienz einer Lieferkette alle Beteiligten am Tisch sitzen sollten. Wenn wir uns jedoch vor Augen führen, dass LKW-Fahrer, Reinigungskräfte oder Kunden mit ihrem wertvollen Vor-Ort-Wissen so gut wie nie gefragt werden, schließt sich an dieser Stelle der Kreis zwischen Schwarmintelligenz und agilem Führen bzw. Managen: In komplexen Situationen ist es schon lange nicht mehr möglich, Strategien im kleinen Kreis und stillen Kämmerlein zu ersinnen und diese auf Gedeih und Verderb durchzuboxen. Das Management und die Führung der Zukunft kommen nicht umhin, das komplette Organigramm inklusive Kunden als Feedbackgeber in Strategien miteinzubeziehen.
Die Vorteile von Schwarmintelligenz liegen auf der Hand:
Gruppenintelligente Prozesse sind robuster, da sie auf einer größeren Meinungsvielfalt fußen.
Sie sind flexibler, weil sie nicht von Einzelpersonen, Experten oder Big Men abhängig sind.23
Und vor allem: Niemand muss bei Veränderungen ins Boot geholt werden, wenn er bereits an Bord ist. Gilt der Nörgler im Team nicht mehr als Grantler vom Dienst, sondern wird zum wertvollen Kritiker umfunktioniert, erfüllt er eine wichtige Rolle in der Gruppe: Der Bremser wird zum Risikomanager.24
1.2.2 Schwarmintelligenz nach Aufgabenabhängigkeit
Wann Schwarmintelligenz effektiv eingesetzt werden sollte, hat nicht nur mit dem Kontext, sondern wie im Schiffsbeispiel gesehen, auch mit den zu lösenden Aufgaben einer Gruppe zu tun. Bei den unterschiedlichen Arbeiten eines Teams bestimmen die beiden Faktoren Kreativität und Abhängigkeit voneinander, ob Schwarmintelligenz angebracht ist:
Wenig kreative Aufgaben, meist Routinetätigkeiten, lassen sich am besten lösen, indem die Summe der Tätigkeiten einzelner Teammitglieder addiert wird. Nimmt die Abhängigkeit zu, weil Person oder Team A erst nach dem Output von Person oder Team B weiterarbeiten kann, sprechen wir von Prozessketten. Hier sollten die einzelnen Personen oder Teams im Prozess für ein reibungsarmes Schnittstellenmanagement miteinander vernetzt werden:
Die Personen oder Teams sollten klären, welchen Input sie brauchen bzw. welchen Output der Vorgänger produzieren sollte, um möglichst nahtlos weiterzuarbeiten.
2.Mithilfe des Wissensaustausches der Prozesskettenpartner können im Sinne eines agilen, schwarmintelligenten Managements möglichst viele Perspektiven vor Ort genutzt werden. So kann beispielsweise das praktische Wissen von Pizzaboten der Schlüssel zur Erkenntnis der schnellsten Wege durch den feierabendlichen Verkehrsdschungel sein.
Nehmen Kreativität, Wissen und Reflexivität zu, sprechen wir im Einzelfall von Experten. Auch hier befinden wir uns in einem nicht immer sauber abgrenzbaren Bereich. Denken wir an ein hochkarätiges Expertenteam, kann sich dieses sehr wohl in einem guten Austausch befinden, während sich einzelne Experten im Team profilieren wollen, um das Team bei der nächstbesten Gelegenheit hinter sich zu lassen. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten mehrere Symbiosen.
Für viele Aufgaben im Team wird nicht unbedingt ein Team benötigt. Manchmal heißt es scherzhaft: Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Sind Einzelpersonen überfordert, soll es ein Team richten, vermutlich weniger der Lösung wegen, sondern mehr, um Entscheidungen zu vertagen. Oft jedoch wären mehrere Symbiosen zweier oder dreier Mitglieder die bessere Lösung, statt alle Teammitglieder aneinander zu binden.
Erst wenn interaktive Kreativität erwünscht ist und auch die Tätigkeiten der Einzelmitglieder eng und dauerhaft verzahnt sind, ist es sinnvoll, ein Team auf Schwarmintelligenz einzuschwören.
Es geht in Unternehmen also nicht primär darum, jede Aufgabe mithilfe eines schwarmintelligenten Teams anzugehen, sondern sich gut zu überlegen, wo dies angebracht ist:
Müssen lediglich Aufgaben abgearbeitet werden, ohne dass ein Team autonome Entscheidungen treffen muss, ist die Bildung eines Teams für die Führung zu aufwendig und für das Team frustrierend, da Teams implizit davon ausgehen, mitentscheiden zu können. Ist dies nicht der Fall ist, sinkt die Motivation des Teams schnell in den Keller: „Wir sind nur da, weil die da oben sich nicht entscheiden können. Aber am Ende kommt doch nichts dabei heraus.“
Können Aufgaben von ein bis zwei Personen übernommen werden, sollten kleine Symbiosen im Sinne eines Tandems gebildet werden.
1.2.3 Arbeitsgruppen oder Teams
Manche Teams werden vorschnell als „Team“ bezeichnet, obwohl sie lediglich lose Arbeitsgruppen sind, um Aufgaben zielorientiert, funktional und per Delegation zu erledigen. Wie wir bereits gesehen haben, gibt es im Arbeitskontext diverse Momente, in denen funktionale Arbeitsgruppen ohne langfristige Teambildung am effizientesten agieren.
Der kreative Austausch in Teams benötigt einen Teambildungsprozess, der nicht immer gegeben ist. Eine Arbeitsgruppe hingegen kann sich kurz oder auch länger zu einer Aufgabe zusammenfinden, Unteraufgaben aufteilen und anschließend wieder auseinandergehen. Aufgrund dieses losen Zusammenschlusses ist in Arbeitsgruppen in der Regel eine hierarchisch übergeordnete Person nötig, um die Tätigkeiten zu verteilen, Meetings zu leiten und klare Anweisungen zu geben.25 So hat in der Natur neben dem Prinzip Schwarmintelligenz auch das Prinzip Leittier seine Berechtigung.26
Der Vorteil dieses Leitsystems: Es geht schneller und braucht keine langwierige Teambildung. Sofern es sich „nur“ um komplizierte, aber berechenbare Aufgaben handelt, sind Fachexperten oder Führungskräfte als Leitwölfe meist besser geeignet als ein zusammengewürfeltes Team. Oder würden Sie es begrüßen, wenn der Arzt während Ihrer Operation das gesamte Team, inklusive Techniker und Pfleger befragt, wo er das Skalpell am besten ansetzen soll?
Betrachten Sie den gesamten Prozess, können Assistenten sehr wohl auf Hygienevorschriften hinweisen und Techniker auf Ergebnisse ihrer Geräte, damit die Ärzte sich um die Operation kümmern können. In diesem Fall geht es jedoch nicht um ein schwarmintelligentes Team, sondern um ein Team aus Experten. Haben Sie stattdessen einen Schlüssel im hohen Gras verloren: Wen würden Sie mit der Suche betreuen? Einstein oder 50 Normalos? Vielleicht braucht es sogar eine Leitfigur, die die Suchaktion koordiniert. Dann jedoch fahren Sie mit den 50 Normalos besser.
Vgl. Surowieki, S. 59
21Vgl. Surowieki, S. 61 f.
22Vgl. Kurzmann/Fladerer, S. 21 ff.
23Vgl. ebd., S. 25
24Weitere Ideen zum Umgang mit Widerständen im Team finden Sie in Kapitel 5.4.
25Vgl. Kurzmann/Fladerer, S. 109
26Vgl. May, S. 51 ff.
1.3 Heldenmythos und Heldenteams
Eine kurze Reflexion zur Einstimmung in das Kapitel:
Zählen Sie im Geiste alle Einzelpersonen auf, die Ihnen spontan als herausragende literarische oder reale Figuren einfallen, als Helden oder Retter der Menschheit, von James Bond bis Mutter Theresa.
Denken Sie nun an literarische, cineastische oder reale Teams, die Ihnen ebenso spontan einfallen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem A- oder Mission Impossible-Team?
Hätten Sie nicht bereits weitergelesen, wären Ihnen aus dem Stehgreif vermutlich Hunderte von Helden als Einzelpersonen eingefallen:
Beginnen wir bei den alten Griechen mit Herakles (besser bekannt als Herkules), Odysseus und Alexander dem Großen. Die Römer hatten Caesar und Kleopatra. Dann gibt es noch die großen religiösen Führer und Sinnstifter wie Jesus, Buddha, Mohammed oder in neuerer Zeit Bhagwan. Die Bibel ist voller einzelner Figuren, die uns im Gedächtnis bleiben: Moses, Abraham, Paulus oder Johannes der Täufer. Wechseln wir in die Politik, fallen uns alleine in Deutschland Adenauer, Strauß, Brandt, Kohl, Genscher, Schröder, Fischer oder Merkel ein. Und in der fiktiven Welt gibt es Superman, Wonder Woman oder Batman. Wenn der Ball in Ihrem Gehirn einmal ins Rollen gekommen ist, können Sie vermutlich gar nicht mehr aufhören: Schindler, Churchill, Dschingis Khan, Marco Polo, Columbus, Martin Luther, Martin Luther King, Newton, Freud … eine endlose Liste bahnt sich an.
Bei Teams fällt uns das schwerer. Die Sieben Schwaben, die mir vermutlich als erstes einfallen, weil ich selbst zu dem Verein gehöre, sind nicht gerade ein herausragendes Beispiel für ein Top-Team. Die Sieben Zwerge sind auch nicht besser. Oder die Schlümpfe? Immerhin hatten die Schlumpfine. Die Avengers oder X-Men aus den Marvel-Comics sind da schon glorreicher. Die X-Men treten jedoch bevorzugt als Einzelkämpfer auf und wenn als Team, dann grundsätzlich mit riesigen Ego-Anteilen: „Na gut, wenn nur so die Welt gerettet werden kann, dann arbeiten wir halt, unter großen Schmerzen und weil es gar nicht anders geht, zusammen.“
Wenn es um den Sportsektor geht, habe ich persönlich meinen ersten gedanklichen Hänger: Natürlich gab es das ein oder andere Sportteam, zum Beispiel die Fußballnationalmannschaft in Brasilien 2014. Vielleicht hilft mir Tante Google weiter: Der erste Vorschlag bei der Suche nach berühmten Teams lautet „berühmte Paare“ wie Bonnie und Clyde oder Derrick und Harry. Aha! Symbiosen also. Nicht gerade das, was ich mir unter einem Team vorstelle. Von Schwärmen ganz zu schweigen. Bei weiterer Recherche stoße ich auf Drei Engel für Charly, Oceans Eleven oder die Inglourious Basterds. Immerhin. Offensichtlich orientieren wir uns lieber an einer heldenhaften Figur und verlassen uns auf die Entscheidungsfähigkeit einer Person, statt auf die demokratische Entscheidungskraft eines Teams zu vertrauen. Gleichzeitig sind einzelne Helden wesentlich gehirnfreundlicher: Auf eine einzelne Person können wir uns leichter fokussieren als auf ein ganzes Team. Wer (außer eingefleischten Fußballfans) merkt sich schon die Namen der deutschen Fußballmannschaft, die für das Wunder von Bern verantwortlich waren?
Einen Ausweg aus diesem Paradoxon könnte die Erkenntnis liefern, dass Teams, real oder fiktiv, grundsätzlich durchschlagkräftiger sind als Einzelpersonen, sofern die einzelnen Teammitglieder möglichst unterschiedlich sind und damit ihrerseits als einzelne Helden auftreten. Ein Blick in berühmte Bands liefert uns ein ähnliches Muster: Was wäre das verrückte Talent des Songschreibers ohne eine kraftvolle Rhythmusgruppe, die jedoch bitteschön auch auf Presseauftritten im Hintergrund bleiben sollte? Was wären Paul McCartney und John Lennon ohne George Harrison und Ringo Starr? George Harrison sorgte für das psychedelisch-exotische Flair in den Songs, während Ringo Starr den Songs einen zuverlässig-taktvollen Rahmen verlieh. Und was wären die Songs von The Who ohne den dynamischen Bass von John Entwistle, der zudem – wie so oft bei Bassisten – den Sound der Band abmischte und produzierte? Was wären die frühen Who ohne die ausufernden Drum-Eskapaden von Keith Moon? In diesem Fall fällt die Rolle der Stabilisierung des Teams schon beinahe zwangsläufig Roger Daltrey und Pete Townsend zu. Während Moon auf Partys regelmäßig eskalierte, fielen die beiden Frontmänner äußerst selten durch Drogeneskapaden auf. Ein Hoch auf die klare Rollenteilung im Team.
1.4 Warum Teams Geschichten brauchen
Heldengeschichten gibt es zur Genüge. Schauen wir uns an, wie es mit Teamgeschichten aussieht.
Vielleicht macht uns erst das Erzählen von Geschichten zum Menschen. Immerhin sind wir vermutlich die einzigen Lebewesen, die sich seit Urzeiten Anekdoten und Witze am Lagerfeuer erzählen, um Werte zu vermitteln und eine Verbindung zueinander aufzubauen. Der Zuhörer denkt sich: „Etwas an dieser Geschichte muss wichtig sein. Sonst würde sich der Erzähler nicht so emotional engagieren“ und begibt sich auf die Suche nach dem Sinn hinter der Erzählung.27 Und schließlich zeigen Storys Entwicklungen auf: Wie geht es weiter? Was wird alles passieren? Und wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder heraus?
Ein möglicher Einsatz von Geschichten in Unternehmen ist enorm vielfältig. Meist werden Geschichten von möglichst vielen Mitarbeitern gesammelt, um daraus Erkenntnisse für die DNA der Firma zu extrahieren. Dieser reaktive Einsatz von Geschichten erfolgt in Debriefings, bei Schwierigkeiten oder zur Auswertung von Projekten und zur Verbesserung von Prozessen, bei Schwierigkeiten in Kooperationen, im Fehlermanagement oder zur Wissensbewahrung von Experten, die demnächst das Unternehmen verlassen.28
Daneben gibt es den aktiven Einsatz von Geschichten, um Mitarbeiter gezielt zu lenken und in Veränderungssituationen mögliche neue Wege aufzuzeigen. Solche Geschichten sollten kurz, nachvollziehbar und interessant sein. Normalerweise ist eine Identifikation mit der Hauptperson, dem Helden, hilfreich. Dass es auch anders geht, werden wir anhand der symbiotischen Geschichten sehen. In der Regel beinhalten Geschichten, Anekdoten oder Metaphern zwei Ebenen: eine offensichtliche und eine unbewusste, die es zu übertragen gilt, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen.29
Während die traditionelle Nutzung von Erzählungen der Wertevermittlung dient, stellt sich hierzu die Frage, für welche Werte es sich heute noch zu kämpfen und zu leiden lohnt. Familien haben genauso wenig Bestand wie Teams. An die täglichen Dramen von Mord, Kindesmissbrauch, Ertrinken im Mittelmeer und Ölkatastrophen hat sich der normale TV-Konsument längst gewöhnt. Die Geschichten in diesem Buch vermitteln daher anhand der Analogien aus der Tier- und Pflanzenwelt weder Werte, nach denen ein Team agieren sollte, noch Regeln, die einzuhalten sind, sondern Prinzipien, die sich aufgrund ihrer Praktikabilität über Jahrmillionen Jahre evolutionär herauskristallisierten. Man mag darüber streiten, ob sich Ihr Team mit Bienen oder Ameisen identifiziert. Oder ob sich einzelne Teammitglieder in Haien oder Erdbeerfröschen wiederfinden. Doch gerade dieser Abstand, die Ferne des Vergleichs, lässt sich bestens kreativ einsetzen.
Natürlich sind wir keine Bienen. Würden wir jedoch als Bienenschwarm vor der Herausforderung stehen, den besten Nistplatz in der Umgebung zum Überwintern finden zu müssen: Was würden wir tun?
1.4.1 Storys verbinden
Die Ergänzung der Teammitglieder durch biografisch gewachsene, unterschiedliche Meinungen, Sichtweisen, Positionen, Beweggründe, Motive, Emotionen und Gefühle – der Diversity-Ansatz vernetzt nicht umsonst Vielfalt und Kreativität – betrifft die eine Seite gelungener Teambildung. Um als Gruppe intelligent zu agieren, brauchen Teams eine gemeinsame Geschichte, selbst wenn sie nur für ein kurzes Projekt zusammenkommen. Die Erzählenden entdecken durch ihre Verortung in der Geschichte sowohl ihr Ich als auch das Wir. Ein ähnlicher Werdegang wirkt enorm verbindend.
Eichhörnchen beherbergen im Sommer zur Vorbereitung auf den Winter andere Mikroben im Darm als während des Winterschlafs, die ihnen für die kalte Jahreszeit ein Fettpölsterchen bescheren. Wir Menschen haben zwar noch nie Winterschlaf gehalten, jedoch pendelten wir früher zwischen Völlerei in reichen und der Entbehrung in armen Zeiten. Evolutionsbiologisch war es sinnvoll, sich ein dickes Fell zuzulegen, aufgrund der nicht durchgehenden Essensversorgung oder Kälte. Heutzutage haben wir zwar alles, was wir brauchen, vom Essen bis zur Goretex-Jacke, dennoch sorgen wir körperlich vor: gegen kommenden Stress, soziale Kälte oder mangelnde Akzeptanz, was die Essensattacken bei Frust oder Liebeskummer erklärt.30
Eine solche Metapher lässt sich ideal als Beginn einer Geschichte einsetzen: Eichhörnchen werden mit einer schwierigen Situation konfrontiert und reagieren mit Vorsichtsmaßnahmen. Die Anekdote wirkt verbindend, wenn gemeinsam im Team darüber reflektiert wird, wie jeder sich auf seine Weise „ein dickes Fell anfrisst“, um sich für schwere Zeiten zu wappnen, auch wenn jeder im Team das auf seine Weise tut:
Kollegin Hunkemüller bearbeitet ihre Aufgaben so akribisch, dass ja nichts passiert und niemand meckern wird. Ihr dickes Fell heißt Perfektionismus.
Kollege Breitmeyer hält seine Kollegen auf emotionalen Abstand, damit er nicht enttäuscht wird. Sein dickes Fell lautet Sachlichkeit.
Und Kollegin Windvogel ist immer hilfsbereit, um sich auf andere verlassen zu können, wenn sie einmal Hilfe braucht. Ihr vorbeugendes, dickes Fell nennt sich Hilfsbereitschaft.
1.4.2 Von der allgemeinen zur persönlichen Geschichte
Manche Geschichten in diesem Buch mögen Ihnen zu abstrakt erscheinen. Ähnlich wie in der Anwendung von Metaphern gilt jedoch:
Je abstrakter, desto weniger muss ich mich damit identifizieren, desto weniger fühle ich mich angegriffen und desto leichter fällt mir eine kreative, lösungsorientierte Auseinandersetzung mit dem Bild. Erzähle ich in meinen Seminaren von scheinbar eiskalten Ameisen und Haien, ist der Abstand zum eigenen Leben oft so groß, dass sich über die Ferne hinweg wunderbar schmunzeln und philosophieren lässt.
Je näher uns ein Bild erscheint, desto mehr es also mit uns zu tun hat, desto klarer wird die Übertragung. Die Nähe kann jedoch auch unsere Kreativität hemmen.
Sie sehen, wie so oft – die Mischung macht’s.
Daher empfehle ich Ihnen, mit den Ferne-Geschichten aus der Tier- und Pflanzenwelt zu beginnen oder diese zur Eigenreflexion zu nutzen und anschließend auf eigene Erzählungen überzuleiten, auf Teamebene oder direkt von Ihnen als Führungskraft. Dazu bietet sich zum Beispiel eine emotionalere Version der bekannten Changemanagement-Phasen an:31
Wir träumen von der ewigen Kontinuität, getreu dem Motto einer berühmten Essensmarke: Ich will so bleiben, wie ich bin.
2.Wir erwachen aus unserem Traum und fallen in ein mehr oder wenig tiefes Loch.
3.Mühsam kämpfen wir uns aus diesem Loch wieder heraus oder ziehen uns wie Münchhausen am eigenen Schopf nach oben.
4.Auf einem einigermaßen gesicherten Pfad erklimmen wir Schritt für Schritt unseren Weg in Richtung Gipfel, der langfristig annähernd so hoch sein sollte wie der, von dem wir hinabstürzten, um motivierend zu sein.
5.Am Gipfel angekommen genießen wir die Aussicht. Wir freuen uns, die Strapazen hinter uns gelassen zu haben und wagen einen Ausblick in die Zukunft.
6.Ab hier beginnen wir wieder zu träumen.
Als ich 2006 als Seminarleiter im Bereich Arbeitssuchende begann, hatte ich wenig Plan davon, was es braucht, um ein richtig guter Trainer zu sein. Ich agierte intuitiv, hatte jedoch von der Lebenswelt meiner Klienten wenig Ahnung. Ich dachte, es reicht aus, sich thematisch vorzubereiten, ein wenig zu schauspielern und spontan zu sein. Wenn ich schon für ein paar Euro fünfzig die Stunde arbeitete, sollten meine Teilnehmer und mein Institut bitteschön dankbar sein, dass sie über mich verfügen dürfen. Mein Ego war davon überzeugt, dass über Sympathie und Frechheit alles möglich sei. Weit gefehlt. Denn im Umgang mit Klienten, die älter sind und weitaus mehr Lebenserfahrung als ein Mitdreißiger mitbringen, ist etwas mehr nötig. Auf den Traum folgte innerhalb weniger Monate ein tiefer Sturz. Ich erinnere mich noch detailgetreu an einen Moment vor etwa zwölf Jahren, als mitten in einer laufenden Seminarreihe der Institutsleiter auftauchte und mich vor versammelter Frau- und Mannschaft kündigte.