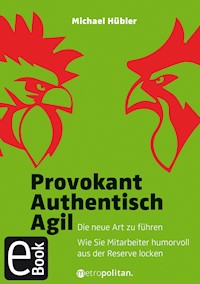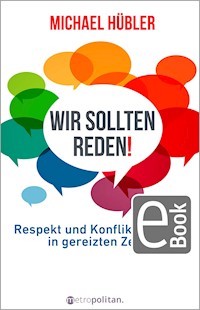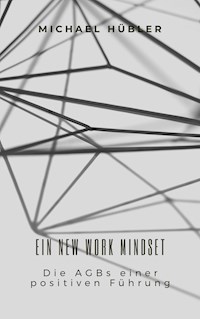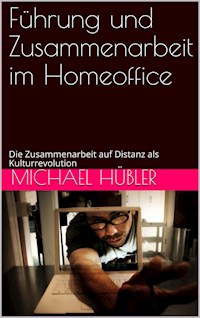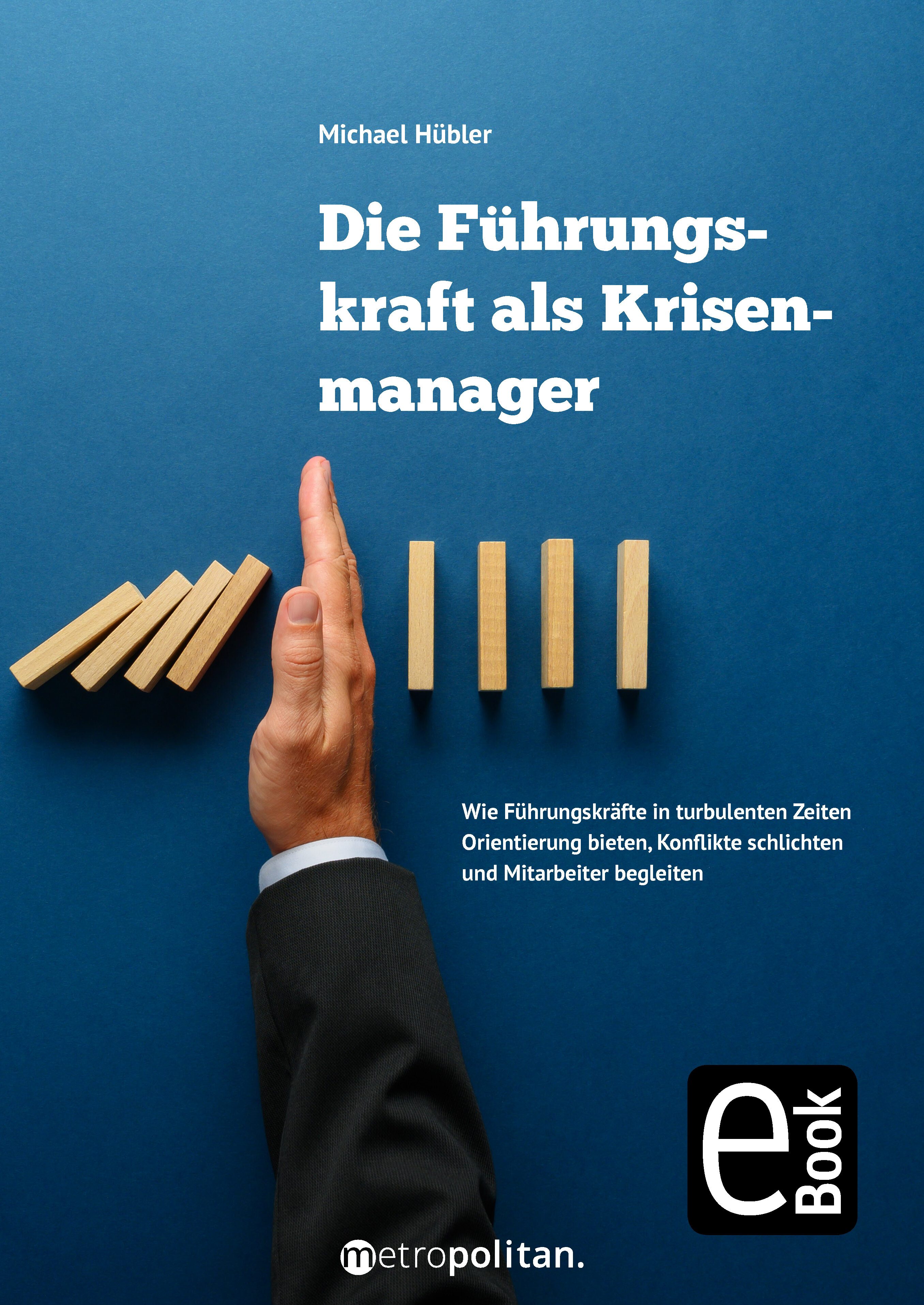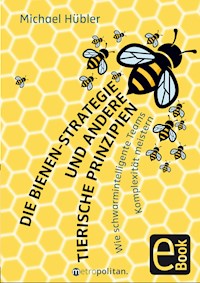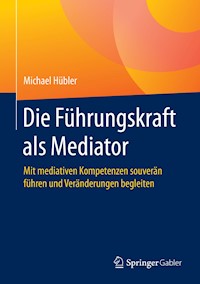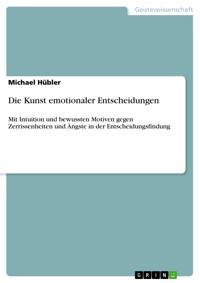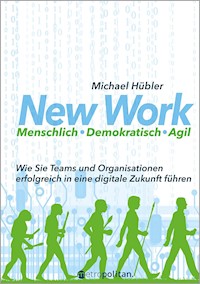
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metropolitan
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mit Agilität und Menschlichkeit durch die digitale Evolution
Agile Strategien setzen auf einen permanenten Flow aus Orientierungszielen, Mitarbeiterideen, Kundeninteressen und stetigen Anpassungen, denn unsere digitalisierte Welt ist zu komplex und wechselhaft für langfristige Ziele. Agilität ist der Dreh- und Angelpunkt der evolutionären Weiterentwicklung unserer Arbeitswelt. Doch führen das dauerhafte Reagieren auf Kundeninteressen nicht ins Chaos und die stetige Selbstoptimierung die Mitarbeiter in den Burn-out?
Die Antwort lautet Nein, wenn wir der juvenilen Agilität zwei reife Geschwister namens Demokratie und Ethik zur Seite stellen. Während Agilität Organisationen hilft, mehr zu improvisieren und in Prototypen zu denken, fördern Demokratie und Ethik autonome Entscheidungsprozesse der Mitarbeiter sowie einen respekt- und vertrauensvollen Umgang miteinander.
Statt auf der Welle der angstmachenden Disruptivität in einer volatilen Welt zu reiten, verleiht Michael Hübler in seinem Buch New Work agilen Strategien ein menschliches Antlitz zum Wohle aller – der Organisation, Kunden, Führungskräfte und Mitarbeiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Mit Agilität und Menschlichkeit durch die digitale Evolution
Agile Strategien setzen auf einen permanenten Flow aus Orientierungszielen, Mitarbeiterideen, Kundeninteressen und stetigen Anpassungen, denn unsere digitalisierte Welt ist zu komplex und wechselhaft für langfristige Ziele. Agilität ist der Dreh- und Angelpunkt der evolutionären Weiterentwicklung unserer Arbeitswelt. Doch führen das dauerhafte Reagieren auf Kundeninteressen nicht ins Chaos und die stetige Selbstoptimierung die Mitarbeiter in den Burn-out?
Die Antwort lautet Nein, wenn wir der juvenilen Agilität zwei reife Geschwister namens Demokratie und Ethik zur Seite stellen. Während Agilität Organisationen hilft, mehr zu improvisieren und in Prototypen zu denken, fördern Demokratie und Ethik autonome Entscheidungsprozesse der Mitarbeiter sowie einen respekt- und vertrauensvollen Umgang miteinander.
Statt auf der Welle der angstmachenden Disruptivität in einer volatilen Welt zu reiten, verleiht Michael Hübler in seinem Buch New Work agilen Strategien ein menschliches Antlitz zum Wohle aller – der Organisation, Kunden, Führungskräfte und Mitarbeiter.
Autor
Michael Hübler, ist Mediator, Berater, Moderator und Coach für Führungskräfte und Personalentwickler. Als Konfliktmanagement- und Verhandlungstrainer zeigt er, wie wertvoll der Schritt von einer „Heilen-Welt-Philosophie“ zu einer transparenten, agil-mutigen Führung ist.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Agilität und Digitalisierung geht uns alle an
2. Ein agital-demokratisches Mindset als Rahmenmodell
3. Führungskräfte im agitalen Spannungsfeld
4. Feedback statt starrer Ziele
5. Gamification statt Fehlermanagement
6. Vernetzung und Wissensaustausch
7. Mit demokratischen Strukturen zu mehr Agilität
8. Die agital-demokratische Transformation
9. Anhang
Einleitende Worte
Agilität ist für mich ein sehr persönliches Thema. Als Schüler bewegte ich mich notentechnisch grundsätzlich zwischen 3 und 4 – wenn es gut lief. Physikalische Formeln oder Englisch-Vokabeln gingen nicht in meinen Kopf. Ein wenig Faulheit spielte sicherlich auch eine Rolle. Doch hauptsächlich lag es daran, dass ich schlicht länger brauchte, um etwas zu begreifen. Im Gegensatz zu meinem älteren Bruder, der sich selbst wissenschaftliche Texte nur einmal durchzulesen brauchte, um sie sowohl zu verstehen, als auch um sie sich zu merken. Soviel zum Thema gerechte Verteilung der Gene.
Jedenfalls ließ ich bei jeder besseren Note als einer 3 im Geiste die Sektkorken knallen. Immerhin schaffte ich mein Abitur mit 3,2 und erwarb mir damit die Chance, etwas zu tun, von dem ich dachte, meine Fähigkeiten besser einbringen zu können. Die ewige Suche nach dem passenden Deckel zu (m)einem Topf. Diplom-Pädagogik beziehungsweise Erziehungswissenschaften in der altehrwürdigen Bamberger Fakultät für Pädagogik, Psychologie und Philosophie als zutiefst geisteswissenschaftliches Fach, war vermutlich die beste Wahl, die ich treffen konnte. Davon abgesehen, dass ich dadurch meine Frau fand (oder sie mich?), erfuhr ich im Studium und später in der Praxis, in welchen Kompetenzen ich gut war: Beziehungsarbeit und Menschen (an)leiten.
Heute leite ich eine Laienschauspielgruppe, eine Impro-Theatergruppe, bin 1. Vorstand eines ehrenamtlichen Vereins, coache, berate und trainiere jedes Jahr Hunderte von Führungskräften im Rahmen von Coachings, Mediationen und Seminaren und verfasse schon wieder ein neues Buch. Und das seit über zehn Jahren. Wie es dazu kam?
Als es vor etwa zwölf Jahren in meinem ersten richtigen Job kriselte und ich mich auf die Suche nach einer neuen Tätigkeit machte, stellte ich mir zwei Fragen:
Was kannst du richtig schlecht?
2.Wovor hast du Angst?
Die Antwort lautete: Vor Menschen stehen und Vorträge halten.
Und in welchem Job geht das am besten? Natürlich als Trainer und Coach, zumindest aus meiner damaligen Sicht.
Damit war mein Weg vorgezeichnet. Warum sollte ich mich auf eine Stelle bewerben, die so ähnlich aussah wie das, was ich gerade hinter mir ließ? Kurzum: Ich hatte Lust, etwas komplett Neues anzugehen. Ich hatte Lust auf eine echte Herausforderung.
Herausforderungen jedoch haben es so an sich, mit Fallen gespickt zu sein. Meine ersten beiden Bücher schrieb ich, um die Erfahrungen aus meinen ersten Trainings- und Coaching-Jahren zusammenzufassen. Leider hatte ich damals keinen Verlag und damit keinen Lektor. Zwar stehe ich nach wie vor hinter den Inhalten meiner alten Bücher über neurobiologische Erkenntnisse und Entscheidungsfindung. Doch sich damals keinen externen Lektor zu gönnen, war ein Fehler, den ich heute nicht mehr machen würde. Aber aus Erfahrungen, vor allem negativen, wird man bekanntlich klug. Trainings von damals, die ich thematisch immer noch bediene, führe ich heute ebenfalls komplett anders durch. All das könnte ich nicht, hätte ich in meinem Leben nicht so viele Fehler gemacht und das Feedback meines Umfelds aufgenommen, verdaut und verarbeitet. So führte jedes kurzfristige Scheitern zu einem langfristigen Erfolg. Jedes Chaos verschaffte mir größere Klarheit. Jede Erfahrung schärfte meine Intuition. Hätte ich damals nicht mit dem Schreiben und Veröffentlichen angefangen, hätte ich heute keinen großartigen Verlag mit einer wunderbaren Lektorin. Wäre ich nicht das Wagnis eingegangen, mit Ende 30 Trainings für Führungskräfte in den 50ern, allwissende Ärzte und hartgesottene Betriebsräte zu geben ... und immer wieder auf mitunter harte Kritik zu stoßen, stünde ich nicht da, wo ich heute stehe. Meine agile Grundeinstellung hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin.
Auch bei der Digitalisierung überwiegen für mich die positiven Seiten. Nie war es für einen Trainer leichter, Bücher zu schreiben, an einen Verlag zu kommen, sich mit Kollegen auszutauschen, über XING Auftraggeber zu finden und per Meetup themenspezifische Stammtische zu gründen.
Und dennoch frage ich mich, wie es weitergeht. CCen wir uns bald zu Tode? Implodieren unsere Gehirne, weil wir bereits jetzt in Informationen ertrinken? Stellen wir extra einen Coach an, der uns unseren digitalen Fastenplan persönlich auf den Leib schneidert?
Ist die Agilität der heilige Gral für die Servicewüste Deutschland, wie es aktuell verkauft wird? Oder führt uns die stetige Selbst- und Überoptimierung des agilen Denkens in den gesellschaftlichen Kollaps?
Und was hast du so?
Ich hab die Reaktionskrankheit.
Was?
Nennt man Adaptivitäts-Syndrom.
Ach das. Das hatte ich letztes Jahr. Drei Monate Analog-Klinik und alles war wieder gut. Das geht schnell wieder vorbei. Die Kasse zahlt ja, seitdem die Krankheit offiziell anerkannt ist.
Damit es nicht so weit kommt, sollten wir der umtriebigen, juvenilen Agilität zwei reife, erwachsene Geschwister mit Namen Demokratie und Ethik zur Seite stellen. Es wäre schade, verkäme Agilität, insbesondere in der digitalen Form, zum Selbstzweck oder würde nach einer grassierenden Burnout-Welle von der Bildfläche verschwinden. Dafür haben die Prinzipien der Agilität zu viel zu bieten.
Dann jedoch heißt es: Freie Fahrt voraus in Richtung demokratischer Agitalisierung.1 Eine Welt, in der wir eine Menge Spaß haben können, wenn wir unserem typisch deutschen Perfektionismus Zügel anlegen und uns auf das Chaos dort draußen einlassen. Eine Welt der Improvisation und der Prototypen. Eine Welt, in der niemand stört, sondern sich alle an einem Prozess Beteiligten, Kunden, Mitarbeiter und Führungskräfte, auf einen Gruppen-Flow einlassen, um Dienstleistungen und Produkte gemeinsam zu gestalten. Wo es weder Kritik noch Lob gibt, sondern lediglich Rückmeldungen zur Standortergründung und Weiterentwicklung. Eine Welt, in der es nur noch gutartige Hierarchien gibt, in denen Führungskräfte und Mitarbeiter sich gegenseitig mit Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit und Respekt begegnen.
Wir befinden uns bereits mitten in einem riesigen Transformationsprozess. Vor Gott und im Internet sind alle gleich. Die Agilität reißt uns mit wie ein Fluss im Frühjahr nach der Schneeschmelze. Wir können nach wie vor die Augen verschließen und das „Ich bin nicht da“-Spielchen spielen. Eine beliebte Zusatz-App dieses Spiels lautet „Ich habe keine Zeit und bin wahnsinnig gestresst“, auch in der Variante „Wir sind total unterbesetzt“ immer wieder gerne genommen.
Oder wir gehen das agitale Wagnis ein, fragen uns nicht, was fehlt, sondern was der Hintergrund des Fehlens ist, trauen unseren Mitarbeitern autonome Entscheidungsprozesse zu, virtuell oder face-to-face, geben ihnen in Richtung Agilität ein Paket Stabilität mit auf den Weg, um das Chaos einzudämmen, führen frisch-freche Feedbackkulturen ein, von oben nach unten, von unten nach oben und zur Seite, wenn es um Kunden geht, installieren eine moderne Führungskultur, in der es wichtiger ist, im Prozess mit den Mitarbeitern kritische Themen auszudiskutieren, als Ziele vorzugeben und betrachten Fehler endlich als das, was sie sind: Rückmeldungen aus der Umwelt und Richtungsanzeiger zur evolutionären Weiterentwicklung.
Gewinnen könnten wir eine Menge. Mitarbeiter könnten zufriedener sein, von glücklich will ich gar nicht sprechen. Denn was sich Mitarbeiter am meisten wünschen – darin sind sich zahlreiche Umfragen einig –, ist die Möglichkeit autonomer Gestaltung. Vielleicht macht es sie sogar gesünder. Gestaltende und mitbestimmende Mitarbeiter wiederum bescheren ihren Organisationen innovativere Ideen, die im nächsten Schritt die Kunden zufriedener machen. All dies wiederum verfeinert durch Feedbackprozesse das demokratische Grundverständnis, Führungs-, Feedback- und Fehlerkultur.
Der Dreh- und Angelpunkt dieser bescheidenen Utopie ist und bleibt die Agilität:
Eben hatte ich mich gefreut, wie kreativ ich bin, dann allerdings erkannt, dass ich nicht der einzige mit Vernetzungsfantasien bin (vgl. https://blog.ewerk.com/tag/agital/).
1. Agilität und Digitalisierung geht uns alle an
1.1 Agilität zu Urzeiten
1.2 Zurück in der Jetztzeit
1.3 Was bedeutet Agilität?
1.4 Digitalisierung als Antreiber
1.5 Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Agilität
1.6 Wie agil müssen wir werden?
1.7 Menschlichkeit und New Work in agitalen Zeiten
1.1 Agilität zu Urzeiten
Das Meer weckte schon immer Sehnsüchte in uns. Am Strand stehen. In die Ferne blicken. Damit einhergehend die Frage: Wie mag es wohl auf der anderen Seite des Meeres aussehen?
Vor Millionen von Jahren entstanden die ersten Bausteine unseres Lebens in unseren Ozeanen. Mitten im Getümmel der Weltmeere war es aufgrund der turbulenten Strömungen unmöglich, dass sich verschiedene Stoffe paaren konnten. Doch am Rande vulkanischer Tiefseeschlote, in einem etwas geschützteren Raum, bildeten sich erst Aminosäuren, dann Peptide, dann Proteine und wurden schließlich, einige Paarungen später, zu unserer DNS, unserer Desoxyribonukleinsäure, dem Speicher unseres genetischen Codes. Dieses muntere Treiben setzte sich fort bis zum nächsten großen Krach. Was wir heute als zum Glück sehr seltene Naturkatastrophen wie Tsunamis und Seebeben kennen, war damals an der Tagesordnung. Also musste sich die Evolution etwas einfallen lassen, um nicht ständig von vorne anzufangen. Vielleicht war es dieses uralte Bild, das uns den Mythos von Sisyphos bescherte. Die Evolution jedenfalls kam auf die glorreiche Idee, eine Schutzhülle um die Proteine, die DNS und all die anderen wertvollen Stoffe zu bauen. So konnten Beziehungen aufrechterhalten werden. Die Stoffe bekamen eine Art Heimat und konnten sich im geschützten Rahmen verbinden und weiterentwickeln. Und jetzt kommt der Clou der ganzen Geschichte: Die Zellwände, mit denen wir heute noch leben, bestehen aus einer semipermeablen Membran. Wichtige Nährstoffe lassen sie durch, Giftstoffe blocken sie ab.3
Dieser kurze Einblick in die Evolution beinhaltet alles, was eine agile Organisation ausmacht: Es gibt keinen allmächtigen Gott, keinen CEO und keine allwissenden Führungskräfte, die auf die Idee einer semipermeablen Membran kommen würden. Eine halbdurchlässige Hülle ist schlichtweg Teil unserer Biologie, um unseren inneren Zellen eine sichere Heimstatt zu bieten und gleichzeitig durch Nährstoffe – nennen wir sie Informationen von außen – am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln. Warum also nicht unseren Abteilungen, Teams und einzelnen Mitarbeitern etwas bieten, in dem sie sich sowohl sicher fühlen als auch die Möglichkeit haben, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln?
Gleichzeitig bietet diese Metapher alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter auf dem Weg in Richtung agitaler Organisation mitzunehmen. Das Bild der Zellen vermittelt den Zusammenhalt, ist kreativ und lebendig und verdeutlicht zudem ein langfristiges Durchhaltevermögen. Immerhin ist der Mensch ein Erfolgsmodell, wenn auch ein sehr widersprüchliches. Die Idee dahinter lautet: Wir entwickeln uns so oder so weiter. Wir können uns darauf einlassen oder uns wehren. Es liegt an uns, wie wir mit Umwelteinflüssen umgehen.
Die Welt, in der wir leben, bezeichnen viele als feindselig und disruptiv. Lassen wir das nicht die Kleinzeller der Urzeit hören. Obwohl, vielleicht lagen die Disruptionen von damals gar nicht an den schwarzen Meeresrauchern, sondern am Humor der Proteine, die mit ihrem lauten Lachen … aber das ist eine andere Geschichte. Überhaupt dieser Begriff. Disruptiv! Was für ein schlechter Treppenwitz. Ein Blick in die Geschichtsbücher würde uns vor einer solchen Bezeichnung bewahren. Der 100-jährige Krieg war disruptiv. Der Erste Weltkrieg. Das Dritte Reich natürlich. Und im London zu der Zeit von Jack the Ripper war es auch nicht gerade gemütlich. Damals hatten die Menschen allerdings keine Zeit, sich Gedanken über solche abstrakten Begriffe zu machen.
Die Beule, die du im Gesicht hast … sieht nicht gut aus.
Ja, ja die Pest. Wir leben in disruptiven Zeiten.
Wahrscheinlich haben wir immer noch zu viel Zeit. Wahrscheinlich geht es uns immer noch zu gut. Wahrscheinlich haben wir zu wenige lebensbedrohliche Probleme.
Geschichten transportieren Werte
Wollen Sie Ihre Mitarbeiter mit einer Metapher oder einem Bild wie diesem an Ihre Idee heranführen, sollten Sie sich klar machen, welche Werte Sie transportieren wollen.
Was wollen Sie Ihren Mitarbeitern vermitteln? Vielleicht folgende Botschaften:
Wir müssen zusammenhalten. Lasst uns innovativ unsere eigene Zukunft in die Hand nehmen.
oder
Die Zeiten werden härter. Doch den Mutigen gehört die Welt.
Die Digitalisierung schafft Organisationen ab, die sich mit Pseudowerten am Leben halten. Dafür erschafft sie aus dem Nichts Unternehmen, die allein aufgrund einer Idee Erfolg haben. Die Idee lässt sich klauen und kopieren. Ideen und Werte müssen aber auch gelebt werden.
Wofür steht Ihre Organisation?
Welche Idee hält alles zusammen?
Wird diese Idee Ihre Organisation auch morgen noch durch die Weltmeere tragen?
Wie Sie der arabischen Ziffer entnehmen, wird es nicht die einzige Evolutionsmetapher bleiben. In der Tat ziehen sich metaphorische Bilder durch das gesamte Buch, 15 Stück an der Zahl, um Sie bei Ihrer Mission zu unterstützen, Ihren Mitarbeitern die Vorzüge der Agilität nahezulegen. Sie sind frei, davon reichhaltig Gebrauch zu machen. Sollten Sie weniger auf Evolutionsmetaphern stehen, helfen Ihnen vielleicht die Witze, die ich inhaltsspezifisch zu den jeweiligen Unterthemen ausgesucht habe.
3Vgl. Schätzing, S. 44 ff.
1.2 Zurück in der Jetztzeit
Ich komme weder aus der IT, noch aus dem Projektmanagement. Mein Schwerpunkt liegt im Coaching und Training von Führungskräften. Die IT arbeitet seit 20 Jahren mit agilen Projektmanagement-Methoden. Die Produktzyklen, der Anpassungsdruck, die Kundenwünsche sind hier ohnehin viel schneller getaktet. Und doch ist die agile Welt als Führungs- und Organisationsentwicklungsthema, nicht zuletzt über die Digitalisierung, in Ansätzen bereits in der restlichen Arbeitswelt angekommen.
Ein Gespräch mit einem Vorstand im kommunalen Bereich heute Morgen:
„Und woran arbeiten Sie gerade so, Herr Hübler?“
„Agiles Management.“
„Aha … Und was ist das?“
„Der Versuch, weniger zu planen und stattdessen adaptiver mit einer sich schnell wandelnden Welt zurechtzukommen. Dafür brauchen wir Leistungsteams, die sich darauf einlassen, selbstorganisatorischer zu werden und mehr Verantwortung zu übernehmen.
„Ach was. Genau da stecken wir gerade drin. Bei den ganzen Umbrüchen, die wir momentan wegzustecken haben, geht es nicht mehr ohne selbstverantwortliche Teams. Wenn die nicht oftmals so rückwärtsgewandt wären!“
Ich arbeite seit zwölf Jahren als Coach, Mediator und Trainer. Unterhaltungen wie diese häufen sich seit etwa fünf Jahren. Gespräche, die Ihnen vermutlich ebenso bekannt sind.
Auch bei Tätigkeiten, von denen viele Arbeitnehmer bisher dachten, das Leben wäre ein langer, ruhiger Fluss, wird die Notwendigkeit adaptiv-agilen4 Handelns gnadenlos vorangetrieben.5 Der technologische Wandel und die Digitalisierung vernetzen nach und nach jeden mobilen und immobilen „Schreibtisch“. Kunden sind zunehmend besser informiert und stellen aufgrund dessen höhere Ansprüche an Dienstleistungen und Produkte. Die Globalisierung wirft Unternehmen aus Ländern auf den Markt, die wir lediglich von Bildern mit einem Meer von Gewürzsäcken kannten, die früher allenfalls romantisch von unseren Küchenwänden grüßten. Auch intern brodelt es in der Teamkantine. Manch einer verzweifelt bei der Bestellung eines bloßen Bleistifts. Ohne Corporate Logo erscheint dieser undenkbar.
Das Lean Management postulierte schon vor vielen Jahren: Ein Prozess, der keinen Wert schöpft, gehört abgeschafft.6 Die dampfende Kaffeemaschine war damit nicht gemeint. Das Corporate Logo auf jedem Gebrauchsgegenstand allerdings schon.
Dabei würde er doch so gerne gestalten und sich einbringen, der Mitarbeiter. Laut einer Studie des Gallup-Instituts beantworteten nur 20 Prozent von 1,7 Millionen Teilnehmern die Frage „Können Sie an Ihrem Arbeitsplatz das tun, was Sie am besten können?“ mit einem Ja.7 Reicht uns das?
Wie lautet unser Organisationszweck?
Worin besteht meine Aufgabe als Führungskraft?
Welche Tätigkeiten sind dafür zwingend nötig?
Welche Tätigkeiten, die ich dennoch mache, sind dafür unnötig?
Welche Meetings, Besprechungen, Dienstanweisungen, Massenmails, könnten wir uns sparen?
Welche Tätigkeiten wären stattdessen sinnvoller zur Erfüllung meiner Aufgabe und unseres Organisationszwecks?
Der demografische Wandel ersetzt die sich verabschiedenden Babyboomer durch die in die Arbeitswelt drängende Generation Y und katapultiert uns mitten hinein in einen enormen Wertewandel-Sandsturm. Ein Wertewandel, der zu mehr Individualisierung8 und Flexibilisierung führt. Die Generation Y (Why!) verlangt logische Erklärungen und wünscht sich eine individuellere Führung. Sie wechselt schneller den Job und will mobiler arbeiten. Kurzum: Es wird eine Menge Staub aufgewirbelt und viele Organisationen fürchten sich weniger vor dem Chaos durch die Staubwolke, als vielmehr vor der Klarheit, wenn sich die Staubwolke wieder lichtet.
Die Evolution kennt kein „Weiter so“. Jede Reaktion der Umwelt führt zu einer Variation einer Vielzahl an „Angeboten“ und der Selektion des erfolgreichsten Modells. Zu diesem Anpassungsdruck von außen kommt das Faktum, dass bereits durch die Vermischung der männlichen und weiblichen Gene in jeder neuen Generation ein komplett neuer Genmix entsteht.9
Angestellte vernetzen ihr Wissen mithilfe von Dokumenten-Management-Systemen und Wissensplattformen. Kommunen rüsten sich für die Digitalisierung. Die Bürger sollen und wollen mehr partizipieren, wie die beredten Bestrebungen der Stadt Nürnberg zur Einbeziehung junger Bürger in den Prozess der Bewerbung zur Kulturhauptstadt bezeugen.10
Mitarbeiter und Führungskräfte klagen über immer weniger Zeit. Wollen sie nicht als unfähig gelten, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihre eigene Rolle und damit die Rollen und Verantwortlichkeiten ihrer Teamleiter und Teams von Grund auf neu zu definieren. Unsere alten Modelle, bestehend aus Hierarchien, Planung und Fehlervermeidung sind zu zeitraubend und stressintensiv. Unser Führungs- und Organisationsmodell der Perfektionierung und Kontrolle mag in Zeiten standardisierter Massenproduktion funktioniert haben. In unserer heutigen Zeit individueller Probleme verhindert dieses alte Modell des Denkens so lange eine Entscheidung, bis sich die Welt wieder verändert und wir von neuem mit dem Denk- und Entscheidungsprozess beginnen müssen. Ein Teufelskreis, der verzweifelt auf der Couch von Zeit- und Stressmanagement-Trainern liegt. Die wirklichen Ursachen bleiben außen vor.
Mittendrin in einer agitalen Welt
Dabei stehen wir seit Jahren mittendrin im Labyrinth der schönen neuen Wirtschaftswelt. Agile Methoden sind keine Neuschöpfungen der letzten zehn Jahre, Lean Management gibt es seit den 1990ern. Wissensmanagementsysteme, Prozessmanagement, agiles Projektmanagement, beziehungsorientiertes Führen, Management by Walking around – alles Bausteine, die mehr oder weniger agil ablaufen.
Wie sehr ein agiles Management in unserem Handeln verankert ist, wenn auch nicht in unserem Denken, zeigt sich an einigen Beispielen:
Der Zugriff auf Dokumenten-Management-Systeme sowie die Arbeit mit Wikis und Weblogs oder Wissenslandkarten finden in einer Schattenkultur statt und umgehen klammheimlich etablierte Hierarchien. Ziehe ich benötigtes Wissen aus meinem digitalen Umfeld, brauche ich niemanden mehr, der mir dieses Wissen abnickt. Die Abnicker würden in unserer Welt der komplexen, schnellen Entscheidungen ohnehin zu spät kommen.
Mobile Lernsysteme wie moodle oder ilias ermöglichen ein Lernen von überall und jederzeit. Solche Systeme sind insbesondere spannend, wenn sie mit Wissensmanagementplattformen und Dokumenten-Management-Systemen gekoppelt werden und so durch stetige Feedbackprozesse ein direktes Während-der-Arbeit-Lernen ermöglichen. Damit könnte sich im besten Fall der Wunschtraum von Personalabteilungen nach einem lebenslangen Lernen für wenig Geld erfüllen.
Die Managementliteratur ist voll von psychologischen Konzepten, die in den letzten Jahrzehnten in Führung, Moderation, Marketing und Kreativitätsabläufe einflossen. Auch hier tröpfelt agiles Denken in die Alltagsprozesse, teils bewusst, teils unbewusst, was jedoch zumeist unter der Oberfläche versickert. So mancher fragt sich, warum eine Methode nicht funktioniert. Warum werden unsere Feedbacksysteme, wie beispielsweise Dialogrunden zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, so selten genutzt? Warum werden Gamification-Versuche nicht so angenommen, wie wir uns das wünschen? Ein agiles Denken kann nur Früchte tragen, wenn es in einem agil-demokratischen Boden, einer agil-demokratischen Kultur verankert ist.
Der gesamte mediatorische Bereich verdeutlicht den Aspekt der Selbstorganisation. Der Kern einer Mediation ist nicht der allmächtige Richterspruch, sondern die Fähigkeit, gemeinsam zu einer für alle Beteiligten befriedigenden Lösung zu kommen. Das funktioniert nur, wenn alle sich als Quellen eines Flusses verstehen, der nach und nach zu einem gemeinsamen Strom wird. Sicherlich gibt es eine Ursprungsquelle, eine Person, die mehr einbringt. Dennoch tragen alle Quellen, auch die Querschläger im Team, dazu bei, den Strom zu etwas Einzigartigem zu gestalten.
Diese Beispiele zeigen, dass es nicht ausreicht, agitale Methoden halbherzig einzuführen, um sie nachhaltig zu etablieren. Ansonsten bleibt es in vielen Organisationen bei einem Stückwerk. Das allein wäre nicht so schlimm, haben doch agile Methoden und die Digitalisierung von Prozessen einen Wert an sich: Sie sparen Zeit und Stress, da wir uns mit agilem Denken und agilen Haltungen von dem Mythos verabschieden, uns mit einer perfekten Planung die Zukunft herbeizudichten. So können einzelne agile Vorgehensweisen sehr wohl in einzelnen Abteilungen etabliert sein, während die restliche Organisation anders tickt, die Agilität des Sonderlings jedoch duldet oder sogar vor dem Hintergrund besonderer Umstände fördert. Zumal nicht jede Abteilung agil handeln muss, dazu später mehr. Schlimm wird es erst, wenn der Rest der Organisation die Bestrebungen des Ausreißers durch festgefahrene Strukturen und eine rückwärtsgewandte Kultur zunichtemacht, was allzu oft passiert. Dann treffen Teams keine autonomen Entscheidungen mehr. Und Dokumenten-Management-Systeme, Wikis und Sharepoint-Plattformen werden nicht so genutzt, wie sie sollten. Vielleicht ist es doch nicht erlaubt, seine Zeit im Intranet zu „vergeuden“. Oder es fehlt das Vertrauen der Mitarbeiter, dass das gepostete Problem am Monatsende wie ein Boomerang zurückkommt und den Problembesitzer bösartig am Schädel trifft. Die Erlaubnis und das Vertrauen in die Mitarbeiter, ihre Zeit sinnvoll nutzen zu wollen, sind Führungshaltungen, die Autonomie und die Nutzung digitaler Entscheidungshilfen erst ermöglichen.
Auch die mediative Denke, dass unterschiedliche Meinungen gemeinsam ein Ganzes ergeben und zu dem Teamgedanken führen, den wir uns wünschen, findet sich noch zu oft ausschließlich in Konflikt- und Problemfällen wieder, statt als Grundlage einer kooperativen Zusammenarbeit zu gelten.
Ähnlich ergeht es Kreativmethoden aus dem Projektmanagement. Wir werden noch sehen, dass die Ideen hinter Methoden wie Design Thinking, Open Space oder Appreciative Inquiry nicht neu sind. Vieles war schon einmal da und wird heute als die preisgekrönte Sau durch's Dorf getrieben. Wenn es hilft, meinetwegen. Verändert sich die Grundhaltung von Führung und Management nicht entscheidend, werden diese Methoden weiterhin ein Nischendasein fristen und so manche agilen Coaches nach aufreibenden Jahren die Flinte ins Korn werfen lassen. Ein Heldendasein ohne Rückendeckung ist niemals von Dauer.
Agilität und Digitalisierung geht jeden an, der mit einem digitalen Endgerät verbunden ist und über dieses Gerät Arbeitsaufträge bekommt. Jeden, der in einem Team arbeitet. Jeden, der Kunden betreut und diesen ein Produkt oder eine Dienstleistung angedeihen lässt. Jeden, der in irgendeiner Weise Teil einer Wertschöpfungskette ist.
Beduinen reiten von Oase zu Oase. Sie denken bereits beim Verlassen einer Oase an die nächste. Touristen hingegen denken nach dem Verlassen einer Oase an die Strapazen der Wüste.
Was sind Sie: Ein agitaler Beduine oder ein Tourist?
Agilität hätte im Ursprung Adaptivität heißen und damit die Fähigkeit bezeichnen sollen, sich wechselnden Umständen evolutionär anzupassen. Aber wahrscheinlich war der Begriff der Adaptivität den Gründervätern und -müttern zu wenig sexy. Jetzt haben wir den Salat und stellen uns unter einem agilen Manager einen ewig wuselnden Menschen mit Hummeln im Hintern vor.
5Vgl. Häusling, Agile Organisationen, S. 17 ff.
6Vgl. Scheller, S. 46
7Vgl. Lind, S. 214, in: Sattelberger et al.
8Glauben wir soziologischen Untersuchungen, verfügen junge Menschen kaum noch über weltverbessernde Visionen wie bei den 68ern. Damit fehlt ihnen eine Vorstellung ihrer Rolle in der Welt, was sie automatisch in den Individualismus drängt. Manche reagieren reaktiv-agil auf ihre Umwelt, um möglichst gut durchs Leben zu kommen. Andere verfolgen einen aktiv-agilen Ansatz, um ihre Karriere voranzubringen. Individualistisch ist beides.
9Vgl. Glaubrecht, S. 33, in: Grolle
10Da ich in einigen hippen Gruppen unterwegs bin, hätte ich mich beinahe zu einer solchen Gruppe angemeldet, bis ich merkte, dass ich das Höchstalter von 28 Jahren knapp überschritten habe. So geht Diversity!
1.3 Was bedeutet Agilität?
1.3.1 Agiles Denken bedeutet nicht, planlos zu sein
Laut dem allgemeinen Agilen Manifest ist der oberste Sinn agilen Vorgehens, den Kunden glücklich zu machen. Alle Prozesse sind strategisch auf den Kunden ausgerichtet.11 Böse Zungen behaupten, agil zu arbeiten führe langfristig zu einer neuen Burnout-Welle. Nun ist Agilität eine Philosophie und keine bloße leistungssteigernde Maßnahme. Mitarbeiter darauf zu trimmen, sich ausschließlich am Kunden zu orientieren, um ihn glücklich zu machen, ohne Verinnerlichung dieser Philosophie, erscheint mir unmöglich. Genau daran scheitern viele Unternehmen. Mitarbeiter, die nicht mitziehen, brauchen nicht vor einem Burnout bewahrt werden. Doch was ist mit der schönen neuen New Economy-Welt aus Kollegen, die tatsächlich den Unternehmer im Unternehmen verkörpern und damit die agile Philosophie mit jeder Zelle ihres Körpers leben?
Die Orientierung am Kunden ist sicherlich richtig und wichtig, zumal der Kunde lange Zeit keinen Platz in Organisationen hatte. Wie André Häusling schreibt: „Und wo ist der Kunde in Ihrem Organigramm?“12
Er durfte bezahlen, sollte aber glücklich über Produkt und Dienstleistung sein. Das Feedback der Kunden in Produkte einzubauen dauerte bei den langen Produktzyklen und Massenproduktionswaren der letzten Jahrzehnte viel zu lange. So blieb es meist bei einer Abfrage, woraufhin zu wenig passierte. Der Kunde dachte sich: Was soll's? Es gibt andere Unternehmen, die mich besser bedienen. Sprach's, verschwand und kaufte sich einen anderen Drucker, nur um fünf Jahre später wieder bei seinem vorherigen Anbieter zu landen.
Andere böse Zungen behaupten, Agilität wäre chaotisch. Agilität bedeutet nicht, dass nicht mehr geplant wird. Vor einem Gespräch mit einem Mitarbeiter oder Kunden sollte ich mir ein paar Gedanken machen, um gut vorbereitet in die Situation zu gehen.
Was also hilft mir, als Mitarbeiter oder Führungskraft sicher in Situationen, Gespräche oder Meetings zu gehen? Ein Minimum an Wissen? – Kann nicht schaden. Die Reflexion vergangener Projekte? – Wäre auch nicht schlecht. Bisherige Erfahrungen mit dem Kunden? – Durchaus sinnvoll. Sich ein paar Fragen zu den Wünschen und Bedürfnissen des Teams zurechtzulegen, wäre ebenso interessant. Wissen ist nichts Schlechtes, solange man nicht den Fehler macht, die Vergangenheit mit der Zukunft zu verwechseln: Die Vergangenheit lässt sich erklären – die Zukunft wird anders verlaufen.
Ansonsten gilt, was ich später im Kapitel über Führung vertiefen werde: Haltung, Haltung und nochmals Haltung. Sie werden sehen: Mit Ruhe, Offenheit und einer neugierigen, fragenden Einstellung kommen Sie weiter als mit einer 100-prozentigen Vorbereitung, die es ohnehin nicht gibt. Weil es im Fall der Fälle doch anders kommt. Hier gilt sinngemäß der Spruch des ansonsten nicht gerade durch philosophische Tiefen auffallenden Mike Tyson: „Jeder hat einen Plan – bis er was auf die Fresse bekommt.“
Aufbauend auf der 20/80-Regel denken eine agile Führungskraft und ein agiles Team in Szenarien und planen in Prototypen. Im Umgang mit komplexen Situationen geht es nicht anders, als eine Situation von vielen verschiedenen Perspektiven aus zu betrachten, einen Prototypen auf die Reise zu schicken und diesen aufgrund der Rückmeldungen stetig zu verfeinern. So könnten Sie als Führungskraft in einem Mitarbeitergespräch ein Thema wie „Unzufriedener Kunde“ als Testballon in die Luft werden. Nicht als Vorwurf, sondern als Frage, ob es wirklich so ist und was daran verändert werden kann. Im agilen Denken kommt es nicht darauf an, am Ziel „Der Mitarbeiter muss sich verändern“ festzuhalten, sondern spielerisch Szenarien durchzudenken, in denen Verfehlungen aus Kundensicht häufig oder drastisch passieren, sich Schritt für Schritt an dem Thema abzuarbeiten und so den ursprünglichen Prototypen „Unzufriedener Kunde“ nach und nach zu verfeinern.
Diese Vorgehensweise, die auf eine Vielzahl von Situationen und Zielen übertragbar ist, führt automatisch dazu, langfristig unnötige Tätigkeiten und Pläne zu unterlassen, die auf dem Weg zwischen Zielsetzung und Zielerreichung entstehen. Als Führungskraft kann ich nicht wissen, was in meinem Mitarbeiter vor sich geht. Genauso wenig wie Mitarbeiter wissen, was Kunden denken, auch wenn uns das Marketing das gerne weismachen würde. Ich kann nur Vermutungen anstellen, die ich anschließend prüfe.13
Gleichzeitig ergibt das schrittweise Vorgehen des agilen Denkens eine Dynamik aufgrund der höheren spürbaren Effizienz (die Dinge richtig tun) und Effektivität (die richtigen Dinge tun) und damit eine Motivation, die in Planungen in aller Regel verloren geht. Das Aufgehen im Tun, der Flow ist es, was den Reiz an einer agilen Vorgehensweise ausmacht und bereits mindestens die halbe IT-Welt mit dem Virus der Agilität ansteckte.
Beinahe nebenbei werden Sie als Führungskraft merken, dass eine Vorgehensweise, die Themen Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Mitarbeiter klärt, Sie nicht (mehr) in die Bredouille bringt, am Engagement Ihrer Mitarbeiter zu (ver-)zweifeln. Angestrebte Ziele und Vorgehensweisen entstehen auf dem gemeinsamen Weg und sind damit wesentlich motivierender als bei aufoktroyierten Zielen.
1.3.2 Grenzen der Agilität
Dennoch gilt es, bei aller Euphorie ein paar Aspekte zu beachten:
Innovationen: Kurz- oder langfristig?
Sagte Steve Jobs nicht einmal (sinngemäß): „Der Kunde hat keine Ahnung. Innovationen entstehen aus Vorgaben des Unternehmens.“ Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass manche meiner Angebote, insbesondere die schrägen, wie die Mischung aus Improtheater und Konfliktmanagement14, die ich gemeinsam mit einer Improtheaterkollegin anbiete, niemals zustande gekommen wären, hätte ich mich ausschließlich an Kundenwünschen orientiert.
Zudem gibt es die bekannte Regel, dass unzufriedene Kunden sich beschweren, während sich zufriedene Kunden denken: „Nix gsagt isch gnug globt“. Verändere ich mein Angebot aufgrund eines unzufriedenen Kunden, erschaffe ich damit unter Umständen zehn neue Unglückliche.
Der Dreh- und Angelpunkt für innovative Ideen muss daher bei der Organisation liegen, die aus jahrelanger Erfahrung weiß, wann sie etwas verändern und wann sie Geduld haben sollte. Der Kunde übernimmt lediglich die Verfeinerung.
Ohnehin stellt sich die Frage der Qualität einer Innovation. Dienen faltbare Minidrohnen wirklich dazu, Kundenbeziehungen Flügel zu verleihen? Wie häufig so eine Drohne für knapp 23 Euro in die Lüfte steigt, ist fraglich. Dafür ist das Produkt superbillig und so neu und hip wie der nächste Klick auf YouTube. Und wenn die Innovation abstürzt, kommt eben die nächste dran. Der Kunde ist ohnehin so ungeduldig wie ein YouTube-User. Die meisten Videos dort werden angeklickt, wenn sie unter einer Minute dauern. Oder ist es innovativ, ein Produkt in den Händen zu halten, das mich ein halbes Leben lang begleiten wird?
Der Soziologe Gerhard Schulze vertritt die Meinung, dass es keine eindeutige Antwort auf solche Fragen gibt. Grund dafür ist, dass der neue Menschentyp sein Heil nicht mehr in der Konsumsteigerung sucht, sondern in Selbstgenügsamkeit und in gerechter Nutzung bestehender Möglichkeiten.15 Besitz war gestern – Sharing lautet heute die Devise. Vielleicht gilt das auch bald für unsere oberflächliche Eventkultur von vorgestern und echte Gefühle treten wieder in den Vordergrund. Hätte damit das letzte Stündchen von incentives geschlagen?
Glücklicherweise gibt es agile Ansätze, die weit über deren Lean Management-Ursprünge hinausreichen und Strategien nicht nur aus Kundenperspektive, sondern aus der Sicht aller Beteiligten betrachten. Der Mitbegründer der Haufe-umantis AG, Hermann Arnold, bezeichnet sie als Architekten des Transformationsprozesses: Mitarbeiter, Führungskräfte, Personalabteilung, Betriebsrat, Geschäftsführer, Kunden, Aktionäre, Aufsichtsrat und Geschäftspartner haben alle ihren Anteil an der Strategieentwicklung der Organisation.16 Gemäß dem Gesetz der erforderlichen Varietät von W. Ross Ashby bleibt uns auch nichts anderes übrig, um mit komplexen Situationen umzugehen: Störungen in komplexen Systemen werden am besten mithilfe eines ebenso komplexen Systems gesteuert.17 Eine Verantwortungsteilung in Organisationen, um neue Lösungen zu finden und Innovationen zu entwickeln, ist daher kein Selbstzweck oder eine Zubilligung an demokratischere Strukturen in der Mitarbeiterschaft, sondern pure Notwendigkeit.
Sollten unsere Produkte und Dienstleistungen in Anbetracht von Umweltkatastrophen, US-amerikanischer Geisterstädte und radikal-politischer Umbrüche nicht ein wenig mehr Stabilität und Sicherheit vermitteln? Bei aller Flexibilität ist es vermutlich das, was Uber und Airbnb ausmachen: eine Plattform für jede Taxifahrt und eine für jede Hotelbuchung. Mir scheint, Uber und Airbnb haben es verstanden, während manche Politiker lediglich so tun, als ob.
Ethik und Jugendwahn
Weiterhin stellt sich mir die Frage, inwieweit ich aus Kundenwünschen ethische Grundsätze generiere? Kunden agieren in der Mehrheit weitgehend nach dem ökonomischen Prinzip und entscheiden sich am liebsten für das am schnellsten lieferbare, schönste und billigste Produkt. Die Langlebigkeit ist wichtig. Moralische Aspekte wie Kinderarbeit oder Umweltzerstörungen und Nachhaltigkeit spielen ebenso eine Rolle, verstecken sich jedoch am Grabbeltisch der Panikkäufe hinter unserem Lustzentrum, sobald die roten Preisreduzierungsschilder in unserem Nucleus accumbens zu blinken beginnen. Auch unternehmerische Verfehlungen sind schnell vergessen, wenn der Preis stimmt. Gesellschaftliche Entrüstungen scheinen eine Erinnerungszeit von etwa drei Monaten zu haben. Gleiches gilt für gehypte „Produkte“ wie den „Schulz-Zug“18, dessen Komet so schnell wieder fiel wie er aufstieg. Zum Gruseln.
Weniger zu planen und sich stattdessen mehr an aktuellen Begebenheiten zu orientieren, erscheint im Hinblick darauf, dass viele unserer Pläne in der heutigen Zeit ohnehin nicht mehr funktionieren, nicht nur wichtig, sondern in manchen Kontexten überlebensnotwendig. Ein Hochwasser oder Fukushima zur richtigen Zeit und – schwupps – sitzt ein grün-grauhaariger Bürstenschnitt im schwäbischen Oval-Office. Ethisch-moralische Grundsätze als Klammer für unternehmerische Strategien und Aktivitäten dürfen jedoch nicht unter den Tisch fallen. Die moralische Verantwortung liegt auf beiden Seiten des Wahl-, Entscheidungs- und Verkaufstischs. Die agile Manie der hauptsächlichen Fokussierung auf den Kunden führt unsere Unternehmen langfristig in den Abgrund. Wird die Spirale der ständigen Optimierung stetig weiter getrieben, werden zusätzlich zu den Mitarbeitern auch Unternehmen ausbrennen. Mir scheint, als hätten Marketing-Experten ausschließlich die Zielgruppe der 10-bis 35-Jährigen im Blick, von der frühen Jugend bis zur Postadoleszenz. Und da 40 das neue 30 ist, fallen die auch noch mit hinein. Die Juvenilisierung unserer Gesellschaft bis ins hohe Alter nimmt erschreckende Züge an. Die Jugend jedoch prägt die Meinungsbildung einer Gesellschaft stärker als alle anderen Gruppen. Sie ist erlebnishungrig, abwechslungsbedürftig, neugierig und expressiv.19 Kein Wunder, dass es kaum noch Marken wie Nivea oder Brandt gibt, deren Optik sich über die Jahre kaum veränderte.
Gespräch mit einer Verkäuferin im Drogeriemarkt:
Schäumt eine Rasiercreme genauso wie Rasierschaum?
Vermutlich ja. Aber die Marketingmenschen glauben, dass das Wort Creme freundlicher zur Haut ist als ein Schaum.
Orientieren wir uns hauptsächlich agil am Kunden, werden wir eines schönen Tages explodieren vor lauter Regal-Wechsel, Shampoo mit Toffee-Geruch, Chili- und Kaffee-Extrakten für besonders wache Haare und verbaler Euphemismen. Die meinungsbildende, juvenile Hauptzielgruppe will es so. Der Markt folgt willig.
Was jedoch würde passieren, würden wir die markenrelevanten Zielgruppen nicht nur mit einem kurzen Like-Klick abholen, sondern in die Entwicklungsprozesse von Produkten und Dienstleistungen demokratisch einbinden? Die Ergebnisse könnten uns überraschen: Im Rahmen eines solchen innovativen Prozesses würde nicht nur das kurz getaktete Belohnungszentrum der Zielgruppe angetriggert, das auf jeden Klick mit einer Ausschüttung von Endorphinen reagiert, als säßen wir immer noch am Lagerfeuer und hörten ein Knacksen im Dunkeln, sondern zusätzlich deren Neocortex, ihr langfristiges, planerisches Denken. Mit einem Mal spielen neben der kurz getakteten Lust auch Werte eine Rolle. Erinnern wir uns noch einmal an die Sharing-Communitys junger Menschen. Willkommen in der Welt des erwachsenen Verantwortungsbewusstseins!
Der Mitarbeiter als Human Resource
Dem Kunden als Umweltfaktor und Nutzer Nummer Eins eine größere Rolle zuzugestehen, erscheint aus agiler Sicht absolut sinnvoll. Zu lange kochten Organisationen in ihrem eigenen Sud. Damit treten allerdings die Personen in den Hintergrund, die Organisationen am Laufen halten: die Mitarbeiter. In manchen Branchen und Arbeitszweigen werden die Mitarbeiter tatsächlich in den Burnout getrieben, durch einen digitalen Kontrollwahn, Entgrenzung der Arbeitszeiten, Arbeitsverdichtung und Powerstunden, die mit AC/DCs „Hells Bells“ eingeläutet werden20 und den prekären Freelancern kurz vor Feierabend (wieso Feierabend?) noch einmal richtig Feuer unterm Hintern machen sollen.
Nach meiner Auffassung sollten Agilität und das Feedback von Kunden deshalb nicht als Entschuldigung dienen, einem Gott namens „Höher, Schneller, Weiter“ zu huldigen (auch wenn die FDP in der letzten Bundestagswahl wieder mächtig zulegte), sondern sich auf einem guten Lernlevel einzunisten. Es könnte sein, dass dies für ein halbes Jahr sinnvoll ist, um seine Erfahrungen auf dieser Stufe nachhaltig zu vertiefen, anstatt wie Super Mario von Bildschirm zu Bildschirm zu springen. Oder um es mit den Worten meiner Frau zu sagen: „Jetzt haben sie im Supermarkt schon wieder die Produkte umgestellt. Das nervt!“ – die Kunden vermutlich ebenso wie die Mitarbeiter. Früher kannte man sich in seinem Lieblingsdiscounter aus wie im heimischen Wohnzimmer – deutschlandweit! Die Zeiten sind offensichtlich vorbei. Oder ist genau das der perfide Plan der Supermarkt-Innenarchitekten? Du brauchst ewig, bis du deine Lieblingsprodukte gefunden hast und kaufst dabei umso mehr Sachen ein, die du gar nicht brauchst?
In anderen Tätigkeitsfeldern werden die Mitarbeiter sich weigern, das Spiel mitzuspielen. Agile Haltungen und agiles Denken haben viel zu bieten, um auf der Basis eines Proto-Perfektionismus gelassener mit Stress umzugehen und sich als Mitarbeiter und Mensch stetig weiterzuentwickeln. Wird der Mitarbeiter primär als Human Resource betrachtet, kommt seine Weigerung gegen das neue große Ding vollkommen zu recht. Zudem steht aus meiner Sicht der Mitarbeiter in der Wertschöpfungskette vor dem Kunden. Ohne Mitarbeiter produziert niemand Produkte und niemand verkauft sie. Und an der Servicetheke sind Mitarbeiter die Visitenkarte einer Organisation. Die Mitarbeiter zu wenig zu beachten ist so, als würden wir uns auf eine Schiffsreise begeben ohne Ausguck, Bootsmann und Ruderer. Niemand hisst die Segel. Niemand kocht. Und niemand schrubbt das Deck.
Achten wir nicht auf diese Rahmenbedingungen, könnte es uns mit der Agilität und den Segnungen der Digitalisierung so ergehen wie dem Fischer mit seiner Frau: Alles neu, alles bunt, alles glänzt. Und doch sind wir niemals zufrieden. Eines schönen Tages wachen wir auf und merken, dass wir vor einem Scherbenhaufen stehen und es im Leben um etwas gänzlich anderes gehen sollte.
Jede agile Idee und Methode sollten wir daher kritisch darauf untersuchen, ob sie zu einer höheren Zufriedenheit der Mitarbeiter, zu mehr Gestaltungsmöglichkeiten, Demokratisierung und Selbstverantwortung im Sinne des New Work-Gedankens führen oder zu neuen Abhängigkeiten und einer Enthumanisierung der Arbeit. Das New Work-Konzept geht auf den austro-amerikanischen Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zurück und beschäftigt sich mit den arbeitsverbessernden Möglichkeiten, die Digitalisierungsmaßnahmen mit sich bringen.21
1.3.3 Quo vadis, Personalabteilung?
Wenn wir in agilen Organisationen ein lebenslanges Lernen durch Fehler, Kunden und voneinander, live und direkt oder per Wissensplattform installieren, wenn wir Mitarbeiterjahresgespräche abschaffen und stattdessen einen dauerhaften gegenseitigen Feedback-Austausch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter anregen, stellt sich folgende Frage: Brauchen wir noch Personalabteilungen, die Leistungsbeurteilungen erstellen und Weiterbildungseinheiten organisieren?
Eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Erfahrungsschatz verdeutlicht die Dramatik: Mitte 2017 wurde ich als Berater für eine Kommune zum Thema Digitalisierung angeheuert. Angetrieben wurde der Transformationsprozess von der IT- und Organisationsabteilung. Die Personalabteilung wurde mehrmals gebeten, sich in den Prozess einzubringen. Mit geringer Resonanz. Offensichtlich sahen die Verantwortlichen im Personalmanagement kaum einen Bedarf oder wussten nicht, wie sie sich positionieren sollten, weshalb sie den ersten von drei großen Workshops für die gesamte Führungsriege komplett verschliefen. Erst im Anschluss – vermutlich durch den guten, alten Flurfunk – wurde ihnen klar, was hier im Gange war und dass die Personalabteilung in der digitalen Transformation eine entscheidende Rolle spielen muss.
Ähnlich wie Führung sich in agilen Organisationen neu positionieren muss, kommen Personalabteilungen nicht umhin, sich neu aufzustellen und andere Aufgaben zu übernehmen.22 Warum sich nicht dem Faktor Mensch agil annehmen und sich im Hintergrund der Steuerung agiler Lernprozesse unterstützend widmen? Der Weg von einer traditionellen zur agilen Organisation ist lang und holprig. Oftmals werden alle Beteiligten überfordert sein von den kulturellen Umbrüchen und der Komplexität der Transformation, die dieser Weg mit sich bringt. Ein wenig Unterstützung vonseiten der Personalabteilung kann nur nützlich sein. Denn eins muss uns klar sein: Transformationen fallen nicht vom Himmel oder entstehen, sobald wir mit einem Workshop den Ball ins Rollen gebracht haben. Transformationen von dieser Dimension erfordern ein dauerhaftes Engagement aller Beteiligten, insbesondere, weil hinter dem Thema Agilität eine neue, ungewohnte, für manche schmerzhafte Philosophie als Basis unseres zukünftigen Handelns steht: mehr Spontaneität, mehr Vertrauen, mehr Demokratie.
Agilität braucht Grenzen, um nicht vor lauter Kreativität und Anpassungslust zu explodieren. Agilität braucht einen ethischen Rahmen, auf der Basis klarer Werte und Überzeugungen, damit zur Ergänzung stetiger selbstaktualisierender Feedbackprozesse eine stabile Haltung hinzukommt, um nicht nur heute, sondern auch morgen noch kraftvoll zubeißen zu können. Den Freiraum, der durch die vermeintliche Arbeitslosigkeit von Personalabteilungen entsteht, könnten diese nutzen, um den Überblick über die Entwicklung der Organisation und humanen Potenziale inklusive der Sorge um die Grenzen dieser Entwicklung zu behalten.
Wie agiert unsere Personalabteilung aktuell und was wünsche ich mir schon lange von unseren Personalern?
Vgl. Scheller, S. 215. Hätte ich das Buch von Scheller als digitales Dokument und würde in die Suchmaske das Wort „Kunde“ eingeben, hätte ich bis zum Ende der Suche die Zeit, mir ein Steak zu braten.
12Vgl. Häusling, Agile Organisationen, S. 63
13Marketing 4.0 würde ich sagen, wenn ich diese .0-Geschichten nicht so albern fände.
14Der Autor freut sich über einen Besuch auf: www.inka-training.de
15Vgl. Heinzlmaier, Theorie und Praxis der Jugend-Soziologie, unter: https://www.jugendkultur.at/wp-content/uploads/Graz-2014-Joanneum1-1.pdf
16Vgl. Arnold, S. 257 ff.
17Vgl. Oestereich/Schröder, S. 20, in: Sattelberger et al.
18Ein Online-Game, das nach dem kometenhaften Aufstieg von Martin Schulz als SPD-Vorsitzender entwickelt wurde.
19Vgl. Heinzlmaier
20Vgl. Dörre, S. 110, in: Sattelberger et al.
21Vgl. www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/new-work
22Vgl. Häusling, Agile Organisationen, S. 83 ff.
1.4 Digitalisierung als Antreiber
Wie der Computer unsere Welt, respektive unsere Arbeitswelt veränderte, erfolgte – entgegen dem marktschreierischen Begriff der Disruptivität – nicht auf einen Schlag, sondern stufenweise über einen längeren Zeitraum hinweg:23
In den 1950er-Jahren galten Computer als klobige Automaten, die mechanische Tätigkeiten nach einem fest vorgegebenen Muster verrichteten. Damit reduzierten sich einfache Tätigkeiten beispielsweise am Fließband. Die Industrie freute sich, die Gewerkschaften begannen zu zittern.
2.In den 1970er-Jahren kamen transportablere Computer auf den Markt, die eine individuellere Nutzung als Werkzeug ermöglichten. Computer begannen, uns unser Leben mittels Tabellenkalkulationen und Textverarbeitungsprogrammen zu erleichtern. Manchmal mehr, manchmal weniger. Der Jubel in dieser Phase war jedenfalls auf allen Seiten groß.
3.Durch den Siegeszug des Internets seit den 1990er-Jahren war es möglich, mit einem kleinen Laptop jederzeit und überall auf Daten zuzugreifen, die zuvor an einen festen Arbeitsplatz gebunden waren. Das erfordert enorme Anforderungen an die Gestaltung von Telearbeitsplätzen hinsichtlich der Datensicherheit, Ergonomie des Arbeitsplatzes sowie des Selbstmanagements der Mitarbeiter. Größere Freiheiten erfordern nun einmal mehr Kompetenzen und eine größere Verantwortung.
4.Anfang des neuen Jahrzehnts stieg das Internet zur Plattform auf. Ressourcen zur Erfüllung einer Tätigkeit wurden damit komplett ausgelagert. Airbnb benötigt keine Betten und Uber keine Taxis. Die Unternehmen erkannten, dass sie die Ressource Arbeit an den Meistbietenden (siehe MyHammer) vergeben konnten. Damit stellt sich die Frage, wieviel Verbundenheit zu einem Unternehmen vorhanden sein muss oder ob die Dienstleistungsunternehmen der Zukunft ausschließlich Jobs-on-Demand zur Verfügung stellen, insbesondere wenn man den Kunden als Hilfsmitarbeiter betrachtet, wie es uns die Scannerkassen bei Media Markt oder Online-Überweisungen vormachen. Fairerweise muss man dazu ergänzen, dass die Nutzungsmöglichkeit des Internets als Plattform es vielen Menschen erst ermöglicht, am Arbeitsleben oder an sozialen Netzwerken teilzuhaben.
5.Ebenfalls seit Beginn der Nuller-Jahre wurden Computer zu unserem treuen Begleiter, der uns, unseren Körper und unsere Persönlichkeit durch diverse Applikationen auf den neuesten Stand bringt: Unsere Uhr misst unseren Puls. Unser Smartphone zeigt uns, wie das Wetter wird und welche Termine wir haben. Ein Fitnessprogramm zeigt uns an, wann es genug ist mit dem Tippen und ich aufstehen und ein paar Dehnübungen machen sollte. Ich selbst spüre das ja nicht mehr.
Die Technologie nimmt uns eine Menge Denkleistungen ab, macht uns aber gleichermaßen unselbstständig, was wir erst merken, wenn unsere Geräte den Dienst aufgeben und wir plötzlich die Wolken selbst deuten oder uns an unsere Termine erinnern sollten. Diese wachsende Abhängigkeit und Unselbstständigkeit sind kritisch zu sehen, wollen wir im Zuge der Agilität Teams oder einzelne Mitarbeiter am Heimarbeitsplatz zu mehr Selbstmanagement anleiten. Wie soll Selbstorganisation funktionieren, wenn Menschen eine App brauchen, um sich daran zu erinnern, dass sie etwas essen sollten? Damit verbunden ist gleichzeitig eine ständige Erreichbarkeit bis hin zur Überwachung von der Führungsseite, die es ebenso zu klären gilt.24
6.Auf der sechsten Stufe dieser Entwicklung gilt der Computer als Prophet. Dank größerer Datenleistungen auf ultrakleinen Chips sind unsere kleinen Rechenmonster in der Lage, Big Data über alles und jeden zu sammeln und mittels künstlicher Intelligenz auszuwerten. Bisherige Ergebnisse sind jedoch noch nicht wirklich zufrieden stellend. Roboter können durch große Menschenmengen navigieren, sind damit allerdings so beschäftigt, dass wenig andere Tätigkeiten möglich sind. Und erfahrene Ärzte treffen ihre besten Entscheidungen nach wie vor aufgrund ihres Bauchgefühls. Zu detaillierte Datenmengen wirken bei Diagnosen oft hinderlich. All das wird sich bald ändern. Algorithmen lernen mit jedem bearbeiteten Fall dazu und werden dadurch dynamisch intelligent. Damit könnten in Zukunft zusätzlich zu einfachen Routinearbeiten auch Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten von Computern übernommen werden. Bald werden keine polnischen Pflegekräfte mehr importiert. Stattdessen bringen Replikanten das Essen zu den Patienten. Wenn ich an meinen letzten Klinikaufenthalt und die überarbeiteten und genervten Pflegekräfte denke, könnte das ein großer Fortschritt sein. Dass dies funktioniert, und zwar nicht einmal schlecht – schlecht im Sinne von „unmenschlich“ –, zeigt die Studie eines amerikanischen Psychologen, der nacheinander zwei Hunde zum Beziehungsaufbau in ein Altersheim schickte. Der erste war echt, der zweite mechanisch. Beide wurden gestreichelt und zu beiden bauten die älteren Menschen laut eigenen Angaben eine Beziehung auf.25
Diejenigen, die ernsthaft von einer disruptiven Digitalisierung sprechen, haben offensichtlich die letzten 25 Jahre verschlafen oder setzen auf die Panikkarte. Spätestens seit dem Millenium hätten wir wissen können, dass hier ein Bob einen Schneeberg hinuntersaust und wir uns entscheiden müssen, ob wir unsere Schienbeine opfern, um ihn aufzuhalten, oder aufspringen und den Fahrtwind genießen.
Die Innovationszyklen werden sich nicht beschränken lassen. Die Globalisierung bleibt uns erhalten und damit der Druck, an den eigenen Rentabilitätsschrauben zu drehen. Die Kunden werden nicht von heute auf morgen wieder so geduldig, nachsichtig und so leicht zufrieden zu stellen sein wie in den 1980er-Jahren. Unser Ökosystem wird sich nicht spontan erholen: „Wisst ihr was? War nur ein Scherz. Mir geht's prima. Ozonloch, Plastik im Meer, Erderwärmung. Schwamm drüber. Da hab ich euch sauber an der Nase herumgeführt.“
Solange die Generation Y brav in die Universitäten strömte, konnten die Unternehmen noch den Kopf in den Sand stecken. Diese Schonzeit ist vorbei. Die meisten dieser jungen Menschen kennen den Arbeitsplatz, wie wir ihn kennen, mit Schreibtisch, Blümchen und Familienbild ohnehin nicht mehr. Sie fordern alleine durch ihre Vielzahl dazu auf, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen.
Wenn Sie schon einmal per Airbnb unterwegs waren, kennen Sie vermutlich die erste Frage, die nach der Ankunft gestellt wird. Sie lautet nicht „Wo ist das Bad?“ oder „Wo ist die Küche?“, sondern: „Wie lautet das WLAN-Passwort?“. Wen interessieren im Hotel noch die Frühstückszeiten? Lässt sich doch alles googeln – wenn nur das WLAN funktioniert!
Auch die Sehnsucht nach einer werteorientierten, menschlichen Führung als Gegenpol zur eiskalten Technologisierung wird ebenso wenig verstummen. „Agilität“ und „Digitalisierung“ sind nicht die einzigen Buzz-Words der letzten Jahre, sondern ebenso „Menschlichkeit“.
Die Digitalisierung als Treiber, Megaeinfluss und Metathema zwingt uns, uns mit Themen auseinanderzusetzen, die wir als lange bearbeitet ansahen. Zum Beispiel die Beschäftigung mit unserem Menschenbild. Gehen wir davon aus, dass der Mensch grundsätzlich gut und fleißig ist, können wir ihn innerhalb bestimmter Grenzen laufen lassen, um mit einem digitalen Endgerät in der Hand weit entfernt vom direkten Zugriff seiner Führungskraft autonom-agile Entscheidungen zu treffen. Mit einem negativen Menschenbild im Hinterkopf wird uns das schwerfallen.