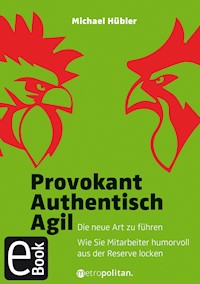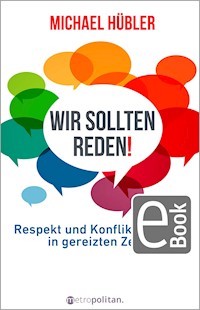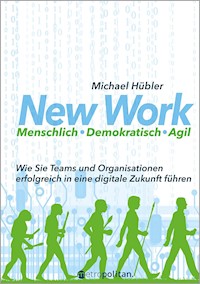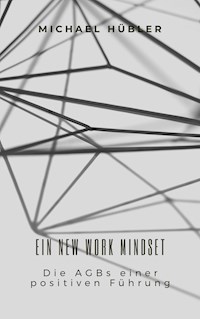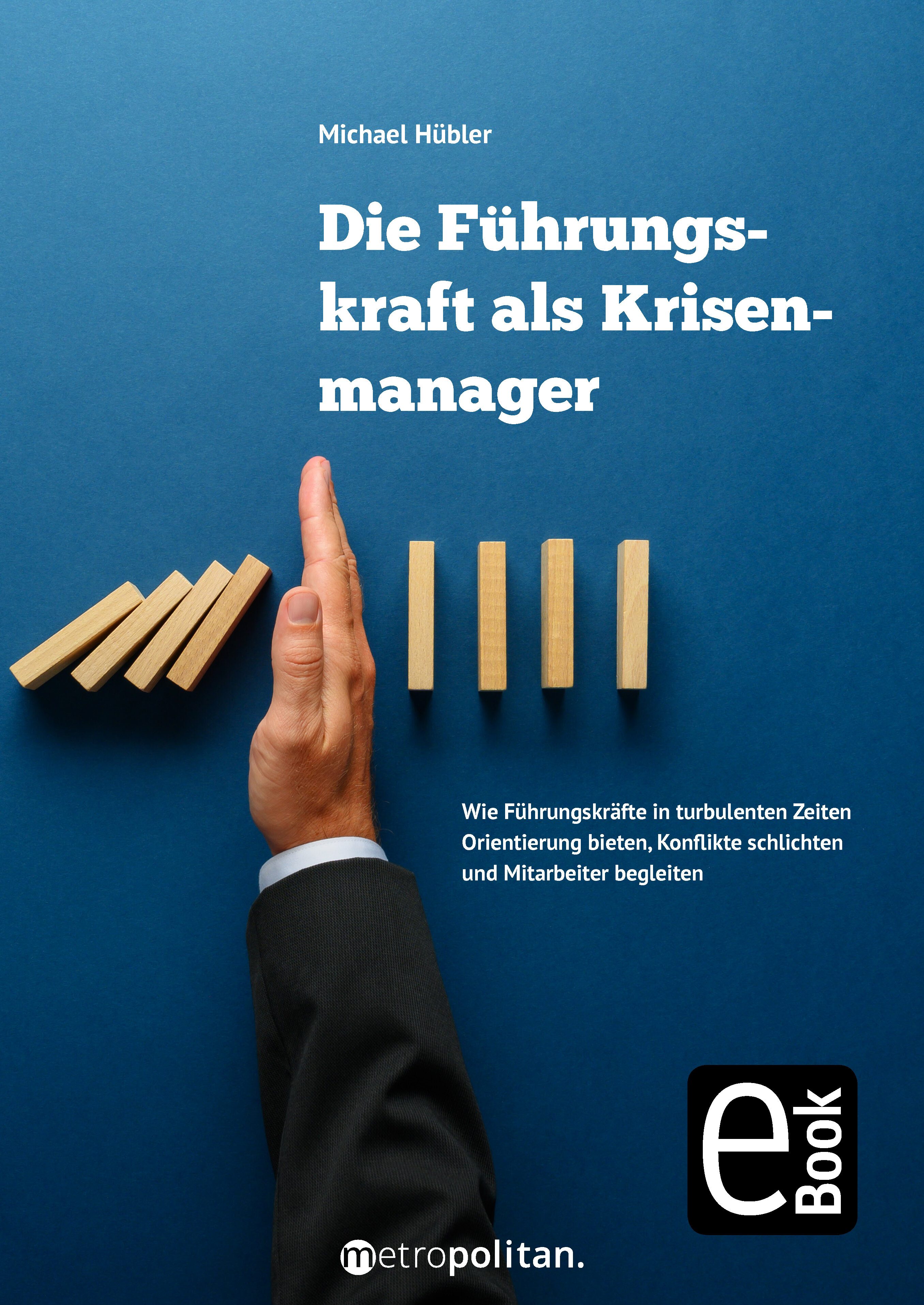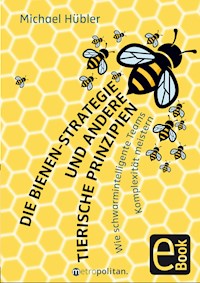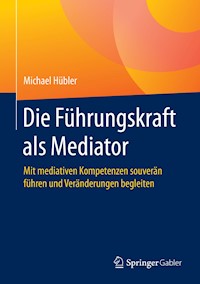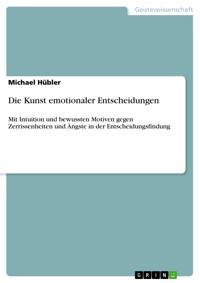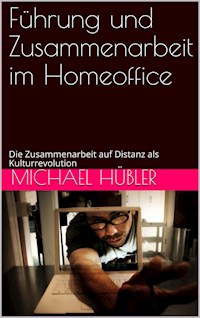
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Dabei zeigt es sich, dass eine Führung auf Distanz nicht nur genauer geplant werden muss als eine Führung vor Ort, sondern die Zusammenarbeit auf Distanz gleichzeitig dazu führt, dass Mitarbeiter ihr Selbstmanagement erhöhen und damit langfristig ihren Führungskräften auf Augenhöhe begegnen. Eine virtuelle Zusammenarbeit ist folglich mehr als eine Verlagerung in das Internet, sondern ein Anstoß zu einer umfassenden Kulturrevolution.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Gekommen um zu bleiben – ein Vorwort
1 Kernthemen einer Zusammenarbeit auf Distanz
2 Führen in einer digitalen Welt
3 Zusammenarbeit auf Distanz braucht einen klaren Rahmen
4 Anforderungen an Mitarbeiter in einer virtuellen Welt
5 Kommunikation auf Distanz
6 Fazit: Eine Zusammenarbeit auf Distanz ist keine Hexerei
Literatur
Impressum
Führung und Zusammenarbeit im Homeoffice
Die Zusammenarbeit auf Distanz als Kulturrevolution
Gekommen um zu bleiben – ein Vorwort
Januar 2021. Seit etwa drei Jahren gebe ich als Coach und Trainer Seminare zum Thema Führung auf Distanz. Damals ging es um die Vorbereitung der Führung von Mitarbeitern im Homeoffice. Damals durften nur geeignete Mitarbeiter ins Homeoffice. Es ging folglich darum, herauszufinden, wer die Herausforderungen, für sich alleine zu arbeiten gut hinbekommen wird und den anderen, die dennoch wollen, um ihre Lebensbalance besser hin zu bekommen, zu erklären, warum sie ungeeignet sind.
In der Regel dauerte es ein bis zwei Jahre, bevor die Arbeit von zu Hause aus überhaupt erlaubt wurde. Es galt Netzwerke zu knüpfen und Arbeitsabläufe zu verstehen. Heute, nach beinahe einem Jahr Corona ist alles anders. Es gibt noch Luft nach oben, aber laut einer aktuellen Studie befanden und befinden sich etwa 18% der Angestellten im Homeoffice. Damit haben Führungskräfte nicht nur hochmotivierte Miterabeiter mit einem top Selbstmanagement über die Distanz zu führen, sondern ebenso Menschen, die dort eigentlich niemals hin wollten, die zu Hause überfordert sind und nun zusätzlich Angst vor dem Virus oder einer Kündigung haben. Damals war die Angst vor einem Missbrauch der freien Zeit groß und das Vertrauen in die eigenen Leute oftmals klein. Ein Thema, das sich nicht in Luft aufgelöst hat.
Gleichzeitig sitzen Führungskräfte selbst im Homeoffice und fragen sich, wie das gehen soll, so eine Führung auf Distanz, am Ende noch von Mitarbeitern, die sie während der Krise virtuell eingestellt haben oder die sie nun virtuell kündigen müssen. Führungskräfte, die sich dies ebenso nicht ausgesucht haben. Führungskräfte, die lieber spontan und nahbar führen, die gerne Anekdoten erzählen und Witze machen. Puh! Wilde Zeiten.
Für mich als Trainer fielen logischerweise auch einige Termine aus. Genug "Freizeit", mich intensiv mit dem Thema Führung auf Distanz und Zusammenarbeit im Homeoffice zu beschäftigen, unter anderem im Rahmen der Bunkerchroniken für meinen Hausverlag metropolitan. Ab Oktober ging es dann wieder los mit Seminaren, natürlich auch zu diesem Thema. Vor der Krise ging es darum, die Zusammenarbeit im Homeoffice vorzubereiten. Nun richtete sich der Fokus auf Kriseninterventionen und die Nachbereitung der Erfahrungen aus den letzten Monaten. Damit konnte ich das, worüber ich in den Monaten nachdachte und schrieb, sofort umsetzen.
Der Bedarf ist immer noch groß. Zum einen ist das Homeoffice gekommen, um zu bleiben. Viele Unternehmen und Führungskräfte, die flexiblem Arbeiten bislang kritisch gegenüberstanden, haben ihren Widerstand gegen den heimischen Schreibtisch mehr oder weniger aufgegeben – und ihre Mitarbeiter:innen ins Homeoffice geschickt. Doch wie geht es nach der Pandemie weiter? Nach der Krise werden viele Arbeitnehmer:innen ein Jahr oder länger von zu Hause aus gearbeitet und sich an die Autonomie und Flexibilität gewöhnt haben. Um dem entgegenzukommen, könnten Unternehmen ihren Mitarbeiter:innen erlauben, zwei oder mehr Tage pro Woche flexibel zu arbeiten. Dabei dürften sich einige für die 3-2-2-Arbeitswoche entscheiden: drei Tage im Büro, zwei Tage Homeoffice, zwei Tage frei. Tatsächlich erwarten 42% der Beschäftigten in Deutschland laut dem Berufstätigen-Stimmungsindex von LinkedIn nach der Krise Regelungen, die zu gleichen Teilen Präsenz am Arbeitsplatz und Telearbeit vorsehen – bei Angestellten sehr großer Unternehmen mit über 10.000 Beschäftigten erwarten dies sogar 54%.
Zum anderen verunsichert eine Führung auf Distanz nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte. Dies liegt in der aktuellen Situation vor allem daran, dass die derzeitigen Homeoffice-Erfahrungen anders sind ist die früheren. Während früher v.a. it-affine und freiberuflich denkende Mitarbeiter von zuhause aus arbeiteten, betrifft es nun eine Vielzahl an Mitarbeitern, die sich ihr Los nicht ausgesucht hatten. Die Frage, ob die Welt dieses Buch noch braucht, ist aus meiner Sicht damit schnell beantwortet. Es geht in diesem Buch nicht nur um virtuelle Teams aus einer globalisiert zusammenarbeitenden Welt, sondern um uns alle. Die Tasache, dass ich als Trainer sehr häufig für öffentliche Verwaltungen tätig bin hilft mir dabei, genau diesen Fokus in das Buch einfließen zu lassen.
Die Essenz aus meinen Erfahrungen zum Thema Zusammenarbeit im Homeoffice vor der Krise und in der Krise sehen Sie vor sich. Ich hoffe wie immer, Ihnen damit einige Erklärungen für Fallstricke aber auch Denkanstöße zu bieten, damit die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen reibungsfreier abläuft.
1 Kernthemen einer Zusammenarbeit auf Distanz
1.1 Unterschiedliche Anforderungen in der Arbeit
Beginnen wir mit der Frage, an welchen Arbeitsplätzen virtuelle Teams oder eine Heimarbeit gut funktionieren und wo und wann mit Schwierigkeiten zu rechnen ist. Damit lässt sich auch klären, warum es manchmal beinahe reibungsfrei funktioniert und manchmal zu vielen Problemen bei einer Zusammenarbeit auf Distanz kommt.
Eine grobe Aufteilung von Arbeitsplätzen in die Sektoren Entwicklung, Produktion und Verwaltung zeigt, worauf es bei den jeweiligen Tätigkeiten ankommt:
Die Tabelle verdeutlicht uns, dass eine Führung auf Distanz am einfachsten möglich ist, wenn Sie mit Mitarbeitern aus der Verwaltung zu tun haben. Hier geht es nicht darum, vor Ort etwas herzustellen, an einer Maschine mit oder ohne Team, und auch nicht darum, gemeinsam mit Kollegen kreative Ideen auszutüfteln, sondern meist darum, einen (virtuellen) Stapel von Arbeitsaufträgen abzuarbeiten, mit Kunden zu telefonieren oder Rechnungen zu schreiben. Ob der Schreibtisch, von dem aus dies erledigt wird, vor Ort oder zuhause ist, ist rein sachlich betrachtet egal. Auch hier gibt es einen regelmäßigen Absprachebedarf, damit Prozessketten nicht abreißen. In typischen Verwaltungstätigkeiten geht es jedoch weniger um kreative Entwicklungen von Produkten wie beispielsweise einer Software, sondern um die Bearbeitung von Akten, den Umgang mit Fällen oder problematischen Kunden. Der Kern der Tätigkeit dreht sich daher um die Entwicklung von Routine, Schnelligkeit, Fehlerreduzierung und Freundlichkeit im Kundenkontakt.
In Entwicklungsabteilungen, was heutzutage häufig von agil-kreativen Projektteams übernommen wird, geht es logischerweise kreativer zu. Kreativität wiederum erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit und damit ein gegenseitiges Vertrauen und flüssige Kommunikationsabläufe. Dies ist virtuell ebenfalls möglich, jedoch schwieriger umzusetzen.
In Produktionsunternehmen schließlich sind kreative Ideen höchstens im Kontext der Fehlervermeidung erwünscht. Während bis vor einigen Jahren die direkte Führung von Teamleitern aus einem falsch verstandenen Lean-Management-Gedanken heraus stetig abgebaut wurden, werden diese in neuerer Zeit ähnlich den traditionellen Meister-Lehrling-Strukturen reanimiert, um den direkten Austausch wieder zu fördern. Führung bedeutet hier, direkt am Arbeitsort Probleme zu besprechen und zu lösen, anstatt später die Güte der Arbeit zu kontrollieren. Dies macht emotional einen enormen Unterschied. Gemba-Walk lautet das japanische Vorbild aus dem Leanmanagement, oder Shop-Floor-Management in der Übersetzung.
In der Realität sind die Grenzen zwischen den drei Sektoren nicht ganz so eindeutig. Dies erfordert für Führungskräfte stetige Neujustierungen:
Soll es in Verwaltungstätigkeiten kreativ werden, beispielsweise in Umbrüchen oder der Einarbeitung neuer Kollegen, braucht es auch mal ein Treffen vor Ort oder sauber moderierte virtuelle Feedbacktreffen. Alternativ dazu bieten sich Business-Chats an.Tauchen in Verwaltungsprozessen oder der Entwicklung Fehler auf, braucht es Konzepte aus dem Lean Leadership. Dann besteht die Aufgabe der Führungskraft mehr oder weniger darin, den Mitarbeitern coachend zur Seite zu stehen. Dies ist mittlerweile auch im Rahmen von Desktop-Sharing auf distanz gut möglich.1.2 Agile Welten vs. Homeofficeparzellen
Wenn ich den Auftrag einer Teambildungsmaßnahme bekomme, kläre ich als erstes, ob ich es überhaupt mit einem Team zu tun habe. Der Begriff des Teams wird viel zu unreflektiert benutzt. Stattdessen habe ich es regelmäßig, gerade in Verwaltungs“teams“, mit Menschen zu tun, die häufig einfach nur ihren Job machen und nicht viel mit den Kollegen zu tun haben wollen. Dies hängt zum einen an der Arbeitsaufgabe, wie wir im vorhergehenden Kapitel gesehen haben, zum anderen am Selbstverständnis der Unternehmenskultur und natürlich jedes einzelnen Mitarbeiters. Häufig treffen hier kulturelle Welten aufeinander. Die einen hätten gerne ein Paket mit Aufgaben, das sie sich vor Ort oder virtuell abholen, um es zu Hause abzuarbeiten. Dort wartet ihre Familie. Die Trennung zwischen Freizeit und Beruf ist für sie lediglich marginal vorhanden. Die anderen suchen in der Arbeit eine Ersatzfamilie. Es gibt nicht viele Fälle, aber es gibt sie, in denen der Hauptgrund für den Widerstand gegen Homeoffice bei einzelnen Menschen darin liegt, dass sie sich zuhause einsam fühlen, weil sie eben keine Familie haben.
Abseits dieser Extremfälle lassen sich aktuell zwei Arbeitsweltkulturen-Trends unterscheiden. In einer New Work-Welt, in der alles so schön bunt erscheint und abends noch gegrillt wird, möchten manche Menschen gar nicht mehr nach Hause gehen. Dort füllt mir schließlich auch niemand meinen Obstkorb auf. Und einen Kicker habe ich auch nicht zuhause. In „Code kaputt“ von Anna Wiener oder „Circle“ von Dave Eggers wird plastisch beschrieben, wie spannend und reizvoll und gleichzeitig ein wenig gruselig die Extremform dieser schönen neuen Arbeitswelten im Silicon Valley aussehen und vielleicht auch in Deutschland eines Tages Realität werden könnten. Der Mensch als Arbeitskraft soll sich so wohl fühlen, dass er gar nicht mehr nach Hause möchte. Damit arbeitet er jedoch rund um die Uhr für uns und ist auch noch glücklich damit. Diese Rechnung geht solange auf, wie dieser Mensch nicht auf die Idee kommt, eine Familie zu gründen. Wie so oft kann ein guter Gedanke, in diesem Fall die spannend-kreative Arbeit im Team, auch pervertiert werden.
Auf der anderen Seite, und darum soll es in diesem Buch vornehmlich gehen, haben wir die Kultur vereinzelter Parzellen im Homeoffice. Der Autor E. M. Forster beschrieb bereits 1928 auf visionäre Weise in seinem Buch „Die Maschine steht still“ wie wir aus seiner Sicht einst leben werden. Laut seiner Dystopie werden wir nur noch von zuhause aus über eine Maschine kommunizieren, weil die Erdoberfläche nicht sicher ist. Eine temporär unheimliche Vorstellung in Zeiten einer Pandemie.
Schauen wir uns nach diesen literarischen Verweisen an, welche Arten von Gruppen in welche Welten passen und wo Sie sich selbst einordnen können:1
Je nach Aufgabengebiet erscheint die eine oder andere Form sinnvoller:
FamiliäreArbeitsgruppen bestehen in der Regel aus gut eingespielten Kollegen, die sich schwer tun, mit anderen Teams zusammen zu arbeiten. Auch Fusionen mit anderen Unternehmen werden aufgrund der Gefahr auseinander gerissen zu werden, kritisch gesehen.AgileLeistungsteams zeichnen sich durch einen hohen Grad an Nähe aus, steuern sich jedoch weitgehend selbst. Sie passen sich schneller an Umweltanforderungen an und sind daher häufiger im Entwicklungsbereich anzutreffen. Interessanterweise setzte IBM nach einer längeren Phase virtueller Teams wieder vermehrt auf agile Präsenzteams, weil diese durch ihre Bindung zueinander kreativer sind.2Sollen verteilte agile Teams virtuell zusammenarbeiten, müssen die Strukturen der jeweiligen Teams erhalten werden, um produktiv zu bleiben. Gleichzeitig gilt es, Aufgabengebiete strikter als zuvor zu definieren und zu trennen, um sich nicht über die Distanz in die Quere zu kommen und Doppelarbeiten zu vermeiden.Spezialeinheiten werden meist kurzfristig zusammengefügt. Hier geht es weniger um die Bearbeitung kontinuierlicher Aufträge durch ein Team, das über das notwendige Vertrauen zueinander verfügt, sondern um die Lösung besonders schwieriger Probleme durch ein "A-Team". Eine solche Ansammlung von Egomanen tut sich meist schwer damit, sich langfristig aneinander zu binden. Daher gilt die Losung: Expertise einbringen – Diskutieren – Problem lösen – Nächster Fall. Das Team wird durch den gegenseitigen Respekt in die jeweilige Expertise des Gegenübers getragen. Aufgrund des mangelnden persönlichen Bedarfs an Nähe und der Kürze der Kontakte entstehen höchstens oberflächliche Sachkonflikte. Eine Zusammenarbeit in virtuellen Chatrooms ist daher gut möglich, ähnlich wie Millionen von IT-Spezialisten an der Verbesserung von Open-Source-Plattformen basteln.Arbeitsgruppen schließlich eignen sich ideal für eine langfristige virtuelle Zusammenarbeit in Unternehmen. Hier geht es weniger darum, kreative Ideen im Team zu entwickeln, sondern um die Abarbeitung von Aufgaben, deren Ziele über die Distanz möglichst klar und detailliert beschrieben sein sollten. Dreh- und Angelpunkt der Führung von Arbeitsgruppen ist nicht das Team, sondern die Führungskraft selbst. Eine Führungskraft, die versteht, dass sie kein Team führen soll, sondern eine Arbeitsgruppe, atmet meist entspannt auf. Auch wenn die Führung im 1:1-Setting viel Mehrarbeit für Führungskräfte erfordert, ist es doch entspannend zu wissen, dass ich keine teambildenden Maßnahmen brauche und folglich nicht enttäuscht sein muss, wenn ich es doch nur mit parzellierten Einzelkämpfern zu tun habe.In der Realität tauchen auch hier Mischformen auf, was zu allerlei Konflikten führen kann. So kann ein Mitarbeiter sich eine engere Bindung wünschen, obwohl dies rein arbeitstechnisch nicht erforderlich ist. Und wenn ein Unternehmen versucht, das familiäre Team aus dem Stammunternehmen mit den Neulingen der Satelliten-Tochterfirma, die aus agilen Teams bestehen, zur Zusammenarbeit zu bewegen, treffen Werte und Bedürfnisse aufeinander, die sich erst durch gemeinsame Klärungen auflösen lassen. Erst hier lässt sich klären, wie viel Nähe, Freiheit, Klarheit, Regeln, Absprachen oder Rückmeldungen einzelne Mitarbeiter und verteilte Teams benötigen, um gut zusammen zu arbeiten.
Reflexion: Ihre Mitarbeiter und Teams
Welche "Teams" arbeiten bei Ihnen und was zeichnet diese aus? Was brauchen Ihre Mitarbeiter? Wo entstehen eventuell Konflikte, die es zu klären gilt?
1.3 Das Problem der Distanz und Isolation
Um die Herausforderung einer Führung auf Distanz einzelner Personen oder verteilter Teams einzuschätzen, ist es hilfreich, fünf Dimensionen der Distanz zu unterscheiden und deren Tragweite einzuordnen:3
Die räumliche oder geografische Distanz bietet den Vorteil, im Sinne einer Dezentralisierung näher an standortabhängigen Ressourcen oder Kunden zu sein. Wir werden sehen, wie eine neue Normalität nach der Corona-Krise aussieht. Der Trend scheint jedoch in Richtung "Raus aus den Zentren großer Städte und Stärkung kleiner Städte und der Peripherie der Großstädte" zu gehen. Dies würde vielen jungen Familien entgegenkommen, die es sich nicht leisten können, in Zentren zu leben und lieber in Speckgürteln ein Haus bauen. Eine hohe örtliche Distanz hat zwar den Nachteil, dass lokale Treffen schwieriger zu organisieren sind. Dennoch macht es gerade für Menschen, die weiter entfernt von ihrer Arbeitsstätte leben einen Unterschied, ob sie täglich mehrere Stunden unterwegs sind oder nur ab und zu.Bei sozialkulturellen Verschiedenheiten treffen unterschiedliche Weltbilder und mentale Arbeitsmodelle aufeinander. Soziale Distanzen im Team bieten die Chance vielfältiger Perspektiven und einer ausgeprägten Kreativität. Gleichzeitig erhöhen sich die Risiken von Missverständnissen und Konflikten durch sprachliche Barrieren und spezifische kulturelle und sprachliche Codes. Auch das Verständnis zwischen verschiedenen Fachgebieten kann eine Rolle für Differenzen spielen.Eine aufgabenbezogene Distanz entsteht durch die Unterschiedlichkeit der Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter. Je nach Aufgabe nimmt ein Teammitglied andere Perspektiven auf die Gesamtaufgabe ein und nimmt entsprechend unterschiedliche Bewertungen als seine Kollegen vor.Eine zwischenmenschliche Distanz kann entstehen, wenn sich Teammitglieder kaum kennen, um produktiv zusammenzuarbeiten. Je unterschiedlicher Teammitglieder in ihrer Persönlichkeit sind und je weniger gut sie sich kennen, desto schwieriger ist es, Vertrauen und ein Wir-Gefühl entstehen zu lassen. In einer modernen Arbeitswelt konnte dies bereits vor Corona durch den kontinuierlichen Wechsel aufgrund projektbasierter Abläufe und einem intensiven Einsatz von Freiberuflern passieren. Diese Arbeitsweise bietet einerseits die Möglichkeit, stetig einen frischen, externen Wind in das Unternehmen zu pusten, um geistig fit für die Bedingungen des Marktes zu bleiben. Gleichzeitig verringern sich die Bindung zum Unternehmen und das Vertrauen zueinander. Warum sollte ich mich auf meine Kollegen einlassen, wenn ich in ein paar Monaten ohnehin wieder woanders arbeite? Damit besteht die Gefahr für ein egoistisches Denken einzelner Teammitglieder.Dies kann im Homeoffice noch verstärkt werden durch eine virtuelle Distanz. Eine erhöhte virtuelle Kommunikation führt einerseits durch die Reduzierung der Kommunikation auf das Wesentliche zu einer Erhöhung der Effizienz. Genau dies führt jedoch gleichzeitig zu einer Verstärkung der sozialen Distanz durch weniger Small Talk, technische Probleme, Missverständnisse durch eine symbolarme, eindimensionale Kommunikation oder die digitale Kommunikationsmüdigkeit.Reflexion: Distanzen in Ihren Teams
Welche Arten der Distanz spielen in Ihren Teams eine wichtige Rolle? Wie gehen Sie bislang damit um? Wie wollen Sie in Zukunft damit umgehen?
Mitarbeiterbedürfnisse
Dass nicht alle Mitarbeiter die gleichen Probleme mit Distanz und Isolation haben, zeigt uns ein Blick ins Gehirn. Dort finden wir die drei großen Bedürfniszentren, die jeden von uns je nach Erfahrungen unterschiedlich prägen:
Kommunikativen und gestaltenden Mitarbeitern ist es wichtig, mitzureden und mitzubestimmen. Für diese Kollegen stellt eine Tätigkeit im Homeoffice eine große Herausforderung dar.Leistungsorientierte Mitarbeiter freuen sich über weniger Kontakte: Endlich werde ich nicht mehr abgelenkt und komme gut voran. Vor allem bin ich mein eigener Chef und kann arbeiten, wann und wie ich will. Diese Gruppe repräsentiert den klassischen Unternehmer im Unternehmen, dieses mal allerdings am eigenen Heimarbeitsplatz.Der klassische Mit-Arbeiter fühlt sich im Homeoffice emotional unterversorgt und wird durch die eigene Abwesenheit oder den nichtpräsenten Chef verunsichert. Die Verunsicherung kann sogar zu Misstrauen führen: Werde ich benachteiligt? Bekomme ich alle wichtigen Informationen mit? Lästern die Kollegen über mich, wenn ich nicht präsent bin?Netzwerkanalysen
Um zu klären, ob Mitarbeiter oder Teams isoliert beziehungsweise wie sie miteinander vernetzt sind, helfen Netzwerkanalysen:4
Netzwerkanalysen zeigen uns, wer mit wem direkt oder über Distanz zusammenarbeitet und wer am meisten vernetzt oder isoliert ist? Anschließend ist zu klären, ob die aktuellen Verbindungen sinnvoll sind oder ob sich etwas verändern sollte, um Arbeitsprozesse zu verbessern.
Klärungsfragen
Um möglichen negativen Folgen der Isolation im Homeoffice frühzeitig entgegen zu wirken, helfen Klärungsfragen im Team:
Werden die nicht-präsenten Kollegen in Meetings ausreichend informiert? Oder haben sie das Gefühl, etwas zu verpassen?Sollen sich virtuell angebundene Mitarbeiter Informationen selbst einholen (Holverantwortung) oder werden ihnen diese gebündelt vermittelt (Bringverantwortung)? Wer übernimmt im zweiten Fall diese Aufgabe?Werden die Ideen der virtuellen Teammitglieder wahr- und ernst genommen?Auf welchen Wegen werden diese Ideen in den Teamprozess eingespeist?Werden Prestigeaufgaben transparent und fair verteilt?Woher wissen die virtuellen Mitarbeiter, dass sie gut arbeiten? Anhand der Zielerreichung oder bereits auf dem Weg dorthin?Werden unsichtbare Arbeiten genügend wertgeschätzt?Muss Arbeit sichtbarer gemacht werden?Wieviel Freiräume und Vertrauen sind gut? Wieviele Regeln und Richtlinien braucht es zur Orientierung?Brauchen wir Kernzeiten der Erreichbarkeit? Wenn ja, wann und wie lange?Brauchen wir Rituale für Debriefings, wenn ein virtueller Mitarbeiter einmal pro Woche im Unternehmen präsent ist? Wenn ja, wie sollten diese aussehen?Brauchen wir Avatare und Steckbriefe im Intranet, um die Bindung im Team zu fördern oder aufrecht zu erhalten?Arbeiten wir mehr mit Einzel- oder auch mit Teamzielen, um zu verdeutlichen, dass die isolierten Kollegen ein Teil des Teams sind?Sollte die Führungskraft als Vorbild auch aus dem Homeoffice arbeiten?1.4 Die Frage nach der Identifikation mit Team und Unternehmen
Neben dem Problem der isolierten Distanz spielt auch das Thema der Identifikation mit dem Team oder der gesamten Organisation eine entscheidende Rolle, ob es mit einer Zusammenarbeit auf Distanz funktioniert. Wer sich mit seinem Team oder Unternehmen verbunden fühlt, erhält die Bindung zu den Kollegen und zur Firma auch über die Ferne aufrecht, er vertraut seinen Kollegen und seinem Chef und macht auch mal Mehrarbeit, wenn es nötig ist. Zugleich wissen Führungskräfte: Wer sich mit Team und Organisation verbunden fühlt, ist vertrauenswürdig. Dies ist vor allem wichtig, wenn Mitarbeiter aus dem Homeoffice heraus Kundenkontakte pflegen.
Zum Aufbau der Identifikation mit dem Team und der Organisation lassen sich Teamreifegradmodelle5 heranziehen:
Zu Beginn braucht es zur Teamentwicklung oder Anbindung einzelner Mitarbeiter an das Unternehmen direkte Kontakte, um Verantwortlichkeiten, Aufgabenverteilungen, Regeln der Zusammenarbeit und Kommunikation und vorhandene oder auszubauende Kompetenzen zu klären. Neue Mitarbeiter sollten nicht sofort ins Homeoffice geschickt werden, sondern zuerst Firmenluft schnuppern und sich mit ihren Kollegen bekannt machen. Diese Devise galt zumindest vor Corona. Nun geht es darum, dem Austausch untereinander nach Corona wieder mehr Raum zu geben.Wollen Sie auf Distanz zusammenarbeitende Teams zusammenbringen, ist es zudem hilfreich, eine Art Austauschprogramm zu organisieren: Während Herr Müller aus Hannover eine Woche lang bei seinen Kollegen in Frankfurt mitarbeitet, bekommt Frau Frenzl aus Frankfurt einen Einblick in die Arbeit ihrer Kollegen in Hannover. Damit kommen die alten Konzepte von Job-Rotation auch in der virtuellen Welt zum Tragen. Diese Phase des Austauschs und Lernens voneinander vermittelt nicht nur Informationen, sondern fördert zudem das Verständnis für die Kultur und Vorgehensweisen der Kollegen, um langfristig Missverständnisse und Konflikte zu reduzieren.
Im Reifegrad 1 kennen sich die Teammitglieder untereinander. Zur Stimme am anderen Ende der Leitung gehört ein Gesicht und hinter der Chat-Nachricht steht ein Mensch mit Werten, Einstellungen, Zielen, Bedürfnissen und Gefühlen.
Als nächstes sollten, am besten wieder face-to-face, mögliche Probleme und Konflikte untereinander offen angesprochen und der Umgang damit geklärt werden. Gute Klärungsfragen lauten:Was machen wir, wenn Freiräume egoistisch ausgenutzt werden, zum Beispiel, wenn sich jemand ausschließlich Prestige-Aufgaben herauspickt?Wie gehen wir damit um, wenn wir erfahren, dass bei Kunden unterschiedliche Informationen ankommen?In welcher Form wollen wir Unklarheiten aus der Welt schaffen?Was machen wir, wenn wir uns über jemanden oder etwas ärgern?Im Reifegrad 2 kennen die Mitarbeiter Regeln und Prinzipien, um gut mit Missverständnissen und Konflikten umzugehen. Auf dieser Basis lassen sich fachliche Kompetenzen und Aufgabenverteilungen leichter besprechen und verteilen.
Eine rein virtuelle Kommunikation funktioniert in der Regel erst, wenn in einer Phase des Übergangs, insbesondere bei Missverständnissen und Konfllikten, zusätzlich traditionelle Wege (zum Beispiel das Telefon) genutzt werden. Die notwendige Symbolvarietät (Gestik, Mimik, Stimme), die ansonsten in der Kommunikation notwendig ist, sobald komplexe Themen auftauchen, sinkt in dem Maße, in dem das Vertrauen im Team zunimmt.6Im Reifegrad 3 können die Teammitglieder mit Konflikten umgehen und verfügen über eine gemeinsame Sprache als Zeichen einer verbindenden Identität.
Ist die Teambildung abgeschlossen, lassen sich gemeinsame Ziele anstreben. Ob dies analog oder virtuell passiert, spielt eine untergeordnete Rolle.Im Reifegrad 4 können sich die Teammitglieder aufeinander verlassen und produktiv zusammen arbeiten.
Praxistipps: Identitätsstiftende Ideen
Zusätzlich zu der Entwicklung eines verteilten Teams oder der Anbindung einzelner Mitarbeiter im Homeoffice an das Stammteam im Unternehmen gibt es eine Menge leicht umsetzbare Ideen, um die Teammitglieder aneinander zu binden:
1.5 Zwischenfazit: Herausforderung für alle Beteiligten
Eine Zusammenarbeit über Distanz ist kein Selbstläufer. Auch wenn die Technik meist im Vordergrund steht ("Könnt ihr mich hören?"), liegt es doch an anderen Themen, ob es funktioniert oder nicht. Dabei zeigt sich häufig, dass eine Zusammenarbeit im Homeoffice zwar einige Vorteile mit sich bringt, beispielsweise was die Fahrtzeiten der Mitarbeiter angeht, jedoch auch unproduktiver sein kann, wenn Probleme nicht gelöst werden, weil nur das Nötigste besprochen wird. Schauen wir uns, bevor wir zur Rolle der Führungskraft kommen, einige dieser Probleme an, die Sie als Führungskraft im Auge behalten oder klären sollten, um auf Distanz effektiv und effizient zusammenzuarbeiten:
Generationen und Bedürfnisse: Das Thema der verschiedenen Generationen hatte ich noch nicht angesprochen. Es birgt insofern Sprengstoff, da jüngere Generationen in der Regel technikaffiner mit neuen Medien umgehen und sich schneller in diese einarbeiten. Sie besitzen von Haus aus eine Medienkompetenz, die manchen älteren Generationen fehlt. Dennoch finden sich auf der Ebene der Bedürfnisse alle Generationen wieder. Auch die Jüngeren wünschen sich präsente Führungskräfte, die sie entsprechend anleiten und als Vorbild fungieren.Bindung und Vernetzung: Regelmäßige Präsenzzeiten bauen nicht nur die gegenseitige Bindung auf, sondern verhindern zudem isolierte Gruppenbildungen. Über die Ferne wird die horizontale Vernetzung der Mitarbeiter untereinander gefördert, indem nicht nur Chatrooms, sondern beispielsweise ein Gruppenbild des Teams als Fotocollage erstellt oder virtuelle Pinwände zum Kennenlernen der teils unbekannten Mitarbeiter installiert werden.7Konflikte: Virtuell führende Leitungskräfte sollten Konflikte frühzeitig erkennen und ansprechen, damit sie nicht eskalieren. Dieser Punkt wird häufig unterschätzt, da Teamleiter oft fachlich optimal aufgestellt sind, in der Moderation von Konflikten jedoch meist Nachholbedarf haben. Ein simples "Das wird schon wieder" oder "Jetzt reißt euch mal zusammen" reicht gerade in virtuellen Kontexten nicht aus.Fairness: Die Ferne mancher Mitarbeiter kann bei einer zu schwachen Teambildung zu einer unklaren Arbeitsverteilung und gefühlten Unfairness führen. Sowohl unbeliebte Standard- als auch Prestige-Aufgaben sollten gerecht verteilt werden, indem alle Aufgaben öffentlich (digital) ausgeschrieben werden, um niemanden zu benachteiligen.Prozesse und Schnittstellen: Die Absprachen zwischen virtuellen und präsenten Teams erfordern häufig eine komplette Überarbeitung der Arbeitsprozesse, klarer und detaillierter als bisher.8Anforderungen am Arbeitsplatz: Nicht jeder Arbeitsplatz ist geeignet für eine Führung im virtuellen Setting. Hochkreative Teamtätigkeiten erfordern mehr Präsenz, während reine Verwaltungstätigkeiten gut für einen Homeoffice-Arbeitsplatz geeignet sind. In der Praxis finden wir eine bunte Mischung beider Arten. Virtuell führende Führungskräfte sollten daher auf eine gute Balance zwischen Präsenz und virtuellem Austausch achten.Transparenz: Eine transparente Informationspolitik wird im Zuge virtueller Führung noch wichtiger als bisher, um mögliche Missverständnisse im Keim zu ersticken. Eine Metakommunikation trägt dazu bei, dass Mitarbeiter sich nicht kontrolliert fühlen, sondern wissen, warum regelmäßige Gespräche geführt werden, zum Beispiel, weil sie eben mit allen Mitarbeitern im Homeoffice stattfinden. Auch Prozessabläufe, Abhängigkeiten oder Konfliktpotentiale sollten in diesem Sinne öffentlich besprochen werden.Personalselektion: Führungskräfte sollten bei der Personalselektion genau hinsehen, wer für eine isolierte Arbeit im Homeoffice geeignet ist und wer nicht und ihre entsprechenden Entscheidungen klar kommunizieren. Dabei ist es neben dem Umgang mit der Isolation ebenso wichtig, dass die entsprechenden Mitarbeiter loyal sind, selbständig arbeiten und gut mit Medien umgehen.Um solche und weitere Themen und Schwierigkeiten einer Zusammenarbeit auf Distanz im Team zu klären, arbeite ich in Führungstrainings und Teambildungsmaßnahmen mit der folgenden Facilitation-Canvas. Während der zweite Quadrant vor Corona "zu klärende Fragen" lautete, frage ich heute die bisherigen Erfahrungen ab. Der Quadrant mit den Lösungen ist noch frei. Am Ende dieses Buches werden Sie mit Sicherheit geägend Ideen haben, um ihn zu füllen.
Dabei zeigt sich, dass Führungskräfte zwar maßgeblich am Gelingen einer Zusammenarbeit auf Distanz gefordert sind, dass jedoch auch Mitarbeiter ihren Teil dazu beitragen sollten, um ihrer Führung das Leben zu erleichtern. Führungskräfte waren schon früher keine Gedankenleser. Über die Distanz wird es noch schwieriger, zu erahnen, was Mitarbeiter brauchen, um eine gute Arbeit abzuliefern. Dies können klare Ansagen und Ziele sein oder ein empathisches Einfühlen in die persönlichen Schwierigkeiten, bei Ablenkungen im Homeoffice dennoch an Aufgaben dran zu bleiben. Vor diesem Hintergrund ist eine Führung auf Distanz nicht nur eine Herausforderung von vielen im aktuellen Führungsalltag, sondern eine Chance, Verantwortung im Team neu zu verteilen.
Die folgenden Kapitel sind entsprechend in die Bausteine unterteilt, die wesentlich zum Erfolg einer virtuellen Zusammenarbeit beitragen:
Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie Führungskräfte sich neu erfinden können und sollten, um sich gut über die Distanz zu positionieren.In Kapitel 3 untersuchen wir den Rahmen einer virtuellen Zusammenarbeit und was dies für Ziele, Regeln, Richtlinien und Rituale bedeutet.