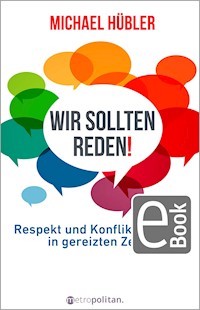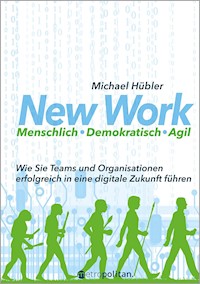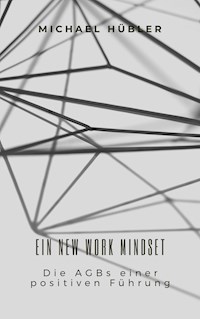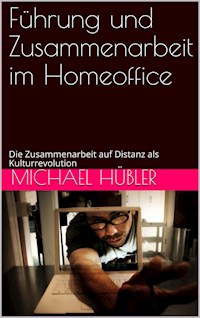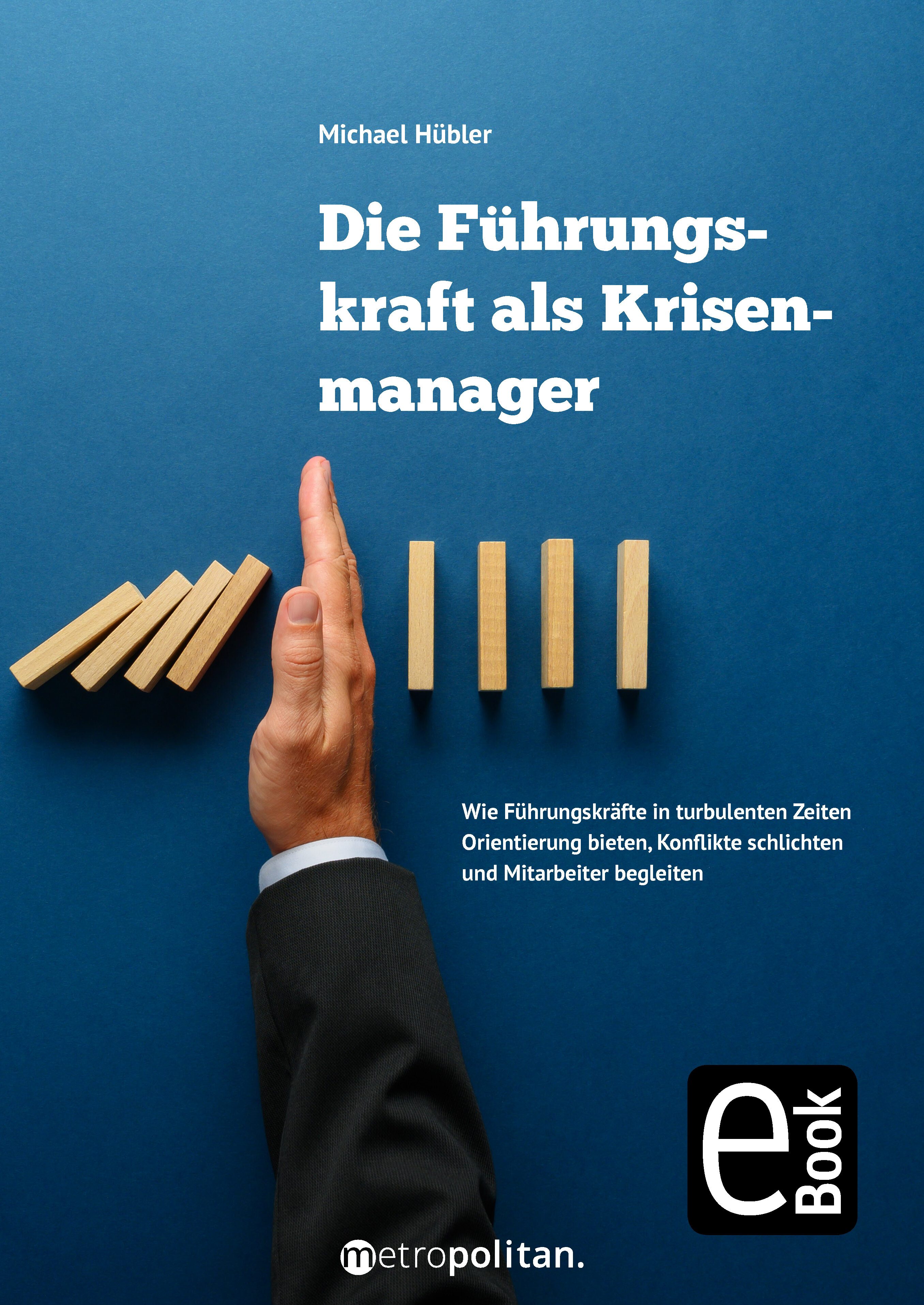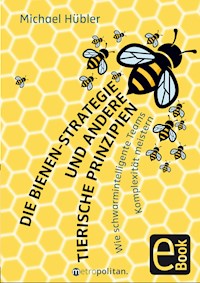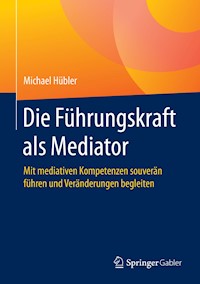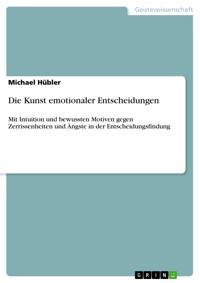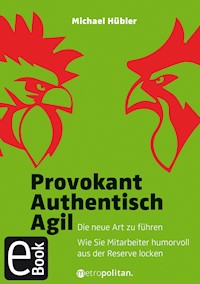
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metropolitan
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum wir uns nicht immer lieb haben müssen
Ist Frieden ohne Konflikte denkbar? Zusammenarbeit ohne Auseinandersetzungen? Das gesamte Leben ist ein Wechselspiel aus egoistischem und kooperativem Miteinander. Ohne Schwarz kein Weiß. Ohne Plus kein Minus. Es muss beides geben, um dem jeweils anderen eine Existenzberechtigung zu verleihen: Provokation und Verständnis.
Auch Mitarbeitergespräche sind ein Balanceakt zwischen kurzfristigem Kampf und langfristiger Kooperation, zwischen humorvoller Provokation und emphatischem Verständnis. Was häufig fehlt, ist eine offene, faire Streitkultur ohne Tricks, Manipulationen und polternde Hasskommentare. Wir sollten viel öfter mit unseren Kindern streiten, mit unseren Partnern, Lehrern, Dozenten und Mitarbeitern. Wir sollten wieder mehr Verantwortung übernehmen für das wir planen, tun und für unsere Fehler, statt uns hinter hierarchischen Masken zu verstecken.
Wer provokant führen möchte, benötigt jedoch
- eine stabile Werte-Basis aus Vertrauen,
- eine gesunde Menschenkenntnis,
- ein mutig-empathisches Konfliktmanagement und
- einen Rucksack voller Humor.
Auch das vielgepriesene flexible, agile Führen beruht im Kern auf einem mutigen und ehrlichen Beziehungsmanagement: Nur so können wir authentisch in Konflikte gehen, Probleme offen ansprechen und mit einem optimistischen Augenzwinkern gemeinsam meistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Warum wir uns nicht immer lieb haben müssen
Ist Frieden ohne Konflikte denkbar? Zusammenarbeit ohne Auseinandersetzungen? Das gesamte Leben ist ein Wechselspiel aus egoistischem und kooperativem Miteinander. Ohne Schwarz kein Weiß. Ohne Plus kein Minus. Es muss beides geben, um dem jeweils anderen eine Existenzberechtigung zu verleihen: Provokation und Verständnis.
Auch Mitarbeitergespräche sind ein Balanceakt zwischen kurzfristigem Kampf und langfristiger Kooperation, zwischen humorvoller Provokation und emphatischem Verständnis. Was häufig fehlt, ist eine offene, faire Streitkultur ohne Tricks, Manipulationen und polternde Hasskommentare. Wir sollten viel öfter mit unseren Kindern streiten, mit unseren Partnern, Lehrern, Dozenten und Mitarbeitern. Wir sollten wieder mehr Verantwortung übernehmen für das, was wir tun und für unsere Fehler, statt uns hinter hierarchischen Masken zu verstecken.
Wer provokant führen möchte, benötigt jedoch
eine stabile Werte-Basis aus Vertrauen,eine gesunde Menschenkenntnis,ein mutig-empathisches Konfliktmanagement undeinen Rucksack voller Humor.Auch das vielgepriesene flexible, agile Führen beruht im Kern auf einem mutigen und ehrlichen Beziehungsmanagement: Nur so können wir authentisch in Konflikte gehen, Probleme offen ansprechen und mit einem optimistischen Augenzwinkern gemeinsam meistern.
Autor
Michael Hübler ist Mediator, Berater, Moderator und Coach für Führungskräfte und Personalentwickler. Als Konfliktmanagement- und Verhandlungstrainer zeigt er, wie wertvoll der Schritt von einer „Heilen-Welt-Philosophie“ zu einer transparenten, agil-mutigen Führung ist.
Schnellübersicht
Vorwort
Wie soll Führung in Zukunft aussehen?
Provokationen und Kämpfe
1. Authentische, wertebasierte Führung
2. Mit Mikroprozessen das Selbstmanagement der Mitarbeiter fördern
3. Das Individuum und das Neue
Anhang
Vorwort
Provozieren Sie gerne Ihre Mitmenschen? Ich provoziere für mein Leben gern. Ich ärgere mein Umfeld mit liebevoller Ironie, stelle Kollegen und Seminarteilnehmern herausfordernde Fragen und arbeite mit Witzen, die nicht jedermanns Sache sind. Kennen Sie zum Beispiel den:
Fünf Personen stehen um den Chef. Vier davon lachen. Die fünfte wird gefragt: „Warum lachst du nicht?“ Darauf der Gefragte: „Ich muss nicht mehr. Ich habe gekündigt.“
In den letzten zehn Jahren als Trainer, Berater, Coach und Mediator lernte ich jedoch, nicht um jeden Preis provozieren zu müssen und mein zündelndes Gemüt durch Versuch und Irrtum zu verfeinern. Die verbale Herausforderung meines Umfelds muss ein Ziel haben, um sinnvoll zu sein. Ansonsten verkommt sie zum selbstherrlichen Schenkelklopfen. Der erwähnte Führungswitz funktioniert erst nach einer halben Stunde Beziehungsaufbau. Sind Provokationen nicht in Wohlwollen und Wertschätzung eingebettet, wirken sie verletzend. Der sprichwörtliche Stoß vor den Kopf sollte keine Leistung von Gottes Gnaden sein, sondern eine mutige Einladung zu mehr Ehrlichkeit und Offenheit im gegenseitigen Austausch.
Doch ohne Provokationen erscheint mir die Welt nicht nur langweilig, es geht auch nichts voran. Wir treten auf der Stelle, wenn wir uns in harmonischen Nichtangriffspakten einbalsamieren. Und ist es nicht der Gipfel bemutternder Respektlosigkeit, einem Menschen wider besseres Wissen ein ehrliches Feedback zu verwehren? Wir sollten öfter darauf vertrauen, dass Mitarbeiter fähig sind, eine gut platzierte und treffend formulierte Rückmeldung zu verarbeiten.
Mehr noch: Die immerwährende Pseudo-Wohlfühlatmosphäre in manchen Büros endet nicht selten in Respektlosigkeit, Gerüchten und Intrigen. Wie in den Stellvertreterkriegen Afghanistans zur Zeit des Kalten Krieges geht es plötzlich nicht mehr um das Ausdiskutieren unterschiedlicher Meinungen, sondern darum, wer seine Bestellungen schneller bekommt, den besseren Parkplatz hat oder mehr Lob vom Chef einheimst. Verständlich, doch leider verlorene Energie.
Eine freche Frage an der richtigen Stelle führt hingegen zu mehr Dynamik, Klarheit und im besten Fall zu einem reinigenden Gewitter. Provokationen zwingen Mitarbeiter, Farbe zu bekennen, indem Sie die Mauselöcher verbarrikadieren. Die wahren Leckereien gibt es ohnehin nicht hinter tapezierten Wänden. An dieser Stelle endet die Provokation und beginnt die Eroberung und faire Verteilung des Käses in der Küche.
Wo jedoch bleibt bei all dem die Empathie- und Bedürfnisorientierung, die wir über die Jahre in unzähligen Kommunikationstrainings eingetrichtert bekamen? Und führen Provokationen nicht unweigerlich zu giftigen Kämpfen?
Wo ich herkomme, aus dem sozialen Bereich, wird nicht provoziert. Aggressionen zwischen dem Personal gibt es nicht. Und der Begriff des Kampfes ist sowieso tabu. Was nicht heißt, dass nicht gekämpft wird. Möglicherweise subtiler, feiner und indirekter als woanders.
Dabei bedeuten Provokationen im Ursinn, etwas aus dem anderen herauszukitzeln, etwas zutage zu fördern, vielleicht eine höhere Leistung oder eine deutlichere Klarheit. Und ist nicht dieses „aus der Reserve locken“ Grundaufgabe jeder Führung? Ist es nicht Aufgabe einer Führungskraft, zu provozieren und damit das Beste der Mitarbeiter zu fördern, bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht sogar mit kämpferischen Maßnahmen? Werden damit nicht automatisch auch Bedürfnisse befriedigt?
Der soziale Bereich bildet lediglich die Spitze der offiziellen Kampfverweigerung. In Verwaltungen, im Dienstleistungssektor und grundsätzlich in frauendominierten Berufszweigen herrschen meist ähnliche Verhältnisse vor. Dennoch wird gekämpft für die gute Sache, den richtigen Weg, den Fortschritt, menschliche Werte oder die eigene Sichtweise. Provozieren und kämpfen muss nichts Schlechtes sein. Prinzipien zu verteidigen, für sein Team einzustehen oder sein Lieblingsprodukt gegen Widerstände durchzuboxen. Warum also das Kind nicht beim Namen nennen?
Kämpfe ziehen uns seit Urzeiten in einen magischen Bann. Was fasziniert uns in unserer (durch-) zivilisierten Welt am archaischen Prinzip des Kämpfens? Warum provozieren und ärgern wir so gerne andere Menschen? Ist nicht auch das Kämpfen ein Ur-Bedürfnis? Ist es das Prinzip „Mensch gegen Mensch“ oder „Auge in Auge“? Oder die Vorstellung eines echten, organischen Gegners, anstatt einer Technik, die wir nicht verstehen? Vielleicht ist es der Zwang, zu reagieren, seine Komfortzone zu verlassen und aktiv Position zu beziehen, anstatt sich selbst in einem Mauseloch zu verkriechen und darauf zu hoffen, dass die Gefahr bald vorüberzieht. Vielleicht ist es die Endlichkeit – schließlich könnte jede Auseinandersetzung, jeder Wettkampf, jeder Sport und jedes Spiel mit psychischen oder physischen Verletzungen bis hin zum Tod enden. Vielleicht ist es der Mut zur eigenen Weiterentwicklung: Wenn ich mich mit einer Provokation aus dem Fenster lehne, muss ich auch dazu stehen. Wer springt, sollte fliegen lernen. Vielleicht ist es die Tatsache, dass im Wettbewerb nicht nur der Schreibtischtäter, sondern der ganze, emotionale Mensch gefordert ist. Er muss seine Bedürfnisse nicht hinter Konventionen verstecken. Dabei darf er in Ausnahmefällen auch laut sein. Er muss sogar, um von anderen respektiert zu werden.
Wie aggressiv wir trotz christianisierter Zivilisierung sind, wird ein ewiges Streitthema bleiben. Ob es jedoch Zufall ist, dass auf das christliche Verbot von Kampfsportarten Hexenverbrennungen und Kreuzzüge folgten? Ist Frieden ohne Kriege denkbar? Eine Kooperation ohne Auseinandersetzung? Was wäre die Hölle, wenn deren Insassen nicht vom Himmel träumen könnten? Das gesamte Leben scheint aus einem Wechselspiel zwischen egoistischem und kooperativem Miteinander zu bestehen. Die Wissenschaft spiegelt diesen Kampf mit ihren Mitteln wieder: Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins ruft das „Egoistische Gen“ aus, der Arzt und Psychiater Joachim Bauer spricht vom „Prinzip Menschlichkeit“. Was denn nun? Beides natürlich! Ohne Schwarz kein Weiß. Ohne Krieg kein Frieden. Schon begrifflich wüssten wir nicht, wovon wir sprechen sollten. Die Weltgesundheitsorganisation sagt: Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Aha! Es muss beides geben, um dem jeweils anderen eine Existenzberechtigung zu verleihen: Provokation und Verständnis.
Mitarbeitergespräche lassen sich folgerichtig als Balanceakt zwischen Kampf und Kooperation darstellen. Ein kurzer Ausflug in deutsche Sprachbilder verdeutlicht, wieviel Kampf in Mitarbeitergesprächen steckt: Sie ringen um gemeinsame Ziele. Die gegenseitigen Erwartungen reiben sich aneinander. Die Vorstellungen von einem funktionierenden Team beißen sich. Bereits das Ansprechen dieser Sprachbilder als Provokation könnte ein Mitarbeitergespräch inhaltlich voran bringen.
Provokationen und Kämpfe entstehen aus dem Wollen der Gegner. Wer jedoch nichts mehr will, ist tot, selbst wenn seine Hülle noch durch die Gänge wandelt. Was uns gesamtgesellschaftlich fehlt, ist eine offene und faire Streitkultur ohne Tricks, Manipulationen und polternde Hasskommentare. Wir sollten viel öfter mit unseren Kindern streiten, mit unseren Partnern, Lehrern, Dozenten und Mitarbeitern, anstatt uns hinter hierarchischen Masken zu verstecken.
Wie soll Führung in Zukunft aussehen?
Sind Sie bereit für einen Paradigmenwechsel? Schauen wir uns zwei Versionen der Zukunft an. Das Wunderbare an der Zukunft ist, dass Sie jederzeit die Wahl haben. Sie müssen lediglich das Notwendige tun, um Ihre Vision von Führung zu erfüllen.
Vision 1
Heute Nachmittag steht das Jahresgespräch mit einem veränderungsresistenten Mitarbeiter an. Als Sie vor einigen Jahren zur Führungskraft aufstiegen, waren Sie noch voller Tatendrang. Sie gingen davon aus, dass jeder Mitarbeiter etwas gestalten will. Und wenn nicht, will er doch wenigstens seine Aufgaben korrekt erledigen und nach Möglichkeit keinen Stress mit seinem Chef oder seinen Kollegen. Mittlerweile wissen Sie, dass dem nicht so ist.
Sie wissen genau, wie es ablaufen wird, das kommende „Aber-Gespräch“: Der Mitarbeiter wird zögerlich zu Ihnen hereinkommen und sich leicht verunsichert setzen. Sie werden ihn fragen, wie das letzte Jahr so lief, er wird flüstern: „Passt schon.“ Sie werden ihn darauf ansprechen, dass sie letztes Jahr vereinbart hatten, dass er mehr Verantwortung übernimmt und eigenständig Entscheidungen trifft. Er wird erwidern, dass er sich alle größte Mühe gegeben hat, doch durch die Zusammenlegung der beiden Abteilungen gezwungen war, sich in viele neue Sachgebiete einzuarbeiten. Sie werden entgegnen, dass es sich hier doch nur um ein neues Sachgebiet handelt. Er wird darauf betonen, dass das zwar stimme, es sich aber dennoch um viele kleine Unter-Sachgebiete handelt, die so schnell nicht zu überblicken sind und er noch einige Zeit braucht, um sich hier durchzuarbeiten. Er wird mittlerweile immer nervöser und um ihm nicht zu sehr auf den Zahn zu fühlen – was ohnehin nichts bringen würde –, werden Sie ihm anbieten, dass Sie jederzeit für Fragen zur Verfügung stehen, wenn er Hilfe braucht (schließlich haben Sie in einem Führungsratgeber vor kurzem etwas über „Die Führungskraft als Coach“ gelesen). Ihr Mitarbeiter wird daraufhin spürbar aufatmen. Zusätzlich werden Sie ihn dafür loben, dass er sich so großartig in sein neues Gebiet einarbeitet, immerhin kam es noch zu keinen größeren Fehlern, worauf er weiter entspannt. Pro forma, dass wissen Sie beide, werden Sie im Prinzip dieselben Ziele vereinbaren wie im letzten Jahr. Sie werden ihn fragen, ob er sich das vorstellen kann, die Ziele in Angriff zu nehmen, sobald die Zusammenlegung der beiden Abteilungen endlich abgeschlossen ist. Er wird nicken. Sie werden ihn fragen, wie er sich eine Umsetzung der Ziele vorstellt. Er wird keine Antwort wissen, denn es ist ja noch nicht so weit. Sie werden ihm ein paar Meilensteine vorschlagen, die Sie sich vorab überlegt haben. Er wird abermals nicken. Sie geben sich die Hand und das war es. Am Ende wird er erleichtert sein, dass er so weiter machen kann wie bisher. Und Sie haben, sofern nichts Schlimmeres passiert, ein Jahr lang Ruhe, bis es nächstes Jahr wieder heißt: Willkommen im Aber-Land! Sollte Ihr Chef fragen, warum der Mitarbeiter hinter seinem Potenzial zurückbleibt, können Sie darauf beharren: Sie hätten ja Ziele vereinbart, aber er ist einfach veränderungsresistent. Ihr Chef wird sich anschließend mit Ihnen solidarisieren, da er solche Fälle ja auch zur Genüge kennt. Der Mitarbeiter ist einfach träge. Da kann man machen, was man will.
Anschließend wird es um das neueste Kamikaze-Projekt gehen. Ständig wird ein neuer Projektesel durchs Dorf getrieben. Die Hälfte davon klappt, die andere wird am besten schnell wieder vergessen. Dabei könnte man aus den Gescheiterten mehr lernen als aus den Funktionierenden. Sie versuchen halbherzig mit Ihrem Chef über ein mögliches Scheitern des Projekts zu sprechen. Irgendwie kommt Ihnen der Grund dafür bekannt vor. Hätten Sie ein wenig mehr Zeit, könnten Sie darüber nachdenken, woran es lag. Sie würden bestimmt drauf kommen. Nur leider haben Sie keine Zeit für solche Kinkerlitzchen. Es muss ja weitergehen. Ihr Chef sieht das genauso und winkt ab. In Gedanken ist er schon bei seinem nächsten Termin, der in zehn Minuten ansteht: Rapport beim Vorstand. So wird es Zeit für Sie zu gehen.
Er wird mit dem Satz enden: Die Veränderungsresistenten sind schlimm. Aber die anderen, die Querulanten, sind auch nicht besser. Kommen ständig mit neuen Ideen, die sich beim besten Willen nicht umsetzen lassen. In dem Moment wird Ihnen wieder einfallen, dass morgen bereits das nächste Mitarbeiterjahres(krampf)gespräch ansteht, mit einem dieser Querulanten.
Vision 2
Heute Nachmittag steht das Jahresgespräch mit einem veränderungsresistenten Mitarbeiter an. Als Sie vor einigen Jahren zur Führungskraft aufstiegen, wussten Sie noch nicht so recht, was auf sie zukommen wird. Doch dank der ein oder anderen Fortbildung, einiger Fachbücher und einem reichhaltigen Meinungsaustausch unter Kollegen, sitzen Sie recht sattelfest im Führungssessel. Manche Vorschläge aus den Seminaren und Büchern waren hilfreich, andere waren zu kompliziert, um sie in den Führungsalltag umzusetzen. Bei all dem Zeitdruck, den Sie haben, müssen Methoden einfach und am besten in einem Satz zusammenfassbar sein, so wie das Prinzip des Problemeigentums, das Sie in einem Seminar erlernt haben.
Der Trainer fragte damals: „Kommt ein Mitarbeiter mit einer Frage: Wer besitzt dann das Problem? Sie oder der Mitarbeiter?“ Die Hälfte der Teilnehmer meinte die Führungskraft, die andere Hälfte der Mitarbeiter. Sollte ein Problem nicht gelöst werden, hat die Führungskraft ein Problem. Das hat jedoch Zeit. Im Moment der Fragestellung hat der Mitarbeiter das Problem. Damit es dort auch bleibt, begannen Sie ihrerseits Fragen zu stellen, anstatt wie früher Lösungsvorschläge zu präsentieren. Dieses kleine Prinzip veränderte Ihr Leben. Es machte Sie ruhiger und präsenter. Sie begannen besser zuzuhören, Ihre Wahrnehmung zu schärfen und Mitarbeiter ernster zu nehmen. Das passt nicht jedem Mitarbeiter. Manche fühlen sich zu ernst genommen. Wollen sie doch ihre Probleme einfach loswerden. Nun werden sie sanft gezwungen, selbst zu denken.
Bei dem Gedanken daran werden Sie leicht schmunzeln. Sie sind auch nur ein Mensch. Und ein klein wenig werden Sie Ihre Mitarbeiter doch wohl ärgern dürfen, oder nicht?
Wie das kommende Gespräch ablaufen wird, wissen Sie nicht. Ein Kollege erzählte Ihnen vor ein paar Jahren vom Pareto-Prinzip: 20 Prozent Vorbereitung für einen 80 prozentigen Erfolg. Der Rest ist Improvisation. Wahrscheinlich wird sich Ihr veränderungsresistenter Mitarbeiter nicht festnageln lassen wollen. Er wird Ausflüchte benutzen. Letztes Jahr fand die Zusammenlegung zweier Abteilungen statt. Es fiel ihm schwer, sich auf die Neuerungen einzulassen. Natürlich werden Sie vollstes Verständnis für seine Situation haben. Und dennoch glauben Sie an seine Potenziale. Da geht noch was. Ein wenig verantwortungsbewusster kann er sicherlich noch werden. Sie werden mit dem Witz von der Schnecke beginnen, die unbedingt wissen wollte, wie schnell eine Schildkröte marschiert. Sie kroch auf den Panzer einer Schildkröte. Doch als diese loswandert, wird der Kopf der Schnecke vom Fahrtwind nach hinten gepresst. Daraufhin ruft sie aus: „Huuuuiiiii, das geht mir jetzt doch zu schnell!“ Da Ihr Mitarbeiter derartige Anekdoten von Ihnen gewohnt ist, wird er sich zwar wundern, aber auch ein wenig schmunzeln. Sie werden daraufhin gemeinsam reflektieren, was dieser Witz mit ihm zu tun hat. Erfahrungsgemäß wird wenig von ihm kommen, deshalb retten Sie ihn aus der Peinlichkeit: Manchmal geht alles so schnell, aber man kommt auch langsam ans Ziel, Hauptsache angeschnallt. Sie werden betonen, dass auch „langsame“ Menschen ihre speziellen Qualitäten haben, da sie oft besser beobachten und ihnen Fehler auffallen, die anderen entgehen. Daraufhin werden Sie gemeinsam überlegen, wo es nächstes Jahr hingehen soll. Der Mitarbeiter wird erneut flüchten wollen. Deshalb raunen Sie in Ihrer authentischsten Mafiosi-Stimme: „Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, das Sie nicht abschlagen können. Oder auch zwei. Oder drei.“ Sie werden ihn daraufhin emotional beim Wort nehmen. Sie werden ihn fragen, ob er sich vorstellen kann, das eine oder andere Angebot in Richtung Selbstverantwortung anzunehmen. Sie werden ihn fragen, wie es ihm damit gehen wird. Sollten Sie in seiner Körpersprache Widerstände erkennen, zum Beispiel abwehrende Hände oder einen verschlossenen Blick, werden Sie auch dies ansprechen und ihn erst entlassen, wenn Sie das intuitive Gefühl haben, dass er ehrlich mitzieht. All das ist anstrengend – für beide Seiten. Doch Sie sind der tiefen Überzeugung, dass es für beide Seiten erfolgreicher und ehrlicher ist, sich gegenseitig respektvoll auf die Füße zu treten. Im ersten Moment wird Ihr Mitarbeiter Sie verfluchen, weil Sie partout nicht locker lassen. Später wird er es Ihnen danken, weil Sie an ihn glaubten und er sich, wenn auch im Schneckentempo, weiterentwickeln konnte. Grinsend werden Sie ihn mit den Worten verabschieden: „Sie wissen ja, ich habe Sie im Blick. Und wenn Sie Hilfe brauchen …“.
Auf dem Gang werden Sie anschließend Ihrem Chef begegnen. Er hat zwar wenig Zeit, wird Sie aber dennoch fragen, wie es Ihnen geht. Sie werden das Gefühl haben, dass er die wenigen Minuten, die er hat, vollkommen präsent ist. Das ermutigt Sie zu erzählen, dass das aktuelle Projekt, an dem Sie arbeiten, mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern wird. Erfreut wird er darüber nicht sein. Dennoch wird er erwidern: „Schreiben Sie Ihre Bedenken auf und kommen morgen damit zu mir. Aber wappnen Sie sich! So leicht werde ich das Projekt nicht aufgeben.“
Auf dem Weg in Ihr Büro werden Sie an das nächste Mitarbeiterjahresgespräch denken. Morgen steht Ihnen ein Querulant bevor. Schön, werden Sie sich denken, ein kleiner Adrenalinstoß zu früher Stunde wird mir helfen, zackig in den Tag zu kommen. Vielleicht brauche ich dann eine Tasse Kaffee weniger. Mal sehen, ob ich morgen etwas Neues über mich lerne. Mal sehen, wie ich ihn aus der Reserve locke. Vielleicht mit ein wenig provokantem Humor. Vielleicht braucht er aber auch ein paar klare Ansagen. In jedem Fall werden wir einen netten Schlagabtausch zusammen haben.
Theoretische Prämissen
Sollten Sie sich für Vision 1 entscheiden, rate ich Ihnen, dieses Buch schnellstens zurückzugeben oder zu verschenken. Sollte Vision 2 einen Reiz auf Sie ausüben, möchte ich drei Prämissen zur besseren Einordnung dieses Buches vorweg schicken:
Das Buch setzt ein positives Menschenbild voraus. Gehen Sie als Führungskraft davon aus, dass Ihre Mitarbeiter sich einer Aufgabe nicht verweigern, sondern im Zweifel eine Aufgabe nicht können oder nicht verstehen, finden Sie eine Menge innovativer Spielarten für Führung und Gesprächsführung vor. Ein positives Menschenbild bedeutet nicht, dass alles „gut“ wird, wenn wir „gut“ miteinander umgehen. Es geht davon aus, dass ein Mitarbeiter, der anders agiert als erwartet, gute Gründe dafür hat. Vielleicht fehlen ihm Informationen. Oder er sieht Lösungen, die Sie nicht sehen. Dass er Gründe hat, kann auch mit Ihnen zu tun haben. Immerhin kreuzen sich Ihre Wege. Vielleicht hatte er Einwände, die Sie nicht hören wollten. Vielleicht hätten Sie mit diesen Einwänden offener umgehen, sie einbinden können. In den seltensten Fällen wird er aus böser Absicht handeln, was nicht heißt, dass es keine Ausnahmen gäbe.
Sollten Sie ein anderes Menschenbild verfolgen, werden Ihnen die vorgestellten Methoden zu soft sein. Bei Mitarbeitern, die eine böse Absicht verfolgen, erscheint es fahrlässig, mit Geschichten Werte zu vermitteln, Humor zur Teambindung einzusetzen oder mit spielerischen Elementen die Motivation zu fördern. Wollen Sie dennoch weiterlesen, prüfen Sie kritisch, wo für Sie die Grenzen der Methoden liegen. Es könnte sich dennoch lohnen. Und prüfen Sie, ob die Umsetzung der Methoden in Ihrer Organisation möglich ist. Nichts ist so frustrierend wie eine funktionierende Methode, die kontextuell nicht erlaubt ist.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob bei der Prämisse „böser“ Mitarbeiter hierarchische Anweisungen von oben die Lösung bringen. Besserwisser-Mitarbeiter machen ohnehin, was sie wollen, mit Handbremse oder gerade so, nach Vorschrift, mehr jedoch nicht. Ein mühsames Geschäft, bei dem Sie – so oder so – wenig zu verlieren haben, wenn Sie ein paar neue Methoden ausprobieren.
2.Der vorgestellte Werkzeugkasten erfordert Mut, weil er mit bekannten Vorgehensweisen bricht. Das Buch spricht den ,agent provokateur‘ in Ihnen an. Dabei geht es jedoch in keiner Hinsicht um Gewalt oder pure Durchsetzung gegen fremde Interessen. Vielmehr geht es um den Mut, weniger an Konventionen zu denken, sondern unerschrocken strittige Punkte anzusprechen, um Prozesse in Fluss zu bringen. „Pfeilgrad“, wie meine Frau zu sagen pflegt. Es erfordert Mut, mit Metaphern bildhafte Vergleiche zu ziehen, mit Humor eine kritische Situation zu entspannen, den Mitarbeiter in eine bindende Verantwortung zu nehmen, auf die eigene Intuition zu horchen und damit zu arbeiten. Humor, Geschichten, Metaphern und Intuitionsfeedback sind keine Schubladenmethoden, die sich wie Feedbackregeln auswendig lernen lassen. Sie erfordern:
Mehr Ehrlichkeit zu sich selbst: Warum nervt es mich, dass dieser Mitarbeiter (wieder einmal) seine Aufträge unzulänglich erledigt?
Mehr Mut und bisweilen Selbstironie, dies auch anzusprechen, weil ich als Führungskraft hier jenseits von Sachzwängen etwas Persönliches von mir preisgebe.
Wodurch ich ein neues Gebiet des Austausches zwischen Führungskraft und Mitarbeiter eröffne. Ich zeige mich als Mensch, der bei aller Souveränität Fehler macht, bei aller Klarheit Zweifel hat. Damit sprechen Sie ein Bindungsangebot aus, das in der Praxis auf unterschiedliche Reaktionen treffen wird: Entweder es wird angenommen oder der Mitarbeiter wird in seinen Erwartungen, wie eine gute Führungskraft zu sein hat, enttäuscht. Aus dieser Enttäuschung heraus könnte er aufblühen oder Sie im ersten Augenblick für einen Leichtmatrosen halten. Einen Mitarbeiter emotional in die Verantwortung zu nehmen und erst dann aus Gesprächen zu entlassen, wenn Ihre Intuition Ihnen sagt, dass er zu seinem Wort stehen wird, ist jedoch alles andere als leicht. Es mag weichgespült klingen, mit bildhaften Vergleichen und Emotionen zu arbeiten. In der Tat ist es mutiger und härter als so manche oberflächliche Anweisung aus dem Katalog des Alltagsgeschäfts, weil es die sichere Seite des Standardrepertoires einer Führungskraft verlässt und sich auf Neuland begibt.
3.Um derart zu führen, genügt es nicht, mit dem Mitarbeiter regelmäßig Ziele zu vereinbaren und ab und an zu prüfen, ob er noch in der Spur ist. Die herkömmliche Art des Führens gleicht unserem Denken in Projekten: Wir setzen uns langfristige, für unser Denken „unmenschliche“, weil Zu-weit-weg-Ziele und definieren Meilensteine. Der Mitarbeiter macht sich auf den Weg und wird regelmäßig zum Rapport gebeten, damit sein Vorgesetzter weiß, ob seine Handlungen angepasst werden sollten oder nicht, um die Jahresziele zu erreichen. Doch wie viele Ziele werden tatsächlich erreicht? Und was passiert, wenn sich Jahresziele vor Jahresabschluss abhaken lassen? Darf der Mitarbeiter dann frühzeitig bezahlten Urlaub nehmen?
Natürlich sind Ziele motivierend. Es hapert jedoch in der Umsetzung. Meist ist der Zeithorizont zu weit entfernt. Oder die Ziele sind zu unpersönlich, das Denken in Projekten zu sachlich. Die Umwelt ändert sich zu schnell.
Um Ziele motivierender und flexibler zu gestalten, ist es sinnvoller, eine Zielrichtung als Kontinuum zu betrachten und diese anschließend in Mikrohandlungen zu übersetzen. Ein Beispiel:
Sollten Sie mit einem Mitarbeiter das Ziel „Mehr Verantwortungsübernahme“ vereinbaren, reflektieren Sie gemeinsam mit ihm seine Verantwortungsübernahme in der Vergangenheit. Er lernt damit nichts Neues, sondern ein Mehr von etwas, das er bereits kennt. In der Umsetzung könnten Sie, im Rahmen eines Mitarbeiterjahresgesprächs, einen Verantwortungs-Check als Mikrohandlung installieren: Ich komme nicht weiter. Wenn ich meinen Chef frage, übernehme ich dann Verantwortung? Habe ich alle in meiner Macht stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft? Sowohl ein Ja als auch ein Nein kann Verantwortungsübernahme bedeuten. Die Beantwortung der Frage ist sekundär. Denn was hiermit erreicht wird, ist Selbstreflexion. Und Selbstreflexion ist per se Verantwortungsbewusstsein und damit die Vorstufe von Verantwortungsübernahme. Das langfristige Ziel verschwindet durch die Verfolgung eines bewussten Mikroverhaltens im unbewussten Hintergrund. Zusätzlich lassen sich Mikrohandlungen im Gegensatz zum langfristigen Ziel mittels Feedbackschleifen agiler und flexibler an ein sich veränderndes Umfeld anpassen.
Vielleicht kennen Sie den Film „Jurassic Park“. Darin gelingt es Wissenschaftlern aus prähistorischer DNS eine neue Generation von Dinosaurier zu züchten. So spannend der Film auch ist, er bleibt unsinnig. Denn die Dinosaurier von damals hatten spezielle Mikroben in sich und lebten in einer speziellen Biosphäre, das heißt sie wären in der Neuzeit nicht überlebensfähig. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wir können uns keinen Dinosaurier basteln. Organismen entstehen durch komplexe Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt sowie durch Feedbackprozesse. Können wir uns Wunschmitarbeiter basteln? Oder wäre es nicht leichter, den Mitarbeiter durch gezielte, prozesshafte Rückmeldungen aus sich heraus entstehen zu lassen?
Dazu benötigen Sie jedoch eine Abkehr vom Denken in langfristigen Projekten hin zu Mitarbeitergesprächen als kurz getaktete Prozesse, in denen Sie und Ihr Mitarbeiter ein System darstellen, das sich gegenseitig in Feedbackschleifen beeinflusst wie Orchideen auf oder Pilze in der Nähe von Bäumen. Dazu müssen wir uns jedoch von dem Glauben lösen, mit Projekten und langfristigen Zielen alles regeln zu können und stattdessen den Fokus auf menschliche prozesshafte Weiterentwicklungen setzen. Der Mensch entwickelt sich nicht in Schüben, sondern schrittweise. Kein Kind steht am Morgen auf und kann sprechen, obwohl es gestern noch kein einziges Wort konnte. Kein Mitarbeiter übernimmt am Freitag Verantwortung, wenn er am Montag noch ausschließlich per Anweisung agierte.
Sind Sie bereit für einen Paradigmen-Wechsel? Wir brauchen wieder mehr Präsenz und Geduld in Gesprächen. Ziele lassen sich schnell aufstellen. Hapert es jedoch an der Umsetzung, ist nichts gewonnen. Wir brauchen Vertrauen in die kontinuierliche, prozesshafte Entwicklung eines Mitarbeiters. Wir brauchen Mut zu lebendigen und provokativen Auseinandersetzungen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, zu einem Eintreten für Ideen mit Widerstand, Einsatz und Wettkampf, damit sich am Ende beide Gesprächspartner koevolutiv weiterentwickeln. Besser eine kämpferische Auseinandersetzung mit produktivem Ende als ein Schmusekurs mit Nichtangriffspakt. Lasst Sie uns wecken, die schlafenden kreativen Geister und die trägen Gestalten hinter den Bildschirmen. Und lassen Sie sich von Königsmördern und Kronprinzen nicht die Butter vom Brot nehmen.
Provokationen und Kämpfe
Fange nie eine Schlägerei an.
Und laufe nie vor einer Schlägerei davon.
WEISE WORTE EINES VATERS ZU SEINEM SOHN, AUS DER WESTERN-SERIE „HELL ON WHEELS“
Führungstypen
Schönwetterführen kann jede(r). Erst unter Stress, besonders in Konflikten mit beweglichen „Gegnern“, zeigt sich die mentale Anpassungsfähigkeit. Manche Chefs werden zu Cholerikern, andere beschwichtigen. Die nächsten verstecken sich hinter Rollen, Regeln und Chefsesseln. Wieder andere verlieren sich im Chaos.
Gute Chefs zeigen genau dann Charakterstärke, wenn es am meisten stürmt. Sie stehen auf dem Schiffsdeck, während ihnen die Gischt ins Gesicht peitscht.2 Sie jedoch bleiben unbeirrbar. Damit vermitteln sie allen an Deck die Zuversicht, dass es am Ende gut ausgehen und jeder reich belohnt werden wird.
Schlechte Kämpfer bestehen nur aus Kampf. Gute Kämpfer bekennen mutig, offen und ehrlich Flagge und nötigen ihren Gegnern damit Respekt ab. Ein Respekt, der sich auch daraus speist, dass sie das Risiko des Scheiterns eingehen. Und Provokationen sind immer eine riskante Angelegenheit. In Kooperationen dagegen bleibe ich auf der sicheren Seite des gegenseitigen Verständnisses und dem „Wir haben uns alle lieb“-Prinzip. Im Kampf gehe ich ein Wagnis ein, das mich fordert und nach Lebendigkeit schmeckt. Dazu muss ich jedoch wissen, was mich antreibt, lebendig hält, für welches Projekt mein Herz schlägt und was ich bereit bin, dafür zu investieren.
Hinter Provokationen und der Wertschätzung eines ehrlichen Kampfes versteckt sich mehr als nur ein Korrektiv. Der innere Zwiespalt zwischen „Sag es nicht, sonst zerreißt dich dein Chef in der Luft!“ und „Ich platze gleich!“ schafft sich endlich Bahn. Endlich darf es gesagt werden. Wer jemals für sich selbst einstand, weiß wie es sich anfühlt, stolz auf sich zu sein.
Luthers Worte „Hier stehe ich und kann nicht anders!“ suggerieren, dass es zuvor eine große, bisweilen schmerzhafte Portion Selbstreflexion und Selbstehrlichkeit benötigt. Dann jedoch muss es raus, um nicht innerlich zu platzen. Das wirkt befreiend.
Damit zeigen wir der anderen Seite unser wahres Ich. Wir zeigen, wofür wir stehen, was uns wirklich wichtig ist. Wir bieten unserem Gegenüber eine Reibungsfläche anstatt eines Wisch-und-weg-Screens.
Wer sich engagieren will, muss seinen Mund aufmachen. Wer es umsetzen will, braucht Verbündete. Es geht darum, im Kontest die Partner so anzugreifen, dass sie anschließend aus Respekt voreinander an der Umsetzung mitarbeiten. Es gilt, Ideen zu verteidigen, anstatt Personen anzugreifen. So wird der Kontest zu einem Probelauf, einem Kon-Test, in dem im Kampf getestet wird, ob die Zusammenarbeit auch im Anschluss miteinander funktioniert. Sollte es auf dieser Mikroebene nicht gelingen, wird es auch später, in der kooperativen Phase, nicht klappen.
Dieses Buch soll Sie nicht zum skrupellosen Zündler anleiten. Dazu wären die meisten von uns ohnehin zu zivilisiert. Es stellt vielmehr eine Handreichung dar, wie Ideen-Wettbewerbe oder Werte-Rivalitäten in Gesprächen sportlich, menschlich und fair, gleichzeitig klar, direkt und mutig ausgefochten werden. Im Kampfsport wie im wahren Leben gilt: Die unfairen Kämpfer kennt jeder. Gerade deswegen will keiner mit ihnen „spielen“. Die fairen Kämpfer kennen, schätzen und respektieren sich untereinander. Sie halten sich an Regeln. Provokationen mit Regeln, die dabei helfen, von einem Gegeneinander, in dem der eine den anderen um jeden Preis dominieren will, zu einem Mit-Einander des gegenseitigen Respekts zu kommen. Der Weg dorthin führt uns über stabile Wertehaltungen, einen offenen Umgang mit Fehlern – denn wer kämpft, geht das Risiko ein, Fehler zu machen –, Provokationen mit Humor und Metaphern, Auseinandersetzungen mit der unnachgiebigen prozessbasierten Gesprächsmethode Focusing, über den Ringkampf eines 360-Grad-Feedbacks bis hin zur Etablierung eines ehrlichen und offenen Schlagabtauschs im Sinne eines Trainingslagers, um Mitarbeiter in Gesprächen auf Ernst-Situationen vorzubereiten.
Wenn wir an die großen Führer der Vergangenheit denken, kristallisieren sich vier archetypische Figuren heraus:
Neugierige Visionäre wie Marco Polo, Christoph Columbus, Isaac Newton, Leonardo Da Vinci oder Steve Jobs, die an ihre Geldgeber oder Kunden Visionen verkauften, von denen sie oft selbst nicht wussten, ob es sie überhaupt gibt oder ob sie funktionieren werden. Visionäre provozieren ihre Mitmenschen mit ihren Ideen.
Idealistische Kämpfer wie Martin Luther King, Rosa Luxemburg, Sigmund Freud oder Karl Marx, die für Reformen einstanden, auch wenn sie sich damit den ein oder anderen Feind machten. Die aggressivere Variante wie Winston Churchill, Jeanne d’Arc oder Che Guevara kämpfte für ihr Land, eine Gruppe oder Idee. Fest entschlossen, den Gegner mit oder ohne Gewalt zu „überzeugen“. Kämpfern liegt das Provozieren im Blut.
Planerische, selbstreflexive Patriarchen oder Feldherren wie Charles de Gaulle, Napoleon Bonaparte, Friedrich der Große, König Salomon, König Artus oder Richard Löwenherz, die ihrem Volk mit allmächtigen Entscheidungen Sicherheit in unsicheren Zeiten vermittelten. Feldherren provozieren taktvoll, geplant und präzise.
Oder geduldige Mediatoren wie Jesus, Buddha, John F. Kennedy, Barack Obama, der Dalai Lama, Nelson Mandela, Mutter Theresa oder Gandhi, die ihre Ziele sanft, aber unnachgiebig verfolgten, voller Vertrauen in eine bessere Zukunft. Auch sie hatten Erfolg. Vielleicht sanfter und langsamer, dafür jedoch mit einem Nachhaltigkeitseffekt, der bis in unsere Zeiten ausstrahlt. Geduld und Provokation? Geduld treibt manche Menschen zur Weißglut.
Sie alle hatten etwas Provokantes, selbst wenn der Kampf im passiven Widerstand bestand. Sie alle wollten etwas bewegen, etwas verändern. Gleichzeitig war niemand von ihnen Einzelkämpfer. Langfristig erleichtern Kooperationen uns das Leben. Ohne Verbündete, auf die wir uns verlassen können, ist Führung unmöglich. Die größten Staaten scheitern ohne Bündnisse. Wir können Führung folglich als möglichst eleganten Übergang von Kampf zu Kooperation beschreiben.
Was bedeutet das Wissen um Führungstypen für moderne Führung? Was macht gute Führung aus? Fragen Sie sich selbst: Was ist Ihnen wichtig?
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Lebendigkeit
Authentizität, Echtheit, Direktheit, Streitbarkeit, Unnachgiebigkeit und Mut
Menschlichkeit, Loyalität und Fairness
Vertrauen, Geduld und Souveränität
Wie sehen Sie sich selbst als Führungskraft? Sie haben 20 Punkte zu verteilen:
Werden Sie wie ein neugieriger Visionär von Ideen getrieben, die Ihre Kreativität immer wieder in neue Höhen treibt? Endet diese Flexibilität und Agilität allerdings manchmal im Chaos?
Kämpfen Sie als Idealist mit klaren moralischen Standards, authentisch, stimmig, einschätzbar, mutig und unnachgiebig wie ein Held für Ihre Prinzipien und verhalten sich loyal gegenüber Ihren Leuten? Manchmal allerdings etwas überperfektionistisch und ohne Rücksicht auf Verluste?
Übernehmen Sie ebenso patriarchalische wie faire, fürsorglich-menschliche Verantwortung für Ihre Mitarbeiter? Treten Sie dabei Mitarbeitern ehrlich und transparent zu deren Besten auf die Füße, weil Sie wissen, dass es in der Führung keine Freunde gibt, bekommen jedoch ab und an diktatorische Anwandlungen, wenn Sie der Meinung sind, nur Sie wissen, wo es lang geht?
Oder betrachten Sie sich als geduldigen Mediator, der im Laufe seines Lebens gelernt hat, mit Fragen unnachgiebig und gleichzeitig empathisch seinem Gegenüber auf den Zahn zu fühlen, jedoch ab und an ein wenig mutiger und forscher sein könnte?
Um Visionen voranzubringen, überschreitet der Visionär die üblichen Konventionen. Viele seiner Ideen versickern im Nichts. Manche jedoch sind genial. Um diese Visionen in die Tat umzusetzen, schart der Idealist loyale Mitstreiter um sich. Etwas kämpferisch durchzusetzen, führt jedoch oftmals zu einer schnelleren Verfallszeit. Langfristig ist es deshalb wichtig, Strukturen aufzubauen, die Veränderungen nachhaltig gestalten. Auch dies kann manchen auf die Füße treten. Wurden die Strukturen etabliert, braucht es Vertrauen und Geduld, dass diese wirken. Ab hier beginnt der Zyklus von neuem.
Im Anhang finden Sie ausführliche Steckbriefe zu den vier provokanten Führungstypen.
Nehmen Sie zusätzlich zu Mut und Unnachgiebigkeit Menschlichkeit, Fairness, Loyalität, Vertrauen und Ambiguitätstoleranz3 in ihren Führungsprinzipienkatalog mit auf: Erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, etwas zu erreichen oder verringert es sie? Was denken Sie?
Und was erwarten Sie von einem guten Mitarbeiter? Dass er in der Ecke sitzt und schmollt? Oder dass er sich aktiv einbringt, auch wenn sich dieses Einbringen manchmal zu bestimmend, nörgelnd, motzend, zickig, grantig oder chaotisch auswirkt? Die Wahl der Waffen ist nicht immer schön. Die Bedürfnisse sind es durchaus.
Nörgler und Grantler sind in jedem Fall eine reichhaltigere Informationsquelle als stille Mäuschen und Ja-Sager.
Resonante Führung
2003 erschien die erste Auflage von Daniel Golemans Buch „Emotionale Führung“. Darin übertrug er die Erkenntnisse seiner ersten beiden Bücher „Emotionale Intelligenz“ und „Der Erfolgsquotient“ auf den Führungsbereich. Goleman unterscheidet persönliche Kompetenzen in der Führung wie Selbstwahrnehmung und Selbstmanagement sowie soziale Kompetenzen wie Empathiefähigkeit und Beziehungsmanagement.
Was er propagiert, ist gerade im Konkurrenzkampf enorm wichtig, um nicht über die Stränge zu schlagen. Führungskräfte sollten unter anderem:
sich ihrer Emotionen und Intuition bewusst sein
emotional selbstkontrolliert sein
transparent in ihren Entscheidungen sein
optimistisch sein
anpassungsfähig sein
empathisch sein
die Organisationsinteressen im Blick haben
die Mitarbeiterinteressen erkennen
inspirierend und mitreißend sein
die Entwicklung der Mitarbeiter fördern
überzeugend sein
Veränderungen lenkend gestalten
konfliktfähig sein
Diese Liste klingt leider schon wieder wie eine Wunschliste an die perfekte Führungskraft. Es geht mir mitnichten darum, Kollegen an den beraterischen Karren zu fahren. Dafür habe ich selbst dieses Spiel der Wissens- und Anforderungsanhäufung schon zu lange mitgespielt, in meinen Büchern, aber auch in zahlreichen Seminaren, und spiele es immer noch mit. Wissensvermittlung ist per se nichts Schlechtes. Sonst würde ich kaum ein weiteres Buch auf den Markt werfen. Im Gegenteil: Lesen Sie Goleman, Sprenger, Malik und am besten so viele weitere Führungsbücher, wie Ihre Zeit es erlaubt. Brechen Sie anschließend die Inhalte der Bücher darauf herunter, was deren Aussagen konkret für Sie bedeuten. Zu viel Wissen hindert uns leider daran, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und zu viel Resonanz kann uns daran hindern, Tacheles zu reden. Eine resonante Führung wird leider, wie im Buch „Die Weichmacher“ von Thomas Vasek treffend beschrieben, oft dazu benutzt, Entscheidungen mittels Weichermacher-Dialektik auszuweichen: Dazu später mehr.
Anstatt dieser Schwammigkeit nach dem Mund zu reden, geht mein Ansatz weg von Anforderungen an die Führungskraft nach einem vorauseilenden Verständnis, hin zu klaren eigenen Standpunkten bei einem gleichzeitigen Mitschwingen mit dem Mitarbeiter. Ein offener Umgang mit Fehlern oder das Führen mit Fragen und Angeboten öffnet Räume, ohne sie beliebig werden zu lassen. Eine prozessorientierte Führung gibt wenig vor, lässt den Mitarbeiter aber auch nicht aus, bis ein Ergebnis steht, um die Selbstverantwortung der Mitarbeiter zu fördern. Führungskräfte sollten dafür sorgen, aus ihren Mitarbeitern mittels Beziehungsmanagement das Beste herauszukitzeln. Sie sollten den Spieß umdrehen, indem sie den Mitarbeiter befragen, was er braucht, statt ständig selbst wissen zu müssen, wie sie ihn motivieren könnten. Damit verschiebt sich etwas im Gefüge Führungskraft – Mitarbeiter: der Mitarbeiter wird mehr in die Verantwortung genommen. Führung bedeutet damit streng genommen weniger Führung, sondern eine Hilfe zur Selbstführung. Wollen Sie als Führungskraft diesen Weg gehen, sollten Sie sich jedoch daran gewöhnen, Verantwortung abzugeben, mehr Fragen zu stellen und weniger zu reden. Erst recht, wenn Ihr Facharbeiter von Dingen spricht, von denen er nun mal mehr Ahnung hat als Sie.
Natürliche Führung
Meine Frau liebt Äpfel. Ich selbst habe mit manchen Sorten meine Probleme: Kernobst-Allergie. Und dennoch gibt es Äpfel, die auch ich liebe: Frisch und knackig, mit dem richtigen Gehalt an Säure. Allzu wohlgeformt müssen sie nicht sein. Meist schmackhafter als edel polierte Äpfel mit einem Durchmesser von 6 Zentimetern und einem Mindestgewicht von 90 Gramm nach EU-Norm sind kleine, fleckige Äpfel in Bio-Qualität aus dem eigenen Garten, statt der Anti-Öko-Äpfel aus dem Biomarkt um die Ecke. Manche Äpfel haben eine harte Schale. Doch darunter steckt oft das beste Fruchtfleisch. Manche taugen zum direkt vom Baum essen, aus anderen sollte man besser unverfälscht naturtrüben Saft pressen lassen.
Führung ist wie Äpfel ernten und verarbeiten. Jede Sorte ist anders. Manche Äpfel sind frühreif, Herbstäpfel brauchen länger, wieder andere müssen nachreifen. Andere werden erst durch die Verarbeitung richtig lecker. Manche sind von EU-Normen geprägt. Andere sind nicht Jedermanns Sache, in dem was sie können jedoch einzigartig. Manchen kann man beim Wachsen zusehen. Es gibt Bäume, da sollten die Zweige zurückgestutzt werden, um den Energiefluss zu fördern. Eines ist jedoch sicher: Kein Apfel, kein Baum und kein Mitarbeiter gleicht dem anderen.
Würden wir einen Mitarbeiter befragen, wüsste er vermutlich am besten, was er bräuchte, um sein volles Potenzial zu entfalten. Vielleicht würden Sie mir widersprechen: „Meine Mitarbeiter wissen oft nicht, worin sie wirklich gut sind.“ Das mag sein. Ich denke, früher wussten sie es, haben es jedoch vergessen. Zu mächtig ist oftmals der hierarchische Ausruh-Effekt: Lieber den Chef fragen, statt eine Entscheidung selbst zu treffen. Das ist zwar bequem, macht aber unmündig.
Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob Ihre Mitarbeiter wissen, was sie brauchen, um zu wachsen, ist es, sie zu fragen. Vielleicht wäre es einen Versuch wert.
Agiles Führen und Stabilität in Balance
Führungskonzepte gibt es wie Förmchen am Meeresstrand, um den Sand in Form zu bringen. Manche lenken ihr Augenmerk auf die Führungskraft. Charismatisch sollte sie sein und kraftvoll auftreten, und nicht zu vergessen empathisch. Andere Konzepte setzen bei den Mitarbeitern an, um das Verständnis für sie zu schulen. Den Höhepunkt dieser Denke erleben wir gerade mit den Neurowissenschaften: Wie schön wäre es, wenn wir endlich wüssten, was unsere Mitarbeiter wollen, was sie motiviert und was sie demotiviert.
All das sind wichtige Informationsquellen für Führungskräfte. Dennoch scheint mir, dass Führung entmenschlicht wurde: Sei Coach! Sei Mediator! Sei Visionär! Sei Empath! Sei Charismatiker! Aber bleib flexibel! Gib an, wo es lang geht, wenn nötig! Lass die Zügel locker, wenn möglich! Führe direktiv, beziehungsorientiert, demokratisch, laissez-faire, resonant! Denke systemisch! Aber bitte authentisch und glaubwürdig! Ist das nicht ein wenig viel verlangt in einem Zeitalter, in dem niemand die Zeit hat, sich über all das Gedanken zu machen und entsprechend aufwändig umzusetzen?
Wir sollten schnellstens Abstand nehmen von der Idee, Menschen zu führen im Sinne einer Kontrolle über Mitarbeiter, die wir als Objekte betrachten, als ließe sich alles und jedes bewerten. Wir sollten Abstand nehmen vom Anspruch, wie mit dem Joystick in einem Computerspiel alles steuern zu können, obwohl wir täglich merken, dass das nicht funktioniert. Kaum sind wir fertig mit unseren Plänen, haben sich die Märkte, Kundeninteressen und Mitarbeiterbedürfnisse wieder gewandelt. Die Folge: Verunsicherung und Überforderung auf allen Seiten.
Dennoch tun wir so, als hätten wir nach wie vor alles im Griff. Dass Führungskräfte den Schein aufrechterhalten wollen, ist verständlich. Wer, wenn nicht sie, könnte ihren Mitarbeitern die nötige Sicherheit geben?