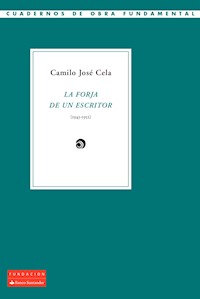9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Literaturnobelpreisträger Cela durchwanderte Spanien zwischen 1948 und 1964. Seine anschließend entstandenen romancierten Reisetagebücher sind als unvergleichlich sensible und zugleich unterhaltsame Darstellung spanischer Wesensart in die Literaturgeschichte eingegangen. Der Vagabund, den Cela erzählen lässt, durchstreift das ärmliche, vom Staat vernachlässigte Hinterland, seine Beobachtungen wirken absichtslos, seine Erlebnisse zufällig. Auch in diesem Werk des Autors, dessen Sympathie für die Geschundenen und Entrechteten der Gesellschaft bekannt ist, verbindet sich Celas aufklärerischer Geist mit seiner tiefen Liebe zu seinem Land und seinem Volk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
Zur Einführung
Die Alcarria
Juden, Mauren und Christen
Vom Miño zum Bidasoa
Erste andalusische Reise
Die Pyrenäen von Lérida
Nachbemerkung des Herausgebers
Die Alcarria
Der Wanderer liegt auf einer mit Kretonne bezogenen Chaiselongue. Er blickt zerstreut zur Decke hoch und läßt seiner Phantasie freien Lauf, die wie ein sterbender Falter, mit müden Schlägen Wände, Möbel und die brennende Lampe streift. Er ist müde und läßt erleichtert die Beine wie Marionetten einfach herunterbaumeln.
Der Wanderer ist ein junger, hochgewachsener, schlanker Mann. In Hemdsärmeln raucht er eine Zigarette. Seit Stunden hat er schon kein Wort gesprochen, seit Stunden ist niemand da, mit dem er sich unterhalten könnte. Von Zeit zu Zeit trinkt er einen – nicht zu kleinen, aber auch nicht zu großen – Schluck Whisky oder pfeift leise vor sich hin.
Im Hause ist alles still; die Familie des Wanderers schläft. Auf der Straße stört nur hin und wieder ein herumirrendes Taxi die trauliche Ruhe der Nachtwächter.
Im Zimmer herrscht ein heilloses Durcheinander. Auf dem Tisch zeugt ein dicker Packen ungeordneter Manuskriptblätter von vielen Stunden Arbeit. Auf dem Boden ausgebreitet, an die Wände geheftet zehn, zwölf, vierzehn Landkarten, vollgekritzelt mit Notizen und Randbemerkungen in Tinte, mit kräftigen Rotstrichen und weißen Fähnchen markiert.
»Am Ende ist das doch alles zu nichts nütze. Es ist immer dasselbe!«
Über einer Stuhllehne schlummert die Jacke aus grobem Kord. Auf dem Teppich neben einem Stapel Romane erholen sich die genieteten Wanderstiefel. Die neue Feldflasche wartet auf schweren, bekömmlichen Rotwein. In der alten, ehrwürdigen Nußbaumuhr ertönt der letzte Schlag einer späten Nachtstunde.
Der Wanderer steht auf, geht im Zimmer auf und ab, rückt ein Bild gerade, schiebt ein Buch zurecht, riecht an ein paar Blumen. Vor einer Landkarte der Halbinsel bleibt er stehen, die Hände in den Hosentaschen und runzelt fast unmerklich die Stirn.
Der Wanderer spricht langsam, sehr langsam mit sich selbst, ganz leise, als sollte es niemand bemerken.
»Ja, die Alcarria. Das muß eine gute Gegend zum Wandern sein, ein schöner Landstrich. Dann werden wir weitersehen, vielleicht bleibe ich dann zu Hause, je nachdem.«
Der Wanderer zündet sich noch eine Zigarette an – beinah verbrennt er sich mit dem Streichholz den Finger – und schenkt sich noch einen Whisky ein.
»Die Alcarria von Guadalajara. Das Hochland von Cuenca nicht mehr, in Cuenca durchwandere ich vielleicht den Kiefernwald oder die Mancha – wer weiß? – mit ihren gemächlichen Wegen.«
Der Wanderer verzieht etwas den Mund.
»Und es macht auch nichts, wenn ich ein bißchen abschweife, falls ich Lust dazu habe. Letzten Endes ist das ganz einerlei. Niemand zwingt mich zu etwas, niemand sagt zu mir: Gehen Sie hier entlang, steigen Sie dort hinauf, nehmen Sie jene Anhöhe, diesen Abhang oder jenes liebliche Tal, in dem es sich gut wandern läßt.«
Der Wanderer wühlt in den Papieren auf dem Tisch, er sucht nach einem Lineal. Er findet es und stellt sich – die Zigarette im Mundwinkel und mit zusammengekniffenen Augen, um den Rauch nicht in die Augen zu bekommen – wieder vor die Wand und führt das Lineal auf der Landkarte spazieren.
»Weder zu kurze noch zu lange Strecken, das ist das Geheimnis. Eine Meile und eine Stunde Pause, wieder eine Meile und wieder eine Pause, und so bis zum Schluß. Zwanzig oder fünfundzwanzig Kilometer am Tag sind ein gutes Tempo, man ist den ganzen Vormittag unterwegs. Nachher an Ort und Stelle wird sich erweisen, daß alle Pläne Makulatur sind und daß die Dinge – wie immer – ihren eigenen Lauf nehmen.«
Er sucht nach ein paar Aufzeichnungen, schlägt in einem Notizbuch nach, blättert in einem alten Erdkundebuch, breitet eine Landkarte der Gegend auf dem Tisch aus. »Ja, ohne Zweifel, die der Natur entsprechenden Regionen. Flüsse verbinden und Berge trennen, eine alte Weisheit, keine andere Einteilung ist sinnvoller.«
Für einen Moment läßt die Aufmerksamkeit des Wanderers nach; er nimmt das erstbeste Buch aus dem Regal: die Geschichte Galiciens von Manuel Murguía in einem mit der Zeit verblichenen, roten Kartoneinband. Er braucht es nicht; er hat ganz unwillkürlich danach gegriffen.
»Ein drolliges Buch … So sorgfältig und mit soviel Geduld geschrieben.«
Dem Wanderer macht die Müdigkeit zu schaffen, er nickt ein paarmal ein, während er in dem Buch herumblättert. Als er unter einer Abbildung »Cromlech, in Pontes de García Rodríguez« liest, wird er wieder hellwach. Er stellt es an seinen Platz zurück und findet, daß seine Bücher tatsächlich ziemlich schlecht geordnet sind. Zwischen dem Band Geschichte Galiciens aus seiner Schulzeit und The Sun Also Rises von Hemingway steht Physiologie und Hygiene.
Der Wanderer tritt wieder vor die Landkarte.
»Wie die Hausierer und Zigeuner, ähnlich wie die Wildschweine und Marder, werde ich einen Bogen um die Städte machen.«
Er kratzt sich an der Augenbraue und runzelt die Stirn. Der Wanderer ist unschlüssig.
»Obwohl, nein, ich werde sie nicht meiden. Man muß die Städte am späten Nachmittag durchqueren, wenn die jungen Mädchen vor dem Rosenkranz spazierengehen.«
Der Wanderer lächelt. Er hat die Augen halb geschlossen, so als träumte er.
»Nun gut, wir werden sehen.«
Schweigend verharrt er eine Weile, sich dem wirren Strom seiner Gedanken überlassend. Es ist schon sehr spät.
»Unerhört!«
Der Wanderer – plötzlich wie ein verletzter Vogel ermattend –, glaubt schließlich, daß er eigentlich nur noch aufzubrechen braucht, daß er sich wahrscheinlich allzu viele Gedanken über eine Reise macht, die er mit etwas Planung, aber auch ein wenig wie das Feuer auf einer Tenne angehen will: auf gut Glück, und wie es sich gerade ergibt.
Er nimmt einen letzten Schluck direkt aus der Flasche. »Nein. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Besser, ich nehme den Rucksack und mache mich auf den Weg.«
Er zieht sich aus, schlägt die Felldecke zurück, löscht das Licht und legt sich auf der mit Kretonne bezogenen Chaiselongue schlafen.
Draußen hört man die Hellebarde des Nachtwächters in der Ferne auf den Bürgersteig klopfen. Durch die Spalten der Jalousie dringt ein feiner Lichtstreifen. Langsam und schwerfällg ziehen die ersten Karren der Lumpensammler vorbei. Als der Tag etwas verschämt – wie ein gerade dem warmen Ei entschlüpftes Küken – anbricht, übermannt den Wanderer endlich der Schlaf.
Der Wanderer verläßt Guadalajara zu Fuß auf der Hauptstraße nach Zaragoza, die neben dem Fluß verläuft. Es ist Mittag, und die Sonne brennt unbarmherzig. Der Wanderer geht am Straßenrand auf erdigem Boden; der Asphalt ist hart und heiß und macht die Füße wund. Draußen am Stadtrand kommt der Vagabund an einem Gartenlokal vorbei, das einen verlockenden, klangvollen Namen trägt: »Die Geheimnisse von Tanger«. Zuvor war er in einem Gemüseladen, um ein paar Tomaten zu kaufen.
»Geben Sie mir anderthalb Pfund Tomaten?«
»Was?«
Die Gemüsehändlerin ist stocktaub.
»Ob Sie mir anderthalb Pfund Tomaten geben!«
Die Gemüsehändlerin rührt sich nicht; sie scheint angestrengt nachzudenken.
»Sie sind noch grün.«
»Das ist mir egal! Ich brauche sie für Salat.«
Die Gemüsehändlerin glaubt wohl, sie dürfe keine grünen Tomaten verkaufen.
»Gehen Sie vielleicht zufällig nach Zaragoza, um ein Gelübde zu erfüllen?«
»Nein.«
»Was?«
»Nein!«
»Früher gingen nämlich viele nach Zaragoza. Die hatten auch ihr Gepäck umgehängt.«
»Früher schon, Señora. Geben Sie mir anderthalb Pfund Tomaten?«
Der Wanderer kann nicht noch lauter schreien. Seine Kehle ist trocken; für eine Tomate hätte er einen Duro bezahlt. In der Tür des Gemüseladens steht ein Haufen Kinder, die den Wanderer anstarren; Kinder unterschiedlichster Haarfarbe und Größe; Kinder, die nichts sagen und ihn anschauen, ohne zu blinzeln, so wie Katzen.
Ein rothaariger Junge mit sommersprossigem Gesicht erklärt dem Wanderer: »Sie ist taub.«
»Ja, das habe ich schon gemerkt, mein Junge.«
Der Junge lächelt.
»Gehen Sie nach Zaragoza, wegen eines Gelübdes?« »Nein, mein Engel, ich gehe nicht nach Zaragoza. Weißt du, wo ich anderthalb Pfund Tomaten kaufen kann?« »Ja, kommen Sie mit.«
Mit zwanzig oder fünfundzwanzig Kindern im Schlepptau macht der Wanderer sich auf die Suche nach Tomaten. Einige Kinder laufen ein paar Schritte voraus, um den Reisenden genau betrachten zu können, um immer neben ihm zu sein. Anderen wird es zu langweilig, und sie bleiben unterwegs zurück. In der Haustür stehend, fragt eine Frau leise die Kinder: »Was will er denn?« Und der Junge mit dem roten Haarschopf antwortet vergnügt: »Nichts, wir suchen Tomaten.« Die Frau gibt sich nicht zufrieden, bohrt nach: »Geht er nach Zaragoza?« Und der Junge dreht sich um und antwortet barsch, beinah empört: »Nein. Geht man denn von hier immer nur nach Zaragoza?«
Als er an dem Gartenlokal vorbeikommt, hat der Mann, der – welch ein Zufall! – nicht nach Zaragoza geht, das Gefühl, als hätte man ihn soeben aus einem Teich herausgezogen und ihn vor dem Ertrinken gerettet. Neben ihm geht sein Helfer, der Junge mit dem rötlichen Haar. Der Junge hatte ihn gefragt: »Erlauben Sie mir, daß ich Sie einige Hektometer begleite?«
Und der Wanderer, der altkluge Kinder grenzenlos bewundert, hatte ihm geantwortet: »Ja, ich erlaube dir, daß du mich einige Hektometer begleitest.«
Bereits auf der Landstraße macht der Wanderer an einem Bach Halt, um sich kurz etwas zu waschen. Das Wasser ist kühl und sehr sauber.
»Das Wasser ist kristallklar, nicht wahr?«
»Ja, mein Junge, ausgesprochen klar.«
Der Vagabund nimmt den Rucksack ab und macht seinen Oberkörper frei. Der Junge setzt sich auf einen Stein, um ihm zuzusehen.
»Sie sind nicht sehr behaart.«
»Nein… gar nicht.«
Der Wanderer geht in die Hocke und wäscht zuerst seine Hände.
»Gehen Sie sehr weit?«
»Hm… wie man’s nimmt… gib mir die Seife.«
Der Junge öffnet die Seifendose und reicht ihm die Seife. Ein sehr gefälliger Junge.
»Na, wenn Sie da weit laufen wollen, bei dieser Hitze!« »Manchmal ist es noch heißer. Gib mir das Handtuch.« Der Junge reicht ihm das Handtuch.
»Sind Sie aus Madrid?«
Während der Wanderer sich abtrocknet, beschließt er, in die Offensive überzugehen.
»Nein, ich bin nicht aus Madrid. Wie heißt du?«
»Armando, zu Diensten, Armando Mondéjar López.«
»Wie alt bist du?«
»Dreizehn.«
»Was lernst du?«
»Eine Fachausbildung mache ich.«
»Was denn?«
»Na ja, eben eine Fachausbildung.«
»Was ist dein Vater?«
»Er ist beim Kreistag.«
»Wie heißt er?«
»Pío.«
»Wieviele Geschwister hast du?«
»Wir sind fünf, vier Jungen und ein Mädchen. Ich bin der Älteste.«
»Habt ihr alle helles Haar?«
»Jawohl. Wir sind alle rothaarig, mein Vater auch.«
Die Stimme des Jungen klingt ein wenig traurig. Der Wanderer wollte gar nicht soviel fragen. Einen Augenblick denkt er, während er Handtuch und Seife verstaut und die Tomaten, das Brot und eine Dose Leberwurst aus dem Rucksack nimmt, daß er mit der Fragerei zu weit gegangen ist.
»Essen wir was?«
»Gut, wie Sie möchten.«
Der Wanderer bemüht sich, nett zu sein, und nach und nach wird der Junge wieder so munter wie vorher, bevor er sagte: »Jawohl, wir sind alle rothaarig, mein Vater auch.« Der Wanderer erzählt dem Jungen, daß er nicht nach Zaragoza geht, daß er eine kleine Wanderung durch die Alcarria machen will; er erzählt ihm auch, woher er kommt, wie er heißt, wieviele Geschwister er hat. Als er ihm von einem schielenden Vetter erzählt, der in Málaga wohnt und Jenaro heißt, lacht sich der Junge halb tot. Dann erzählt er ihm vom Krieg, und der Junge hört ihm aufmerksam, betroffen, mit großen Augen zu.
»Haben Sie einen Schuß abbekommen?«
Der Wanderer und der Junge sind schon gute Freunde, und eifrig plaudernd erreichen sie den Weg nach Iriépal. Der Junge verabschiedet sich.
»Ich muß zurück, meine Mutter will, daß ich zum Essen zu Hause bin. Außerdem mag sie es nicht, daß ich so weit gehe, sie sagt es mir immer wieder.«
Als der Wanderer dem Jungen die Hand hinstreckt, weicht er aus.
»Meine ist nämlich schmutzig, wissen Sie?«
»Na, nun stell dich nicht an! Das macht doch nichts!« Der Junge blickt zu Boden.
»Ich bohre nämlich immer in der Nase.«
Na und? Das ist doch egal. Ich hab’ das schon gemerkt.
Ich bohre auch manchmal in der Nase. Das macht Spaß, nicht wahr?«
»Jawohl, es macht Spaß.«
Der Wanderer geht weiter, der Junge bleibt am Straßenrand zurück und blickt ihm nach. Von ferne dreht der Wanderer sich noch einmal um. Der Junge winkt ihm zum Abschied. In dem grellen Licht leuchtet sein Haar wie Feuer. Der Junge hat schönes, glänzendes, wunderbares Haar. Er glaubt das Gegenteil.
Zwei auf den Hinterläufen sitzende, mit den Löffeln wackelnde Hasen schauen kurz zu dem Wanderer hinüber und hoppeln dann schnell davon, um sich hinter ein paar Steinen niederzukauern. Nicht sehr weit davon zieht ein Adler seine Kreise. Eine Frau auf einem Esel kommt an dem Wanderer vorbei. Er grüßt sie, aber sie schaut ihn nicht an, erwidert auch seinen Gruß nicht. Eine junge Frau, blaß und schön, in Trauerkleidung, mit einem Kopftuch und großen, schwarzen, unergründlichen Augen. Der Wanderer dreht sich nach ihr um. Die Frau reitet aufrecht, sich ganz dem Trab des stattlichen, kraftvollen Tieres überlassend. Man könnte sie für eine einsame Tote halten, auf dem Weg zum Friedhof, um dort begraben zu werden.
Der Wanderer nimmt einen Schluck außer der Reihe, um Trost zu finden und setzt sich an einen Baum an der Außenumfriedung des Palastes von Ibarra, der an der Straße liegt. Der Palast von Ibarra ist ein halbverfallenes Gebäude mit einem verwahrlosten, bezaubernden Garten; er wirkt wie ein höfischer Tänzer, der erschöpft und krank die gesunde Landluft atmet. Der Garten ist von Unkraut überwuchert. Eine Ziege, mit einem Strick festgebunden, liegt dösend und wiederkäuend in der Sonne, und ein strubbeliges Eselchen tollt herum und schlägt wie verrückt mit den Hinterhufen in die Luft. Aus dem Gestrüpp ragt hoch und schlank, voller Anmut und Würde eine Lärche; eine Lärche, die einem alten, ruinierten Edelmann ähnelt – gestern noch voll Arroganz und heute Schuldner aller seiner Diener.
Eine Meile weiter endet der Wald und beginnen wieder die Saatfelder. Auf dem Acker sind einige Pfützen zu sehen. Ein alter Mann klagt dem Reisenden: »Ja. Glauben Sie das nicht. Es hat zu stark geregnet. Die Alcarria, wissen Sie, braucht genau ihr richtiges Maß an Wasser, nicht mehr und nicht weniger.«
Der Wanderer denkt, daß dieser Mann, wenn er so redet, immer recht behalten wird.
Die Landstraße beschreibt eine große Kurve, und nach der Kreuzung sieht der Wanderer plötzlich Brihuega vor sich, das in einer Mulde liegt. Von der Kreuzung gehen außer der, die der Wanderer benutzt, zwei Landstraßen ab: eine zur Linken, die nach Utande führt, und eine zur Rechten nach Algora, das wieder an der Hauptstraße liegt.
Nach Brihuega hinunter gibt es einen Richtweg, der ziemlich abkürzt. Der Wanderer nimmt den Richtweg, der voller Steine ist, anscheinend ist er das trockene Bett eines Sturzbaches. Als er gut den halben Weg hinter sich hat, begegnet er einem Hirtenjungen, der auf einem Stein neben einer verfallenen Mauer sitzt, einer Mauer, die nichts einfriedet.
»Junge, wie heißt dieser Abstieg?«
Der Junge antwortet nicht.
»Du, ich spreche mit dir. Ich habe dich gefragt, wie dieser Richtweg heißt.«
Der Junge ist verlegen und weiß nicht, was er tun soll. Er blickt auf die Füße des Wanderers, errötet bis über die Ohren und reibt mit einer Hand an seinem Knie. Dann antwortet er schließlich mit ganz dünner Stimme: »Er hat keinen Namen.«
Der Wanderer gibt dem Jungen ein paar Münzen. Zuerst will der Junge sie nicht annehmen.
Vom Richtweg aus sieht Brihuega sehr schön aus mit seinen Mauern und der alten Tuchfabrik, die groß und rund ist wie eine Stierkampfarena. Hinter der Ortschaft fließt der Tajuna mit seinen dichtbelaubten Ufern und seinem grünen Tal.
Brihuega hat eine bläulich-graue Farbe wie von Zigarrenrauch und erweist sich als eine alte Stadt mit viel Gestein, solide gebauten Häusern und dicken Bäumen. Die Dekoration hat sich plötzlich verändert, als ob ein Vorhang aufgezogen worden wäre.
Den Namen des Richtwegs wußte ein Stotterer, der im Schatten einer bejahrten Ulme neben dem »Gasthaus an der Tenne« Zwiebelpflanzen stutzte. Als der Wanderer ihn fragt, fängt der Stotterer an zu lachen.
»Er hat einen sehr häßlichen Namen, das ist es.«
Der Wanderer gibt ihm eine Zigarette.
»Aber man wird ihn doch wohl sagen können.«
»Gewiß, sagen kann man ihn schon.«
Der Mann spricht mit großer Mühe. Da er gleichzeitig stottert und lacht, ist er kaum zu verstehen.
»Auf halbem Wege ist die Quelle von Quiñoneros.« »Und der Weg heißt so?«
»Nein, so heißt er nicht.«
Der Stotterer lacht sich kaputt. Eine Frau mit einem Kind an der Brust sagt zu ihm: »Na, du bist vielleicht albern! Will er ihn nicht wissen? Dann sag ihn doch!«
Die Frau hätte nur noch hinzuzufügen brauchen: »Geschieht ihm recht! Weshalb fragt er soviel!«
Sie sagt es nicht, aber womöglich denkt sie es. Der Stotterer neigt den Kopf zur Seite und gibt sich einen Ruck. »Also, der Richtweg heißt, nun, so nennen wir ihn wenigstens, Weg der Quelle vom Schiß.«
Der Wanderer findet, daß der Mann mit den Zwiebelpflanzen ein sehr zartbesaiteter Stotterer ist, denn so schlimm war das Ganze auch wieder nicht. Als der Wanderer sich entfernt, lacht der Stotterer immer noch vor sich hin, während er mit einem Abhäutmesser, einem gewaltigen Messer, die zarten Triebe der Zwiebelpflanzen stutzt, die er am Nachmittag setzen wird.
Der Wanderer geht ins Gasthaus, um zu essen. Vorher nimmt er ein Fußbad in heißem Salzwasser, und danach fühlt er sich wie neugeboren. Im Eßzimmer sitzen ein Fräulein aus dem Dorf und seine Mama.
»Guten Tag, wohl bekomm’s.«
»Einen schönen guten Tag. Möchten Sie mithalten?« Das Fräulein trinkt Weißwein und nimmt Tricalcine ein. Es ist ein blasses Mädchen mit wohlgeformten Händen und kastanienbraunem Haar, das in Löckchen über die Stirn fällt. Von Zeit zu Zeit hüstelt es etwas.
An den Eßzimmerwänden gibt es eine Uhr mit Gewichten, einen Kanarienvogel namens Mauricio in seinem Käfig aus vergoldetem Drahtgeflecht und drei grellbunte Drucke in Metallrahmen. Ein Bild stellt Die Lanzen dar; das andere Die Trinker und das dritte Die Heilige Familie mit dem Vogel. Zwei Katzen streichen herum und warten, daß für sie etwas abfällt. Eine ist blond und heißt Blondchen, die andere ist dunkel und heißt Mohrchen. Der sie taufte, hatte zweifellos viel Phantasie.
Der Wanderer wird von einem hübschen, koketten Mädchen in einem Kleid aus Perkal bedient.
»Wie heißt du?«
»Merceditas, zu Diensten, man nennt mich Merche.«
»Ein sehr hübscher Name.«
»Nein, ein sehr häßlicher Name.«
»Wie alt bist du?«
»Siebzehn.«
»Du bist sehr jung…«
»Nein, ich bin nicht mehr jung.«
»Hast du einen Bräutigam?«
»Huch! Was Sie alles wissen wollen!«
Das Mädchen errötet und flüchtet in die Küche. Als es zurückkommt, ist es sehr ernst und wechselt dem Wanderer den Teller, ohne ihn anzusehen.
»Was hast du?«
»Nichts.«
Ein plumpes bäurisches Dienstmädchen, dessen Namen der Wanderer nicht kennt, geht Merche zur Hand. Das Wachstuch auf dem Tisch ist gelb und schon etwas verblichen und hat leicht ausgefranste Kanten. Ein Kalender mit einer jungen Dame darauf wirbt für eine Anismarke. Die junge Dame ist eine schwarzäugige Blondine in einem grünen Kleid, das ihre Schultern freiläßt. Sie trägt einen tiefsitzenden Haarknoten und einen stark glänzenden, sogleich ins Auge fallenden Steckkamm; der Steckkamm ist mit dem Silberstaub gemacht, der für die Sterne der Weihnachtskrippen benutzt wird. Das Eßzimmerfenster hat ein leicht vorspringendes Balkongitter.
Als der Wanderer mit dem Essen fertig ist, geht er auf die Straße hinaus. Er hätte sich nach dem Essen gern eine Weile ausgeruht, aber zwei Männer haben das Eßzimmer betreten, die ihm auf die Nerven gegangen sind, und er hat es vorgezogen, aufzustehen und hinauszugehen.
Neben dem Gasthaus stößt der Wanderer auf ein Tor namens Puerta de la Cadena, durch das er den Ort betritt. Die Puerta de la Cadena hat eine Mauernische mit einem Marienbild, und darunter ist ein Stein aus weißem Marmor mit der Inschrift: »1710–1910. Der Flecken Brihuega zum 200. Jahrestag seiner erinnerungswürdigen Bombardierung und Erstürmung.« Und weiter unten ist ein anderer Gedenkstein, der nur teilweise lesbar ist. Der Wanderer notiert die Buchstaben auf einem Zettel. Er braucht ziemlich lange dazu, weil er manchmal einen Fehler macht. Leute stehen um ihn herum. Dem Wanderer macht es riesigen Spaß, daß man ihn für einen Gelehrten hält.
Die Inschrift ist mehr oder weniger wie folgt:
Sie ist nicht sehr gut kopiert, das ist wahr, aber es fehlt auch kein Buchstabe, das ist gewiß. Fast alles ist verständlich, nur am Ende nicht ganz, wenigstens nicht für den Wanderer. In der vorletzten Zeile, fast in der Mitte, ist zwischen dem T und dem V ein Loch, das ein Einschuß sein muß. Der Wanderer betritt den Ort wie gesagt durch die Puerta de la Cadena und geht eine Weile umher. Hinter dem Tor ist eine schattige, einladende Allee. Auf einer Bank plaudern ein paar Mädchen. Sie lachen laut und klatschen sich auf die Schenkel. Dann stehen sie auf und gehen zum Brunnen, um Wasser zu trinken.
Mehrere Männer scheren Schafe in einem Stall, der auf die Straße geht. Die Wolle ist voller Fett und fällt in einem Stück herunter wie ein Hemd, und die Schafe stehen nackend da, mager, dickbäuchig und entstellt. Ein paar Jungen sehen lüstern zu, während sie wortlos grinsen. Eine Schafschur in einem weniger warmen als hitzigen Stall mit einem scharfen, durchdringenden Geruch ist ohne Zweifel ein betäubender Anblick von uraltem Reiz, der die Bürschchen in Erregung versetzt, wenn sich unversehens Wollust und Grausamkeit in einem dunklen, unbeschreiblichen Aufwallen des Blutes vereinigen.
Die Sonne zeigt den späten Nachmittag an. Es kommt ein Moment, wo dem Wanderer alle Frauen schön erscheinen. Er setzt sich auf einen Stein und blickt mit wehem Herzen auf eine Gruppe von acht bis zehn jungen Mädchen, die Wäsche waschen. Der Wanderer ist in Gedanken versunken, und seine Erinnerung füllt sich mit lieblichen heidnischen Wölkchen, während er die frischen Verse aus dem Liederschatz hervorholt:
Mutter, die Mägdelein,
die aus diesem Flecken,
in fließendem Wasser
waschen ihre Hemden;
ihre Hemden, Mutter,
Mutter, die Mägdelein.
Die Mädchen haben die Ärmel aufgekrempelt. Eines singt etwas aus einer Zarzuela; ein anderes ein schon aus der Mode gekommenes Couplet, ein Couplet von vor vier oder fünf Jahren.
Ein Mädchen, das nicht singt, hat ein paar blaue Blumen im kastanienbraunen Haar. Man kann es nicht gut erkennen, aber von hinten gesehen könnte es Merche aus dem Gasthaus sein.
»Mein Name ist sehr häßlich… bin nicht mehr jung…« Als der Wanderer am nächsten Tag wieder unterwegs ist und an schon Vergangenes denkt, schließt er kurz die Augen, um seinen Herzschlag zu spüren.
Ein graugelber, alter Ochse mit langen Hörnern und einem spitzen Gesicht wie ein toledanischer Edelmann trinkt, das Wasser nur leicht mit dem grauen Maul streifend, aus dem Trog eines üppig quellenden Brunnens direkt neben dem Waschplatz. Als er zu Ende getrunken hat, hebt er den Kopf und geht demütig und weise hinter den Frauen vorbei. Man könnte sagen, ein treuer, gelangweilter und diskreter Eunuch, Wächter eines Harems, der so geräuschvoll wie der Tagesanbruch ist. Betroffen sieht der Wanderer dem langsam und resigniert davongehenden Tier nach. Der Wanderer wundert sich manchmal über die seltsamsten Dinge.
Zwei Hunde lieben sich verbissen, heftig, schamlos im prallen Sonnenschein. Eine Glucke spaziert vorbei, umringt von Küken, die so gelb sind wie reifes Korn. Aus einer Seitenstraße kommt ein Ziegenbock mit hocherhobenem Kopf, eindringlichem Blick, stolzem und herausforderndem Gehörn. Der Wanderer wirft einen letzten Blick auf die Wäscherinnen, steht auf und geht fort. Der Wanderer ist ein Mann, dessen Leben aus Entsagungen gewebt ist. Der Wanderer geht einige Gassen hinunter und raucht vor einer Haustür mit einem alten Mann eine Zigarette. »Scheint ein schöner Ort zu sein.«
»Nicht schlecht, aber Sie hätten ihn vor der Luftwaffe sehen sollen.«
Die Leute von Brihuega sprechen von vor und nach der Luftwaffe, wie die Christen von vor und nach der Sintflut sprechen.
»Jetzt ist er nicht einmal mehr der Schatten von dem, was er war.«
Der Alte ist nachdenklich, wehmütig. Der Wanderer blickt auf die Kiesel und läßt die Worte langsam, wie nebenbei fallen.
»Und mit schönen Mädchen, wie ich sehe.«
»Bah! Glauben Sie das nicht, die sind keinen Heller wert. Wenn Sie die Mütter gekannt hätten!«
Der Alte, dessen Kopf zittrig ist, seufzt auf und wechselt das Thema.
»Hier war es, wo die Italiener die Beine in die Hand nahmen, wissen Sie das?«
»Ja, ich weiß es.«
»Das war vielleicht was!«
Der Alte erhebt sich und geht ins Haus. Kurz darauf kehrt er, schwerfällig auf seinen Stock gestützt, zurück.
»Sie müssen entschuldigen, ich mußte nach dem Eintopf sehen.«
Der Alte setzt sich wieder und legt eine Hand an die Wange.
»In meinem Alter ist man zu nichts mehr nütze, wir taugen nur noch dazu, auf den Eintopf achtzugeben. Jetzt bin ich ein Wrack, aber wenn Sie mich als jungen Burschen gesehen hätten!«
Der Wanderer denkt, daß es seinem Freund, dem Alten, geht wie Brihuega – früher, ja, da hätte man es sehen müssen! – und wie aller Welt und allen Dingen. Der Wanderer, der heute lieber nicht traurig werden möchte, steht auf, verabschiedet sich von dem Alten und macht sich bergabwärts auf den Weg.
Es ist wohltuend frisch und angenehm zu wandern. Über dem Fluß liegt ein zarter Streifen kaum wahrnehmbaren Nebels. Stare und Mauersegler fliegen hin und her; eine schwarz-weiße Elster hüpft von Stein zu Stein, während über den Saatfeldern eine Lerche trillert. Der Morgenwind weht über das Land, und die Luft ist rein, durchsichtig, glasklar, licht.