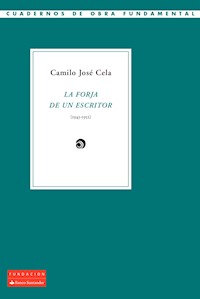4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit »Pascual Duartes Familie« begann die Karriere des späteren Literaturnobelpreisträgers Camilo José Cela. Nach Cervantes »Don Quijote« das meistgelesene Buch der spanischen Literatur. Pascual Duarte erzählt uns sein Leben aus seiner Gefängniszelle heraus, dort wartet er auf seine Hinrichtung. Pascual wächst in einem lieblosen Elternhaus in der spanischen Provinz auf. Sein Vater ist ein Schläger, seine Mutter Alkoholikerin - so wächst Pascual in einer lieblosen Umgebung auf und lässt für sein Erwachsenenleben nichts Gutes erahnen. Einzig die Frauen in seinem Leben, seine Schwester und seine Ehefrauen sind Lichtblicke in seinem Leben. Doch der aufbrausende Pascual stolpert von einem Unglück ins nächste, oft weiß er sich nicht anders als mit Gewalt zu wehren und so scheint sein Schicksal unausweichlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Spanischen von George Leisewitz überarbeitet von Gerda Theile-Bruhns unter Mitwirkung des Autors
ISBN 978-3-492-99112-4
© für diese Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2018
© Camilo José Cela
© Heirs of Camilo José Cela, 2002
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »La Familia de Pascual Duarte« bei Editorial Aldecoa, Madrid 1942
Deutschsprachige Ausgabe:
© Verlags-AG Die Arche, Zürich, 1960, 1989
Covergestaltung: Zero Media GmbH
Covermotiv: FinePic, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Vorwort des Herausgebers
Ein Brief, der das Manuskript ankündigt
Klausel aus dem eigenhändigen Testament des Joaquin Barrera Lopez
Kapitel 1 – Ich bin nicht schlecht, …
Kapitel 2 – Von meiner Kindheit habe ich …
Kapitel 3 – Der Rosario zimmerten sie ein …
Kapitel 4 – Es verging einige Zeit, …
Kapitel 5 – Die Vorsehung wollte, dass …
Kapitel 6 – Etwas über einen Monat später, …
Kapitel 7 – Sie können mir glauben, …
Kapitel 8 – Etwa einen Monat lang …
Kapitel 9 – Ich verlor keine Zeit, …
Kapitel 10 – Ich hatte kaum das Notwendigste geordnet, …
Kapitel 11 – Seit meiner Rückkehr waren …
Kapitel 12 – Ein Nest voll Skorpione lebte …
Kapitel 13 – Man hielt mich drei Jahre lang …
Kapitel 14 – Wir waren bereits zwei Monate …
Schlussbemerkungen des Herausgebers
Der zweite Brief
Vorwort des Herausgebers
Die Zeit scheint mir gekommen, Pascual Duartes Erinnerungen dem Druck zu übergeben. Es eher zu tun, wäre vielleicht übereilt gewesen; ich wollte die vorbereitenden Arbeiten nicht überstürzen, denn gut Ding will Weile haben, auch die Korrektur von orthographischen Fehlern in einem Manuskript, und weil es mit Recht heißt, daß übers Knie gebrochene Arbeit nichts taugt. Die Veröffentlichung nun noch länger zu verzögern, wäre wohl kaum zu rechtfertigen; man soll das fertige Werk ruhig zeigen.
Seit ich diese Blätter Mitte 1939 in der Apotheke zu Almendralejo fand, wo Gott weiß welche unwissenden Hände sie deponierten, habe ich mich damit beschäftigt, sie sprachlich zu überarbeiten und zu ordnen. Das Manuskript war teilweise wegen der schlechten Schrift, teilweise auch, weil die Seiten nicht nummeriert waren und durcheinander lagen, fast unleserlich.
Gleich anfangs möchte ich feststellen, daß an dem Werk, das ich heute der Neugier des Lesers übergebe, mein Anteil gering ist: ich habe nichts verbessert und nichts hinzugefügt, da ich den Stil der Erzählung unverändert bewahren wollte. Allerdings hielt ich es für angezeigt, an einigen allzu groben Stellen die Schere zu gebrauchen und kurzen Prozeß zu machen. Dies Verfahren wird dem Leser wohl einige Einzelheiten vorenthalten, doch verliert er dabei nichts. Es hat hingegen den Vorzug, dem Blick vielleicht widerwärtige Intimitäten zu ersparen, für die, ich wiederhole es, mir die schere geeigneter schien als Verbesserungen.
Die Person Pascual Duartes, so meine ich, ist beispielhaft in ihrem Verhalten, und vielleicht ist dies der einzige Grund dafür, daß ich sie ans Licht ziehe. Kein Beispiel zur Nachahmung, wohl aber, um es zu meiden; ein Beispiel, demgegenüber jeder Zweifel fehl am Platze ist, angesichts dessen man nur sagen kann: siehst du, was er tut? Das genaue Gegenteil von dem, was er tun sollte.
Doch lassen wir Pascual Duarte sprechen, der uns manches Interessante zu erzählen hat.
Ein Brief, der das Manuskript ankündigt
Herrn
Joaquín Barrera López
Mérida
Sehr geehrter Herr Barrera!
Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen mit diesem an sich schon nicht kurzen Brief noch eine lange Erzählung übersende. Da ich aber von all den Freunden des Herrn Jesús Gonzalez de la Riva (dem Gott verziehen haben möge, ebenso wie er gewißlich mir vergeben hat) nur noch Ihre Anschrift im Kopf habe, wende ich mich an Sie, um das Geschriebene loszuwerden. Der Gedanke allein, daß ich so etwas habe niederschreiben können, verzehrt mich, und ich möchte vermeiden, daß ich in einem Augenblick der Niedergeschlagenheit – Gott gebe mir noch viele davon – die Blätter vernichte und so anderen unmöglich mache, aus dem zu lernen, was ich nicht begriff, ehe es zu spät war.
Ich will es Ihnen etwas näher erklären. Es ist mir leider nicht verborgen, daß die Erinnerung an mich verflucht sein wird. Ich möchte deshalb mein Gewissen, soweit möglich, mit diesem öffentlichen Bekenntnis erleichtern. Das ist keine geringe Buße, und ich will dazu einiges aus meinem Leben erzählen, dessen ich mich noch entsinne. Erinnerung war nie meine Stärke, und ich weiß, daß ich wahrscheinlich viel Interessantes vergessen habe; dennoch habe ich mir vorgenommen, das zu erzählen, was mir nicht aus dem Sinn will und was die Hand zu Papier zu bringen sich nicht sträubt. Denn es gab auch einiges, was ich wohl erzählen wollte. Dabei war mir aber so elend zumute, daß ich vorzog, es zu verschweigen und der Vergessenheit zu überantworten. Als ich dieses Bekenntnis niederzuschreiben begann, gab ich mir Rechenschaft darüber, daß es etwas in meinem Leben gab, nämlich mein Ende, das Gott kurz machen möge, wovon ich nichts würde berichten können. Darüber habe ich viel nachgegrübelt und kann Ihnen, bei den wenigen Augenblicken, die mir noch bleiben, versichern, daß ich mehr als einmal glaubte, mein Vorhaben aufgeben zu müssen, da mir einfach nicht einfallen wollte, wo der Schlußstrich zu ziehen sei. Doch meinte ich, es sei am besten, erst einmal zu beginnen und den Schluß zu lassen bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott mein Leben zu beenden denkt. So habe ich es denn auch getan. Heute aber, wo ich der Hunderte von Seiten, die ich mit meinem Geschreibe angefüllt habe, bereits überdrüssig zu werden beginne, höre ich nun endgültig damit auf und überlasse es Ihrer Einbildungskraft, sich auszumalen, was noch kommt. Das dürfte Ihnen nicht schwerfallen, denn abgesehen davon, daß es sicher nur noch wenig ist, glaube ich nicht, daß mir zwischen diesen vier Wänden noch viel Neues begegnen wird.
Als ich niederzuschreiben begann, was ich Ihnen jetzt zusende, quälte mich der Gedanke, daß damals irgend jemand schon darum wissen mußte, ob ich meine Erzählung würde bis zu Ende führen können, oder wo ich hätte abbrechen müssen, weil ich die Zeit falsch bemessen hatte, die mir zur Verfügung stand. Diese Gewißheit, daß alles, was ich tat, mir schon vorgezeichnet war, in bereits vorausbestimmten Furchen ablief, raubte mir fast den Verstand. Heute, nahe schon dem anderen Leben, habe ich mich damit abgefunden. Möge Gott mich seiner Vergebung für wert befinden.
Ich bin etwas ruhiger geworden, nun ich all das niedergeschrieben habe, und für Augenblicke quält mich sogar das Gewissen weniger. Ich baue darauf, daß Sie verstehen werden, was ich besser ungesagt lasse. Es ist richtiger, wenn niemand davon erfährt. Heute reut es mich, meinen Weg verfehlt zu haben. Aber in diesem Leben bitte ich niemanden mehr um Gnade. Wozu auch? Es ist vielleicht besser, sie tun mit mir, was sie vorhaben. Denn es ist mehr als wahrscheinlich, daß ich in meine schlechten Gewohnheiten zurückfallen würde, täten sie es nicht. Auch um Straferlaß will ich nicht nachsuchen, denn zu viel Schlechtes hat mich das Leben gelehrt, und ich bin zu weich, den Trieben zu widerstehen. Es geschehe also, wie es im Buch des Himmels geschrieben steht.
Empfangen Sie, sehr geehrter Don Joaquín, zugleich mit diesem Bündel beschriebener Blätter die Bitte, mir zu verzeihen, daß ich mich an Sie wandte, und nehmen Sie diese Bitte um Vergebung an, die ich an Sie richte, als seien Sie Don Jesús selbst.
Ihr untertänigster Diener
Pascual Duarte
Klausel aus dem eigenhändigen Testament des Joaquin Barrera Lopez
der ohne Erben verstarb und sein Vermögen den dienenden Nonnen vermachte
Viertens: Ich befehle, daß das mit Bindfaden verschnürte Paket Papiere in meiner Schreibtischschublade, das in roten Lettern die Aufschrift »Pascual Duarte« trägt, unverzüglich ungelesen den Flammen überantwortet wird, da sein Inhalt zersetzend ist und gegen die guten Sitten verstößt. Wenn es aber das Schicksal will, daß ohne böse Absicht das Paket während achtzehn Monaten dem ihm bestimmten Schicksal entgeht, so befehle ich dem Finder, es vor Zerstörung zu bewahren, es als sein Eigentum zu betrachten und nach seinem Gutdünken damit zu verfahren, vorausgesetzt, daß er nicht anderer Ansicht ist als ich.
– – – – –
Gegeben zu Mérida (Badajoz) und auf dem Sterbebett am 11. Mai 1937
Kapitel 1
Ich bin nicht schlecht, Herr, wenn es mir auch nicht an Gründen fehlte, es zu sein. Alle, die wir sterblich sind, tragen bei der Geburt die gleiche Haut. Und dennoch gefällt es dem Schicksal, wenn wir älter werden, uns zu verändern, als seien wir aus Wachs, und uns auf verschiedenen Wegen demselben Ziele, dem Tode, zuzuführen. Es gibt Menschen, die dürfen auf Blumen wandeln, während andere den Weg der Disteln und Dornen gehen müssen. Jene erfreuen sich eines steten Blicks und lachen ihrem Glück mit unschuldsvollem Gesicht entgegen. Die anderen sind den erbarmungslosen Sonnenstrahlen der Ebenen ausgesetzt und runzeln die Stirn, wie das kleine Raubzeug in der Verteidigung. Ein großer Unterschied ist zwischen dem, der sich schminkt und mit Kölnisch Wasser abreibt, und dem, der sich mit dem Schmuck von Tätowierungen begnügen muß, die nachher nicht mehr zu beseitigen sind …
Vor vielen Jahren schon – es sind mindestens fünfundfünfzig her – bin ich auf die Welt gekommen, in einem Dorf tief in der Provinz Badajoz. Zwei Meilen von Almendralejo war das Dorf entfernt, hingeduckt auf eine staubige Landstraße, völlig eben und schnurgerade wie ein Tag ohne Brot, endlos und gerade wie die Tage von einem, der zum Tode verurteilt ist, so grenzenlos lang, wie Sie zu Ihrem Glück es sich gar nicht vorstellen können …
Das Dorf war heiß und sonnig, ziemlich reich an Olivenbäumen und Schweinen (mit Verlaub!), seine Häuser so weiß gestrichen, daß mir heute noch die Augen schmerzen, wenn ich daran zurückdenke, mit einem Dorfplatz, der ganz mit Steinplatten ausgelegt war und einem schönen Brunnen mit drei Rohren mitten auf dem Platz. Als ich das Dorf verließ, war schon seit ein paar Jahren kein Wasser mehr aus den Rohren geflossen. Und doch, wie leicht, wie elegant erschien uns allen der Brunnen mit der Figur des nackten Kindes obendrauf und dem Rand des Brunnenbeckens, geriffelt wie die Pilgermuscheln. Am Dorfplatz lag die Bürgermeisterei, groß und rechteckig wie eine Tabakskiste, mit einem Turm in der Mitte und in dem Turm eine Uhr, weiß wie eine Hostie, deren Zeiger immer auf neun standen, als wenn das Dorf die Uhr nur zur Zierde brauchte. Im Dorfe gab es natürlich gute Häuser und schlechte. Die letzteren waren, wie das bei allen Dingen so ist, in der Mehrzahl. Eines, das zweistöckig war und Don Jesús gehörte, war ganz besonders schön, mit seinem Empfangszimmer, das ganz mit Fliesen ausgelegt war und voller Blumentöpfe stand. Don Jesús war immer sehr für grüne Pflanzen. Mir kam es vor, als habe er seiner Haushälterin befohlen, die Geranien, Heliotropen, die Palmen und Minzen mit der gleichen Zärtlichkeit zu pflegen, als seien es seine Kinder. Denn die Alte lief immer mit einem Schöpflöffel in der Hand herum und begoß die Töpfe mit einer Miene, für die ihr die Pflanzen ohne Zweifel dankbar waren, so üppig wucherten sie, so grün waren sie. Das Haus von Don Jesús lag auch am Dorfplatz, und es unterschied sich von allen anderen, abgesehen durch all das Schöne, von dem ich schon erzählte, besonders in einem Punkt, in dem ihm alle anderen überlegen waren; und das trotz des vielen Geldes, das der Herr sonst bedenkenlos ausgab: in der Hausfront, die in der natürlichen Farbe des Steines gehalten war, was doch so gewöhnlich aussieht. Es war gar nicht geweißt, wie das des Ärmsten im Dorf. Nun, er wird seine Gründe gehabt haben. Über dem Portal war ein Wappen in den Stein gehauen, das, wie man sich erzählte, großen Wert besaß. Es stellte zwei alte Ritterköpfe dar, mit Helm und Federbusch, von denen der eine nach Osten, der andere nach Westen schaute, als wollten sie den Anschein erwecken, sie wachten über das, was von der einen oder anderen Seite kommen könnte. Hinter dem Platz an der Seite, wo das Haus von Don Jesús lag, war die Kirche mit ihrem steinernen Turm und der kleinen Glocke, deren Klang ich nicht beschreiben kann, den ich aber jetzt im Ohr habe, als würde sie hier um die Ecke geläutet … Der Glockenturm war ebenso hoch wie der Uhrturm, und im Sommer, wenn die Störche kamen, dann wußten sie immer, in welchem Turm sie das Jahr zuvor ihr Nest gebaut hatten. Der lahme Storch, der noch zwei Winter überlebte, war aus dem Nest vom Glockenturm, von wo er als ganz kleines Tier einmal heruntergefallen war, weil er sich vor dem Sperber erschreckt hatte.
Mein Haus lag außerhalb des Dorfes, etwa zweihundert große Schritte vom letzten der eigentlichen Siedlung entfernt. Es war eng und alle seine Räume lagen zu ebener Erde, meinem Stande entsprechend. Aber ich habe es doch lieb gewonnen, und es gab sogar Zeiten, wo ich stolz darauf war. In Wirklichkeit war das einzige, was sich vom Haus sehen lassen konnte, die Küche, der erste Raum, den man betrat, immer sauber und tadellos geweißt. Der Fußboden war zwar nur aus Lehm, aber er war so schön festgetreten, und die Kieseln darin gaben ein so feines Muster ab, daß er in nichts den vielen anderen nachstand, die der Besitzer auszementieren ließ, weil er sich fortschrittlich dünkte.
Der Herd war groß und sauber. Um den Rauchfang herum lief ein Gestell mit Keramik darauf als Zierde, Krügen mit blau aufgemalten Bildern, Tellern mit blauen oder orangefarbenen Zeichnungen. Einige davon zeigten ein Gesicht, andere eine Blume, wieder andere einen Namenszug oder einen Fisch. An den Wänden hing Verschiedenes: ein sehr hübscher Kalender, der ein junges Mädchen zeigte, das sich in einem Boot Luft zufächelte, und unter dem in Buchstaben von Silberstaub zu lesen war »Modésto Rodríguez«, feine Spezereien, Mérida (Badajoz), dann ein Bildnis in Farben vom »Espartero« im Torerokostüm, und drei oder vier Fotografien, die einen klein, die anderen größer, von, ich weiß nicht, wem. Ich sah sie immer am gleichen Platz hängen, und ich habe nie daran gedacht, danach zu fragen. Auch eine Weckuhr hatten wir an der Wand hängen, und das will etwas heißen. Sie funktionierte immer, wie Gott es befahl. Dann war da noch ein Nadelkissen aus rotem Plüsch, in dem einige hübsche Nadeln mit farbigen Glasknöpfen steckten. Die Einrichtung der Küche war so knapp wie sie einfach war: drei Stühle, davon einer besonders gut mit gedrechselter Lehne und geschwungenen Beinen und einem Rohrsitz. Ein Tisch aus Tannenholz mit einer Schublade, der für die Stühle etwas niedrig war, aber doch seinen Dienst tat. In der Küche ließ es sich gut sein. Sie war bequem, und im Sommer, wenn der Herd nicht brannte, war es auf den Herdsteinen köstlich frisch, wenn wir gegen Abend die Türen weit öffneten. Im Winter war es durch die Glut fein warm. Manchmal, wenn man aufpaßte, glimmte sie die ganze Nacht über weiter, und wie unterhaltend war es, unsere Schatten an der Wand zu sehen, wenn ein paar Flammen hochschlugen! Sie kamen und gingen, mal langsam, mal sprunghaft, wie im Spiel. Ich erinnere mich, daß sie mir als kleines Kind Furcht einflößten, und noch jetzt, als Erwachsener, läuft es mir den Rücken herunter, wenn ich an jene Ängste zurückdenke.
Es verlohnt sich nicht, den Rest des Hauses zu beschreiben, so armselig war es. Wir hatten noch zwei Wohnräume, wenn man sie, angesichts der Tatsache, daß sie bewohnt wurden, so nennen will, und den Stall, von dem ich heute manchmal nicht weiß, warum wir ihn so nannten, so leer und vernachlässigt war der Raum. In einem der Zimmer schliefen meine Frau und ich, in dem anderen meine Eltern, bis Gott oder vielleicht der Teufel sie sich holten. Nach ihrem Tode stand der Raum immer leer, anfangs, weil niemand da war, der ihn hätte bewohnen können, und später, als jemand da war, weil dieser Jemand immer die Küche vorzog, die heller war und nicht so zugig. Wenn meine Schwester zu Besuch kam, schlief sie immer dort, und auch die Kinder, wenn welche da waren, strebten dorthin, sobald sie der Mutterbrust entwachsen waren. In der Tat waren die Wohnräume nicht sehr sauber und auch nicht gut gebaut Andererseits konnte man sich nicht beklagen: sie boten, was die Hauptsache ist, Schutz vor den Wolken der Weihnachtszeit, und man war in ihnen, soweit man es verdiente, vor der stickigen Hitze des Augusts sicher. Der Stall war das Schlimmste. Er war düster und dunkel, und an seinen Mauern klebte der gleiche Geruch nach totem Tier, der an den Felswänden im Monat Mai emporsteigt, wenn die verendeten Tiere zu verwesen anfangen und dann von den Raben gefressen werden …