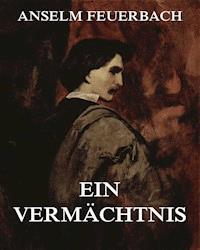
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Ein Vermächtnis" ist die Autobiographie eines der bedeutendsten deutschen Maler der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Das E-Book Ein Vermächtnis wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Vermächtnis
Anselm Feuerbach
Inhalt:
Anselm Feuerbach – Biografie und Bibliografie
Ein Vermächtnis
Vorwort zur neuen Ausgabe
Geleitwort der Mutter
Vorwort
Erinnerungen aus der Kindheit
Düsseldorf
München
Antwerpen
Paris
Karlsruhe
Venedig
Florenz
Rom
Bilderschicksale
Dante
Ein Erinnerungsblatt
Kindergruppen, Madonna, Skizzen zu Amazonenschlacht und Gastmahl
Erste Iphigenie. Pietà
Die Bilder für die Galerie des Herrn Grafen v. Schack
Erstes Gastmahl. Zweite Iphigenie. Orpheus
Medea. Urteil des Paris
Schöpfungsgeschichte der Medea
Amazonenschlacht. Zweites Gastmahl
Wien
Die Weltausstellung betreffend
Selbstkritik
Ausstellung der Amazonenschlacht im Künstlerhause
Beschreibung des Mittelbildes: Sieg der Kultur über die rohen Naturkräfte
Zwei Briefe aus Rom
Nürnberg
Die Ausstellung in München
Das Konzert
Letzte römische Reise
Beschreibung des Ateliers
Letzte Aufzeichnung
Anhang
Künstlerisches
Vermischtes
Ein Vermächtnis, Anselm Feuerbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849612498
http://www.jazzybee-verlag.de
Anselm Feuerbach – Biografie und Bibliografie
Maler,geb. 12. Sept. 1829 in Speyer, gest. 4. Jan. 1880 in Venedig, begab sich, als sich während seiner Gymnasialstudien in Freiburg sein Künstlerberuf unzweideutig dargetan, 1845 für zwei Jahre nach Düsseldorf, wo er sich anfangs an W. Schadow, dann an Rethel anschloss, dessen großartige Auffassung seinem Wesen mehr entgegenkam. Nach kurzem Aufenthalt in der Heimat (1848) ging F. nach München, wo ihn Rahl eine Zeitlang fesselte. Doch war sein Streben bereits damals auf eine größere Ausbildung im Kolorismus gerichtet, und er begab sich daher 1850 nach Antwerpen und 1851 nach Paris, wo er noch die modernen Meister studierte und in Coutures Atelier eintrat, dem er nach seinem Geständnis eine große Förderung seiner Maltechnik verdankte. Zwei seiner ersten Gemälde: Hafis in der Schenke und der Tod Pietro Aretinos, zeigen den Einfluss Coutures, weisen aber auch bereits auf das Vorbild der Venezianer hin, denen er sich später noch enger anschloss. 1854 nach Karlsruhe zurückgekehrt, erhielt er 1855 die Mittel zu einer Studienreise nach Italien, die ihn zunächst nach Venedig, wo er Tizians Himmelfahrt kopierte, und von da nach Florenz und Rom führte, wo sich im Studium von Michelangelo und Raffael allmählich seine eigentümliche Richtung ausbildete. Er strebte danach, die Größe und Erhabenheit des historisch-monumentalen Stils mit dem Reichtum des venezianischen Kolorits zu verbinden, geriet aber bei diesem Streben insofern auf einen Abweg, als er die Leuchtkraft der Lokalfarben durch graue Zwischentöne abdämpfen zu müssen glaubte, wodurch er den Erfolg seiner bedeutendsten und genialsten Kompositionen beeinträchtigte. Fast alle seine Schöpfungen waren daher bis zu seinem Tode heftigen Angriffen ausgesetzt, und es scheint, dass seine bitteren Lebenserfahrungen sein ohnehin zu Melancholie geneigtes Gemüt derartig niederdrückten, dass er vor der Zeit aufgerieben wurde. Die glücklichste Zeit seines Lebens war die Periode seines römischen Aufenthalts von 1857–72, während der er im Grafen von Schack einen hochherzigen Beschützer fand, der den größten Teil seiner Werke ankaufte. In dieser Zeit entstanden: Dante und die edlen Frauen in Ravenna (1858), Francesca da Rimini und Paolo Malatesta, Laura und Petrarca, Hafis am Brunnen, die Pieta (1863) und die Kinderbilder: Idyll aus Tivoli, belauschtes Kinderkonzert und Mutterglück. War in diesen Gemälden neben der klassischen Formengebung noch ein romantischer Zug zu finden, so wendete sich F. von da ab fast ausschließlich der Darstellung antiker Gegenstände im Gewande des modernen, aber durch eine völlig plastische Formenbehandlung gedämpften und gebundenen Kolorismus zu. Diesem Ideal ist er am nächsten gekommen in der Iphigenia (1871, Galerie zu Stuttgart), die man als die vollendetste Verschmelzung des klassischen und des romantischen Stils bezeichnen darf, und in dem Gastmahl des Plato (1873, Berliner Nationalgalerie). Minder gelungen, namentlich weil die Komposition nicht einheitlich genug und der Ausdruck der Figuren zu übertrieben ist, sind die Amazonenschlacht, das Urteil des Paris und mehrere Bilder aus der Sage der Medea (Medea zur Flucht gerüstet, in der Neuen Pinakothek zu München). 1873 wurde F. als Professor an die Akademie nach Wien berufen und erhielt dort den Auftrag, die Aula der Akademie mit Plafondmalereien zu dekorieren. Es gelang ihm nur, das Hauptbild, den Sturz der Titanen (die Skizze dazu in der Neuen Pinakothek zu München), und einige Nebenbilder zu vollenden. Die übrigen wurden, z. T. nach seinen Entwürfen, von Chr. Griepenkerl und H. Tentschert ausgeführt, und die ganze Dekoration 1892 an der Decke der Aula angebracht. Seine geniale Natur war für eine Lehrtätigkeit nicht geschaffen, und er schied bereits 1876 aus seiner Stellung aus. In den letzten Jahren seines Lebens führte er ein Gemälde für den Justizpalast in Nürnberg, Huldigung Ludwigs des Bayern, neben dem Titanensturz aus. Die scharfe Beurteilung des letzteren auf der Münchener Ausstellung von 1879 scheint seinen Tod beschleunigt zu haben. Sein letztes, unvollendet gebliebenes Werk, ein Konzert, besitzt die Berliner Nationalgalerie. Vgl. »Ein Vermächtnis von Anselm F.« (5. Aufl., Wien 1902, autobiographische Aufzeichnungen etc. enthaltend); O. Berggruen, Die Galerie Schack (das. 1883); J. Allgeyer, Anselm F. (2. Aufl., von Neumann, Stuttg. 1904, 2 Bde.). Eine Sammlung seiner Handzeichnungen (33) erschien München 1888.
Ein Vermächtnis
Vorwort zur neuen Ausgabe
Das "Vermächtnis" Anselm Feuerbachs, das hier in neuer Ausgabe vorgelegt wird, ist zum klassischen Werk geworden. Seit dem Zeitpunkte, da sich des Meisters Geschick erfüllte, dessen tragischer Lauf dem persönlichsten aller selbstbiographischen Bücher der deutschen Literatur eine allgemeine menschlich-herzliche Teilnahme zuspricht, fand endlich der Deutsche den Weg zu der reinen Schönheit seiner Kunst. Auf der deutschen Jahrhundertausstellung wandelte sich die stille Verehrung zur freudig sich aussprechenden Begeisterung, die Feuerbachs Namen nennen will zusammen mit den großen Meistern des vergangenen Jahrhunderts. Sein Werk steht für sich, wie in einem eigenen Tempel gewahrt vor den herausfordernden Blicken der Menge, Menschen allein zugänglich, die in der rhythmischen Gliederung und der harmonischen Ruhe des künstlerischen Eindrucks die bedeutungsvolle Schönheit künstlerischen Lebens und künstlerischer Tat zu fassen geneigt sind. Wundersam schließt sich die persönlich-menschliche Erscheinung des Genius, je weiter wir uns von der Grenze seines irdischen Daseins entfernen, immer einheitlicher zusammen mit seinen Schöpfungen, und, wie dieser Zusammenschluß ständig fester und dauerhafter wird, so gewinnt das Buch, das die Enttäuschungen des Lebens in schmerzlicher Mahnung kündet, an unpersönlichem, ethischem Gehalt. Es erhebt sich über die Tragik des einzelnen Schicksals, dessen Verherrlichung es vor einem Menschenalter hatte dienen sollen, zu einer elegischen Betrachtung des menschlichen Unvermögens, das wahrhaft Große zu erkennen, zu einem eindringlichen Appell, die Berühmtheiten der Mode, die morgen vergessen sein werden, zu verachten, Distanz zu halten zwischen vergänglichem und unvergänglichem Besitz. Dem "Vermächtnis" ist aus der persönlichen die kulturelle Mission erwachsen. Hier liegt sein heutiger, bleibender Wert, hier und noch in einer zweiten, nicht minder wichtigen Eigenschaft, in seiner erst jetzt richtig einzuschätzenden charakteristischen Bedeutung als literarisches Kunstwerk.
Anselm Feuerbachs "Vermächtnis" hat seine ursprüngliche hohe Aufgabe herrlich erfüllt. Es ist eine hohe Aufgabe, für den Sieg einer verkannten Existenz zu streiten, auf die Bahre des Gefallenen zu weisen, der im schwersten Kampf, dem Ringen um das Recht der selbständigen Persönlichkeit, menschlich unterlegen war, die Qualen dieses Ringens zu wiederholen, und so die Waffen niederzuschlagen, die noch immer drohend genug entgegenstarrten. Als Feuerbach, eben fünfzigjährig, am 4. Januar 1880 einsam in einem Gasthause zu Venedig gestorben war, hatte der Ruhm kaum erst seine Schläfen berührt. Nur ein bescheidener Kreis treuer, erkenntnisvoller Freunde stand neben dem Toten, denen die Ehrungen eines offiziellen Begräbnisses, die emphatischen Ansprachen und zahlreich gewidmeten. Lorbeerkränze – nur ein einziger war dem Lebenden zuteil geworden – seltsam genug vorkommen mochten. Denn mit der treuen Mutter des Meisters wußten sie, daß alle Bemühungen, seinen hinterlassenen Werken die gebührende Stätte zu sichern, nur nach langer entsagender Anstrengung aufhören sollten, daß der Kampf um die endliche Anerkennung noch bevorstehe. Während Feuerbachs Zeichnungen nach München und Berlin sich zerstreuten, zog die "Amazonenschlacht" von einem Kunsthändler zum anderen; ein vergeblicher Brief nach dem anderen mußte geschrieben werden, Kommission auf Kommission lehnte die "plumpe Farblosigkeit der Riesenleinwand" ab, bis sich Frau Henriette Feuerbach entschloß, das Bild der Stadt Nürnberg als Geschenk anzubieten. In fünfzig Minuten, pflegte sie zu äußern, könne sie des Sohnes Grab und sein Werk von Ansbach aus erreichen. Es gehörte der übermenschliche Wille der heroischen Frau dazu, die unendliche Liebe, mit der sie an dem Stiefsohne hing, den sie wie ihr eigenes Kind zu behandeln dem Vater auf dem Totenbette gelobt hatte, daß sie unmittelbar nach dem fürchterlichen Schlag die Aufgabe übernahm, das Denkmal "ihres Anselm" zu errichten und das "Vermächtnis" herauszugeben. Wir haben später davon zu sprechen, wie sie in treuer Pflichterfüllung zu Werke ging. Es war ihr beschieden, daß der Erfolg weit über die Hoffnungen hinausging, die sie nur den nächsten Freunden mitteilte. Als die erste Auflage des "Vermächtnisses" erschien (1882), kamen aus allen Teilen Deutschlands die Zeichen der Wirkung, Briefe und Zeitungsberichte, zu der Greisin. Eine neue Auflage mußte binnen kurzem vorbereitet werden, die Ahnung, dem Sohne die Unsterblichkeit künden zu können, verklärte die letzten Jahre der Einsamen, und die Nachricht von dem einstimmig beschlossenen Ankauf des "Gastmahls des Plato" für die Karlsruher Galerie, die sie zwei Jahre vor ihrem Tode (5. August 1892) erhielt, wirkte wie eine göttliche Fügung, wie ein versöhnender Abschluß ihres selbstlosen, kummervollen Lebens.
Es ist mehrfach und mit Recht auf die Tatsache gewiesen worden, daß der Sieg der Feuerbachschen Kunst durch das "Vermächtnis" beschleunigt worden sei. Es wäre aber ein gefährlicher Irrtum, diesen Sieg nur auf Kosten des "Vermächtnisses" zu setzen und zu sprechen von der Wehleidigkeit seines Inhaltes, das zur Erregung öffentlichen Mitleids gedruckt worden sei. Diese Entwürdigung des Werkes und die Verkennung des Zusammenhanges zwischen ihm und Feuerbachs Kunst mag dort vorgetragen werden, wo der unsichere Beruf des Künstlers noch als Almosenempfängerei angesehen wird. Wir haben uns hier um solche müßigen Reden ebenso wenig zu kümmern, wie um die Hypothese, ob Feuerbachs Kunst ohne das "Vermächtnis" jemals den ihr heute gewährten Ruhm erreicht hätte. Aber es ist sicher wahr, daß das "Vermächtnis" in einer Zeit erschien, die darauf gestimmt war, das Tragische der Aufzeichnungen in der ganzen Schwermütigkeit ihres Gehaltes zu erfassen und ihnen in ihrer Nachdenklichkeit einen sentimentalen Nebenbegriff zu geben, der allein durch eine auf Veranlagung beruhende und der Anlage gerne sich hingebende Reflexion des Lesers entstand. Hätte Frau Feuerbach also mit der Veröffentlichung warten sollen? Das Manuskript ein Jahrzehnt zurückhalten, damit das ungebärdige Übermenschentum der neunziger Jahre an der Empfindsamkeit und Reizbarkeit des Feuerbachschen Charakters höhnisch Anstoß genommen hätte? Die Mutter darf keineswegs ein Vorwurf treffen, wenn sie einen Vorteil wahrnahm, dessen Nutzen auch sie nicht "gerad und unbedingt erwartete". Mit ihrer ausgezeichneten klassischen Bildung, ihrem Verständnis für die Aktualität literarischer Ereignisse sah Henriette Feuerbach deutlich, daß das Volk der Deutschen durch den Verstand gewonnen wird, nicht durch das Auge, durch das Wort, nicht durch das Bild. Wenn sie diesen Umstand klug in den Kreis ihrer Berechnung zog – einen Beweis dafür auf Grund mündlicher oder schriftlicher Mitteilung haben wir nicht, soviel sie auch über ihre redaktionelle Tätigkeit für das Buch geäußert hat – hat sie dem Erfolg ihrer treuen Bemühungen jedenfalls trefflich genutzt. "Habe ich doch Dich, liebe Mutter, Du wirst mein guter Stern sein, der mir leuchtet, wenn es Nacht werden will um mich", hatte Feuerbach am 14. Juli 1861 geschrieben. Vierzig Jahre lang (wir können dies aus den Briefen feststellen) hat Henriette Feuerbach mit ihrem "Sohn und Freund" die Schwankungen seines Schicksals, die durch die wechselnden Stimmungen seines Temperamentes verstärkt wurden, mutig ertragen; sie ist die Stütze gewesen, an der er sich aufrichtete, wenn seine Kraft zu versagen drohte. Sie war, vielleicht weil sie die Stiefmutter war, eine Mutter von jener seltenen Uneigennützigkeit, die für das Talent des Sohnes und seine menschlich-selbständige Eigenart zugleich Verständnis hatte. Und nach diesen vierzig Jahren begrub sie während ihres letzten Lebensjahrzehntes fast alles, was sie sonst etwa hätte erfüllen können. "Dies ist alles, was mir bleibt", schreibt sie, "womit ich die Schulden bezahlen kann, abgesehen von dem, was die Hauptsache ist, wofür ich 50 Jahre gelebt, gelitten und gestritten habe, die Künstlerehre meines Sohnes zu sichern durch anständige Unterbringung seiner Werke." Im Handexemplar des "Vermächtnisses" finden sich die Worte eingeschrieben: "Der herbste Schmerz kann durch die Kraft einer reinen und starken Seele geadelt werden. Dann drückt er nicht nieder, sondern wird zu einem Stoffe, aus dem der Mensch sein eigenes Geschick mitbildet und erfüllt."
Über die Entstehung und die ursprüngliche Anlage der Lebenserinnerungen Feuerbachs sind wir unterrichtet durch einen Brief aus Wien vom August 1874. Damals war schon der größere Teil des Aufsatzes "Der Makartismus, eine pathologische Erscheinung" niedergeschrieben und ebenso der Artikel "Die Deutschen in Italien". In dem erwähnten Briefe heißt es: "Mein Buch hat drei Kapitel und geht vorwärts. Da es nur Tatsachen sind, ist es von so kapitaler Lächerlichkeit, daß ich nicht mehr nach Deutschland dann kann." Die Manuskripte wurden zum Ferienaufenthalt nach Heidelberg mitgeführt, wo sie zum Schrecken der besorgten Mutter, die aus dem Bekanntwerden der polemischen Absichten ihres Lieblings Schaden fürchtete, einigen vertrauten Freunden mitgeteilt wurden. Zu einer Fortsetzung, die schon für diese Zeit geplant war, scheint der Künstler nicht gekommen zu sein, da er unermüdlich mit den Entwürfen für die Wiener Deckenbilder beschäftigt war, die er hier fertigstellte. Im Frühjahr und Sommer 1876, wo schwere Erkrankung Feuerbach zur Ruhe zwang, hat er in Heidelberg und bei den Verwandten in Ansbach, dann in Streitberg in der fränkischen Schweiz während eines Erholungsaufenthaltes und im August nochmals in Nürnberg sich den Lebenserinnerungen wieder zugewandt. Diese Beschäftigung, bei welcher er mit seinen alten Widersachern in Karlsruhe und Wien kräftig abrechnete, trug wesentlich dazu bei, die Wiederherstellung seiner Gesundheit und seine gute Laune zu fördern. Die Absicht, auch über die Kaspar Hauser-Frage, in welcher er kurz vorher in der Allgemeinen Zeitung zwei Erklärungen erlassen hatte, sich zu äußern, gab er mit Rücksicht auf die Mutter auf, die angeblich selbst über den merkwürdigen Findling Familienpapiere drucken lassen wollte. Als Feuerbach abreiste, erst zur Kunstausstellung nach München, dann nach Venedig, ließ er das Manuskript zurück, über das nichts mehr verlautet. Doch ist es 1877 und 1878 nochmals vorgenommen und durchgesehen worden, auch entstand damals, am 31. Oktober 1878, die Niederschrift der Zeilen, die aus mehreren Entwürfen die Mutter auswählte, um sie bei der Veröffentlichung an die Spitze des Buches zu stellen, und der sie den schönen Schlußsatz anfügte. Freilich ist dieser nicht, wie behauptet wurde, von der Mutter willkürlich erfunden, sondern die in schriftdeutsche Form umgegossene Wendung, mit der Anselm Feuerbach selbst auf einen Nebenzweck seiner Aufzeichnungen zu deuten pflegte, nachdem er sich klar geworden war, daß "sein Pamphlet gegen die Canaillen" in der von ihm beliebten kerndeutschen Grobheit nur schaden könne, was er nicht für sich, aber für die Mutter fürchtete. Zu einer endgültigen Redaktion ist er nicht gekommen. Einen Pack weitläufig beschriebener, durcheinander liegender Quartblätter nahm die Mutter von Nürnberg in ihre neue Wohnung nach Ansbach. Aus dem unordentlichen Wust schuf sie das wundervolle Buch.
###
Anselm Feuerbachs "Vermächtnis" ist also in der Fassung, in der es genau mit den gleichen Worten der zweiten Auflage, die die Mutter selbst besorgt hat, hier vorgelegt wird, ein Werk Henriette Feuerbachs. Nicht die kleinste Änderung am Texte durfte vorgenommen werden, es erscheint als Pflicht der Pietät, selbst die wenigen, meist belanglosen falschen Datierungen beizubehalten. "Wie das Buch jetzt ist, so bleibt es für alle Zeit. Es wäre ein Unglück, würde eine fremde Hand das Buch berühren", lauten ihre eigenen Worte. Dafür ist es notwendig, in ausführlicher Weise auf die redaktionelle Tätigkeit Frau Feuerbachs einzugehen. Denn seit dem Erscheinen der fünften Auflage des "Vermächtnisses" im Jahre 1902 ist eine Reihe von Werken und größeren Artikeln erschienen, die das Leben Feuerbachs behandeln und die historische Genauigkeit der Mitteilungen des "Vermächtnisses" mit größerer oder geringerer Schärfe anzweifeln. Leider hat sich das allgemeine Urteil, statt die Nachprüfung abzuwarten, diesen Zweifeln angeschlossen, so daß es, wenn nicht ein energisches Veto eingelegt wird, dazu kommen kann, das Buch zu werten mit dem freien Maß von "Dichtung und Wahrheit" oder es gar auf den Rang eines Romanes zu degradieren.
Vor allem enthält die große, 1904 in zweiter, völlig umgearbeiteter Auflage erschienene Biographie Julius Allgeyers, die Karl Neumann herausgab, nach dem Vorwort einen Abschnitt "Das Vermächtnis Feuerbachs im Zusammenhang mit den Originalquellen", worin dem Buche nur mehr der Wert eingeräumt wird, "der verklärte Abdruck der Vorstellung zu sein, die von dem Geschiedenen im Andenken der Mutter fortlebte". Kurz vor Erscheinen dieses Werkes veröffentlichte H. Werner seine auf Allgeyers Anregung hin notierten Vergleichstellen nach den von der Mutter der kgl. Nationalgalerie in Berlin überwiesenen Vorlagen, die aus dem Originalmanuskript und zahlreichen Briefen bestehen, in der Zeitschrift "Die Kunst für Alle" (Jahrgang XIX, S. 19ff.). Hier heißt es: "Die Herausgeberin hat bei der Bearbeitung der zusammenhängenden Lebensgeschichte den Text zum großen Teil selbst gestaltet und dabei mitunter direkt falsche Angaben gemacht. Vor allem aber ist sie bei der Auswahl und Verwertung des außerordentlich reichhaltigen Briefmaterials mit großer Willkür und Flüchtigkeit verfahren, indem sie die Briefe oft ganz falsch datierte, aus mehreren zu ganz verschiedenen Zeiten geschriebenen einen nach ihrem Geschmack kompilierte oder auch ganze Briefstellen in veränderter Fassung als angeblich biographischen Text in die Darstellung der Lebensgeschichte einfügte." Wie bereits angeführt, konnten diese beiden fast gleichzeitig erscheinenden Vorwürfe, die längere Zeit unwidersprochen blieben, die Verfasser einer Reihe von Aufsätzen überzeugen, unter welchen der schöne Essay von Wilhelm Weigand, der das Beste enthält, was jemals kurz über Feuerbach gesagt wurde ("Süddeutsche Monatshefte", Jahrgang I, Heft 2), an der Spitze steht. Es ist das Verdienst A. von Oechelhäusers, daß er in seinem Buche "Aus Feuerbachs Jugendjahren" nach eingehender Prüfung des Nachlasses "Allgeyers absprechender Beurteilung des Vermächtnisses als lebensgeschichtlicher Quelle keineswegs zustimmen zu können" erklärte. Des weiteren erhob der juristische Beirat Frau Feuerbachs, Justizrat Berolzheimer, welcher, damals in Nürnberg, mit seiner Gattin Frau Feuerbach eng befreundet war und die Arbeit am Vermächtnis persönlich miterlebt hat, unter Mitteilung einiger Briefstellen Protest gegen die neuen Anschauungen, die sich gegen das "Vermächtnis" geltend machten, in der Beilage zur "Allgemeinen Zeitung", Jahrgang 1908, Nr. 10 und 11.
Erfreulicherweise finden sich nun in den Briefen, die Frau Feuerbach an ihren Neffen Justizrat Heydenreich und eine Reihe von Freunden, vor allem an die Gräfin Noer und an Allgeyer gerichtet hat, zahlreiche Mitteilungen, aus welchen wir ganz klar sehen, daß Frau Feuerbach nicht eine einzige Stelle zu dem Vorhandenen erfunden hat, daß ihre redaktionelle Tätigkeit ein bewunderungswürdiges Muster von Pflichtgefühl und Taktgefühl zugleich gewesen ist. Wenn man zu lesen versteht, wird auch aus der Vorrede, die Karl Neumann als Herausgeber dem Allgeyerschen Buche beigefügt hat (S. 19), klar ersichtlich, wie dieser das Verhältnis zwischen dem Nachlaß und dem "Vermächtnis" beurteilt: "abgesehen davon, daß Frau Feuerbach hin und wieder einen Gedanken aus dem Schatz ihres Gedächtnisses eingeflochten ...." Mit dieser Auffassung deckt sich die Ansicht des Herausgebers durchaus.
Wer das Manuskript der Feuerbachschen Aufzeichnungen einmal in Händen gehalten hat, wird, rein technisch zunächst, die Unmöglichkeit erkennen, ein solches ungeordnetes Durcheinander zum Druck zu geben. Angenommen, ein mit strengster literarhistorischer Methode vertrauter Philologe würde plötzlich ein unbekanntes Manuskript von Aufzeichnungen eines berühmten Schriftstellers finden, das sich in einem ähnlichen Zustande befände – auch er müßte, wenn er nicht an der Herausgabe verzweifelte, vorgehen wie Frau Feuerbach es tat, oder einen ellenlangen Kommentar beifügen. Wie nun hier, wo es sich um einen verhältnismäßig wenig bekannten Künstler handelte, um Mitteilungen über zahlreiche noch lebende Menschen, um einen bestimmten Zweck, der durch die Veröffentlichung erreicht werden sollte? Die Überlegung dieser Umstände, in Verbindung mit der genauen Kenntnis des Nachlasses, gibt Grund genug für die Überzeugung, daß die Mutter nicht allein der würdigste, sondern immer noch im philologischen Sinne der geeignetste Redaktor der "Vermächtnisses" gewesen ist. Wenn man Frau Feuerbach die angebliche Entschuldigung zubilligt, sie habe ihre Tätigkeit in einer Zeit ausgeführt, die Aufzeichnungen biographischen Inhaltes gegenüber noch nicht die entsprechende kritische Treue gewahrt habe, so ist dies an sich unzutreffend, es ist aber auch gerade für Frau Feuerbach unzutreffend. Die Gattin eines vorzüglichen Archäologen und Universitätslehrers, an dessen Seite sie außer der Einsicht in die Methode dieses Studiums eine eingehende Kenntnis der deutschen Klassiker erwarb, selbst begabt mit einem guten philologisch-historischen Feingefühl, dessen Sicherheit Gervinus und Weber anerkannten, hatte sie die gesammelten Werke ihres Mannes herausgegeben und mit einer biographischen Einleitung versehen, deren Klarheit und Gründlichkeit entschieden erfreulicher anmuten als so mancher kapriziös geschraubte, überpersönliche "biographische Essay" von heutzutage. Sie hat Monographien über Uz und Chronegk geschrieben, welche freilich jetzt überholt sind, aber der literarhistorischen Forschung der 60 er Jahre des vergangenen Jahrhunderts völlig entsprechen. Sie las griechisch in der Ursprache, war intim befreundet mit Gelehrten wie Hettner und Bernays – an dem Vorhandensein des obligaten philologischen Gewissens ist doch wohl nicht zu zweifeln.
Dieses philologische Gewissen, dessen ängstliches Klopfen wir aus manchem Briefe in einer Deutlichkeit heraushören, die jedem Herausgeber biographischer Schriften wohl anstünde, hatte nun ein Konvolut durchzuprüfen, dessen Inhalt weder druckfertig noch druckfähig war. Es mußte sich darum handeln, nicht allein die Form zu schaffen, die Flüchtigkeit der Aufzeichnungen an manchem abgerissenen Satze zu bessern, ein fehlendes Verbum, einen in der temperamentvollen Schnelligkeit des Niederschreibens übersprungenen Gedanken einzufügen, sondern vor allem die Schärfen und Kanten abzuschleifen. Es wurde gesagt, daß das "Vermächtnis" ursprünglich als eine persönliche Abrechnung gedacht war, mit persönlichen Feinden, wie Feuerbach sie in Karlsruhe und Wien witterte, mit dem "Kunstgeschmack" der Allgemeinheit, die Makart und Werner verehrte, während sie Feuerbach verhöhnte, mit der Kunstkritik, kurz mit der absoluten, allenthalben vorhandenen Verständnislosigkeit für Feuerbachs Künstlertum und seine Persönlichkeit. Das Wesentliche ist nun, daß der Künstler, schon durch eine unselige Vererbung von väterlicher Seite her, ungemein empfindlich und reizbar war, Widerspruch nicht ertragen konnte und seiner persönlichen Laune oftmals in schwerer Verbitterung allzusehr nachgab. Es ist das Verhängnis seiner Natur, die so manchen Charakterzug mit dem glücklicheren Lord Byron gemein hat, daß sie der unbedingten Anerkennung bedurfte, und da diese ausblieb, mit sich und schuldlosen Anderen in Zwiespalt geriet. Auf das Selbstquälerische einer solchen Individualität können wir Alfonsos Worte an Tasso beziehen:
"Dich führet alles, was du sinnst und treibst, Tief in dich selbst. Es liegt um uns herum Gar mancher Abgrund, den das Schicksal grub, Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste, Und reizend ist es, sich hinabzustürzen."
Mehr noch als die "Lebenserinnerungen" geben die Briefe das Spiegelbild dieses schwermütig schwankenden Charakters. Aber nicht zur Anklage gegen Feuerbach wollen wir diese dunkle Gabe eines trüben Geschicks erheben, sondern zur Anklage gegen diejenigen, in deren Macht es lag, die ursprüngliche Eigenschaft seines Wesens, die kindliche Heiterkeit und Naivität, hell leuchten zu lassen und das Negative zu bannen. Wahrlich, es wäre leicht gewesen!
War der Niederschlag dieser Stimmungen das eigentliche Element der selbstbiographischen Aufzeichnungen, eine Art Selbstbefreiung und Selbstreinigung, die Mutter durfte als Herausgeberin hier keinen Kompromiß schließen, sie hatte das Recht und die Pflicht, persönliche Angriffe zu streichen und zu ändern. Über die einzuhaltende Grenze heute, nach Kenntnis des Nachlasses, Vorschriften machen zu wollen, erscheint absurd. Jeder Herausgeber biographischer Schriften hat die Berechtigung, wenn er sie überhaupt ziehen muß, sie zu ziehen nach seinem eigenen Belieben. Daß Henriette Feuerbach die hellen, sonnigen Stellen bevorzugte, zurückschob, was im Schatten stand, lichter strahlen ließ, was, selten genug, freundlich aufleuchtete, wie ihr schöner, in Karl Neumanns Vorrede mitgeteilter Brief ausspricht, war im Einvernehmen mit dem Gewissen der Herausgeberin, deren Befugnisse niemals ausgedehnt oder überschritten wurden, vom Herzen der Mutter befohlen. Als Chateaubriand seine "Mémoires d'Outre-Tombe" redigierte, schrieb er an Joubert: "Meine Bekenntnisse dürfen nichts Peinliches enthalten. Ich werde die Nachwelt nicht von meinen Schwächen unterhalten, nichts über mich berichten, das nicht der Manneswürde und der Gesinnung meines Herzens entspräche. Nur das Schöne soll der Welt zugänglich gemacht werden; es heißt nicht Gott betrügen, wenn man nur enthüllt, was dazu geeignet ist, edle und großartige Gefühle zu erwecken. Die Klage über mich selbst mag genügen, um der Welt das gemeinsame Elend verständlich zu machen, das am besten verschleiert bleibt."
Solche Prinzipien hatte Feuerbachs Mutter für sich aufgestellt, als sie an ihre Arbeit ging. Fast siebzigjährig, dazu augenleidend, unterzog sie sich der Anstrengung, die vielen, winzig klein zusammengeschriebenen Briefe des Sohnes zu ordnen und abzuschreiben. Als sie einmal versuchte, Teile des Manuskriptes selbst in die Setzerei zu geben, erhielt sie die Blätter als unleserlich zurück. Das schwere Augenleiden, das später sogar eine Operation in Würzburg nötig machte, ist Schuld daran, daß einige Briefe ein falsches Datum erhalten haben. Das soll nicht geleugnet werden. Aber Feuerbach selbst verfuhr bei der Datierung seiner Briefe mit großer Leichtfertigkeit, verwechselte Daten und sogar Jahreszahlen (vgl. auch Allgeyer, Bd. I, S. 143 und Paul Hartwig, Anselm Feuerbachs Medea, Leipzig 1904. S. 16. 17, 20), und so sind bei manchen römischen Briefen die von der Mutter geänderten Daten die richtigen, während sie sich bei den Briefen aus Antwerpen wirklich einmal (gerade hier erscheint der Inhalt des Briefes keineswegs dem, übrigens durch den Poststempel beglaubigten Datum entsprechend) versehen hat. Wie schwer es doch sein muß, das Richtige zu treffen, zeigen, nebenbei bemerkt, zwei gegenteilige Auffassungen von Werner und Allgeyer über den Beginn des Antwerpener Aufenthaltes, den die Mutter und Allgeyer auf Grund eines Briefes an Binder auf den Frühling 1850 ansetzen, während Werner auf Grund des ersten aus Antwerpen datierten Briefes erst den Herbst 1850 annehmen möchte. Daß Feuerbach Mitte Mai aus München nach Antwerpen abreiste, bestätigt ein von ihm am 13. Mai 1850 an seine Tante Sophie in Ansbach gerichteter Abschiedsbrief. Das Vorgehen der Mutter ist also hier vollkommen gerechtfertigt.





























